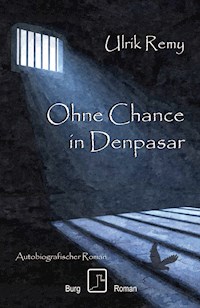Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Burg Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diese Auswahl von 12 Kurzgeschichten spiegelt die Bandbreite des Schaffens von Ulrik Remy wieder - autobiographisch, fiktiv, kontemplativ, und immer auf hohem sprachlichen und literarischen Niveau. Im Laufe des abenteuerlichen Lebens des Autors sind viele seiner Arbeiten verloren gegangen oder nur noch in Fragmenten vorhanden; er wird sie nun nach und nach im Burg-Verlag wieder publizieren. Dieser Band soll einen Vorgeschmack darauf vermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhalte
Neuer Artikel
Ulrik Remy
Im Auge des Sturms
Kurzprosa
Die Frau, die nicht nehmen konnte
Die alte Frau war geachtet vom ganzen Dorf. Man hätte sie reich nennen mögen, so groß war das Maß an Respekt und Zuneigung, das man ihr allgemein entgegenbrachte.
Die alte Frau verfügte über keine großen materiellen Güter. Das Holzhaus, das sie bewohnte, ein Spückchen*Gemüseland drum herum, von knorrigen Obstbäumen bestanden, einige alltägliche Kleider und der übliche Hausrat sowie eine Rente, die ihr das zum Leben Notwendige sicherte, das
waren die unauffälligen Umstände ihres Lebens. Auch war sie keine Gebürtige, und nennenswerter Grundbesitz war ihr nicht zuzurechnen.
Woher sie ursprünglich stammte und wie ihr Leben gewesen war, bevor sie ins Dorf kam, ob sie
einen Mann oder sonstige Verwandte hatte oder gehabt hatte, darüber wusste man nichts; sie pflegte nicht davon zu sprechen, und die allgemeine
Achtung, die sie genoss, ließ Fragen nach derlei intimen Dingen nicht zu. Die alte Frau war schon lange, im
Zeitverständnis selbst älterer Dörfler eigentlich schon immer, Bestandteil des Dorfes, und die Tatsache, dass sie
nicht hier geboren war, spielte nur mehr eine abstrakte Rolle: Sie war in
keiner der eingesessenen Familien erbberechtigt, stand also außerhalb aller Ansprüche und Interessen.
Dieser Umstand allein war es jedoch nicht, der die herausgehobene Stellung der
alten Frau im Dorf begründete. Hätte man irgendjemanden gefragt, warum man ihr mit so viel Hochachtung begegnete,
mehr, als den anderen Frauen gleichen Alters entgegengebracht zu werden
pflegte, eine Antwort wäre nur zögernd gekommen, und sie wäre ungenau gewesen:
Die alte Frau gab.
Solange die Erinnerung der Dörfler zurückreichte, war dies der auffälligste Wesenszug der alten Frau gewesen: Sie gab. Sie rief die Kinder von der
Straße zu sich herein, um ihnen Quittenbrot oder warme Apfelkringel zu schenken; sie
bastelte Papiergirlanden für das Feuerwehrfest und brachte sie zu der Sitzung mit, auf der beraten wurde,
ob überhaupt ein Feuerwehrfest stattfinden sollte; sie schrieb Noten aus dem
Chorgesangbuch ab und schenkte sie dem Gesangverein des Dorfes, sie holte alte
Sprossenfenster vom Dachboden ihres Hauses und schenkte sie den Städtern, die das Haus neben dem ihren restaurieren wollten – sie gab und gab.
Wollte man hingegen ihr eine Freude machen und brachte ihr etwa einen Arm voll
frischem Lauch oder eine Steige Birnen, so wehrte sie die Gabe jedes Mal
unwirsch ab: Sie könne sich ganz gut selbst ernähren, sie bedürfe keiner Fürsorge, und an Obst oder Feldfrüchten mangele es ihr ja nun wohl wirklich nicht. Auch das Angebot, ihr bei der
Gartenarbeit zu helfen, schlug sie mit einer Harschheit aus, die den
Anbietenden fast beschämte – sie schien das Privileg des Schenkens und Helfens für sich allein beanspruchen zu wollen.
Auf den allfälligen Festen des Dorfes war es ihr unmöglich, an einer Apfelweinrunde teilzuhaben, die jemand anders ausgegeben hatte,
ohne sogleich darauf zu bestehen, die nächstfolgende Runde müsse nun aber ihr gehören. Selbst das Geschenk des Bürgermeisters zu ihrem siebzigsten Geburtstag, das sie nun wirklich nicht
ausschlagen konnte, quittierte sie mit einem knurrigen „… älter werden ist ja kein Verdienst …“.
Die alte Frau konnte nicht nehmen.
Man belächelte diese Eigenart als die liebenswerte Schrulligkeit einer alten Frau,
rechnete sie auch einer althergebrachten Bescheidenheit zu, deren Fehlen bei
der jüngeren Generation von den Älteren beklagt wurde. Selbst als sie, nur um kein Geld dafür annehmen zu müssen, den unteren Zwickel ihres Grundstücks an ihre städtischen Nachbarn herschenkte, damit diese einen ungehinderten Zugang zu ihrer
Garage hätten, erklärte man sie hinter vorgehaltener Hand zwar für komplett weltfremd, aber nicht ohne einen achtungsvollen Unterton, stellte sie
sich doch mit solchem Verhalten außerhalb jeden Verdachtes der Käuflichkeit.
Nach und nach aber gingen den Leuten des Dorfes die Argumente aus, mit denen sie
das ungewöhnliche Verhalten der alten Frau erklärbar zu machen versuchten. Nicht etwa, dass man den Wert des Gegebenen oder gar
ihre Motive des Gebens in Zweifel gezogen hätte – die Gaben waren immer von großer Nützlichkeit und wurden ganz offenbar von Herzen gern gegeben. Allein die
offenkundige Unfähigkeit der alten Frau, ihrerseits Gaben anzunehmen, die gleichermaßen nützlich gewesen und mit gleicher Freude gegeben worden wären, irritierte mehr und mehr.
Es wurde erkennbar – auch wenn keiner der Dorfbewohner sich angemaßt hätte, es so klar auszusprechen –, dass die alte Frau aus demselben Grund so großzügig gab, aus dem sie so unfähig war, zu nehmen: aus dem Grund nämlich, dass sie sich selbst gering achtete und den Wert des von ihr Gegebenen für niedriger hielt als den Wert dessen, was ihr ohne Aufrechnung oder Vergleich
angedient wurde.
Aus dieser nie ausgesprochenen, gleichwohl empfundenen Erkenntnis erwuchs ein
zunehmendes Unbehagen der Dörfler gegenüber den Gaben der alten Frau: Sie hielt sich und ihre Gaben für nicht wert. Wie sollte da für andere wert sein, was sie gab?
Die schroffe Ablehnung eines unschuldigen bunten Frühlingsstraußes, den ein dankbares Kind im elterlichen Garten für die alte Frau gepflückt hatte, wurde zum Anlass für den offenen Ausbruch dieses aufgestauten Unbehagens. Jenes Kind war weinend
und verschreckt ob der verständnislosen Abweisung nach Hause gelaufen, und die Eltern hatten ihm von weiteren
Besuchen bei der alten Frau abgeraten, wissend, dass nichts für ein Kind schmerzlicher ist als die Zurückweisung seiner Liebe und Zuneigung.
Die anderen Kinder des Dorfes, obgleich für Quittenbrot und warme Apfelkringel stets empfänglich, machten in der Folgezeit weite Umwege, um nur nicht an dem kleinen
Holzhaus der alten Frau vorbeigehen und ein unerbetenes Geschenk empfangen zu müssen. Auch die Haltung der erwachsenen Dorfbewohner änderte sich. Bei allen Begegnungen mit der alten Frau achtete man peinlichst
darauf, ihr keinerlei Gelegenheit zum Schenken zu geben, und selbst bei den
alltäglichsten Kontakten vermied man es, die Worte „bitte“ oder „danke“ zu gebrauchen, in welchem Zusammenhang auch immer. Zu Zeiten bekam diese Art
des Umgangs den Charakter einer absurden sozialen Ächtung.
Nichts von alldem aber geschah absichtsvoll oder gar auf Grund einer Absprache
oder Verschwörung: Das Dorf reagierte so auf den offenkundigen Anspruch der alten Frau, die
Einzige zu sein, die geben durfte.
Es gab viele Stimmen an den Stammtischen und Theken, die diese Entwicklung mit
Besorgnis begleiteten. Denn niemand im ganzen Dorf hätte jemals behaupten mögen, er könne die alte Frau nun nicht mehr leiden. Im Gegenteil, den meisten Dörflern tat sie leid.
Aber niemand wollte mehr etwas mit ihr zu tun haben, geschweige denn eine Gabe
von ihr annehmen, für die man sich nicht einmal bedanken durfte.
Unter dieser Isolierung verkümmerte die alte Frau zusehends. Das Geben war ihre einzige Möglichkeit gewesen, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen. Diesen Kontakt
durch das Zulassen einer Gegenseitigkeit zu pflegen vermochte sie nicht; denn
sie war sich selbst nicht wertvoll.
Die alte Frau verstummte. Sie erschien nicht mehr auf den Festen, kam nur noch
selten zum Einkaufen in den Laden des Dorfes und setzte sich auch abends nicht
mehr auf das niedrige Mäuerchen vor ihrem Haus, um die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen, wie sie es früher gern getan hatte. Und eines Tages im Herbst starb die alte Frau, stumm und
beinahe unbemerkt.
An ihrer Beerdigung nahm das ganze Dorf teil. Dies war ein Dank, gegen den sie
sich nicht mehr wehren konnte, ein Dank für die Erkenntnis, die sie ihren Nachbarn durch ihr seltsames Verhalten ermöglicht hatte: Es ist wunderbar, wenn man schenken kann. Es ist die eine Hälfte der Liebe.
Die Liebe aber lebt nur als ein Ganzes.
Paul
Paul stank. Auch mit dem größten Wohlwollen hätte man es nicht anders ausdrücken können. Er stank nach Schweiß, nach Urin, nach Dung und nach vielem, was man am liebsten zu analysieren
vermeiden möchte.
In der Dorfkneipe, bei Susanne, stank zwar jeder – zeig mir einen Schlosser, der nicht nach Schmieröl und Ruß stinkt, wenn er, wie zum Beispiel der Georg, direkt von der Arbeit in die
Kneipe kommt. Aber Paul kam nur am Samstagabend, wenn jeder andere zuvor
Gelegenheit zum Duschen gehabt hatte, und da fiel sein Gestank natürlich besonders auf.
Deshalb stand Paul auch nie mit den anderen Dorfbewohnern an der Theke, sondern
saß immer abseits an einem Tisch in der Ecke des Gastraumes und trank seinen
Rotwein.
Sein Aussehen und seine Kleidung entsprachen dem Gestank, den er verströmte. Die Haut seines Gesichts war weiß und großporig, so ein krankes, ein Fischbauch-Weiß, seine Nase, vom Rotweingenuss bereits in jungen Jahren gezeichnet, ragte etwas
schief aus seinem Gesicht – möglicherweise in Folge einer Kindheitsprügelei. Sein Körper war kräftig, seine Hände tellergroß, mit dicken, behaarten Fingern, und seine Klamotten waren immer dreckig und
teilweise zerrissen.
Wegen dieses Gestanks und wegen seiner abweisenden und eigenbrötlerischen Art sprach kaum jemand mit ihm; seine Familiengeschichte war jedoch
allgemein bekannt. Sein Vater hatte in einen der wohlhabendsten und
angesehensten Höfe der Gegend eingeheiratet, der dann, beim Tode des Großvaters, unter den drei Söhnen und Pauls Mutter aufgeteilt worden war, wobei diese, als Mädchen, natürlich den kleinsten Anteil abbekommen hatte.
Immerhin hatte dieser Anteil der Familie noch ein bescheidenes Einkommen
gesichert, das Pauls Mutter dadurch ergänzt hatte, dass sie in einer Anwaltskanzlei in Königswinter als Sekretärin arbeitete.
Doch dann war die Mutter am Krebs gestorben, und der Vater, allen Lebensmuts
beraubt, hatte sich in der Scheune des Anwesens erhängt. Paul hatte ihn dort gefunden.
Zur Trauerfeier für Pauls Vater war das ganze Dorf gekommen; er hatte immerhin zu einer der
angesehensten Familien gehört. Auch Paul war da gewesen, in einem speckigen schwarzen Anzug, und er hatte
gestunken, wie immer. Die anderen Trauergäste ließen ihn nicht durch zu seinem Vater.
Dies wurde am Abend nach der Beerdigung in der Kneipe bei Susanne lebhaft
diskutiert, und diejenigen, die ein solches Verhalten am strengsten
missbilligten, waren diejenigen, die Paul am Nachmittag nicht durchgelassen
hatten.
Der verbleibende Hof wurde zwischen Paul und seinem Bruder Gerd aufgeteilt. Gerd
hatte in Köln Betriebswirtschaft studiert und war an der Landwirtschaft nicht interessiert;
er verkaufte seinen Anteil des Hofes an einen anderen Landwirt, zahlte Paul aus
und verkaufte dann auch das Haus.
Nun hatte Paul also ein Stück Land geerbt, ein Pferd und ein bisschen Geld. Jeder im Dorf erwartete nun,
dass er das Land und das Pferd ebenfalls zu Geld machen würde, das er dann in Köln würde versaufen können.
Aber Paul blieb. Wilhelm Mertins, der bei Oberpleis eine kleine, aber feine
Pferdezucht betrieb, erzählte, dass er einen wirklich anständigen Preis für das Pferd geboten und dieses Angebot sogar noch erhöht habe, aber Paul hatte um keinen Preis verkaufen wollen. Das Pferd war ein großrahmiger, rotbrauner Wallach mit Namen Horst.
Paul brachte Horst zunächst in einer Bretterhütte am Rande der Pferdekoppel unter, dem einzigen Gebäude – wenn man es denn so nennen konnte – auf seinem soeben ererbten Land. Diese Hütte verkroch sich im Wildwuchs unter einer Gruppe von alten Eichen, und offenbar
hatte auch Paul sich dort häuslich eingerichtet.
Nach wie vor kam er samstagabends zu Susanne in die Kneipe, trank seinen Rotwein
und stank vor sich hin. Tagsüber sah man ihn oft über sein Land gehen, von Zeit zu Zeit Proben der Ackerkrume aufnehmen, die Gräser und Wildblumen betrachten und leise Selbstgespräche führen
Offenbar waren in der Bretterhütte auch landwirtschaftliche Gerätschaften, Saatgut und Düngemittel untergebracht gewesen, denn im Frühjahr sah man Paul täglich mit Horst auf den Feldern, pflügend, eggend und säend, so, wie man es aus alten Kinderbüchern kennt, die den Bauernberuf romantisch verklären.
Im Gegensatz zu Pauls vernachlässigtem Äußeren war Horst ein außerordentlich gepflegtes Tier. Sein Fell war stets auf das Sorgfältigste gestriegelt, Mähne und Schweif gründlich gekämmt, und seine Hufe waren morgens, bevor es aufs Feld ging, blitzsauber. Auch
sein Zaumzeug und Geschirr sahen immer so aus, als würden sie mit Hingabe und Sachkenntnis instand gehalten.
Wenn Paul eine Pause von der Feldarbeit einlegte und sich auf einer Böschung ins Gras setzte, stand Horst neben ihm, rupfte ohne Hast ein bisschen Grünzeug und trank aus dem bereitgestellten Eimer. Von Zeit zu Zeit rieb er seine
Nase an Pauls Schulter und forderte ihn auf, wieder an die Arbeit zu gehen, die
ihm offensichtlich Spaß machte.
Nachdem die Saat ausgebracht war, begann Paul, den Wildwuchs hinter seiner
Bretterhütte zu roden und mit Spitzhacke und Spaten eine große, tiefe Grube auszuheben. Nach zwei Wochen bereits war diese Grube so tief,
dass Paul zur Gänze darin verschwand, wenn er darin arbeitete. Nur die Schaufel tauchte in
regelmäßigen Abständen über dem Grubenrand auf, und eine weitere Woche später trug Paul dann den Aushub in Körben hinaus.
Nach insgesamt etwa anderthalb Monaten war die Baugrube – denn um nichts anderes handelte es sich – schließlich fertig, und Paul begann, mit einem Handkarren diejenigen Baustellen in der
Umgebung abzuklappern, bei denen der Rohbau bereits fertig war. Auf jeder gab
es übrig gebliebenes Material, ein paar Bimskoffer hier, einen halben Sack Zement
dort, Bretter und Balken, die nicht mehr benötigt wurden. Paul klaute die Sachen nicht, sondern bot den Bauherren kleines
Geld an, und die waren froh, dass er das Zeug entsorgte.
Jeden Abend kam Paul mit seinem hoch beladenen Handkarren zurück, meistens mit zufriedener Miene, und da mein Grundstück an sein Land grenzte, führte sein Weg ihn morgens und abends an meinem Haus vorbei. Nach einigen
unverbindlichen „Tach“s und „’n Abend“s kamen wir ganz allmählich in eine Art nachbarlichen Gesprächs.
Eines Abends brachte er strahlend und stolz einen rostigen Betonmischer mit und
blieb vor meinem Haus stehen, um mir Gelegenheit zu geben, seine Errungenschaft
zu bewundern.
„Läuft das Ding?“, fragte ich zweifelnd.
„Sie hatten’s letzte Woche noch in Betrieb. Ist leider elektrisch, aber ich hab’s billig gekriegt. Kann ich ’ne Kabeltrommel bei dir anschließen?“
„Ja, klar. Brauchste auch Wasser?“
„Nee, hab ’ne Pumpe im Stall, für dem Horst seine Tränke.“
„Soll ich dir abladen helfen?“
„Nenee, geht schon.“
Er zerrte den Handkarren zu seiner Bretterhütte und begann ihn zu entladen. Für die Mischmaschine legte er zwei Holzplanken an die Rampe des Karrens und
balancierte seinen Schatz vorsichtig und beinahe zärtlich hinunter auf den Boden. Ich holte derweil eine Kabeltrommel aus meiner
Garage, schloss sie an und brachte sie zu ihm hinüber. Das Kabel reichte nicht ganz bis zu seiner Hütte.
„Macht nix, ich hab auch noch eine“, sagte er, und: „Danke.“
„Meld dich, wenn du was brauchst.“
„Jou.“
Die folgenden Tage bekam ich ihn kaum zu Gesicht, hörte nur, wie er in der Baugrube hämmerte und sägte. Danach lief die Mischmaschine in viertelstündigen Intervallen nahezu zwei Tage lang, und danach war erst mal wieder Ruhe.
Paul zog morgens wieder mit seinem Handkarren los und kam abends erschöpft, aber meistens glücklich wieder zurück, den Karren voller Baumaterial.
Er veränderte sich. Sein Gesicht war, wohl auch durch die ständige Arbeit im Freien, nicht mehr so käsig weiß, seine Figur straffte sich, und seine Bewegungen waren nicht mehr so tapsig und
unbeholfen wie zuvor. Er ging weiterhin samstags in die Dorfkneipe, saß dort weiterhin allein an seinem Ecktisch und trank seinen Rotwein, aber er
schien nicht mehr so dumpf vor sich hin zu brüten, sondern den Gesprächen an der Theke zu folgen; ab und zu lachte er auch schon mal über einen Witz, der dort erzählt wurde. Und er stank nach wie vor.
Unsere nachbarlichen Gespräche hatten sich wieder auf gelegentliche „Tach“s und „’n Abend“s reduziert, denn er schuftete jetzt hart an seinem Bau, zog eine Betondecke über seiner Baugrube ein, indem er Balken darüberlegte, sie von unten mit Brettern verschalte, von oben mit Stücken von Baustahlgewebe armierte und sie dann mit Beton ausgoss – eine etwas gewagte Vorgehensweise, wie mir schien.
Überraschenderweise arbeitete er dann nicht an diesem vorderen Teil seines Baus
weiter, sondern zog erst mal einen rechteckigen Graben tiefer in das Buschwerk
hinein, den er mit Beton ausgoss und so ein Fundament schaffte, auf dem er
einige Zeit später zu mauern anfing. Er war ein geschickter Maurer und arbeitete hart; nach
wenigen Tagen bereits standen die Wände dieses Anbaus, den er mit Wellblech und Planen abdeckte, um eine Art Stall für Horst zu schaffen.
Er schien sein Arbeitstempo stetig zu erhöhen, so, als ob er unter einem Zeitdruck stünde. Als der Stall für Horst stand, zog er für eine Weile wieder über Land, um weiteres Baumaterial heranzuschaffen, mauerte dann wieder für ein paar Tage, goss Fenster- und Türstürze aus Beton in selbst gezimmerten Holzformen, und allmählich wuchs sein Haus in die Höhe, grob und ungeschlacht wie er selbst, aber es war sein Haus.
Irgendwann im Spätsommer kam er an meine Haustür, einen riesigen Champignon in der Hand. Das Ding maß bestimmt 30 Zentimeter im Durchmesser und gleich viel in der Höhe.
„Hab ich hinterm Stall gefunden.“
„Kann man das essen?“
„Ja, klar –“, er brach ein Stück ab und steckte es in seinen Mund. „Ganz normaler Champignon. Kannste klein schneiden und in der Pfanne braten.“
„Na, super. Lass ihn dir schmecken.“
„Hier, ist für dich.“ Er hielt ihn mir entgegen. „Für den Strom, aber auch so.“
Für einen Moment war ich baff; dann schoss mir der Gedanke durch den Kopf, dass er
in seinem Rohbau da drüben vermutlich gar keine Kochgelegenheit hatte. Gleichzeitig schämte ich mich dafür, ihm ein so banales Motiv zu unterstellen –
„Das ist viel zu viel für eine Person. Vorschlag: Ich mach uns eine leckere Pilzpfanne, ein paar Steaks
dazu, und wir essen das gemeinsam bei mir auf der Terrasse.“
„Nee, lass mal – danke“, er war verlegen, „ich bin total dreckig und verschwitzt – ich will dir nicht die Bude vollstinken.“
„Wenn du willst, kannst du ja in der Einliegerwohnung duschen. Und ein paar
frische Klamotten finden wir auch.“
„Is’ nich’ dein Ernst“, brach es aus ihm heraus.
„Mein voller Ernst“, versetzte ich, „die Einliegerwohnung hab ich sowieso nur für Gäste. Komm, wir gehen mal runter.“ Ohne seine Antwort abzuwarten, nahm ich den Schlüssel vom Haken und ging um das Haus herum zum Souterrain.
„Hier – Seife, Shampoo, alles da. Lass dir Zeit. Ich bring dir gleich ein Handtuch
runter, ein paar frische Klamotten. Leg ich hier im Wohnzimmer aufs Sofa, okay?“
Offenbar hatte es ihm die Sprache verschlagen, denn er murmelte nur ein leises „Okay“ und sah sich ungläubig in dem Gästebad um. Ich ging schnell wieder nach oben in meine Wohnung, suchte ein altes
Flanellhemd heraus, eine Cordhose, die mir zu weit geworden war, ein Paar
Socken und Unterwäsche und ein frisches Handtuch. Die Sachen sollten ihm einigermaßen passen, wir waren etwa gleich groß, wenn er auch etwas kräftiger gebaut war als ich.
Als ich den Wäschestapel im Wohnzimmer des Gäste-Apartments ablegte, hörte ich bereits das Wasser in der Dusche rauschen. Gut so. Ich ging wieder nach
oben und machte mich über den Riesen-Champignon her.
Eine gute halbe Stunde später klingelte Paul an meiner Wohnungstür. Er trug meine Cordhose, die er an den Hosenbeinen umgeschlagen hatte, und
mein Flanellhemd, das über seiner Brust ein wenig spannte. Er stank nicht mehr und sah zufrieden aus.
„Und?“, fragte ich.
„Tat gut“, sagte er.