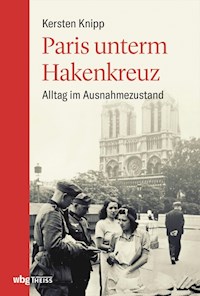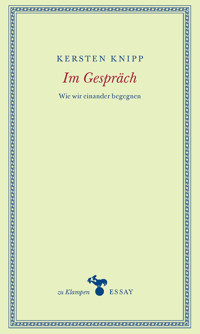
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: zu Klampen
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Gespräch, häufig unterstützt durch Mimik und Gestik, ist die wohl wichtigste Form menschlicher Interaktion – sei es im privaten Umfeld, beim Flirt, im Beruf, in Politik und Wirtschaft. Der Rückzug ins »Homeoffice« hat aus dem Blickfeld geraten lassen, wie entscheidend, ja inspirierend ein beiläufiger verbaler Austausch am Arbeitsplatz sein kann. »Wir bleiben im Gespräch«, diese Aussage signalisiert die Bereitschaft zur Verständigung. Verstummt das Wort, steht es auch um unsere Freiheit schlecht. Im Dialog kommen wir einander näher, grenzen uns ab, deuten unsere Welt, verorten uns, entfliehen der Einsamkeit. Kersten Knipp erkundet in diesem Essay die vielfältigen Möglichkeiten, in denen wir sprechend miteinander in Kontakt treten und weshalb das Wort zwar nicht unbedingt der Anfang von allem gewesen sein mag, unser Dasein aber weitgehend bestimmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
KERSTEN KNIPP
Im Gespräch
Wie wir einander begegnen
Reihe zu Klampen Essay
Herausgegeben von
Anne Hamilton
Kersten Knipp, geboren 1966, Romanist
und Autor, arbeitet für die Deutsche Welle, den WDR und andere Sender der ARD und schreibt für verschiedene Printmedien. Schwerpunkt seiner Arbeit ist zum einen die Kulturgeschichte der romanischen Welt und zum anderen die politische Zeitgeschichte des Nahen Ostens. Zu beiden Themen hat er mehrere Bücher veröffentlicht.
Für Wilma.All die Gespräche.
Inhalt
1. Völlig losgelöst Einleitung
2. Dröhnende Stille Labyrinthe der Einsamkeit 25
3. Das Schweigen zum Tode Verstummen vor der totalen Macht
4. Love Is in the Air Das Gespräch der Verliebten
5. Nur ein kleines Wort Von der Produktivität des Widerspruchs
6. Zu solchen Stunden Das Gespräch als Aufbruch
7. Zauberworte Die Kraft der Fiktion 127
8. »Okaaay!«Vom Schrecken der Phrase
9. Lust am Plappern Der Small Talk
Impressum
1. Völlig losgelöst
Einleitung
Die Seele haschte –
da hatte sie ein tönendes Wort!
Johann Gottfried Herder,
»Abhandlung über den Ursprung
der Sprache«
ALS existierte die Schwerkraft nicht, durchmessen sie die Lüfte, losgelöst von allem. Ätherisch und leicht schweben sie dahin, ohne Sinn für ihr Umfeld offenbar, ohne Blick für die Schönheit der Landschaft, die bukolische Ruhe des Waldes, den sich träge hinwälzenden Fluss. All dies, ist zu vermuten, sehen sie nicht, so vertieft sind sie in ihr Gespräch. Getragen von Worten, haben sie nicht einmal Sinn für die Dramatik der Situation, ihren Schwebezustand in Himmelshöhen, knapp unter den Wolken, weit oberhalb jener Regionen, in denen sie sonst zu Hause sind. Doch als wäre es das Normalste der Welt, sich in solchen Lüften aufzuhalten, haben sie nur Sinn für das, was sie verbindet, ihr Gespräch. Einander zugewandt, miteinander vertraut ganz offenbar, lassen sie ihrer Unterhaltung freien Lauf, einem Dialog, der sie im Wortsinn beflügelt. In höchste Höhen hat die Unterhaltung sie getragen, dahin, wo die üblichen Gesetze nicht mehr gelten, selbst die der Natur für eine Weile ausgehebelt sind, die Schwerkraft ihre Gültigkeit verliert, wo nichts mehr zählt als das gleitende Wort – das Wort, das alles andere vergessen lässt, das nie gekannte Räume öffnet, in unerreichbare Regionen trägt, in Dimensionen, von denen Menschen meist nicht einmal ahnen, dass sie ihnen offen stehen, jedenfalls einen Moment lang, für die Dauer ihres Gesprächs.
»La reconnaissance infinie« hat der belgische Maler René Magritte sein 1960 entstandenes Bild genannt: zwei Männer, deren Spaziergang sie geradewegs in den Himmel führt. Es ist kein religiös konnotierter Himmel, aber doch ein Himmel. Nicht strahlend, sondern grau verhangen, jeden Moment könnte ein Regen losbrechen. Mit Witterungen ist zu rechnen, so viel moderne Skepsis allem Himmlischen gegenüber muss sein, deutet Magritte an – und doch: Himmel bleibt Himmel, die hohe Luft ist das Reich des Außergewöhnlichen und Unwahrscheinlichen, und dass die beiden Spaziergänger diese Höhen erklommen haben, darf man doch dem Wunder zurechnen, etwas nüchterner: der enormen Kraft, die das Gespräch, jedenfalls in seinen besten Momenten, entfaltet. Wer so vertieft ist in die Unterhaltung mit dem Gegenüber, gibt das Bild zu verstehen, für den gelten die üblichen Beschränkungen nicht mehr, der setzt sich traumgleich über alle Hindernisse hinweg, der muss mit den Vorgaben der physischen Realitäten für eine Weile nicht leben. Gewiss, Wunder sind nicht zu erwarten, alles ist konventionell. Gehrock, Spazierstock und Melone der Spaziergänger deuten vollkommene Normalität an. Doch die hindert an nichts, das Ungeheure, das die Szene einfängt, lässt sich vom Gewöhnlichen nicht beeindrucken, im Gegenteil, es bläst alles herkömmliche Kalkül zur Seite und führt nebenbei geradewegs in die Kunstgeschichte, die Epoche des Surrealismus mit seinem Sinn für das Phantastische hinter allem Alltag, einem Sinn, der sich von der Biederkeit der Welt partout nicht geschlagen geben will.
»La reconnaissance infinie«: Das ist nicht leicht zu übersetzen: Als »Unendliche (gegenseitige) Anerkennung« ließe es sich übertragen, aber auch als »unendliche Dankbarkeit«. Beides fließt in diesem Bild zusammen. Die beiden Gesprächspartner schätzen einander, das deutet schon der ansatzweise geschlossene und darum dem Gespräch günstige Winkel an, in dem sie zueinanderstehen, ebenso auch der Spazierstock, der eine fast physische Verbindung zwischen ihnen schafft. Diese Wertschätzung ist Voraussetzung jedes gelingenden Gesprächs, das seinerseits die erstaunlichsten Effekte bewirken kann (etwa, Magritte zufolge, die Aufhebung der Schwerkraft).
Am Anfang war das Wort, ist an prominenter Stelle zu lesen, und das heißt, es schafft etwas ganz und gar Neues. Es entfaltet eine Kraft, über die das für kaum denkbar, kaum möglich Gehaltene Wirklichkeit werden, der Welt einen neuen Lauf geben kann. Ungleich nüchterner formuliert: »Die Spiele der Sprache sind das Spiel, das uns zu Lebewesen macht, die in ihrem Denken und Handeln einen Spielraum zu ihrem Denken und Handeln haben.«1 Im Gespräch geht es ganz wesentlich auch um dieses: neue Ideen zu entwickeln, Ungesagtes zu sagen, Übersehenes sichtbar zu machen, neue Perspektiven aufzuzeigen. Und nicht nur aufzuzeigen, sondern auch ihre Plausibilität offenzulegen, den Gedanken, ja sogar die Überzeugung zu wecken, das Gesagte finde tatsächlich seinen Weg in die Welt und könne sie verändern. Das Gespräch wirkt, intellektuell wie psychologisch, es erschafft Ideen, die allein schon darum, dass sie artikuliert werden, enormes Potential entfalten, jedenfalls entfalten können.
Für dieses Wunder, das zeigt die zweite Übersetzungsmöglichkeit, kann, ja muss man unendlich dankbar sein. Das Gespräch ist eine kulturelle Technik, die uns im besten Fall bis in den Himmel hebt. Nichts Neues kommt in die Welt, ohne dass zuvor das Wort erklingt. Das Gespräch steht am Anfang aller Verwandlung. Vermutlich ist es sogar der Grund aller Veränderung.
»Eine närrische Sache«
Damit deutet es sich an: In diesem Buch geht es nicht um jede Art von Gespräch. Es geht nicht um die Frühkonferenz am Montagmorgen, nicht das Dienstgespräch zwischen Kollegen, nicht um das gemeinsame Erstellen der Einkaufsliste, nicht um die Absprache, wer wann das Kind zur Schule bringt oder wieder abholt. Es geht nicht um das schnelle Gespräch zwischen Arzt und Patient, nicht um die Fachberatung im Elektrogeschäft, nicht um die kurze Erkundigung am Infoschalter der DB. Nichts gegen solche Gespräche: Sie sind wichtig, bisweilen sogar überlebenswichtig; in ihrem dichten Netzwerk halten sie letztlich die Funktionen ganzer Gesellschaften zusammen. Und dennoch: Um sie geht es nicht in diesem Buch. Der rasche, präzise Informationsaustausch, so unverzichtbar er im Alltag sein mag, so wenig wir in nahezu jeder Hinsicht ohne ihn auskommen: Er spielt in diesem Buch allenfalls eine kleine Rolle. Er tritt in den Hintergrund gegenüber einer anderen Form der Kommunikation: dem vertrauten Gespräch, der Unterhaltung, die über den reinen Austausch oder Abgleich von praktischen Informationen weit hinausreicht. Jenes Gespräch, in dem es vor allem um die Partner selbst geht, ihre Weltsicht, ihre Wünsche, ihre Absichten, ihr Selbstverständnis. Natürlich schwingen solche Motive auch in ganz alltäglichen Gesprächen mit. Aber erst im vertrauten Gespräch kommen sie ganz zur Geltung, erst hier wird eine Art Offenbarung möglich. Wenn das vertraute Gespräch einen himmlischen Charakter hat, wie Magritte es in seinem Gemälde andeutet, dann darum, weil es aller konkreten Zwänge enthoben ist, keinem Druck entsprechen, keine – oder nur wenige – Rücksichten nehmen muss, sondern sich frei entfalten kann. Es bietet die Chance, sich zu zeigen, den anderen zu sehen, über alles und nichts zu sprechen und darüber – vielleicht – zu neuen Einsichten zu kommen, aus denen ganz Unerwartetes entstehen kann. Und doch handelt es sich hier um kein psychoanalytisches Gespräch im engeren Sinne, das ja gerade darauf setzt, bei einem der Partner – dem Patienten – Blockaden abzubauen. Natürlich ist auch das möglich, und davon wird in diesem Buch noch die Rede sein. Aber letztlich sind auch neue Einsichten, ein neues Selbstverständnis, nur Nebeneffekte jenes tiefen Verlangens, das uns Tag für Tag dazu drängt, uns auszutauschen, genauer: in Kommunikation miteinander zu treten. Dieses Verlangen, den anderen im Gespräch zu hören und damit auch zu spüren, ist vielleicht der Grund, warum wir das Bedürfnis haben, miteinander zu sprechen. Nein, es geht nicht um Informationen, bemerkt Georg Philipp von Hardenberg alias Novalis. Uns treibt etwas ganz anderes. »Es ist eigentlich um das Sprechen und Schreiben eine närrische Sache«, notiert der Dichter. »Das rechte Gespräch ist ein bloßes Wortspiel. Der lächerliche Irrtum ist nur zu bewundern, dass die Leute meinen – sie sprächen um der Dinge willen. Gerade das Eigentümliche der Sprache, dass sie sich bloß um sich selbst bekümmert, weiß keiner. Darum ist sie ein so wunderbares und fruchtbares Geheimnis, – dass wenn einer bloß spricht, um zu sprechen, er gerade die herrlichsten, originellsten Wahrheiten ausspricht.«2
Nein, wir sprechen nicht um der Dinge willen. Wir sprechen, sehr oft jedenfalls, um den Austausch mit anderen zu pflegen. So verstanden, ist das Gespräch nichts anderes als die konzentrierte, intensive Begegnung zweier Menschen. Darum ist es nicht erstaunlich, dass wir das Gespräch brauchen, fast wie die Luft zum Atmen. Das Gespräch, das ernsthafte Gespräch – »deep talk« heißt es sehr schön im Englischen –, ist eine Gnade. Und während Magritte seine beiden Spaziergänger in die Höhe führt, zieht es die Gesprächspartner im Englischen nach unten, in die »Tiefen« des Gesprächs, also auf ein Level weit unterhalb unserer gewöhnlichen Aktionsbasis, auf eine Ebene, die sich der alltäglichen Ebene unseres Daseins entzieht. Der Begriff der »Tiefe« deutet es an: Sprache öffnet einen Raum, in dem der Mensch verschwinden kann, der ihn an andere Orte führt, weit weg von jenen, in denen er sich sonst aufhält. Das Gespräch, deuten Magritte und der »deep talk« an, ist eine Reise – es kann zumindest eine sein. Und wenn keine Reise, dann zumindest eine Wegmarke, ein Fingerzeig.
Körpersprache
Und wie es so ist mit dem Reisen: Es ist in erster Linie eine körperliche Angelegenheit. Auf Reisen begibt man sich physisch, man ist mit dem gesamten Leib unterwegs. Beine und Füße überwinden im Gehen mal größere, mal kleinere Distanzen, sind in unablässiger Bewegung, tragen das übrige voran, derweil die Arme in passendem Rhythmus seitwärts baumeln, während der Kopf wiederum sich dreht und aufnimmt, was Augen und Ohren nur zu fassen kriegen. Auch Magrittes Bild ist das einer Reise, und das heißt auch: Ohne den Körper geht es nicht. Der Körper ist Voraussetzung allen Reisens, und im Gespräch ist es nicht anders: Das Wort kommt nicht von allein. Damit es erklingt, ist vieles vorausgesetzt: Artikulationswerkzeuge, vom Rachen bis zum Gaumen über die Zunge bis zu den Zähnen und den Lippen, während es, um verstanden zu werden, auf der anderen, der Empfängerseite, der komplexen Mechanik des Gehörs bedarf. Phonetiker haben eindrucksvoll gezeigt, was es im Detail braucht, damit das Wort zu Schall wird – in welchem Grad sich etwa die Lippen bei einem »I« spannen, während sie beim »Ü« einiges über deren Wölbung sagen. Auch der Mechanismus nasaler Resonanz bei »M« und »N« lässt sich phonetisch präzise, nämlich durch den Austritt des Konsonanten durch die Nase beschreiben, derweil die sogenannten Plosivlaute – »P«, »T« oder »K« etwa – auf ein orales Hindernis stoßen, das den Luftstrom zunächst am Entweichen hindert, und zwar so lange, bis er sich kraftvoll entlädt und dabei den gewünschten Laut erklingen lässt. All dies zeigt: Das Wort ist auch eine hochgradig körperliche Angelegenheit. Und noch viel mehr ist es das Gespräch. Das Wort schwebt nicht als rein geistige Emanation dahin, und ein Gespräch ohne Körper – ohne Körpersprache – ist schlicht unvorstellbar: »Das Wort ist mit dem Menschen verschweißt«,3 schreibt der Philosoph Philippe Breton, und das heißt, jedes Gespräch ist auch ein optisches Schauspiel: Unterarme schwingen durch die Luft, Hände drehen sich, weisen nach oben oder unten, Finger nuancieren die Richtung noch einmal, stufen ab und setzen Akzente, verleihen den Worten Bedeutungen, die ohne unsere Gesten nicht zum Ausdruck kämen. Wenn wir sprechen, scheint es bisweilen, wir seien eine Art Orchester. Wir dirigieren mit den Händen, neigen uns vor und zurück und geben den Worten so ihre Dynamik, drehen den Kopf und verschaffen dem Gespräch auf diese Weise einen Rhythmus oder sogar Gegenrhythmus, schatten die Worte durch Drehungen des Kopfes ab oder lassen sie um so kräftiger aufleuchten, und mit den Augen stellen wir noch einmal ganz neue Klangfarben her, imaginäre, die man nicht hört, aber doch wahrnimmt. Es ist so faszinierend wie amüsant, bei Gesprächen verstärkt auf Körpersprache zu achten, zu sehen, wie eng Körper und Wort miteinander verbunden, vermutlich gar nicht voneinander zu trennen sind. In unserem langen Gang durch die Zivilisation haben wir gelernt, unseren Körper zu kontrollieren, ihm allzu unwillkürliche Begegnungen nicht mehr durchgehen zu lassen. Aber Gespräch für Gespräch zeigt sich, wie schwer uns das fällt, wie sehr der Körper immer wieder nach vorne, zum Ausdruck drängt, wie viel auch er zu sagen hat. In eine Konversation vertieft, merken wir es gar nicht, aber schaut man anderen Menschen beim Sprechen zu, fällt es in die Augen: Das Wort sagt viel. Aber es sagt längst nicht alles. All die Blicke, die wir uns noch beim nebensächlichsten Geplauder zuwerfen: Was sind sie anderes als der Versuch, dem Gesprochenen Bedeutungen abzulauschen, die über vieles kommen mögen, nur nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, über die Worte, die wir aneinander richten?
Das Wort lädt zum Aufbruch. Der inspirierende und darum dynamische Charakter des vertrauten Gesprächs ist immer wieder gesehen worden. »Der genießende Mensch, der im Denken während der einsamen Mahlzeit an sich selbst zehrt, verliert allmählig die Munterkeit«, notiert Immanuel Kant. Er könne sie aber zurückgewinnen – nämlich dann, »wenn ein Tischgenosse ihm durch seine abwechselnden Einfälle neuen Stoff zur Belebung darbietet, welchen er selbst nicht hat ausspüren dürfen«.4 Kant lässt keinen Zweifel, und man kennt es selbst: Das Gespräch, insbesondere das Gespräch zu zweit, regt an. Zwei, drei oder noch mehr Personen stecken die Köpfe zusammen, schauen einander an, äußern sich, hören einander zu. Kopfnicken, kleine Gesten, Verständigungszeichen, und es geht von neuem los: neue Worte, neue Blicke, neue Gesten. Unendlich viel kann sich entwickeln in diesen Momenten, »neuer Stoff«, wie Kant sagt. Stoff, der sehr viel in Gang setzen kann.
Mag sein, dass das »tiefe« Gespräch dafür die besten Voraussetzungen bietet, aber Exklusivrecht für die Entstehung neuer Einsichten und damit Pläne, ja sogar Lebensentwürfe kann es nicht beanspruchen. Eines der folgenreichsten Gespräche, das ich selbst je geführt habe, war kurz, bestand nur aus wenigen Sätzen. Stattgefunden hat es 1984 in einem Bus in der Stadt Arles, in der Provence. 1984: ein Jahr, bevor ich Abitur machte, die Abschlussfahrt. Französisch hatte ich nach nicht sonderlich beeindruckenden Leistungen in der Schule wieder abgewählt, wenn auch mit innerem Bedauern – was ich mir allerdings nicht recht eingestehen wollte. Meine Kenntnisse der Sprache waren darum vor allem eines: überschaubar. Der Bus rollte also durch die Innenstadt von Arles, mein Blick fiel auf einen Juwelierladen oder das Schild, mit dem er für sich warb. »OR« war darauf zu lesen, in großen Buchstaben. Ich kannte das Wort nicht, und da ich gerade neben meinem Lateinlehrer saß, der auch Französisch unterrichtete, fragte ich ihn, was das Wort bedeute. »Gold« heiße das, erklärte er mir, das Wort komme aus dem Lateinischen, nämlich von »aurum«, und das kennte ich wohl als Teilnehmer des Leistungskurses Latein. Ja, das kannte ich. Und ich mochte es, wie eigentlich alle lateinischen Wörter.
Natürlich, ich hatte schon tiefere Gespräche geführt als dieses – ernstere, längere, vertrautere. Und doch gehörte dieses zu den eindrücklichsten. »Aurum« wird zu »or«: Hunderte Jahre Sprachgeschichte steckten in der Entwicklung – dem Wegfall des auf das Neutrum verweisenden Endpartikels wie auch der Verwandlung des Vokals. Die verschlankte Form schlug eine Brücke von der Gegenwart in eine ferne und gefühlt doch nahe Vergangenheit. Diese Verwandlung wühlte mich auf, ich empfand, so denke ich es mir heute, eine historische Kontinuität, der ich mich verpflichtet fühlte, mit der Folge, dass ich zu Hause umgehend die beiseitegelegten Französischbücher wieder hervorkramte, die Sprache nachmittags, nach dem Unterricht, lernte, sie fast über Nacht nicht mehr schwierig fand, vielmehr schlüssig durch und durch – und im folgenden Jahr mit dem Romanistikstudium begann, außer Französisch auch Spanisch und Italienisch lernte, ein Jahr darauf auch mein späteres Hauptfach, Portugiesisch, eine Sprache, deren zentrales Sonderzeichen, die sanft geschwungene Tilde – etwa in dem Wort »coração«, »Herz« –, mich faszinierte, so sehr, dass ich das Fach heute wieder wählen würde – in großer Dankbarkeit für das kurze und doch so wichtige Gespräch im Bus in den Straßen von Arles.