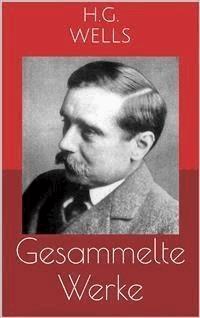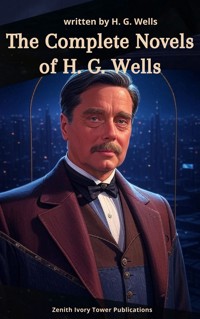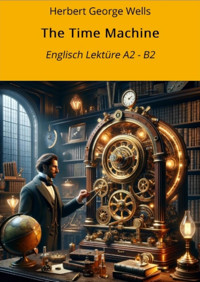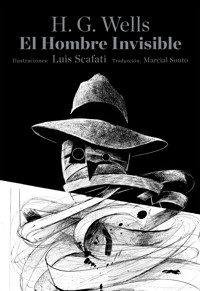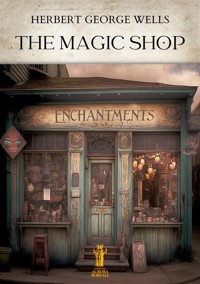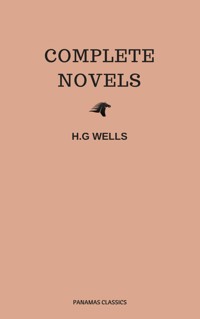0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Science Fiction & Fantasy bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
William Leadford, ein Vertreter der britischen Arbeiterklasse und Unterschicht, sieht sich um sein Glück betrogen. Überall wittert er Verschwörungen und Unterdrückung. Er fühlt sich missbraucht und ausgebeutet durch seinen Vermieter, den Pfarrer, den reichen Nebenbuhler seiner Auserwählten – kurz: durch die Oberschicht. Als er das Liebepaar am Strand mit einer Waffe stellen will, greift auch noch die deutsche Kriegsmarine an. Und als würde es noch nicht der Katastrophen genug sein, sieht man am Himmel einen Kometen auf die Erde zurasen. Doch der Komet wird anders auf die Menschheit einwirken als erwartet. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
H. G. Wells
Im Jahre des Kometen
Phantastischer Roman
H. G. Wells
Im Jahre des Kometen
Phantastischer Roman
(In the Days of the Comet)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-954189-32-8
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Prolog – Der Mann im Turm
Erstes Buch – Der Komet
Erstes Kapitel – Staub im Schatten
Zweites Kapitel – Nettie
Drittes Kapitel – Der Revolver
Viertes Kapitel – Krieg
Fünftes Kapitel – Die Verfolgung des Liebespaares
Zweites Buch – Die grünen Gase
Erstes Kapitel – Die Wandlung
Zweites Kapitel – Das Erwachen
Drittes Kapitel – Der Kabinettsrat
Drittes Buch – Die neue Welt
Erstes Kapitel – Liebe nach der Wandlung
Zweites Kapitel – Die letzten Tage meiner Mutter
Drittes Kapitel – Das Fest der Neugeburt und der Neujahrstag
Epilog – Das Fenster im Turm
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Science Fiction & Fantasy bei Null Papier
Auf zwei Planeten
Der Herr der Welt
Der Brand der Cheopspyramide
Die Macht der Drei
Befehl aus dem Dunkel
Die Spur des Dschingis-Khan
Der gestohlene Bazillus
Der Krieg der Welten
Der Unsichtbare
Die ersten Menschen auf dem Mond
und weitere …
Prolog – Der Mann im Turm
Ich sah einen grauhaarigen Mann, ein Bild kraftvollen Alters, an einem Schreibtisch sitzen und schreiben.
Es schien, als sei er in einem Turmzimmer, hoch oben, so daß man durch das große Fenster zu seiner Linken nur Weiten sah: einen fernen Meereshorizont, ein Gebirge und den unbestimmten Dunst und Schimmer des Sonnenuntergangs, der auf eine meilenweit entfernte Stadt deutet. Die ganze Einrichtung des Zimmers machte den Eindruck der Ordnung und Schönheit und war mir durch ein unnennbares Etwas, durch allerhand kleine Nüancen neu und fremd. Sie entsprach keinem Stil, den ich hätte bezeichnen können, und die einfache Kleidung des alten Mannes erinnerte weder an eine bestimmte Zeit noch an ein bestimmtes Land. Es mochte, so dacht’ ich, etwa die glückliche Zukunft sein, oder Utopien, oder das Land der reinen Träume. Ein irrendes Erinnerungs-Sonnenstäubchen, Henry Jones’ Wort und Erzählung von der »großen, guten Stadt«, blitzte mir durchs Gehirn und flog davon und ließ mich im Dunkeln …
Der Mann, den ich sah, schrieb mit einer Art Füllfeder … ein moderner Zug, der jeden historischen Rückblick verbot. Und so oft er in seiner leichten, fließenden Schrift einen Bogen beendete, legte er ihn zu einem wachsenden Stoß auf einem zierlichen kleinen Tisch unter dem Fenster. Die letzten Bogen lagen lose da und verdeckten zum Teil andere, die zu Heften zusammengefaßt waren.
Offenbar war er sich meiner Gegenwart nicht bewußt, und ich stand und wartete, bis seine Feder pausieren würde. Trotz seiner hohen Jahre schrieb er mit fester Hand …
Hoch über seinem Kopf entdeckte ich einen schräg geneigten Konkavspiegel; eine Bewegung darin fesselte unwiderstehlich meine Aufmerksamkeit. Ich hob die Augen und sah, verzerrt und phantastisch, aber hell und in schönen Farben, das vergrößerte, zurückgestrahlte, flüchtige Bild eines Palastes, einer Terrasse, der Perspektive einer breiten Straße mit vielen Menschen – – infolge der Krümmungen des Spiegels grotesk, unmöglich aussehenden Menschen – – die ab und zu gingen. Rasch drehte ich meinen Kopf, um durch das Fenster hinter mir deutlicher zu sehen; aber es lag zu hoch, als daß ich diese näherliegende Szene direkt hätte überblicken können, und nach einem kurzen Zögern wandte ich mich wieder dem Zerr-Spiegel zu.
Jetzt aber lehnte sich der schreibende Mann im Stuhl zurück. Er legte die Feder weg und stieß den halb unmutigen, halb von einer gewissen Befriedigung über das, was er geschrieben hatte, erfüllten Seufzer aus: »Ah! Arbeit, Arbeit! wie du mich froh machst und verzagt!«
»Was ist dies für ein Ort?«, fragte ich, »und wer sind Sie?«
Er sah sich mit der raschen Bewegung des Erstaunens um.
»Was ist dies für ein Ort?«, wiederholte ich, »und wo bin ich?«
Einen Augenblick lang blickte er mich unter gerunzelten Brauen fest an; dann milderte sich sein Ausdruck zu einem Lächeln.
Er wies auf einen Stuhl neben dem Tisch. »Ich schreibe«, sagte er.
»Über dies hier?«
»Über die Wandlung.«
Ich setzte mich. Es war ein sehr bequemer Stuhl, der geschickt unter dem Licht aufgestellt war.
»Wenn Sie lesen möchten – –« sagte er.
Ich deutete auf das Manuskript. »Die Erklärung?«, fragte ich.
»Die Erklärung!«, antwortete er.
Und während er mich ansah, zog er einen frischen Bogen zu sich heran.
Ich blickte von ihm auf sein Zimmer und wieder auf den kleinen Tisch … Ein Heft, das eine deutliche »I« trug, fiel mir auf und ich nahm es zur Hand; dabei lächelte ich ihm in die freundlichen Augen. »Schön!«, sagte ich, plötzlich ohne jedes Unbehagen, und er nickte und schrieb weiter. Und in einer Stimmung, die zwischen Vertrauen und Neugier schwankte, begann ich zu lesen.
Dies ist die Geschichte, die jener glückliche, emsig aussehende alte Mann in dem heiteren Raum geschrieben hat.
Erstes Buch – Der Komet
Erstes Kapitel – Staub im Schatten
I.
Ich habe mir vorgenommen, die Geschichte der »großen Wandlung« zu schreiben, soweit sie mein eigenes Leben und das Leben einiger eng mit mir verbundener Menschen berührt hat, und zwar ursprünglich nur zu meinem eigenen Vergnügen.
Vor langer Zeit schon, in meiner herben, unglücklichen Jugend, regte sich in mir der Wunsch, ein Buch zu schreiben. Heimlich zu kritzeln und mich als Schriftsteller zu träumen, war einer meiner Hauptgenüsse, und voll Mitempfindung und Neid las ich jeden Fetzen über die Welt der Literatur und das Leben von Literaten, den ich nur erwischen konnte. Selbst inmitten des gegenwärtigen Glücks ist es mir noch ein Genuß, daß ich Muße und Gelegenheit finde, diese alten, hoffnungslosen Träume wieder aufzunehmen und teilweise zu verwirklichen. Aber das allein, glaube ich, würde in einer Welt, in der für einen alten Mann so vieles zu tun ist, was ein lebhaftes und stets wachsendes Interesse bietet, noch nicht genügen, mich an den Schreibtisch zu treiben. Ich sehe, daß eine solche Zusammenfassung meiner Vergangenheit, wie sie dieser Bericht mit sich bringen muß, notwendig wird für meinen eigenen, sicheren, geistigen Zusammenhang. Der Gang der Jahre bringt den Menschen schließlich zum Rückblick; mit Zweiundsiebzig ist einem die eigene Jugend weit wichtiger, als mit Vierzig. Und ich habe den Kontakt mit meiner Jugend verloren. Das alte Leben scheint mir so abgeschnitten vom neuen, so fremdartig und unvernünftig, daß ich bisweilen finde, es grenzt ans Unglaubliche. Die Daten sind dahin, die Orte, die Gebäude. Neulich, auf meinem Nachmittagsspaziergang übers Moor, da, wo ehedem die düsteren Ausläufer von Swathinglea sich nach Leet zu erstreckten, blieb ich wie erstarrt stehen und fragte mich: Hab ich wirklich hier im Gestrüpp, zwischen Abfall und Scherben gekauert und – mordbereit – meinen Revolver geladen? War so etwas je in meinem Leben denkbar? War eine derartige Stimmung, ein solcher Gedanke, ein solches Vorhaben jemals möglich bei mir? Hat nicht vielmehr irgendein wunderlicher Nachtmar aus dem Land der Träume eine falsche Erinnerung in die Geschichte meines entschwundenen Lebens geschmuggelt? Es müssen noch viele am Leben sein, die an sich dieselben oder ähnliche Fragen stellen. Und ich denke, auch die, die jetzt heranwachsen, um in dem großen Unternehmen der Menschheit an unsere Stelle zu treten, werden manch einer Erzählung wie der meinen bedürfen, um die alte Welt der Schatten, vor dem Anbruch unseres Tages, auch nur zum kleinsten Bruchteil zu verstehen. Zufällig ist mein Fall auch ziemlich typisch für die Wandlung, die mich inmitten eines Wirbels von Leidenschaft packte; und ein seltsames Geschick stellte mich eine Zeitlang geradezu in den Angelpunkt der neuen Ordnung …
Meine Erinnerung führt mich durch den Zeitraum von fünfzig Jahren zurück in ein kleines, schlecht erleuchtetes Zimmer mit einem Schiebefenster, das auf den gestirnten Himmel blickt, und im selben Augenblick kehrt mir auch der charakteristische Geruch jenes Zimmers wieder – der durchdringende Geruch einer schlecht geputzten Lampe, in der billiges Petroleum brennt. Die Beleuchtung durch Elektrizität war damals schon seit fünfzehn Jahren bekannt; aber der größere Teil der Welt benützte noch immer solche Lampen. Diese ganze erste Szene spielt sich, wenigstens für mich, in dieser Geruchsbegleitung ab. Das war die abendliche Atmosphäre des Zimmers. Bei Tag hatte es ein feineres Aroma, etwas Stickiges, eine besondere Art leiser, prickelnder Schärfe, die sich mir – weshalb, weiß ich nicht – mit dem Begriff Staub verbindet.
Man gestatte mir, dieses Zimmer im einzelnen zu beschreiben. Es hatte vielleicht acht zu sieben Fuß Flächeninhalt; die Höhe übertraf diese Dimensionen um ein Beträchtliches. Die Decke war aus Gips, stellenweise gesprungen und ausgebaucht, grau vom Lampenruß und an einer Stelle von einer Gruppe gelber und olivgrüner Flecken gefärbt, die von durchgesickerter Feuchtigkeit stammten. Die Wände waren mit einer trüb-braunen Tapete bedeckt, auf der sich in schrägen Reihen in Form einer krausen Straußenfeder oder einer Akanthusblüte ein rotes Muster wiederholte, das an den weniger verblichenen Stellen von einer Art schmutziger Farbenpracht war. Diese Tapete wies mehrere große, gipsrandige Wunden auf, die von Parloads vergeblichen Versuchen herrührten, Nägel in die Wand zu schlagen, um Bilder daran aufzuhängen. Ein Nagel hatte die Ritze zwischen zwei Backsteinen getroffen und saß; und an ihm hingen, von zerrissenen und zusammengeknoteten Jalousieschnüren ein bißchen unsicher gehalten, Parloads Bücherborte: mit einem klebrigen blauen Lack angestrichene und mit einer Franse aus ausgeschlagenem amerikanischem, mit Reißstiften befestigten Tuch verzierte Bretter. Darunter stand ein kleiner Tisch, der sich gegen jedes plötzlich daruntergeschobene Knie mit der Gehässigkeit eines Maultieres benahm; auf ihm lag eine Decke, deren schwarz und rotes Muster durch die Unfälle von Parloads mitteilsamem Tintenfaß etwas weniger monoton erschien; und auf ihr wiederum, als Leitmotiv des Ganzen, stand und stank die Lampe. Diese Lampe, muß man wissen, bestand aus einer weißlichen, durchsichtigen Substanz, die weder Porzellan noch Glas war; sie hatte eine Glocke aus derselben Substanz, eine Glocke, die die Augen des Lesers in keiner Weise schützte und wundervoll geeignet war, rücksichtslos die Tatsache hervorzuheben, daß nach dem Füllen der Lampe Staub und Petroleum mit sorglosester Freigebigkeit auf ihr herumgeschmiert worden waren.
Die unebenen Dielenbretter des Zimmers waren mit zerkratztem, schokoladefarbenem Lack überzogen, auf dem in Staub und Schatten undeutlich eine kleine Insel zerschlissenen Teppichs erblühte.
Ferner war da ein sehr kleines Kamin aus Gußeisen, in einem Stück, ledergelb angestrichen und ein noch kleineres gußeisernes Mißgebilde von Ofenvorsetzer, das den ganzen Feuerstein sehen ließ. Kein Feuer brannte darin; nur ein paar Fetzen zerrissenen Papiers und der zerbrochene Kopf einer Maiskolbenpfeife waren hinter dem Gitter zu sehen; in der Ecke stand, wie beiseite geworfen, ein enger eckiger, lackierter Kohlenkasten mit schadhaftem Griff. In jenen Tagen war es Sitte, jedes Zimmer von einer gesonderten Feuerstelle aus zu heizen, die mehr Schmutz als Wärme spendete; und von dem klapprigen Schiebefenster, dem kleinen Kamin und der schlecht sitzenden Tür erwartete man, sie würden auch ohne weitere Anleitung die Ventilation des Zimmers untereinander organisieren.
Parloads Rollbett auf der einen Seite des Zimmers barg seine grauen Laken unter einer alten Flickendecke, und unter ihm standen seine Kisten und allerhand sonstiges Zubehör; die beiden Fensterecken waren von einer alten Etagere und einem Waschständer versperrt, auf dem die einfachen Toilettenrequisiten ausgebreitet lagen.
Dieser von Drechslerarbeit starrende Waschtisch aus Tannenholz war von irgend jemand gemacht, der versucht hatte, durch fesselnde Dekorationen von Kugeln und Knollen, die über Gefüge und Beine gesät waren, die Aufmerksamkeit von der groben Dürftigkeit der Arbeit abzulenken. Darauf war das Werk offenbar einem Menschen von unendlicher Muße übergeben worden, der mit einem Topf Ocker, Firnis und ein paar biegsamen Kämmen ausgerüstet war. Dieser hatte den Gegenstand zunächst angestrichen, ihn dann, so denke ich mir, mit Firnis überschmiert und sich schließlich mit den Kämmen daran gemacht, den Firnis zu einer gespenstischen Nachahmung irgendeines braunen Holzes umzustreichen und zu kämmen. Der also entstandene Waschtisch hatte offenbar eine lange Laufbahn rücksichtslosen Gebrauches hinter sich; er war beschnitzelt, getreten, zersplittert, geknufft, versengt, gehämmert, ausgedörrt und überschwemmt worden, er hatte alle möglichen Abenteuer erlebt, nur in Brand gesteckt und gescheuert hatte man ihn noch nie; und schließlich war er in dies hohe Asyl, in Parloads Mansarde, geraten, um den einfachen Anforderungen, die Parloads persönliche Reinlichkeit stellte, gerecht zu werden. Man sah in der Hauptsache eine Schüssel, einen Krug, einen Eimer aus Blech, ferner ein Stück gelber Seife auf einem Schälchen, eine Zahnbürste, einen rattenschwänzigen Rasierpinsel, ein Drillichhandtuch und noch ein paar nebensächliche Gegenstände darauf. In jenen Tagen besaßen nur sehr wohlhabende Leute mehr als eine solche Ausrüstung, und es ist anzumerken, daß jeder Tropfen Wasser, den Parload verbrauchte, von einem unglücklichen Dienstmädchen getragen werden mußte – Parload nannte sie die »Sklavin« – und zwar vom Kellergeschoß bis oben ins Haus und umgekehrt. Schon beginnen wir zu vergessen, eine wie moderne Erfindung die körperliche Reinlichkeit ist. Es ist eine Tatsache, daß Parload in seinem ganzen Leben niemals schwimmen gegangen war und daß er seit seiner Kindheit kein Vollbad mehr genommen hatte. Das tat zu der Zeit, von der ich erzähle, unter Fünfzig nicht Einer.
Eine Kommode mit zwei großen und zwei kleinen Schiebladen – ebenfalls sonderbar gefasert und gestreift – enthielt Parloads Kleiderreserve; hölzerne Pflöcke an der Tür trugen seine beiden Hüte und vervollständigten das Inventar eines »Schlaf- und Wohnzimmers«, wie ich es vor der Wandlung kannte. Aber ich vergaß – noch ein Stuhl war vorhanden, ein Stuhl mit einem Polsterkissen, das für die Löcher in dem geflochtenen Sitz nur unzulänglich um Entschuldigung bat. Ich vergaß ihn im Moment, weil ich bei der Gelegenheit, mit der ich diese Geschichte am besten beginne, auf eben diesem Stuhl saß.
Ich habe Parloads Zimmer so genau beschrieben, weil es zum Verständnis der Tonart beitragen wird, in der meine ersten Kapitel geschrieben sind; aber man darf nicht etwa denken, diese sonderbare Ausstattung oder der Lampengeruch wären mir damals besonders aufgefallen. Ich nahm all diese schmutzige Ungemütlichkeit hin, als sei sie die natürlichste und passendste Umrahmung des Daseins, die man sich nur vorstellen konnte. Es war die Welt, wie ich sie kannte. Mein geistiges Ich war damals ganz von ernsteren und wichtigeren Dingen in Anspruch genommen, und jetzt erst fallen mir diese Einzelheiten der Umgebung als bemerkenswert, als bezeichnend, ja geradezu als die äußeren, sichtbaren Kundgebungen der Unordnung unseres inneren Wesens in jener alten Welt auf.
II.
Parload stand am offenen Fenster, das Opernglas in der Hand, und suchte den neuen Kometen, fand ihn, wurde unsicher und verlor ihn wieder.
Ich hielt den Kometen damals einfach für Blödsinn, weil ich von andern Dingen reden wollte. Aber Parload war ganz von ihm erfüllt. Mir war der Kopf heiß, ich fieberte vor Ärger und Erbitterung, ich wollte ihm mein Herz öffnen – wollte mir endlich das Herz durch irgendeine romantische Darstellung meiner Kümmernisse erleichtern – und ich achtete kaum auf das, was er mir sagte. Es war das erstemal, daß ich von diesem neuen Fleck unter den zahllosen Flecken am Himmel hörte, und ich fragte wenig darnach, ob ich je wieder von dem Ding hören würde.
Wir waren zwei junge Leute ziemlich desselben Alters. Parload war zweiundzwanzig, acht Monate älter als ich. Er war – ich glaube sein eigentlicher Titel war »Urkundenschreiber« – bei einem kleinen Anwalt in Overcastle, während ich Dritter im Bureaustab von Rawdons Tongrube in Clayton war. Zuerst waren wir einander im »Parlament« des Vereins christlicher junger Männer zu Swathinglea begegnet; wir hatten entdeckt, daß wir zu denselben Stunden Kurse der Fortbildungsschule in Overcastle besuchten, er für Naturwissenschaften, ich für Stenographie; wir hatten uns daher gewöhnt, zusammen nach Hause zu gehen. So entstand unsere Freundschaft. (Swathinglea, Clayton und Overcastle waren zusammenhängende Städte in dem großen Industriegebiet der »Midlands«) Wir hatten einander unsere geheimen religiösen Zweifel mitgeteilt, wir hatten uns unser gemeinsames Interesse für den Sozialismus anvertraut; er war zweimal Sonntags bei meiner Mutter zum Nachtessen gewesen, und ich hatte freien Zutritt in seine Wohnung. Parload war damals ein großer, flachshaariger, linkischer junger Mann mit unverhältnismäßig stark entwickeltem Nacken und Handgelenk und ungeheurer Begeisterung fähig. Jede Woche widmete er zwei Abende den Kursen der wissenschaftlichen Fortbildungsschule in Overcastle. Sein Lieblingsgegenstand war die Physiographie, und durch diese geheime Brücke zu seinem Geistesleben war es den Wundern des Weltenraumes gelungen, von seiner Seele Besitz zu ergreifen. Er hatte sich ein altes Opernglas von seinem Onkel angeeignet, der jenseits des Moors zu Leet eine Farm besaß, dazu hatte er sich eine billige Papier-Planisphäre und einen astronomischen Almanach gekauft, und eine Zeitlang waren Tag und Mondschein für ihn nur leere Unterbrechungen der ihn allein befriedigenden Beschäftigung – des Sternguckens. Die Tiefen hatten ihn gepackt, die Unbegrenztheiten und geheimnisvollen Möglichkeiten, die unerleuchtet in jenem unermessenen Abgrund schweben mochten. Mit unendlicher Mühe und an der Hand eines sehr klar geschriebenen Artikels in einer kleinen Monatsschrift, die nach allen unter dem gleichen Bann Stehenden angelte, war es ihm schließlich gelungen, sein Opernglas auf den neuen Besucher einzustellen, der aus dem äußeren Raum in unsere Sphäre eintrat. In einer Art Verzückung starrte er auf jenen kleinen zitternden Lichtfleck unter den glänzenden Nadelspitzen – starrte und starrte. Meine Kümmernisse mußten warten.
»Wundervoll!«, seufzte er; und dann, als genüge ihm dieser erste Ausbruch nicht, nochmals: »Wundervoll!«
Er wandte sich zu mir. »Möchtest du nicht sehen?«
Ich mußte sehen, und dann mußte ich hören: Dieser kaum sichtbare Eindringling sollte bald zu einem der größten Kometen werden, den diese Welt jemals gesehen hatte; sein Lauf mußte ihn der Erde auf eine Entfernung von höchstens so und so viel zwanzig Millionen Meilen nahe bringen – ein reiner Katzensprung, wie Parload zu finden schien; das Spektroskop sondierte schon seine chemischen Geheimnisse und verwirrte die Forscher durch eine nie dagewesene Linie in Grün. Schon jetzt, während er – in ganz ungewöhnlicher Richtung – einen sonnenwärts gewandten Schweif entrollte, den er alsbald wieder aufrollte, wurde er photographiert. Während dieser Eröffnung dachte ich die ganze Zeit über in einer Art Unterströmung erst an Nettie Stuart und den Brief, den ich eben von ihr erhalten hatte, und dann an das abscheuliche Gesicht des alten Rawdon, wie ich es diesen Nachmittag gesehen hatte. Bald entwarf ich Antworten an Nettie und bald verspätete Erwiderungen an meinen Brotherrn und dann wieder flammte »Nettie« auf im Hintergrunde meiner Gedanken …
Nettie Stuart war die Tochter des Obergärtners bei der Witwe des reichen Herrn Verral. Sie und ich hatten Küsse getauscht und waren ein Liebespaar geworden, noch eh wir unser achtzehntes Jahr vollendet hatten. Meine und ihre Mutter waren Cousinen und alte Schulfreundinnen, und obgleich meine Mutter durch ein Eisenbahnunglück vorzeitig zur Witwe geworden war und Zimmer vermieten mußte (der Pfarrer von Clayton wohnte bei ihr), was sie im öffentlichen Ansehen weit unter Frau Stuart stellte, so hielt doch die freundliche Gewohnheit gelegentlicher Besuche im Landhaus des Gärtners zu Checkshill Towers die Beziehungen der Freundinnen aufrecht. Meist begleitete ich meine Mutter. Und ich entsinne mich, wie Nettie und ich, in der Dämmerung eines hellen Juliabends, eines jener langen, goldenen Abende, die nicht so sehr der Nacht weichen als vielmehr aus Ritterlichkeit schließlich den Mond und ein gewähltes Gefolge von Sternen einlassen, neben dem Goldfischteich, wo die von Buchs eingefaßten Wege zusammenstoßen, unser erstes scheues Geständnis tauschten. Ich entsinne mich noch – und immer wird in mir etwas erbeben bei dieser Erinnerung – der zitternden Erregung jenes Abenteuers. Nettie war weiß gekleidet, ihr Haar floß in Wellen weichen Dunkels über ihren tiefen, leuchtenden Augen nieder, um ihren zart geformten Hals lief ein kleines Halsband von Perlen mit einer kleinen Goldmünze, die auf ihrer Brust ruhte. Drei Jahre meines Lebens – ja, ich glaube fast ihr und mein ganzes Leben lang – hätte ich von da ab für sie sterben können!
Man muß verstehen – und mit jedem Jahr wird es schwerer zu verstehen – wie vollständig anders damals die Welt war als jetzt. Es war eine finstere Welt, voll von Unheil, Krankheiten und Schmerzen, die zu verhüten gewesen wären, voll von Härten und törichten, ungewollten Grausamkeiten. Und doch, vielleicht gerade infolge des allgemeinen Dunkels, gab es Augenblicke einer seltenen und flüchtigen Schönheit, wie sie, meiner Erfahrung nach, heute nicht mehr möglich zu sein scheinen. Die große Umwälzung ist hereingebrochen auf immerdar, Glück und Schönheit ist unsere Atmosphäre, es ist Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen … Niemand würde auch nur zu träumen wagen, er könnte zum Leid früherer Zeiten zurückkehren – und doch ward jenes Elend durchdrungen, ward der graue Vorhang da und dort durchblitzt von Freuden voll einer Intensität, von Empfindungen voll einer Lebendigkeit, wie sie mir heute völlig aus dem Leben entschwunden scheinen. Ich möchte wohl wissen, – hat die Wandlung das Leben seiner Extreme beraubt, oder ist es vielleicht nur, daß mich die Jugend verlassen hat – selbst die Kraft der mittleren Jahre verläßt mich schon! –, daß sie ihre Verzweiflungen, ihre Entzückungen mit sich genommen und mir nur die Kritik und vielleicht Sympathie und Erinnerung gelassen hat?
Ich weiß es nicht. Man müßte jetzt jung sein und zugleich damals jung gewesen sein, um diese unmögliche Frage zu entscheiden.
Vielleicht hätte ein kühler Beobachter in den alten Tagen wenig Schönheit in unserer kleinen Gemeinschaft gefunden. Ich habe, während ich arbeite, hier im Schreibtisch unsere zwei Photographien zur Hand; sie zeigen mir einen linkischen jungen Menschen in schlecht sitzenden, fertig gekauften Kleidern; und Nettie – – ja, Nettie ist ebenfalls schlecht angezogen und ihre Haltung ist mehr als nur ein bißchen steif. Ich aber sehe sie durch das Bild hindurch: ihre lebensvolle Frische und etwas von dem geheimnisvollen Reiz, den sie auf mich ausübte, kommen mir wieder in Erinnerung. Ihr wahres Gesicht triumphiert über den Photographen – sonst hätte ich dies Bild längst weggeworfen.
Das Wesen der Schönheit läßt sich nicht in Worte fassen. Ich wollte, ich beherrschte die Schwesterkunst und vermöchte hier am Rande etwas zu zeichnen, was sich der Schilderung durch Worte entzieht. In ihren Augen lag ein gewisser Ernst. Ein Etwas, eine kaum merkliche Eigenart, lag um ihre Oberlippe, so daß ihr Mund sich reizend schloß und süß zum Lächeln öffnete. Ach, jenes ernste, süße Lächeln!
Nachdem wir uns geküßt und beschlossen hatten, unseren Eltern noch eine Weile nichts von der unwiderruflichen Wahl, die wir getroffen hatten, zu sagen, kam der Augenblick, da wir, scheu und vor Zeugen, Abschied nehmen mußten. Meine Mutter und ich wanderten durch den mondbeglänzten Wald – das Farndickicht raschelte vom aufgescheuchten Wild – zum Bahnhof von Checkshill und dann nach unserer ärmlichen Kellerwohnung in Clayton zurück, und fast ein Jahr lang sah ich, außer in meinen Gedanken, nichts mehr von Nettie. Aber bei unserer nächsten Begegnung wurde abgemacht, wir wollten uns schreiben, und dies taten wir auch – in allergrößter Heimlichkeit – denn Nettie wollte nicht, daß irgend jemand bei ihr zu Hause, nicht einmal ihre einzige Schwester, von ihrer Liebe erfuhr. So mußte ich denn meine kostbaren Dokumente versiegelt und unter der Adresse einer vertrauten Schulfreundin von ihr, die nahe bei London wohnte, schicken … Noch heute könnte ich jene Adresse aufschreiben, obgleich Haus und Straße und Vorort so spurlos verschwunden sind, daß keiner mehr sie zu finden vermöchte.
Mit unserer Korrespondenz begann unsere Entfremdung; denn zum erstenmal kamen wir in andere als sinnliche Berührung, suchte unser Geist nach Ausdruck.
Nun muß man wissen, daß die Welt des Denkens damals im seltsamsten Zustand war; sie erstickte fast an veralteten, untauglichen Formeln; sie wand sich wie ein Labyrinth in nebensächlichen Schablonen und Kompromissen, Unterschlagungen, Konventionen und Ausflüchten. Niedrige Umschreibungen besudelten auf jedermanns Lippen die Wahrheit. Ich war von meiner Mutter in einem wunderlichen, altmodischen Glauben an gewisse religiöse Formeln, gewisse Anstandsregeln, gewisse Begriffe sozialer und politischer Ordnung erzogen, die zur Wirklichkeit und den Bedürfnissen des damaligen Alltagslebens nicht mehr in Beziehung standen als reine Wäsche, die man mit Lavendel in einen Schrank einschließt. Ihre Religion roch auch tatsächlich nach Lavendel. Sonntags tat sie alle Dinge der Wirklichkeit, die Kleider, sogar den Hausrat des Alltags von sich ab, barg ihre Hände, die voller Beulen und manchmal vom Scheuern aufgerissen waren, in schwarzen, sorgsam geflickten Handschuhen, legte ihr altes, schwarzseidenes Kleid an, setzte ihren Hut auf und führte mich, der ich ebenfalls unnatürlich sauber und nett aussah, in die Kirche. Dort sangen wir und senkten das Haupt, hörten melodische Gebete an und stimmten in melodische Antworten ein, und standen erquickt und erleichtert, mit einem Gemeinde-Seufzer, auf, wenn die Lobpreisung mit ihrem Anfang: »Gott der Vater, Gott der Sohn«, die kurze zahme Predigt abschloß. In dieser Religion meiner Mutter gab es eine Hölle, eine rothaarige Hölle voll krauser Flammen, die dereinst sehr furchtbar gewesen sein mußte; es gab einen Teufel, der zugleich ex officio des englischen Königs Feind war. Die argen Lüste des Fleisches wurden schwer verketzert. Man erwartete von uns, wir sollten glauben, der größere Teil unserer unglücklichen Welt werde für all seine Wirren und Unruhen allhier büßen, indem er dereinst die auserlesensten Qualen zu erdulden habe – in alle Ewigkeit, Amen. Aber freilich sahen diese krausen Flammen recht lustig aus. Das Ganze war längst vor meiner Zeit zu einer sanften Unwirklichkeit ausgereift und verblaßt. Wenn es mir in meiner Kindheit noch großen Schrecken einflößte, so habe ich das vergessen; es war lange nicht so furchtbar wie die Geschichte vom Riesen, der von der Bohnenranke erschlagen wurde … Und jetzt sehe ich es alles nur noch als Rahmen für meiner armen Mutter abgearbeitetes, runzliges Gesicht, sehe es fast mit Liebe, als einen Teil ihrer selbst. Und Mr. Gabbitas, unser kleiner, rundlicher Mieter, seltsam verändert durch seine Amtstracht, schien ihr, wenn er mannhaft die Stimme erhob, um jene altväterischen Gebete zu singen, noch ein ganz besonderes und intimeres Interesse an Gott einzuflößen. Sie strahlte ihre eigene zitternde Milde auf ihn über und verteidigte ihn gegen alle Angriffe ränkesüchtiger Theologen. Sie war in Wahrheit – wenn ich das damals hätte sehen können – die werktätige Erfüllung alles dessen, was sie mich gern gelehrt hätte.
So erscheint es mir jetzt; aber es ist etwas Unerbittliches, Hartes um die ernsthafte Intensität der Jugend; und wenn ich anfänglich all diese Dinge, die feurige Hölle und Gottes Rache für jede Unterlassungssünde, so ernst genommen hatte, als seien das genau so feststehende Tatsachen wie Bladdens Eisenwerke und Rawdons Tongruben, so schlug ich sie mir doch bald mit gleicher Ernsthaftigkeit aus dem Sinn.
Mr. Gabbitas nämlich nahm bisweilen, wie man sagte, »Notiz« von mir; er hatte mich veranlaßt, weiterzustudieren, als ich die Schule verließ, und mit den besten Absichten hatte er mir, um dem Gift der Zeit von vornherein entgegenzuarbeiten, Burbles »Widerlegte Skepsis« geliehen und mich auf die Stiftsbibliothek in Clayton aufmerksam gemacht.
Der ausgezeichnete Burble war ein schwerer Schlag für mich. Aus seiner Widerlegung der Skepsis schien klar hervorzugehen, daß die Dinge für die doktrinäre Orthodoxie und das ganze abgeblaßte und keineswegs grauenvolle Jenseits, das ich bisher ebenso hingenommen hatte, wie ich die Sonne hinnahm, äußerst schlecht standen; und um mir diese Idee noch fester einzupauken, war das erste Buch, das ich mir von der Bibliothek holte, eine amerikanische Ausgabe der gesammelten Werke Shelleys, seine leichtbeschwingte Prosa und seine ätherische Poesie. Bald war ich für den schreiendsten Unglauben reif. Gleich darauf machte ich im Verein junger Männer Parloads Bekanntschaft, der mir unter dem Siegel der schwärzesten Verschwiegenheit mitteilte, daß er »durch und durch Sozialist« sei. Er lieh mir mehrere Nummern einer Zeitschrift, die den Lärm-Titel »Die Trompete« trug, und die eben auf einem Kreuzzug gegen die überlieferte Religion begriffen war. Die Jugendjahre jedes nur einigermaßen intelligenten jungen Mannes sind der Ansteckung durch philosophische Zweifel, durch Geringschätzung und neue Ideen ausgesetzt und werden es gesunderweise immer sein, und ich muß gestehen, das Fieber dieser Phase packte mich heftig. Ich spreche von Zweifel, aber es war weniger Zweifel – was etwas Kompliziertes ist – als vielmehr ein aufgeregtes, nachdrückliches Verneinen. »Das sollte ich geglaubt haben!« Und dabei war ich – nicht zu vergessen – eben am Anfang meiner Liebesbriefe an Nettie!
Wir leben heute, seit sich die »große Wandlung« in fast allen Dingen vollzogen hat, in einer Zeit, in der jeder Mensch zu einer Art intellektueller Milde erzogen wird, einer Milde, die unsere Kraft in nichts beeinträchtigt; und es wird uns schwer, die halb erstickte, blindlings kämpfende Art und Weise zu verstehen, in der sich das Denken meiner Generation von jungen Männern vollzog. Über gewisse Fragen überhaupt nur nachzudenken, war ein Akt der Auflehnung, der einen sofort ins Schwanken versetzte zwischen Heimlichkeit und Trotz. Man beginnt heutzutage Shelley – all seiner Sangbarkeit zum Trotz – lärmend und schlecht zu finden, weil seine Gegenpartei verschwunden ist, nicht mehr existiert; und doch hat es eine Zeit gegeben, in der neue Gedanken zu diesem Klimbim zerschmetterten Glases greifen mußten. Es wird nachgerade etwas schwierig, sich diese gärende Geistesverfassung vorzustellen, die Neigung, loszubrüllen, der bestehenden Autorität ein »Bäh!« ins Gesicht zu schreien, die anhaltende Note der Herausforderung aufrechtzuerhalten, wie wir ungeschliffene Burschen sie damals anschlugen. Ich fing an, mit Gier eine Lektüre zu verschlingen wie Carlyle, Browning und Heine sie zur Verblüffung der Nachwelt hinterlassen haben – und nicht nur sie zu lesen, sondern sie zu bewundern und nachzuahmen. Meine Briefe an Nettie schwenkten nach ein oder zwei aufrichtig gemeinten Ausbrüchen glühender Zärtlichkeit in schwülstigen und aufreizenden Wendungen zur Theologie, Soziologie und zum Kosmos ab. Ohne Zweifel machten sie ihr viel zu schaffen.
Noch immer hege ich die lebhafteste Sympathie und etwas, was dem Neid ganz merkwürdig gleich sieht, für meine entschwundene Jugend; dennoch würde es mir schwer fallen, mich gegen irgendwen zu verteidigen, der mich als einen albernen, posierenden, sentimentalen, meiner verblaßten Photographie außerordentlich ähnlichen Tölpel glatt verurteilen wollte. Und wenn ich mich genauer auf die Art und den Ton der mühseligen Versuche, meiner Liebsten bedeutende Dinge zu schreiben, besinnen soll, so muß ich gestehen – ich zittere … Trotzdem wollte ich, sie wären nicht alle vernichtet.
Ihre Briefe an mich waren einfach genug, in einer rundlichen, unausgeschriebenen Schrift und schlechtem Stil geschrieben. Die ersten zwei oder drei verrieten ein scheues Vergnügen am Gebrauch des Wortes »Liebster«, und ich entsinne mich, daß ich erst in Verlegenheit geriet, dann aber entzückt war, weil sie unter meinen Namen ein irisches Dialektwort geschrieben hatte, das »Liebling« bedeutete. Als dann freilich die in mir herrschende Gärung zum Ausdruck zu kommen begann, lauteten ihre Antworten weniger beglückt.
Ich will nicht mit unserer Geschichte ermüden: wie wir uns auf alberne, jugendliche Art zankten und wie ich am nächsten Sonntag uneingeladen nach Checkshill ging und die Sache nur schlimmer machte, wie ich dann einen Brief schrieb, den sie »süß« fand und alles damit wieder gutmachte. Auch von all den späteren Schwankungen des Mißverstehens will ich nicht erzählen. Stets war ich der Sünder und schließliche Büßer, bis zu jenem letzten Kummer, der hier anfing; dazwischenhinein erlebten wir ein paar Monate innigster Zusammengehörigkeit, und ich liebte sie zärtlich. Das Unglück bei der ganzen Geschichte war das: sobald ich im Dunkeln und allein war, dachte ich ganz intensiv an sie, an ihre Augen, an ihre Küsse, an ihre ganze süße, holdselige Gegenwart; wenn ich mich aber hinsetzte, um zu schreiben, dachte ich an Shelley und Burns und mich selber und allerlei derartige nicht hergehörige Dinge. Wenn man verliebt ist, und dabei in solch gärender Verfassung, so ist es schwerer, den Liebenden zu spielen, als wenn man gar nicht liebt. Und Nettie, das weiß ich, liebte nicht mich, sondern die süßen Geheimnisse … Nicht meine Stimme sollte ihre Träume zur Leidenschaft erwecken! … So blieb in unsern Briefen ein Mißklang. Dann schrieb sie mir plötzlich einen, in dem sie ihre Zweifel aussprach, ob sie je einen Menschen lieb haben könne, der Sozialist sei und nichts von der Kirche wissen wollte. Kurz darauf kam ein zweiter Brief, mit ganz unerwartet neuen Wendungen. Sie glaube, wir paßten nicht zueinander, unser Geschmack und unsere Ideen seien zu verschieden, sie habe schon lang daran gedacht, mir mein Wort zurückzugeben. Kurz … wenn ich es auch erst nicht ganz begriff – ich war verabschiedet. Ihr Brief hatte mich erreicht, eben als ich nach der keineswegs höflichen Weigerung des alten Rawdon, mein Gehalt aufzubessern, nach Hause gekommen war. Ich war also an jenem Abend, von dem ich hier schreibe, in einem Zustand fiebrischer Erregung, weil ich mich mit zwei neuen und erstaunlichen, zwei fast überwältigenden Tatsachen vertraut machen mußte: nämlich, daß ich weder für Nettie noch für Rawdon unentbehrlich war.
Und dabei von Kometen reden!
Was war zu tun?
Ich hatte mich so daran gewöhnt, Nettie als mein unverbrüchliches Eigentum anzusehen – die ganze Tradition »treuer Liebe« wies mich darauf hin – daß es mich aufs tiefste verletzte, als sie plötzlich, nachdem wir Küsse getauscht und uns Liebesworte zugeflüstert hatten und einander in den kleinen, kühnen Vertraulichkeiten der Jugend so nah gekommen waren, von Trennung sprach. Und auch Rawdon fand mich nicht unentbehrlich! Ich fühlte mich plötzlich vom ganzen Weltall so zurückgestoßen und mit Vernichtung bedroht, daß ich mich auf irgendeine positive und nachdrückliche Weise behaupten mußte. Weder in der Religion, die man mich gelehrt, noch in der Religionslosigkeit, die ich selbst mir erworben hatte, gab es Balsam für verwundete Eigenliebe.
Sollte ich die Stellung bei Rawdon sofort aufstecken und auf irgendwelche außergewöhnliche, rasche Weise der benachbarten Tongrube seines Konkurrenten Frobisher zum Aufschwung verhelfen?
Der erste Teil des Programms war ja leicht ausführbar. Man ging einfach zu Rawdon und sagte ihm: »Sie werden noch von mir hören!« Aber wenn Frobisher mich im Stich ließ? Doch das war Nebensache. Viel wichtiger war die Angelegenheit mit Nettie. Ich fühlte schon, wie mir der Kopf förmlich schwirrte von rhetorischen Fragmenten, die mir in dem Brief, den ich ihr schreiben wollte, von Nutzen sein konnten. Hohn, Ironie, Zärtlichkeit … was sollte ich wählen? …
»Verdammt!«, sagte Parload plötzlich.
»Was?«, fragte ich.
»Sie feuern in Bladdens Eisenhütte und der Rauch steigt gerade vor mein Stück Himmel!«
Die Unterbrechung kam just, als ich so weit war, meine Gedanken auf ihn loszulassen.
»Parload!«, sagte ich, »höchst wahrscheinlich werd’ ich fort müssen. Rawdon will mir keine Zulage geben, und, da ich sie einmal verlangt habe, finde ich, daß ich zu den alten Bedingungen nicht mehr bleiben kann. Du verstehst. Also werd’ ich wohl weg müssen aus Clayton … für immer.«
III.
Parload legte das Opernglas weg und sah mich an.
»Schlechte Zeit zum Wechseln jetzt!«, sagte er nach einer kleinen Pause.
Rawdon hatte dasselbe gesagt, nur in weniger liebenswürdigem Ton.
Aber Parload gegenüber war ich immer geneigt, die heroische Saite anzuschlagen.
»Ich bin dieser eintönigen Sklavenarbeit für andere müde!«, sagte ich.
»Man kann ebensogut anderswo seinen Körper verhungern lassen, wie hier seine Seele!«
»Da bin ich nicht ganz deiner Meinung«, begann Parload langsam …
Und damit eröffneten wir eine unserer endlosen Unterhaltungen, eines jener langen, ziellosen, intensiv verallgemeinernden und weitschweifig persönlichen Gespräche, wie sie den Herzen junger Menschen bis zum Ende der Welt teuer sein werden. Das jedenfalls hat die Wandlung nicht beseitigt.
Es wäre eine unglaubliche Gedächtnisleistung, wenn ich mich noch jenes ganzen labyrinthischen Wortnebels entsinnen könnte; ich erinnere mich auch tatsächlich kaum eines Wortes, obgleich die äußeren Umstände und die uns umgebende Atmosphäre als scharfes, klares Bild vor meinem Geiste stehen. Ich posierte, nach meiner Gewohnheit, und benahm mich ohne Zweifel sehr töricht, als gekränkter und leidender Egoist; Parload dagegen spielte die Rolle des mit unermeßlichen Weltenräumen beschäftigten Philosophen.
Wir gingen hinaus in die warme Sommernacht und sprachen uns nur um so freier aus. Aber eines Wortes von mir entsinne ich mich noch.
»Mitunter möchte ich«, sagte ich mit einer Geste gen Himmel, »dein Komet oder irgend sonst was stieße wirklich auf diese Welt und fegte uns alle weg, uns und alles, Streiks, Kriege, Aufruhr, Liebe, Eifersucht und das ganze Elend des Lebens.«
»Ah!«, sagte Parload; und der Gedanke schien ihn zu beschäftigen.
»Das würde den Jammer des Lebens nur noch vermehren«, sagte er unvermittelt, als ich gleich darauf von anderen Dingen zu sprechen begann.
»Was?«
»Der Zusammenstoß mit einem Kometen würde die Dinge nur zurückbringen. Was vom Leben übrig bliebe, würde nur noch wüster, als es jetzt ist.«
»Aber weshalb sollte überhaupt etwas übrig bleiben?«, sagte ich …
Das war so unser Stil; und mittlerweile gingen wir die enge Straße vor seiner Wohnung und dann die Stufen und Gassen hinauf nach Clayton und zur großen Landstraße.
Aber meine Erinnerungen führen mich so lebendig zu jenen Tagen vor der Wandlung zurück, daß ich vergesse, daß heute all diese Orte bis zur Unkenntlichkeit verändert sind. Die enge Straße, die Stufen, der Ausblick von Clayton Crest, ja, die ganze Welt, in der ich geboren und erzogen und geformt ward – all das ist aus Raum und Zeit und fast auch aus der Vorstellung all derer verschwunden, die um eine Generation jünger sind als ich. Der Leser vermag nicht, wie ich, den dunkeln, schmalen verlassenen Weg zwischen den häßlichen Häusern zu sehen, den dunkeln, verlassenen Weg, den an der Ecke eine trübe Gaslaterne beleuchtete; er fühlt nicht unter seinen Sohlen das harte, kleingesteinte Pflaster, er bemerkt nicht da und dort die matt erleuchteten Fenster, noch die Schatten der dahinter eingesperrten Menschen auf den häßlichen, oft geflickten, krummgezogenen Gardinen. Noch auch vermag er im Geist an dem Wirtshaus vorüberzugehen mit seinem helleren Gaslicht und seinen sonderbaren, undurchsichtigen Fenstern, noch die verdorbene Luft und ebenso verdorbene Sprache zu wittern, die der Tür entströmten oder die verschrumpfte scheue Gestalt – irgendein zerlumptes Gassenkind – zu erblicken, die die Stufen herab und an uns vorbeischleicht.
Wir kamen durch eine längere Straße, durch die rasselnd und Rauch und Feuer speiend eine plumpe Dampftrambahn fuhr, während man weiter abwärts den schmierigen Glanz der Schaufenster und die Pechfackeln der Hausiererkarren sah, deren Feuer die Nacht durchloderte. Ein wirres Menschengeschiebe drängte sich durch jene Straße, und von einem leeren Bauplatz zwischen den Häusern her hörten wir die Stimme eines Wanderpredigers. Der Leser kann all das nicht sehen, wie ich, und kann sich auch – es sei denn, er kenne die Bilder, die der große Maler Hyde der Welt hinterlassen hat – die Wirkung des großen Gerüsts nicht vorstellen, an dem wir vorüber kamen, das, unten von einer bleichen Gaslampe erleuchtet gegen den blassen Himmel emporragend, mit einem plötzlichen, scharfen Rand abschnitt.
Diese Gerüste! Sie waren das bunteste in jener ganzen verschwundenen Welt. Auf ihnen vereinigten sich in immer neuen Schichten von Leim und Papier all die rohen Unternehmungen jener Zeit zu einer Dissonanz greller Farben: Pillenverkäufer und Prediger, Theater und Wohltätigkeitsanstalten, Wunderseifen und erstaunliche Konserven, Schreibmaschinen und Nähmaschinen verbanden sich zu einer Art sichtbar gewordenen Geschreis. Und dahinter kam eine schmutzige Aschengasse, eine Gasse ohne Beleuchtung, in deren zahllosen Pfützen sich da und dort ein Stern des Himmels spiegelte. Achtlos patschten wir im Eifer des Gesprächs hindurch.
Dann weiter durch die Gartenparzellen – eine Kohlwildnis. Vorüber an verkommen aussehenden Schuppen und einer gespenstischen, verlassenen Fabrik bis zur Landstraße. Die Landstraße führte in einer Kurve an ein paar Häusern und einer Bierkneipe vorbei bis zu einer Stelle, von wo aus man das ganze Tal übersah, in dem überfüllt und zusammenwachsend vier Industriestädte lagen.
Ich will nicht leugnen, daß mit dem Zwielicht ein Zauber geisterhafter Größe über die ganze Gegend kam und bis zum Tagesgrauen auf ihr brütete. Die furchtbare Gemeinheit ihrer Einzelheiten ward verschleiert. Die Hütten mit ihren Bewohnern, das starrende Gewimmel der Schornsteine, die häßlichen Flecken widerwilliger Vegetation zwischen den notdürftigen Zäunen aus Faßdauben und Draht, die rostfarbenen Narben, die die Hügel drüben umrahmten, wo man das Eisenerz aushob, und die unfruchtbaren Schlackenberge bei den Blasöfen waren verschleiert; der Dampf und der brodelnde Rauch und Staub aus Gießerei, Lehmgruben und Hochöfen waren von der Nacht verwandelt, in ihr aufgegangen. Die staubgeschwängerte Atmosphäre, tagsüber ein grauer Alpdruck, wurde mit Sonnenuntergang zu einem Mysterium tiefer, leuchtender Farben: blau und purpurn, dunkelrot und grellrot, seltsam helle, klargrüne und gelbe Streifen über dem dunkeln Himmel. Jeder der Hochofen-Parvenüs krönte sich, wenn die Königin, die Sonne, fort war, mit Flammen; zitternde Glut begann die dunkeln Aschenhaufen zu beleben, jede Tongrube brüstete sich rebellisch mit einem vulkanischen Lichtkranz. Die Herrschaft des Tags zersplitterte zu tausend kleinen Einzelstaaten brennender Kohle. Die kleineren Straßen im Tal besteckten sich mit mattgelben Gaslaternen, die sich an allen Hauptplätzen und Kreuzpunkten mit der grünlichen Blässe der Glühstrümpfe und dem grellen kalten Glanz der elektrischen Bogen mischten. Verschlungene Bahngeleise hoben helle Signal-Häuschen über ihre Schnittpunkte, und in rechteckigen Konstellationen sah man rote und grüne Signalsterne funkeln. Die Züge wurden zu feuerfauchenden, schwarzen Gliederschlangen.
Und hoch über all dem hatte Parload ein Reich entdeckt, ein Reich, ungreifbar und fast vergessen, weder von Sonne noch Hochofen beherrscht – das All der Sterne.
Dies war die Szenerie manch eines Gesprächs, das wir miteinander geführt hatten. Und wenn wir am Tag über die Höhe wanderten und nach Westen blickten, so lagen vor uns Ackerland und Parks und große Herrenhäuser, in der Ferne der Turm einer Kathedrale; dazwischen, wenn ein Regen im Anzug war, hingen die Kämme ferner Berge klar in der Luft. Jenseits des Gesichtsfeldes, weit hinten, lag Checkshill; immer fühlte ich es dort, und im Dunkel noch mehr als bei Tag: Checkshill und Nettie.
Uns beiden jungen Burschen, die wir den Aschenpfad neben der ausgefahrenen Straße dahinwanderten und unsere Kümmernisse erörterten, uns schien es, als sei dieser Hügelrücken ein allumfassender Ausblick auf die ganze große Welt.
Dort auf der einen Seite, in wimmelndem Dunkel, um die scheußlichen Fabriken und Werkstätten herum, scharten sich die Arbeiter, schlecht gekleidet, schlecht ernährt, schlecht unterrichtet, schlecht versorgt, übervorteilt bei jeder Gelegenheit, nicht einmal ihres ungenügenden Lebensunterhalts von einem Tag zum andern gewiß, und zwischen ihren elenden Heimstätten schwollen die Kapellen und Kirchen und Kneipen gleich Mistgewächsen inmitten einer allgemeinen Fäulnis; und drüben, in Raum, Freiheit und Würde, kaum der wenigen Hütten achtend, die so übervölkert und malerisch waren, und in denen die Arbeiter verkamen, lebten die Grundbesitzer und Herren, denen Tongrube, Gießerei, Farm und Mine gehörten. Weit in der Ferne, unvermittelt und schön, aus einem kleinen Gewirr alter Buchläden, Pfarrhäuser und Gasthöfe und allem sonstigen Zubehör einer verfallenden Handelsstadt heraus reckte die Kathedrale von Lowchester einen schlichten, aber wirkungsvollen Turm in unbestimmte, verschwimmende Himmel empor. So erschienen uns in unsern ersten Jugendeindrücken die Umrisse der ganzen Welt.
Wie junge Menschen pflegen, sahen wir alles ganz naiv. Zornig und zuversichtlich erdachten wir uns Lösungen der bestehenden Zustände, und wer sie kritisierte, war ein Parteigenosse der Räuber. Es war ja auch eine ganz offenbare Räuberei, fanden wir: dort, in den großen Häusern, lauerte der Grundbesitzer und Kapitalist mit seinem Schurken von Anwalt und seinem Betrüger von Pfaffen, und wir andern alle waren Opfer ihrer ausgeklügelten Gemeinheiten. Ohne Zweifel zwinkerten und kicherten sie sich zu, über ihren auserlesenen Weinen, inmitten ihrer blendenden, schamlos angezogenen Damen, und dachten sich aus, wie sie die Armen noch mehr schinden könnten! Und auf der anderen Seite, inmitten von Schmutz, von Brutalität, von Unwissenheit und Betrunkenheit, duldeten die Massen ihrer schuldlosen Opfer, die Arbeiter. Und wir hatten all das fast auf den ersten Blick durchschaut; es brauchte nur noch mit der nötigen Beredsamkeit und Eindringlichkeit behauptet zu werden, um das Antlitz der ganzen Welt zu wandeln. Der Arbeiter würde sich erheben – in Gestalt einer Arbeiterpartei und mit jungen Leuten wie Parload und mir an der Spitze – würde sich sein Recht erzwingen, und dann – –?
Dann wurde den Räubern die Hölle heiß gemacht und alles löste sich auf in Wohlgefallen.
Wenn mir mein Gedächtnis nicht einen schlimmen Streich spielt, so tat das dem Katechismus des Denkens und Handelns, den Parload und ich für das Endergebnis menschlicher Weisheit hielten, durchaus keinen Abbruch. Wir glaubten daran voll Glut, und voll Glut wiesen wir jede noch so naheliegende Milderung seiner Härte zurück. Manchmal waren wir bei unseren großen Gesprächen voll übereilter Hoffnungen auf einen nahen Triumph unserer Lehre, noch häufiger war unsere Stimmung ein heißer Groll gegen die Verworfenheit und Borniertheit, die eine so einfache Neugestaltung der Weltordnung aufhielten. Dann wurden wir bösartig und dachten an Barrikaden und ähnliche Gewalttaten. Ich weiß, in jener Nacht, von der ich hier erzähle, war ich sehr erbittert, und das einzige Gesicht der Hydra des Kapitalismus und Monopolismus, das ich einigermaßen deutlich zu erkennen vermochte, lächelte genau so, wie der alte Rawdon gelächelt hatte, als er sich weigerte, mir mehr als lumpige zwanzig Schilling in der Woche zu geben. Ich hatte das dringende Bedürfnis, meine Selbstachtung durch einen Racheakt an ihm zu wahren, und ich fühlte, – könnte dies dadurch geschehen, daß ich die Hydra erschlug, so konnte ich ihre Leiche auch gleich Nettie vor die Füße werfen und meine zweite Frage erledigen. »Was sagst du jetzt, Nettie!«
Jedenfalls kommt dies dem Stimmungsgehalt meiner damaligen Denkweise so ziemlich nah; und der Leser kann sich vorstellen, wie ich an jenem Abend wütete und gestikulierte. Man stelle sich vor – zwei kleine schwarze Gestalten, von wenig anziehenden Umrissen, mitten in jener trostlosen Nacht des flammenden Industrialismus, während meine schwache Stimme mit einem Stich ins Pathetische protestierte … anklagte …
Man wird diese Phantastereien meiner Jugend als ärmliches, albernes, gemachtes Zeug ansehen; besonders wenn man zur jüngeren Generation gehört, die nach der Wandlung geboren ist. Heutzutage denkt alle Welt klar, mit Überlegung, denkt durchsichtige Gewißheiten; und man vermag sich nicht mehr vorzustellen, wie je ein anderes Denken möglich war. Es sei mir daher ein Wink gestattet, wie man sich etwa in den früheren Zustand versetzen kann. Zunächst muß man sich durch unvernünftiges Essen und Trinken ungesund und durch Vernachlässigung jeder Leibesübung ungelenk machen; dann muß man darauf ausgehen, sich recht viel plagen zu lassen, recht viele Sorgen zu haben, und muß vier oder fünf Tage lang, jeden Tag lange Stunden hindurch, recht schwer an irgend etwas arbeiten, was zu kleinlich ist, um interessant, zu kompliziert, um mechanisch zu sein und was überhaupt von nicht dem geringsten persönlichen Interesse ist. Daraufhin verfüge man sich allsogleich in ein Zimmer, das nicht ventiliert und voll verbrauchter Luft ist, und mache sich daran, irgendein recht verwickeltes Problem durchzudenken. In ganz kurzer Zeit wird man in einem Zustand intellektuellen Wirrwarrs, wird ärgerlich und ungeduldig sein, wird nach dem Handgreiflichsten schnappen und bald aufs Geratewohl Folgerungen ziehen und verwerfen. Man versuche einmal, unter solchen Bedingungen Schach zu spielen … man wird schlecht spielen und die Geduld verlieren. Man versuche, irgend etwas zu unternehmen, was Intelligenz oder Temperament erfordert … es wird nicht gehen.
So krank, so verfiebert war vor der Wandlung die ganze Welt; gequält, überbürdet, verwirrt von Problemen, die sich nicht einfach aufstellen ließen, die ständig wechselten und der Lösung spotteten – eine Atmosphäre, so dumpf und verdorben, daß kein Atemholen mehr möglich war. Ein klares Denken gab es überhaupt nicht mehr in der Welt. Nirgends etwas anderes als halbe Wahrheiten, übereilte Voraussetzungen, Halluzinationen und Aufregung. Nichts …
Ich weiß, dies scheint so unglaublich, daß schon manche der Jüngeren an der Größe der Wandlung zu zweifeln beginnen, die unsere Welt durchgemacht hat; aber man lese – man lese die Zeitungen aus jenen Tagen. Jedes Zeitalter erscheint, wenn es in die Vergangenheit zurückweicht, unserem Geist gemildert und veredelt. Es ist die Aufgabe derer, die gleich mir Geschichten aus jener Zeit zu erzählen haben, durch strengen Geistesrealismus ein Gegenmittel gegen jenen falschen Schimmer zu schaffen.
IV.
Immer war ich der Hauptredner, wenn Parload und ich zusammen waren.
Ich glaube, ich kann fast völlig unparteiisch auf mich zurückblicken; alles ist so verwandelt, daß ich tatsächlich jetzt ein anderes Wesen bin, und kaum noch etwas mit jenem prahlerischen, törichten Burschen gemein habe, dessen Kümmernisse ich hier berichte. Ich sehe ihn vor mir … vulgär, theatralisch, egoistisch, unaufrichtig, und ich empfinde wirklich keine Liebe für ihn, außer jener instinktiven materiellen Sympathie, die die Frucht ununterbrochener Intimität ist. Weil er ich war, bin ich vielleicht imstande, verstehend über Dinge zu schreiben, die ihn die Sympathie fast aller Leser kosten werden; aber weshalb sollte ich sein Wesen bemänteln oder verteidigen?
Immer, wie gesagt, führte ich das Wort, und ich wäre maßlos erstaunt gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, in diesen wortreichen Zusammenkünften sei die stärkere Intelligenz nicht die meine gewesen. Parload war ein ruhiger junger Mensch, steif und zurückhaltend in allen Dingen, während ich die für junge Leute und Demokratien unschätzbare Gabe wortreichen Ausdrucks besaß. Parload hielt ich im geheimen für ein bißchen langweilig; er posierte, so glaubte ich, als interessanter Schweiger und war von dem verwandten Begriff der »Gelehrten-Zurückhaltung« besessen. Ich merkte nicht, daß, während meine Hände hauptsächlich zum Gestikulieren und Federführen taugten, Parloads Hände alles mögliche zuwege brachten. Ich dachte also auch nicht daran, daß von diesen Fingern aus Fibern zu irgend etwas in seinem Gehirn laufen mußten. Obgleich ich fortwährend mit meiner Stenographie, meiner Literatur, mit meiner Unentbehrlichkeit in Rawdons Geschäft prahlte, hob Parload niemals die Kegelschnitte und Differenzialgleichungen hervor, die er in der Fortbildungsschule »büffelte«. Parload ist heute ein berühmter Mann, eine große Erscheinung in einer großen Zeit, sein Werk über sich schneidende Strahlungen hat den intellektuellen Horizont der Menschheit für alle Zeiten erweitert; und ich, der ich bestenfalls ein intellektueller Holzhacker, ein Träger des lebendigen Wassers bin, ich kann lächeln – so wie er lächeln kann – bei dem Gedanken, wie ich ihn im Dunkel jener früheren Tage begönnerte, wie ich posierte und schwatzte.
In jener Nacht war ich maßlos schrill und beredt. Rawdon war natürlich die Achse, um die ich mich drehte, Rawdon und der Rawdonsche Typ des Arbeitgebers, und die Ungerechtigkeit der »Lohnsklaverei«, und all die unmittelbaren Bedingungen jener industriellen Sackgasse, in die unser Leben geschleudert zu sein schien. Aber hin und wieder dachte ich an andere Dinge. Nettie war immer im Hintergrund meiner Gedanken und sah mich mit rätselhaften Augen an. Es gehörte zu meiner Pose Parload gegenüber, daß ich irgendwo außerhalb der Sphäre unseres Verkehrs eine romantische Liebesaffäre hatte; und dieser Ton gab vielen der unsinnigen Dinge, die ich zu seinem Erstaunen vorbrachte, einen Byronschen Anklang.