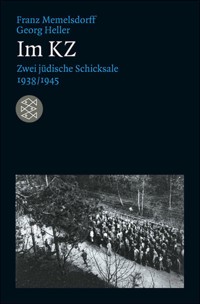
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
1938 | 1945. Zwei Schicksale – zwei Berichte: Was es hieß, als Jude den NS-Schergen in die Hände zu fallen. Nur wenige Memoirentexte spiegeln die Entwicklung und Wirkung des NS-Terrors auf so eindringliche Weise wie diese: Der wohlsituierte Berliner Jurist Franz Memelsdorff war 1938 fünf Wochen im KZ Sachsenhausen, der junge Ungar Georg Heller wurde Ende Mai 1944 aus Budapest nach Auschwitz deportiert, mit den letzten Todesmärschen kam er nach Dachau. Ihre authentischen Berichte, der eine sofort niedergeschrieben, der andere Jahrzehnte später, werden hier erstmals veröffentlicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Franz Memelsdorf | Georg Heller
Im KZ
Kommentiert und mit einer Einleitung versehen von Angelika Benz
Über dieses Buch
»Was haben Georg Heller und Franz Memelsdorff gemeinsam? Was verbindet ihr Leben und rechtfertigt ein gemeinsames Buch? Es ist die Tatsache, dass sie beide aufgrund ihrer jüdischen Abstammung Opfer der nationalsozialistischen Rasseideologie wurden und brutal aus ihren Lebensumständen gerissen worden sind. Beide wurden Opfer des nationalsozialistischen Terrors: Franz Memelsdorff als »Aktionsjude« zu einem Zeitpunkt, als die Intention des Regimes noch war, alle Unliebsamen zu vertreiben und durch massive Gewaltandrohung und –anwendung zur Auswanderung zu bewegen; und Georg Heller, ungarischer Jude aus Budapest, zu einem Zeitpunkt, da die Radikalisierung zur Vernichtungspolitik geworden war. Der eine sollte eingeschüchtert und vertrieben, der andere nach Ausbeutung seiner Arbeitskraft ermordet werden. Gerade die Unterschiedlichkeit der Berichte und der Leidenswege ihrer Autoren macht deutlich, wie sich Ausrichtung und Vorgehen der nationalsozialistischen Judenpolitik radikalisierten. Gerade in der Zusammenstellung wird deutlich, wie groß die Bandbreite der Grausamkeiten und Schrecken des KZ-Systems gewesen ist.«Angelika Benz in ihrer Einleitung
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Franz Memelsdorff, geb. 1889 in Berlin, studierte Rechtswissenschaften und machte Karriere als politischer Beamter. Von 1923 bis 1933 war er Beigeordneter des preußischen und deutschen Städtetages. 1938 wurde er für 6 Wochen in Dachau gefangengehalten. Er emigrierte mit seiner Familie anschließend nach Argentinien, wo er 1958 starb.
Georg Heller, geb. 1923 in Budapest, war von Juni 1944 bis Januar 1945 in Auschwitz, wurde 1947 in Mathematik promoviert, studierte anschließend in Budapest Romanistik und Slawistik und arbeitete fortan als Übersetzer. Er floh 1956 nach Deutschland und lebt seither in München. Von 1965 bis 1989 lehrte er Ungarisch an der dortigen Universität.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Die Zeit des Nationalsozialismus
Eine Buchreihe
Begründet von Walter H. Pehle
Lebensbilder
Jüdische Erinnerungen und Zeugnisse
Herausgegeben von Wolfgang Benz
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401290-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Jüdische Erfahrungen
Fünf Wochen im Konzentrationslager Sachsenhausen
Franz Memelsdorff (1889–1958) mit [...]
Die Verhaftung
Auf dem Polizeirevier
Die Fahrt ins Konzentrationslager
Die ersten 24 Stunden im Konzentrationslager
Die Einkleidung als »Häftling«
Der erste Arbeitstag
Die Lagerinsassen
Die Bekleidung
Die Verpflegung
Die Arbeit
Der ärztliche Dienst
Die Strafen
Die Korruption im KZ
Der tägliche Dienst
Die Entlassung
A-12153Bericht eines Jahres
Georg Heller (geb. 1923)
7. Juni (1944)
Im Ghetto Großwardein
Deportation
Ankunft in Birkenau
Gute Ratschläge
Block 13 im Stammlager Auschwitz I
Arbeitskommando Kiesgrube
Lageralltag in Auschwitz
Begegnungen
Quarantäne
Bücher
Neue Freunde
Luftangriff der Amerikaner
Anciennität in der Häftlingsgesellschaft
Selektion
Gott und Auschwitz
Solidarität und Widerstand?
Hochstimmung
Ein Geschäft
Endzeit
Evakuierung
Todesmarsch
Stopp Stopp Stopp
Von Gleiwitz nach Groß-Rosen
Im Waggon
Dachau
Ampfing
Es geht dem Ende zu
Flucht
Gerettet
Nachwort
Jüdische Erfahrungen
»Judenaktion« 1938 und Todesmarsch 1945
Es sind zwei sehr unterschiedliche Geschichten, die in diesem Buch vereint sind. Was haben Georg Heller und Franz Memelsdorff gemeinsam? Was verbindet ihr Leben und rechtfertigt ein gemeinsames Buch? Es ist die Tatsache, dass sie beide aufgrund ihrer jüdischen Abstammung Opfer der nationalsozialistischen Rassenideologie wurden und brutal aus ihren Lebensumständen gerissen worden sind. Beide wurden Opfer des nationalsozialistischen Terrors: Franz Memelsdorff als »Aktionsjude« zu einem Zeitpunkt, als die Intention des Regimes noch war, alle Unliebsamen zu vertreiben und durch massive Gewaltandrohung und -anwendung zur Auswanderung zu bewegen; und Georg Heller, ungarischer Jude aus Budapest, zu einem Zeitpunkt, da die Radikalisierung zur Vernichtungspolitik geworden war. Der eine sollte eingeschüchtert und vertrieben, der andere nach Ausbeutung seiner Arbeitskraft ermordet werden. Gerade die Unterschiedlichkeit der Berichte und der Leidenswege ihrer Autoren macht deutlich, wie sich Ausrichtung und Vorgehen der nationalsozialistischen Judenpolitik radikalisierten. Gerade in der Zusammenstellung wird deutlich, wie groß die Bandbreite der Grausamkeiten und Schrecken des KZ-Systems gewesen ist.
Franz Memelsdorff, christlich getauftes Kind einer angesehenen Juristenfamilie, gut situierter und integrierter Rechtsanwalt, der im Ersten Weltkrieg das Eiserne Kreuz I. Klasse erhalten hatte, wird im November 1938 als »Aktionsjude« nach Sachsenhausen verschleppt. Diese Judenaktion richtet sich speziell gegen wohlhabende Juden, die durch mehrwöchige Haft im Konzentrationslager zur Überschreibung ihrer Vermögenswerte und zur Ausreise gedrängt werden sollen. Zwar hatte sich Memelsdorffs Frau, Charlotte Lemm, Tochter des Gründers der Schuhcreme-Firma Urbin, von ihm scheiden lassen – unter anderem um ihr Vermögen zu retten, das wegen der Nürnberger Gesetze durch ihre Ehe mit einem Juden gefährdet gewesen wäre. Doch der überfallartige Abtransport ins Konzentrationslager, als SA-Männer in die Wohnung eindringen und ihn vor den Augen der Familie in demütigender Weise abholen – wie seine Tochter sich später erinnert – trifft Memelsdorff vollkommen unerwartet. Seine Exfrau scheint ihm trotz der Scheidung bei der Vorbereitung zur Ausreise zu helfen. Kurz nach seiner Entlassung aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen reist er am 25. August 1939 mit der Cap Arcona von Hamburg nach Buenos Aires, Argentinien, aus, wo sein älterer Bruder, der schon früher ausgewandert war, sich bereits erfolgreich als Anwalt niedergelassen hat. Franz Memelsdorff bleibt in Argentinien, während seine Exfrau und seine Tochter in Deutschland den Krieg überleben. Die Tochter folgt 1946 nach Argentinien, wo er ihr das Manuskript seiner Erinnerungen aushändigt. 1952 kehrt sie nach Deutschland zurück. Franz Memelsdorff folgt ihr bald, bis zu seinem Tod 1958 lebt er in Baden-Baden. Die akribische Genauigkeit, mit der er in seinen Aufzeichnungen die fünfwöchige Haft im Konzentrationslager Sachsenhausen beschreibt, macht diesen Bericht besonders wertvoll und liefert einen einzigartigen Einblick in das Schicksal der »Aktionsjuden«.
Georg Heller, ein sehr liebenswürdiger Herr, der im Mai 1944 von Budapest nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, lebt in München. Ich konnte ihn dort besuchen und von ihm erfahren, dass er vor dem Krieg mit seiner Familie in Budapest gelebt – man sprach daheim wie selbstverständlich Ungarisch und Deutsch – und dort Mathematik und Physik studiert hatte. Nach seiner Flucht aus dem Konzentrationslager Mühldorf und dem Eintreffen der Amerikaner, die seinem Verstecken ein Ende machten, kommt er mit Fleckfieber ins Krankenhaus München-Schwabing. Dort verbringt er einige Monate, ehe er nach Ungarn zurückkehrt, wo er seine Eltern wiedertrifft. Er studiert weiter Mathematik und Physik, arbeitet als Übersetzer. Als er nicht wie erhofft einen Studienplatz in der Sowjetunion erhält, entschließt er sich, auf Sprachwissenschaften umzusatteln. Es folgt die Hochzeit mit einer seiner Studentinnen, sie bekommen zwei Kinder. Nach der Niederschlagung der ungarischen Revolution 1956 flieht er, aus Angst als Dolmetscher bei den Prozessen eingesetzt zu werden, nach München. Erst eineinhalb Jahre später gelingt es ihm, Frau und Sohn nachzuholen, die Tochter lebt fünf Jahre bei den Großeltern, ehe es gelingt, auch sie nach Deutschland zu bringen. Georg Heller schlägt sich als Buchhändler, Buchdrucker und Maschinensetzer durch, bis er 1965 an der Ludwig-Maximilian-Universität, wo er seit 1960 unbesoldet einen Lehrauftrag am Institut für allgemeine Sprachwissenschaft und Finnougristik hatte, eine Planstelle erhält und bis zu seiner Pensionierung 1988 als Lektor für die ungarische Sprache arbeitet. Einen Namen macht er sich auch in der historischen Geographie. Dieser Weg ist ein Beweis für seinen Einfallsreichtum, seine Spontaneität und Entschlossenheit. Über das Schreiben seiner Erinnerung sagt er, er habe lange Zeit nicht darüber sprechen können. Auch als seine Studenten Ende der 1970er Jahre fragten, habe er nicht antworten können. Erst 2008, als er Kontakt zu der damaligen Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, Barbara Distel, knüpft und sie ihn ermuntert, schreibt er im September 2009 innerhalb von sechs Wochen alles auf seiner 1957 in 24 Monatsraten gekauften Schreibmaschine herunter. Und zwar auf Deutsch. Sein Bericht schildert die Zeit in Auschwitz-Birkenau, wo er, als »arbeitsfähig« selektiert, in einem Arbeitskommando arbeiten muss, bis die Evakuierung des Lagers einsetzt. Ein Todesmarsch führt ihn ab Mitte Januar bis Gleiwitz; es folgt ein Bahntransport bis Groß-Rosen und dann nach Dachau. Letzte Station ist das Dachauer Außenlager Ampfing. Sein Erinnerungsbericht ist ein wichtiges Dokument der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik. Er erzählt sehr eindrucksvoll von den Zufällen, dem Glück, den vielen kleinen Dingen, die auf seinem Weg über Leben und Tod entschieden haben.
Die beiden Texte wurden für diese Ausgabe minimal überarbeitet. Neben Rechtschreibfehlern wurden kleinere sprachliche Unebenheiten geglättet und in einigen wenigen Fußnoten Ergänzungen oder Sachverhalte erläutert. Die an wenigen Stellen auftauchenden Unklarheiten oder kleinen Irrtümer, die nahezu jeden Zeitzeugenbericht begleiten und oft aus der Überlagerung von Wissen und Erinnerung entstehen, die aber dem Wert des Dokuments und seiner Glaubwürdigkeit keinerlei Abbruch tun, wurden, soweit möglich, aufgelöst.
Angelika Benz
Franz Memelsdorff
Fünf Wochen im Konzentrationslager Sachsenhausen
Franz Memelsdorff (1889–1958) mit seinen Kindern, 1931
Die Verhaftung
Am 10., 11. und 12. November 1938 fanden in Deutschland die größten Judenpogrome statt, die es bisher in diesem Land gegeben hat. In diesen Tagen wurden im ganzen Reich Synagogen, jüdische Schulen, Internate, Kinderheime, Altersheime und andere soziale Einrichtungen, die von Juden benutzt wurden, angezündet und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. In diesen Tagen wurden alle jüdischen Geschäfte in Stadt und Land, in Nord und Süd, in Ost und West, in den einfachsten und den elegantesten Vierteln der Städte demoliert und ausgeraubt. In den kleineren und auch in manchen größeren Städten wurden die Privatwohnungen der Juden gestürmt, verwüstet und geplündert. Vor den brennenden Häusern stand die Feuerwehr Wache, nicht etwa, um ihrer öffentlichen Hilfspflicht nachzukommen, nein, um zu verhindern, dass der Brand auf die »arischen« Nachbarhäuser übergriff. Die Plünderung der Geschäfte besorgte die SA in Zivil, in vielen Orten leitete der Bürgermeister persönlich die Aktion. Nach einem einheitlichen Plan wurden des Nachts schwere Steine vor die jüdischen Läden gefahren und abgeladen. Dann kamen die Rollkommandos der SA, die die Eisengitter und die Jalousien entfernten, die Scheiben einwarfen und im Innern der Läden ihr Werk vollbrachten. Während der ganzen Aktion sperrte die Hitlerjugend[1] die Geschäfte in weitem Bogen ab und beteiligte sich nachher sehr lebhaft daran, sich die schönsten Sachen aus den Läden anzueignen. Die uniformierte Polizei sorgte dafür, dass die Plünderer bei ihrer segens- und erfolgreichen »Arbeit« nicht gestört wurden.
Außer diesen »sachlichen« Maßnahmen ging man in diesen Tagen auch gegen die Juden persönlich vor: Juden wurden zu Zehntausenden verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt.[2] Auch mir wurde dieses Schicksal zuteil. Man brachte mich in das berüchtigte Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg, etwa 80 km nördlich von Berlin. Ich schreibe meine Erinnerungen an diese Zeit auf, damit meine Kinder wissen und immer wieder lesen können, was die Nationalsozialisten ihrem Vater und zehntausenden anderen anständigen, unschuldigen Menschen angetan haben. Ich werde in diesem Bericht nur die nackten Tatsachen anführen, ohne irgendetwas zu übertreiben oder gar zu erfinden. Die Tatsachen sind so ungeheuerlich, dass sie für sich allein sprechen.
Es war Freitag, der 11. November 1938. Ich saß beim Mittagessen in meiner Wohnung, als es klingelte und zwei Herren erschienen, die mich zu sprechen wünschten. Es waren ein älterer und ein jüngerer Mann. Sie kamen herein und wiesen sich als Kriminalbeamte des Polizeipräsidiums aus, indem sie ihre Blechmarken vorzeigten. Der eine nannte meinen Namen und sagte zu mir, als ich die Frage, ob ich der Betreffende sei, bejaht hatte: »Machen Sie sich fertig und kommen Sie mit!« Ich war natürlich aus allen Wolken gefallen, war ich mir doch keiner strafbaren Handlung, auch nicht der geringsten, bewusst. Meine Fragen, weshalb ich verhaftet würde, wohin ich gebracht und wie lange ich von zu Hause fort sein würde, wurden nicht beantwortet. Ich war im höchsten Maße erregt. Ich hatte zwar den Krieg mitgemacht, war drei Jahre als Leutnant an der Front gewesen, hatte bei Verdun, an der Somme, in Flandern, am Chemin des Dames, in Russland und auf dem Balkan mitgekämpft, bin verwundet worden – aber verhaftet war ich in meinem Leben noch nicht worden. Auf meine wiederholten Fragen, was das zu bedeuten habe, sagte der eine Beamte: »Na, Sie wissen doch, was los ist!«
Ich wusste aber nicht, was los war. Am Vormittag war ich in den Straßen Berlins gewesen und hatte die ausgeraubten Läden mit den fensterlosen Schaufenstern gesehen. Das große, weltbekannte Kindergarderobengeschäft von Arnold Müller in der Tauentzienstraße war bis zum letzten Stück geplündert worden, die zahlreichen riesengroßen Fensterscheiben waren zertrümmert, Glassplitter bedeckten in Haufen den Bürgersteig. Ich hatte wohl zwei Dutzend andere jüdische Geschäfte in der Tauentzienstraße, am Kurfürstendamm und in den Nebenstraßen gesehen, in denen in der gleichen vandalischen Weise gehaust worden war. Ich hatte auch die rauchende Synagoge in der Fasanenstraße gesehen. Die festen Mauern widerstanden dem Brande, aus der Kuppel kam eine dicke Rauchsäule: Das Holzgebälk im Innern brannte. Ich beobachtete, wie Feuerwehrmänner und Schutzleute herumstanden, das Synagogengrundstück absperrten und verhinderten, dass irgendjemand sich ihm näherte.
All das hatte ich am Vormittag gesehen. Noch als ich mittags in meine Wohnung zurückkehrte, fuhr ich an einem lichterloh brennenden jüdischen Kinderheim in Schmargendorf vorbei. Auf der Straße traf ich eine mir bekannte Dame aus einem brandenburgischen Städtchen, die mir erzählte, dass in ihrer Wohnung in der vergangenen Nacht alles demoliert worden sei und dass sie und ihr Mann, ohne auch nur das Geringste mitnehmen zu können, zu ihren Verwandten nach Berlin geflüchtet seien.
All das hatte ich gesehen und gehört. Aber ich hatte keine Ahnung davon, dass auf Menschen Jagd gemacht wurde, dass Menschen, die nichts getan hatten, verhaftet werden sollten, um ins Konzentrationslager gebracht zu werden. An diese Möglichkeit hätte ich auch nicht im Entferntesten gedacht.
Und weshalb das alles? Etwa eine Woche vorher war in Paris Herr vom Rath, Sekretär an der deutschen Botschaft, von einem 17-jährigen Polen namens Grünspan, der Israelit war, durch einen Revolverschuss zu Boden gestreckt worden. An der Verletzung starb der deutsche Beamte; der Todestag war, glaube ich, der 6. November.[3] Darauf setzten schlagartig die Pogrome ein. Die Zeitungen brachten natürlich nichts über die Plünderung und Ausraubung der Gechäfte und Wohnungen. Jedoch las ich am 10. morgens und abends in der Zeitung, dass in Berlin, Breslau, Köln, Frankfurt a.M. und einigen anderen Städten, die namentlich aufgeführt waren, die Bevölkerung in gerechter Empörung über die schändliche Tat des Juden Grünspan die Synagogen angezündet habe und dass die Polizei nicht fähig gewesen sei, die Gebäude vor der Wut des Volkes zu schützen. Gleichzeitig überschlugen sich die Zeitungen und das Radio in wüstesten antisemitischen Hetzereien. Aber am 10. November abends um 10 Uhr wurde die amtliche Nachricht des Propagandaministers Dr. Goebbels im Radio bekanntgegeben, dass »nunmehr alle Einzelaktionen gegen Juden einzustellen seien und dass ein besonderes Gesetz erlassen werden würde, dass die Juden für den Pariser Mord zur Verantwortung ziehen würde«. Am 11. November stand diese amtliche Nachricht in den Morgenblättern. Man hätte annehmen sollen, dass diese amtliche Nachricht der Wahrheit entsprach und alle sogenannten »Vergeltungsmaßnahmen« fortan nur durch das in Aussicht gestellte Gesetz angeordnet werden würden. Stattdessen setzten die Verhaftungen ein.
Ich ersuchte die Beamten, mir einen Haftbefehl vorzulegen – sie erklärten, sie hätten keinen. Auf meine wiederholten Fragen, ob ich etwa über Nacht fortbleiben würde und vielleicht Nachtzeug mitnehmen solle, sagte der ältere, es wäre gut, wenn ich ein Nachthemd und eine Zahnbürste mit hätte, außerdem riet er mir, Geld, etwas zum Essen und mehrere Taschentücher mitzunehmen und die Sachen in einer Aktentasche zu verstauen. In aller Eile wurden ein paar belegte Brote zurechtgemacht, Äpfel und eine Tafel Schokolade in die Aktentasche gesteckt, sechs Taschentücher gegriffen. Ich hatte 200RM im Schreibtisch, das Geld steckte ich zu mir. Instinktiv zog ich meinen alten Wintermantel an, obwohl es draußen noch recht warm war. So zogen wir zu dritt los, zum Polizeirevier, das in wenigen Minuten zu erreichen war.
Fußnoten
[1]
Für eine organisierte derartige Beteiligung der HJ gibt es keine Belege.
[2]
Vgl. Wolfgang Benz, Mitglieder der Häftlingsgesellschaft auf Zeit. Die »Aktionsjuden« 1938/39, in: Dachauer Hefte 21 (2005), S.179 – 196.
[3]
Ernst vom Rath erlag am 9. November seinen Verletzungen, woraufhin Goebbels beim Veteranentreffen der »Alten Kämpfer« im Münchner Alten Rathaus das Signal zum Pogrom gab. In Nordhessen und Anhalt hatte es schon in den Tagen davor judenfeindliche Exzesse gegeben.
Auf dem Polizeirevier
Auf dem Revier wurde ich in einen Raum geführt, in dem bereits zwei Leidensgenossen warteten, ein Fabrikbesitzer und ein Rechtsanwalt. Wir machten uns bekannt und fragten uns gegenseitig ohne Erfolg, was unsere Verhaftungen zu bedeuten hätten. Auch die anderen wussten nicht, wohin wir gebracht werden würden. Wir wurden einzeln herausgerufen und mussten einem uniformierten Polizeibeamten Namen, Adresse und Geburtstag angeben. Ich sagte dem notierenden Wachtmeister, dass ich christlicher Religion sei, und ersuchte ihn, dies mitaufzunehmen; er lehnte dies mit den Worten ab, dass das nicht hierhergehöre. Ein Protokoll oder etwas Ähnliches wurde nicht aufgenommen. Im Laufe einer Stunde kamen fünf weitere »Juden« hinzu, eigenartigerweise waren es ausschließlich, wie ich feststellte, Herren, die getauft, aber der Abstammung nach Juden waren. Die beiden Kriminalbeamten kamen herein und sagten uns achten, es ginge jetzt zum »Präsidium« nach dem »Alex«. Wir könnten mit dem Autobus oder der U-Bahn fahren. Sie rieten uns, eine Taxe oder vielmehr deren zwei zu nehmen, das ginge am schnellsten, um so früher würden wir wieder zu Hause sein. In Wirklichkeit wollten die beiden Wachtmeister nur möglichst schnell zu Muttern. Wie wir nachher hörten, waren sie mit unserer Ablieferung dienstfrei. Einige von uns fielen auf diesen Vorschlag herein, dazu gehörte auch ich. Wir nahmen zu dritt eine Autodroschke, neben uns setzte sich der eine der beiden »Kriminals«. Unterwegs fragte ich unseren Begleiter, ob ich meine Orden abnehmen sollte, ich trug im Knopfloch das Eiserne Kreuz erster und zweiter Klasse, das Ehrenkreuz für Frontkämpfer, das Verwundetenabzeichen u.a.m. Er antwortete, ich solle sie ruhig anbehalten. Wenn es nötig sein sollte, sie abzunehmen, würde man mir es schon sagen. Ein paar Stunden später sollte mir das zum Verhängnis werden.
Es war halb fünf, als wir am »Alex« eintrafen. Die Taxe hielt vor dem Präsidium in der Alexanderstraße. Eine Riesenmenschenmenge vor den Eisengittern, die die Eingangstore bewachen. Wir bezahlten den Chauffeur, jeder durfte vier RM blechen, und überquerten den Bürgersteig, angestarrt von der Volksmenge, die sich völlig ruhig verhielt. Von »Volkswut« keine Spur. In den riesigen Höfen, die ich zum ersten Male in meinem Leben sah, befanden sich bereits Hunderte von Juden, die meisten im Mantel und mit Hut, viele aber auch im Anzug ohne Kopfbedeckung. Wie mir später viele erzählten, waren sie von ihrer Arbeitsstelle weg, aus dem Büro, dem Geschäft, der Fabrik verhaftet worden, ohne dass ihnen die Möglichkeit gegeben war, ihre Überkleidung zu holen.
Polizeibeamte in Zivil, offenbar von der GESTAPO, hatten hier die Befehlsgewalt, ließen die Leute in Gliedern zu acht antreten, und wir mussten warten. Viele wollten den Beamten Mitteilungen machen, neben mir stand z.B. ein Herr, der erzählte, er sei schwer herzkrank und sei eben im Sprechzimmer seines Arztes verhaftet worden. Nichts wurde angehört, jede Erklärung wurde zurückgewiesen. Ein anderer wollte, wie ich hörte, davon Kenntnis geben, dass er Halbarier sei, ein anderer war Vierteljude. Was aus diesen Leuten später geworden ist, weiß ich nicht. Bestimmt sind sie zunächst auch ins KZ geschafft worden. Es war ein jämmerlicher Anblick: Hunderte von Menschen auf den Höfen zusammengepfercht, im Scheine einiger Lampen, die alles im Halbdunkel ließen, nicht wissend, was die nächsten Stunden bringen würden.
Allmählich setzte der Abtransport ein. Ein Lastauto fuhr nach dem anderen herein. Es waren lange Wagen mit einer Plane versehen, nur hinten offen. Innen befanden sich quer gestellt acht Holzbänke. In jedes Auto kamen 60 Mann, am hinteren Ende nahmen zwei Polizeiwachtmeister in Uniform mit Gewehr und umgeschnallten Patronentaschen Platz. Da die Wagen sehr hoch waren, wurden ein Tisch und davor ein Stuhl gestellt, die das Einsteigen ermöglichten. Schließlich kam auch ich mit einem Block von 60 Mann an die Reihe. Man suchte sich im Innern, wo es stockfinster war, so gut es ging, einen Platz, hinten wurde eine Kette quer gespannt, und fort ging es.
Die Fahrt ins Konzentrationslager
Mit großer Geschwindigkeit fuhren wir durch die abendlichen Straßen Berlins. Wir konnten an den Straßenschildern erkennen, dass es durch Pankow, also in nördlicher Richtung, ging. Doch dann versagte unser Orientierungsvermögen. Immer noch waren wir über das Ziel unserer Reise im Unklaren, wenn auch mehrere Leidensgenossen die Vermutung aussprachen, es würde wohl nach Sachsenhausen gehen, dem berüchtigten Konzentrationslager bei Oranienburg, ca. 80 km nördlich von Berlin.
Es war halb sechs, als wir vom Polizeipräsidium abfuhren. Noch hatten wir unsere Uhren und konnten uns informieren.
Unterwegs benutzte ich die Gelegenheit, einige Papiere zu zerreißen, die ich in meiner Brieftasche hatte. Man konnte nicht wissen, ob nicht alles revidiert werden würde, und es ist ja nicht nötig, dass die Gestapo alles erfährt. Die Papierschnitzel warf ich an die Seite unter die Bank. Mit meinem Nebenmann kam ich ins Gespräch, es stellte sich heraus, dass wir gemeinsame Bekannte hatten. Wir konnten uns, da es völlig finster war, nicht sehen. Trotzdem verabredeten wir zusammenzubleiben, wenn es irgend ginge. Gemeinsame Not führt zusammen. Unser Vorhaben ist uns auch geglückt: Jeder wusste den Namen des anderen, und so kamen wir in dieselbe Baracke. Wir haben uns sehr angefreundet, »der andere« ist ein besonders lieber Mensch, ein bekannter Arzt aus Charlottenburg.
Nach etwa einer Stunde Fahrt machte das Auto eine scharfe Kurve nach rechts, und wir kamen auf einen schlecht befestigten Weg. Der Wagen fuhr durch tiefe Löcher, und wir wurden ordentlich durcheinander geworfen. Nach vielleicht 20 Minuten wurde die Straße wieder gut, bald verlangsamte sich die Fahrt, wir merkten, dass vor uns ein Auto fuhr, und konnten hinter uns einen gleichen Wagen erkennen. Wir befanden uns offenbar in einer langen Kette. Vor uns hörten wir plötzlich lautes Johlen und Geschrei, taghelle Bogenlampen waren über den Weg gespannt, und – das Auto hielt.
Die ersten 24 Stunden im Konzentrationslager
»Ihr Judenschweine, wollt Ihr wohl herauskommen?!« Das war das Erste,was ich hörte. »Na, wird’s bald mit euch vollgefressenen Arschlöchern? Kommt nur herunter, ihr Mistviecher!« Die beiden Polizeibeamten waren heruntergesprungen, nun sollten wir hinterher. Mir fiel trotz meiner 50 Jahre der Sprung nicht schwer, aber es waren alte, gebrechliche, lahme, todkranke Leute dabei, alle mussten herunterspringen. Vor dem Ausgang des Lastwagens standen etwa ein Dutzend Männer in grau-grünen Uniformen, am Kragen die beiden SS-Zeichen, junge Leute, jeder mit einer Peitsche oder einem Stock »bewaffnet«. Alle hieben wahllos auf die Menschen, die aus dem dunklen Loch herauskamen, mit aller Kraft ein. Vor mir stürzte ein Mann, er wurde mit Füßen bearbeitet. »Wollt ihr wohl die Hüte abnehmen, ihr Judenlümmel?! Wollt ihr wohl laufen, ihr Schweine?!«, hörte ich rufen. »Ihr wisst wohl nicht, dass ihr ins Konzentrationslager kommt?«
Man sah schon, wo man laufen sollte. Von lauter Uniformierten war eine Gasse gebildet, die man passieren musste. Von rechts und links hagelten die Hiebe. Viele dieser Leute stellten den Juden ein Bein, nicht wenige fielen hin und wurden dann mörderisch zugerichtet, ich entging diesem Schicksal, einmal sprang ich über das hingehaltene Bein eines Uniformierten. Aber Prügel habe ich eine Menge bezogen, als ich die etwa 500 m durchlaufen hatte und das riesengroße Tor erreichte, das den Eingang des Konzentrationslagers Sachsenhausen bildet. Kommt man durch das Tor, so ist man auf einem riesengroßen, mit schwarzer Asche belegten Platz, dem sogenannten Appellplatz. War es draußen schon hell, so wurde man auf dem Platz geradezu geblendet: Stärkste Scheinwerfer erleuchteten taghell das Gelände. Wir 60 Mann aus dem Lastauto wurden mit zwei, drei anderen Gruppen zusammengetan, die vor uns angekommen waren.
Überall auf dem Platz standen Menschenhaufen in Zivilkleidern, ergeben in ihr Schicksal, SS-Männer ließen unsere Gruppe in vier Gliedern antreten. Natürlich ging das nicht mit der geforderten Schnelligkeit, und wahllos teilten die Jünglinge Fausthiebe und Fußtritte aus. Zwei Glieder mussten ein paar Schritte zur Seite machen, sodass eine Gasse gebildet wurde, zu der hin wir Front machten. In der Gasse gingen die SS-Männer einher, bald waren zehn und zwanzig da, bald nur einige wenige. Wir standen, mit dem Hut in der Hand. So hatten wir Zeit, unsere neue Umgebung zu betrachten und die Fülle der Eindrücke in uns aufzunehmen.
Ich stellte fest, dass die Strahlen der Scheinwerfer von dem Eingangstor kamen, wo sie im ersten Stockwerk auf einem Balkon angebracht waren. Der Platz, auf dem wir standen, war ein großer Halbkreis, den Durchmesser von vielleicht 800 m Länge bildete eine lange, hohe Mauer, in deren Mitte das Tor war. Strahlenförmig standen an der Außenseite des Halbkreises Holzbaracken, jeweils mit der schmalen Kopfseite dem Tor zugekehrt. Wenn die Scheinwerfer am Tor sich im Halbkreis herum bewegten, so beleuchteten sie die Gänge zwischen den Baracken bis in die hintersten Ecken. Ein ausgeklügeltes System, wie man es übrigens auch in den modernen Gefängnissen hat, nur dass dort die strahlenförmige Anlage sich innerhalb eines massiven Gebäudes befindet. Am Tor entdeckte ich eine Uhr, es war sieben Uhr abends, als ich in das KZ »einlief«. Diese Stunde des 11. November 1938 werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Die größten Eindrücke, die ich in meinem Leben gehabt habe, waren der Weltkrieg und das Konzentrationslager. Damals war man jung, begeistert, voller nationaler Ideale, bereit, sein Blut für sein Vaterland, für Deutschland, herzugeben – heute, 25 Jahre später, wurde man körperlich und seelisch gepeinigt und misshandelt, in seiner Ehre aufs tiefste gedemütigt und verletzt.
Wir sahen, dass bei anderen Gruppen Schilder herumgetragen wurden, bald kamen sie auch zu uns, und zwei von uns mussten die Schilder langsam in unserer Gasse einhertragen. Auf dem einen war zu lesen: WIR SIND DIE VERNICHTER DER DEUTSCHEN KULTUR
Ich habe lange darüber nachgedacht, was dieser sinnige Spruch wohl zu bedeuten haben mag. Es ist mir bis heute nicht klargeworden. Das zweite Plakat trug ein Mann, den ich als einen früheren Klassenkameraden und Conabiturienten wiedererkannte. Ein schönes Wiedersehen. Auf diesem Schild stand zu lesen: WIR SIND SCHULD AN DER ERMORDUNG DES HERRN VOM RATH Diese Worte waren zwar nicht zutreffend, aber wenigstens verständlich. Die Juden in Deutschland sollten also in ihrer Gesamtheit dafür verantwortlich gemacht werden, dass ein deutscher Beamter im Ausland von einem polnischen Juden erschossen worden war. Zu den »Juden« wurden nach nationalsozialistischer Doktrin auch die Christen gerechnet, die jüdischer Abstammung waren.
Es war inzwischen acht Uhr geworden. Wir standen, mit dem Hut in der Hand.
Die SS-Männer trugen nicht die schwarzen Uniformen, wie man sie sonst kannte. Sie hatten Jacken und Hosen aus grau-grünem Stoff. Es war nicht das Braun der SA, auch nicht das Grün der Gendarmerie, sondern eine eigene schmutzig-grau-grüne Farbe, sehr ähnlich der Uniform der Serben im Kriege. Ich musste immer, wenn ich die Uniformierten sah, an die serbischen Kriegsgefangenen denken, die wir anno 1915 machten … An der Mütze war ein Totenkopf aus Weißblech angebracht, am Kragen befanden sich die beiden SS-Runen. Die Wachtruppe war nicht die übliche SS. Sie bestand nicht etwa aus Personen, die eine zivile Beschäftigung hatten und sich nur von Zeit zu Zeit ihre Uniform anzogen, sondern die SS im Konzentrationslager ist eine Berufstruppe und bildet als sogenannte SS-Verfügungstruppe einen Teil der regulären Wehrmacht,[4] die aber nicht dem Kriegsminister, sondern Herrn Himmler als Chef der deutschen Polizei untersteht. Wie mir später erzählt wurde, machen die SS-Leute zunächst ein freiwilliges Probejahr durch, und dann verpflichten sie sich, wenn sie es wollen, für zwölf Jahre zum Dienst in dieser Truppe. Nach Ablauf dieser Zeit haben sie wie jeder Unteroffizier der Wehrmacht Anspruch auf den Zivilversorgungsschein und damit auf eine Anstellung im mittleren Beamtendienst.
Es fiel mir auf, dass alle SS-Männer, die man sah, Sterne am Kragen hatten. Es waren dies also keine »Gemeinen«, sondern »Chargen«. Ich kannte so viel von den Abzeichen, um zu wissen, dass ein Stern einen Scharführer darstellt – das ist so viel wie etwa ein Obergefreiter – und dass zwei Sterne einen Oberscharführer bezeichnen, einen Rang, der etwa dem Unteroffizier gleichzusetzen ist.[5] Wenn hier Hunderte von diesen Chargen herumliefen, wie groß musste erst die Zahl der ihnen unterstellten SS-Männer sein. Vier, fünf Scharführer kamen an der Reihe entlang, in der ich stand. Sie hatten elektrische Taschenlampen in der Hand und beleuchteten damit aus der Nähe die einzelnen Gesichter. Sie machten sich einen Spaß daraus, mit ihren behandschuhten Händen Ohrfeigen auszuteilen und den Leuten Fußtritte zu versetzen. Ich hörte Worte wie: »Sieh Dir doch mal diese Nase an! Das ist der Abraham aus Jerusalem« – und schon hatte der Jude einen Schlag ins Gesicht bekommen. Ein paar Schritte neben mir stand ein großer, sehr gut aussehender Mann. Einer der Scharführer fragte ihn, was er sei. »Universitätsprofessor«, lautete die Antwort. Schon hatte der Mann eine gewaltige Ohrfeige, die von den Worten begleitet war: »Eine Frechheit, mich so anzulügen! Juden sind keine Universitätsprofessoren. Die Juden treiben nur Wucher und ziehen uns Ariern das Geld aus der Tasche«.





























