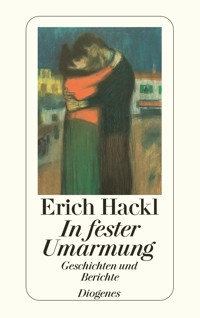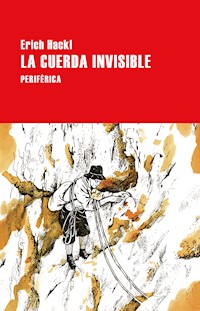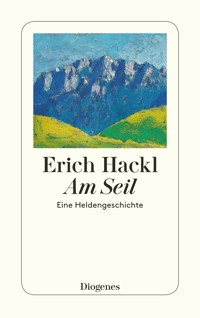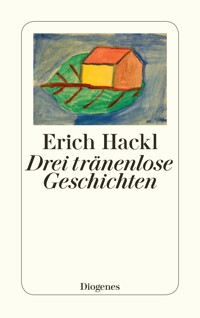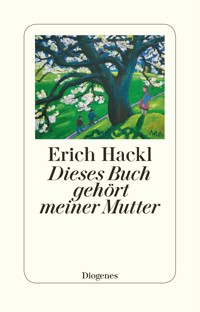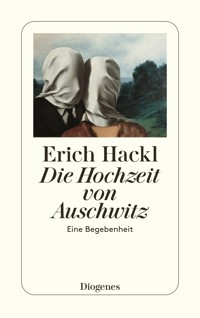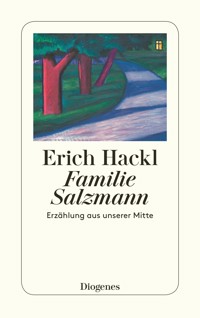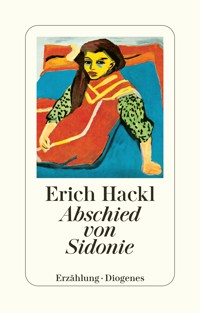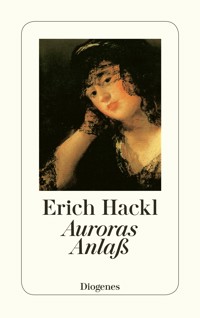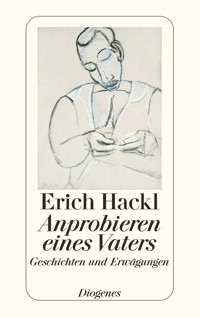10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Im Leben mehr Glück‹ versammelt Würdigungen von Menschen, die Erich Hackl wichtig sind. Wer sie waren und wofür sie einstanden. Über die Bedeutung von Freundschaft, von Widerstand, von Heimat. Aber auch Bissiges, Komisches. Unartige Dankesreden. Über Schriftsteller, die er bewundert, und über die Schwierigkeiten beim Schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Erich Hackl
Im Leben mehr Glück
Reden und Schriften
Diogenes
Die Jugend wartet ungeduldig auf unsere Berichte,
auf unsere Erzählungen. Das Herz hängt aber an
denen fest, die der Blick nicht mehr finden kann.
Anna Seghers, ›Der erste Schritt‹
Heimatkunde
Alphabet mit Auslassungen
Stichworte zum Thema Heimat, Land, Geschichte
ARBEIT Wer über ungetrübte Erinnerungen seiner Vorfahren verfügt, wird das Leben auf dem Land nicht a priori für das gesündere halten. Berichte von Mühsal und Armut, beides gemildert durch das Versprechen auf ein Jenseits, in dem die Äcker weniger steinig sind, die Rücken weniger gekrümmt … Aber ebensosehr wie die detailfreudigen Schilderungen meiner Eltern, die im Unteren Mühlviertel aufgewachsen sind, hat mich ein erfindungsreiches Gedicht des Schriftstellers Wulf Kirsten beeindruckt. Kirsten lebt seit langem in Weimar, stammt jedoch aus der Gegend um Meißen, deren Massiv wie das Mühlviertel aus Granit besteht, und ist dem ländlichen Österreich wie dessen kritischen Chronisten – vor allen anderen dem Kärntner Michael Guttenbrunner, dem Oberösterreicher Franz Kain – eng verbunden gewesen. Kirstens Vater war Steinmetz, seine Mutter ging zu Bauern arbeiten. Sie hatten fünf Kinder und ein Stück Land, das ihnen im Zuge der Bodenreform in der Sowjetisch Besetzten Zone 1945 übereignet wurde; das Gedicht die ackerwalze handelt davon, wie sie mangels Zugviehs sich selbst ins Joch spannten und statt einer eisernen Walze, die nicht aufzutreiben war, eine gestürzte Grabsäule übers Feld zogen, »bergauf, bergunter«, um Erdklumpen zu zerdrücken, das Saatbeet zu bereiten. Ihre Schinderei ist, im Gedicht, aufgehoben in der im Lehm sich abzeichnenden Inschrift auf dem gerundeten rollenden Grabstein: »geliebt, beweint und unvergessen«.
BRÜDERLICHKEIT Ohne Verweis auf ihre Seelenlandschaft lassen sich Leben, Werk und Gesinnung der Linzer Arbeiterschriftstellerin Henriette Haill nicht begreifen. Im Mühlviertel, hat sie einmal gesagt, sei sie aufgegangen, »als wenn ich es selbst gewesen wäre. Das Hohe, das Gigantische ist mir nichts, mir ist nur das Kleine, wie ich selbst bin, etwas. Die Hügel, die kleinen Erhebungen, das Herbe. Das Mühlviertel ist ja herb im Winter. Mich hat das Herbe so angezogen.« Darüber hat sie unzählige Gedichte, auch in Mundart, und viele Erzählungen verfaßt. Aber nicht diese will ich jetzt würdigen, sondern eine Reminiszenz aus dem Ersten Weltkrieg, bei der sich Haills Tugend erweist, mit dem Herzen eines anderen zu fühlen. Damals, 1915, mußten russische Kriegsgefangene einen alten Wasserspeicher am Linzer Römerberg instand setzen. Mit einem der jungen Männer, Porfiri Oleschko, freundete sich die elfjährige Jettel an. Porfiri erzählte ihr von seinen Eltern, den Geschwistern, der Not zu Hause in Odessa und davon, daß er im Krieg, aus revolutionärer Überzeugung, nicht auf die österreichischen Soldaten geschossen habe. Nach beendeter Arbeit, ehe der zerlumpte Trupp wieder abgezogen wurde, küßte er die rauhe, rissige Hand ihrer Mutter und strich dem Mädchen übers Haar, während er ihr seine Wahrheit zuflüsterte: »Du darfst nicht vergessen Porfiri Oleschko, einmal nicht mehr Krieg, einmal alle Brüder.« Haill sah ihn noch einmal, nach Wochen, auf einem Gerüst am neuen Linzer Dom, wo die Gefangenen Handlangerdienste verrichten mußten. »Ich winkte und rief nach ihm, er aber sah und hörte mich nicht. Er stand und blickte nach Osten, wo in weiter Ferne Brüder einander immer noch töteten und seine arme, verwüstete Heimat lag.«
CHRISTKINDL, BESITZANZEIGEND Elektropost aus einer Heimat, die weder arm noch verwüstet ist, genau hundert Jahre später. Erstens: »Sehr geehrter Herr Hackl, wir möchten keine Flüchtlinge in unserer Christkindlsiedlung. Wir sind ganz sicher, dass Ihre Mutter das auch nicht gewollt hätte. Mit freundlichen Grüßen Ihre Gegenübernachbarn ███ ████ ███████ Von meinem iPhone gesendet 4400 Steyr.« – Zweitens: »Sehr geehrter Herr Hackl! Ich habe von Ihrem direkten Nachbarn in der Goldbacherstraße, Steyr Herrn Schober erfahren, dass Sie überlegen im Haus Ihrer verstorbenen Mutter Asylanten oder Flüchtlinge unterzubringen. Ich möchte Ihnen – nachdem ich Sie bislang nicht erreichen konnte – auf diesem Weg mitteilen, dass ich in unserer Siedlung keine Flüchtlinge oder Asylanten einquartiert haben möchte und ich mir das auch offen zu sagen traue. Mit freundlichen Grüßen aus der Wegererstraße Mag. Gerhard ██████ 4400 Steyr.«
DEFINITIONEN Die erste stammt vom spanischen Dichter Antonio Machado, der in der andalusischen Metropole Sevilla aufwuchs und in der kastilischen Kleinstadt Soria seine Erfüllung fand. Uno es de donde nace al amor, no a la vida, lautete seine Botschaft. »Einer ist von dort, wo er zur Liebe erwacht, nicht zum Leben.« Den zweiten Satz hat Machados Landsmann Max Aub geschrieben, der in Paris geboren und im mexikanischen Exil gestorben ist: Se es de donde se hace el bachillerato. »Man ist von dort, wo man die Matura macht.« Wo man also erste Bindungen außerhalb des Elternhauses eingeht, nach Orientierung sucht, das Bewußtsein von Recht und Unrecht schärft, Wissen und Ohnmacht im Umgang mit Lehrern und anderen Erwachsenen erfährt. Die dritte schlüssige Definition hat der Dramatiker Heiner Müller gegeben, im Monolog Ajax zum Beispiel, sie lautet kurz und bündig: »Heimat ist / Wo die Rechnungen ankommen sagt meine Frau.«
EINMAL NOCH … schrieb mein Vater am 13.3.1982 auf ein Blatt Papier, unter der Überschrift »Gedanken in der Intensivstation« … »möchte ich vorm Haus auf der Gasse beim Wasser spielen / neben dem Fluder kleine Wasserräder laufen lassen / in der Hammerschmiede spielen, den Wasserrädern zuschauen / mit Onkel Hans den Wehrkanal bis zur Weißen Aist abgehen / am Sonntag vorm. während des Hochamtes den Reiterweg mit meiner Großmutter begehen / mit meiner Mutter die Gärten spritzen / mit Tante Gusti in die Maiandacht gehen / in der Mühlkammer Holz bearbeiten u. basteln / auf dem Mühlboden alte Bücher und Schriften anschauen und lesen / dem Müller Onkel Max in der Mühle helfen / auf dem Mühlanger herumlaufen und in der Waldaist baden / meiner Mutter beim Brotbacken im großen Backofen helfen / im Herbst bei der Flachsbearbeitung mithelfen / Freunden und Gästen in der großen Stuben an langen Winterabenden zuhören / möchte ich Wiesen, Felder und den Wald begehen / dem Köhler das Essen bringen und beim Kohlenziehen helfen / den Handwerkern zusehen und kleine Hilfsdienste leisten / einmal noch möchte ich ein Kind sein wie vor 56 Jahren!«
FREUNDSCHAFT In Erinnerung der Partisanentätigkeit im Salzkammergut würdigte Franz Kain die Bedeutung der Großfamilie. Entfernte Verwandte, zu denen früher kaum noch Beziehungen bestanden hatten, seien den von den Nazis Gejagten beigestanden. »Eine alte, im Dialekt noch durchaus lebendige Bezeichnung für die Verwandtschaft ist ›Freundschaft‹. Der Ausdruck ›wir sind in der Freundschaft‹ heißt soviel wie ›wir sind miteinander verwandt‹. Diese Freundschaft hat sich bewährt in der schwersten Zeit als eine Freundschaft auf Leben und Sterben. Tauf- und Firmpaten, meist nur noch Formalität und freundliche Gefälligkeit, bekamen das Gewicht echten und tapferen Beistandes. Viele dieser ›Godn‹ und ›Gödn‹ haben in bewundernswerter Solidarität unter Einsatz ihres eigenen Lebens das der tödlich bedrohten ›Patenkinder‹ gerettet.« – Auch unter der Francodiktatur half der Familienzusammenhalt oft über politische Abgründe hinweg. Der österreichische Spanienfreiwillige Josef Kotz, der während des Bürgerkriegs Josefa Gimeno Charco geheiratet hatte und kurz vor der Niederlage der Republik nach Frankreich geflohen war, kehrte 1940, nach dem Überfall Deutschlands auf Frankreich, heimlich nach Barcelona zurück, wo er unter seinem katalanisierten Namen José Cots als Chauffeur arbeitete. Obwohl sie mit den Frankisten sympathisierte, hielt seine Schwägerin ihre schützende Hand über ihn, so daß er bis Ende des Zweiten Weltkrieges von politischer Verfolgung verschont blieb. 1946 ließ er sich mit Frau und vier Kindern repatriieren.
GEFALLEN Hier die Erinnerung des spanischen Chemieprofessors Miguel Ángel Alario Franco, mitgeteilt in einem Leserbrief an die Tageszeitung El País: Im April 1965 war Miguel Ángel zusammen mit vierzig anderen jungen Leuten nach Perpignan gefahren. »Uns zog Europa an, ein magischer, beinahe mythischer Begriff für unsere Generation. Die Freiheit sehen. Vielleicht war das unser eigentliches Reiseziel gewesen.« Dort in der südfranzösischen Stadt begegnete er einem etwa dreißigjährigen Mann, ärmlich gekleidet, der einen zwei- oder dreijährigen Jungen an der Hand führte. Der Mann war Spanier, vertrieben mitsamt seinen Eltern. Als er herausfand, daß Miguel Ángel geradewegs von dort kam, fragte er: »Darf ich dich um einen Gefallen bitten?« – »Ja natürlich«, sagte Miguel Ángel ein wenig überrascht. »Kannst du dem Jungen einen Kuß geben?« Und wie um sich zu rechtfertigen, fügte er hinzu: »Es ist … weil ihn noch nie jemand aus Spanien geküßt hat.«
HEIMWEH Frage Nr. 5 aus Max Frischs Fragebogen zum Thema Heimat: »Gesetzt den Fall, Sie wären in der Heimat verhaßt: könnten Sie deswegen bestreiten, daß es Ihre Heimat ist?« Eine Antwort darauf hat Fritz Kalmar gegeben, in einer seiner »Heimwehgeschichten aus Südamerika«, die er unter dem Titel Das Herz europaschwer veröffentlicht hat. Darin wird erzählt, wie im fernen Bolivien die aus Wien vertriebenen Juden Anfang 1945 in helle Aufregung gerieten, als sie von den Luftangriffen auf die Stadt erfuhren. In ihrem Urteil waren sie gespalten; während die einen die Zerstörungen für einen Akt der Barbarei hielten, erschienen sie den anderen als logische Folge der Naziherrschaft und der Gesinnungslumperei der Bevölkerung. Unter den Diskutanten saß ein alter Mann, Herschel Goldglas nennt ihn der Autor, der in Wien ein schlechtgehendes Kurzwarengeschäft geführt hatte, von den Nazis erniedrigt und verhöhnt worden war und in La Paz nur dank der Hilfe seiner Landsleute überleben konnte. Goldglas schwieg, er hörte sich nur an, was die Leute sagten. »Aber auf einmal brach es aus ihm heraus, eine Explosion war das. ›Zerstören sollen sie es!‹ schrie er, dieser stille Mensch schrie, brüllte beinahe, ›zerstören, zerschlagen, vernichten, bis nix mehr übrig bleibt als ein Haufen Trümmer, und dort sollen sie ein Taferl aufstellen, auf dem steht Hier war Wien!‹. In diesem Moment hielt er inne, schlug beide Hände vor die Augen und schluchzte, heulte: ›Aber zu dem Taferl möchte ich hinfahren, zurück dorthin und nie mehr weggehen von dort, mein Lebtag nie mehr weggehen!‹ Tränen rollten über seine Wangen, er weinte, schämte sich dessen und rannte davon.«
IDYLLE Was der Kommunistin Haill das Mühlviertel, ist ihrem Genossen Kain das südliche Salzkammergut gewesen: Landschaft, die seinem Wesen entsprach, nicht weil er sie, wie Haill, aus freien Stücken erwählt hatte, sondern weil er in sie hineingeworfen worden war. Sie gefiel ihm, aber er hielt sie weder für lieblich noch für idyllisch, denn, so schrieb er über sich in der dritten Person, »er weiß zu viel von ihr«.
JUBELN »Zirkusgasse! Heimat!« jubelte Fritz Kalmar, als wir von der Schrottgießergasse in die Zirkusgasse einbogen. Fritz war damals neunzig, er lebte seit 1939 im Exil, verbrachte aber jedes Jahr mehrere Wochen in seiner Geburtsstadt Wien. In der Zirkusgasse hatte er mit seiner Mutter und seinen Brüdern gewohnt, von hier aus war er jeden Morgen über Salztorbrücke und Rudolfsplatz ins Wasagymnasium gegangen, an dessen Fassade heute eine Tafel an ihn erinnert. Schräg gegenüber dem Wohnhaus hatte sein älterer Bruder ein Kaffeehaus betrieben, das nach der Annexion Österreichs arisiert und umbenannt worden war: von Café Mignon in Café München. Aus Fritz’ Mund klang der neue Name wie ein Peitschenhieb. Auf derselben Straßenseite wie das Wohnhaus hatte sich der Türkische Tempel befunden, eine Synagoge, die in der Pogromnacht geschändet und niedergebrannt worden war. Jetzt stand dort ein Gemeindebau aus den achtziger Jahren. Das einzige Gebäude in der Straße, das noch genauso aussah wie in seiner Jugend und dem gleichen Zweck diente, war das namenlose Stundenhotel an der Ecke Schmelzgasse: Gruß der Heimat an einen Vertriebenen, der sie bejubelt.
KOMMUNISMUS Während der Vorführung des Films Über die Jahre des österreichischen Regisseurs Nikolaus Geyrhalter mußte ich an ein Bonmot aus der Zeit des Kalten Krieges denken, das Johannes Bobrowski einmal zitiert hat: »Kommunismus ist, wo allen alles gehört und niemand etwas hat.« Die Menschen, die Geyrhalter über zehn Jahre gefilmt hat, leben im nördlichen Waldviertel. Zu Beginn der Dreharbeiten, 2004, sind sie die letzten Arbeiter einer Textilfabrik, die kurz darauf geschlossen wird. Ihre Ansprüche an das, was man für gewöhnlich das Leben nennt, sind – gemessen an den »Herausforderungen«, mit denen der Kapitalismus die Menschen traktiert – in ihrer Bescheidenheit derart subversiv, daß einem der Gedanke kommt, sie könnten sich nichts Besseres wünschen als den Kommunismus.
LOSER Der hegemonialen Auffassung zufolge gelten sie jedoch gerade ihrer beständigen Anspruchslosigkeit wegen als Loser: Verlierer, die um so verachtenswürdiger sind, als ihnen nicht in den Sinn kommt, das Leben für ein verpflichtendes Gewinnspiel zu halten. Ihr Widerstand ist beachtlich, trotz der Tatsache, daß ihnen Aufruhr und Empörung fremd sind. Vermutlich gehen die meisten von ihnen nicht einmal wählen oder geben jenen Parteien ihre Stimme, die gegen »Sozialschmarotzer« wie sie hetzen.
MACHADO Noch einmal der Dichter Antonio Machado: Se canta lo que se pierde. »Man besingt, was man verliert.« Die Kindheit, die Liebe, die Heimat, oder was man dafür hält.
NESTBAUEN Eugenie Kain zufolge, der Tochter des Schriftstellers, die selber eine bedeutende Schriftstellerin war, lassen sich zwei Menschentypen unterscheiden: die Nestbauer und die Zeltaufsteller. Mit den Nestbauern, die ihre Häuser in die Landschaft klotzen, umzäunen, mit allerlei Schöner Wohnen-Zeug, »Hier wache ich«-Schildern und Alarmanlagen dekorieren, wollte sie sich nicht anfreunden; das Zelten dagegen war ihr lieb und vertraut. Unterwegs sein, »daheim im Reisen – und auf der Hut«, das war Eugenies Praxis wie Programm. Ans Wohnen stellte sie keine großen Ansprüche – ihr genügten ein Küchenradio, ein großer Eßtisch, ein eigener Schreibtisch, Platz für Bücher, ein ruhiger Raum zum Schlafen.
ORIGINALE Vor neunzig Jahren hat der junge Ernst Fischer sich an der Provinz abgearbeitet, an der Kleinstadt, die ihm im Gegensatz zur großen nichts, oder nur Abstoßendes, bedeutete, und mir scheint, sein harsches Urteil ist nicht überholt: »Hier in der Provinz, wo sich das Leben langsam im Kreise dreht, ist jeder, da große Aufgaben, lodernde Horizonte fehlen, immerfort mit sich selber beschäftigt, hier wuchert der Individualismus, hier wird man zum Original, weil es das einzige ist, was man werden kann. Der Pensionist, der Raunzer, der Nörgler, er ist das Urbild des Originals, und mannigfaltig variiert beherrscht der Typus die Stadt. Wunderliche Gestalten, geisterhafte Figuren, Sonderlinge und Eigenbrötler aller Art treiben sich in den Kaffeehäusern, in den Gärten und Gassen umher, und der Schatten, den sie werfen, ist grotesk, phantastisch, unwahrscheinlich. Kleine Absonderlichkeiten blähen sich auf und werden zur Weltanschauung, eifersüchtig wacht jeder von diesen Aposteln seiner selbst darüber, daß keiner ihm nachahme, keiner ihm ähnlich sei. Nirgends gibt es so selbstbewußte, so selbstgefällige Narrheit wie in der Provinz.«
PERIPHERIE Alberto Nessi ist im Mendrisiotto aufgewachsen, dem südlichsten Zipfel des Tessins, hart an der italienischen Grenze, der lange das Armenhaus der Schweiz war – die Männer suchten Arbeit in den Marmorsteinbrüchen von Carrara, von wo sie mit Staublungen zurückkamen, oder wanderten nach Amerika aus, die Frauen verdingten sich in den Städten als Ammen oder Küchenhilfen. Man könnte also sagen, daß das Mendrisiotto an sich schon Peripherie war, geographisch wie sozial. Aber bereits als Jugendlichen zog es Nessi an die Peripherie dieser Peripherie, in das Niemandsland zwischen Fabrik, Halde und Gestrüpp, das ihm »ein Ort der Entdeckungen« war. Geheimnisvoll, ungebunden, frei. Davon ist nichts geblieben. »In meiner Umgebung wohnt heute an der Peripherie die Feindseligkeit. Jene Feindseligkeit, die wir dem Fremden entgegenbringen, wenn er die Grenzen heimlich überschreitet. Das ›Unbekannte‹, das ich in meiner Jugend gesucht habe, ist heute anderswo zu finden: in den Augen der Einwanderer, die ferne Wüsten und Meere gesehen haben, im kleinen Jungen aus Sierra Leone, der neben mir wohnt, in den Erlebnissen der Frau aus dem Iran, die ihre Heimat verlassen mußte, in der Geschichte von Karuna, dem Flüchtling aus Sri Lanka, der in einer Fabrik im Mendrisiotto arbeitet, in den Gesichtszügen des bosnischen Mädchens Alma, das vor dem Krieg geflohen ist und nun mit meiner Tochter zur Schule geht. Die neue Peripherie sind sie. Sie sind es, die Geschichten zu erzählen haben. Doch in diesen Geschichten spiegelt sich nicht mehr die Poesie des Geheimnisvollen, sondern das Drama der Entwurzelung.«
STIMMUNG In einem nachgelassenen Gedicht bringt Franz Xaver Hofer zur Sprache, was ihn zeitlebens geprägt hat – ohne den Begriff ›Prägung‹ überhaupt zu verwenden. Er kommt auch ohne die geläufigen Synonyme wie Herkunft, Wurzeln, Kindheit, Formung oder Heimat aus. Das Wort, das er statt dessen setzt, trifft in seiner Verhaltenheit den Sachverhalt viel besser:
Ich komme aus dieser Stimmung.
Woanders komme ich nicht her.
Ich gehe wohin, ohne das Woher
vergessen zu können oder zu wollen:
Ich komme aus der Stimmung
des Kornspeichers
der Scheune
des Kellers
und der schwarzen Selchkammer.
TOTSCHLAG Ein anderer Mühlviertler Autor, Bauernkind wie Hofer, der die Torheiten des heutigen Landlebens grimmig benennt und, stets gefährdet, darüber zu verzweifeln, die Fülle handwerklicher und bäuerlicher Verrichtungen rühmt, ist Richard Wall: »Wer sagt, das Einfamilienhaus ist eine Brutstätte von Mord und Totschlag, gehört nicht zu uns! Also, wohin gehöre ich?«
VAGABUND Der größte soziale Dichter des vergangenen Jahrhunderts, Theodor Kramer, hat den Vagabunden – einem Menschenschlag angehörig, der bei uns offenbar ausgestorben ist – wie allen Menschen am Rand jene Gerechtigkeit widerfahren lassen, die ihnen von den Behausten vorenthalten wurde, und in ihrer Bedürftigkeit, Verzweiflung, Verworfenheit, aber auch in ihrem Stolz ernst genommen. Daniela Strigl weist darauf hin, daß in Kramers Gedichten Heimat nicht als Vorrecht der Bodenständigen erscheint, sondern auch den Landstreichern, Stromern, Vaganten zugestanden wird, und zitiert ein Rollengedicht Kramers über einen im Burgenland umherziehenden Vagabunden, der darauf besteht, das Land genauso zu lieben wie der Bauer – und sich durch das Verständnis, das er für ihn aufbringt, ein Stück weit über seinen Kontrahenten erhebt:
Wie viel es, Bauer, sind, die mich vertreiben;
an dir allein versteh ich Haß und Ruh.
Ich lieg, der Erbfeind, hier vor deinen Scheiben,
und liebe doch das Land so tief wie du.
[…]
Vielleicht muß einer düngen, pflügen, graben
und ein Erhalter und Bewahrer sein,
ein andrer aber nichts als Beine haben,
die rastlos fallen in ein Schreiten ein.
WEITE UND WÜRDE In einem Gespräch über seinen Film Seit die Welt Welt ist hat Günter Schwaiger staunend festgestellt, daß Weite sich erst dann einstellt, wenn man die Nähe sucht. »Je näher man einer Figur kommt, desto mehr erweitert sich der Horizont. Je tiefer man in den Mikrokosmos dringt, umso größer wird der Makrokosmos. Die Figur von Gonzalo, die familiäre Beziehung, das Dorf, die Entvölkerung, die Landschaft – all das zusammen stellt etwas Universelles dar. Je länger wir dort arbeiteten, umso klarer wurde mir, daß dieses Dorf für so vieles symptomatisch ist, was nicht nur in Kastilien, sondern in der ganzen Welt passiert.« Nehmen wir Schwaiger den Ausrutscher, seinen Protagonisten Gonzalo Martínez Arranz als »Figur« zu bezeichnen, nicht weiter übel; beeindruckend an dem Film ist nämlich gerade die mitgeteilte Tatsache, daß er durch den langen, geduldigen Blick auf einen oder einige Menschen, die er durch den Alltag und in der Arbeit begleitet, die Welt zu verstehen hilft. Aber da ist noch etwas, das Mitgefühl nämlich, ohne das Kunst entbehrlich wäre. Es prägt auch zwei andere Dokumentarfilme, die mich in letzter Zeit tief beeindruckt haben, Geyrhalters Langzeitprojekt, das ich schon erwähnt habe, und Volker Koepps Landstück über Natur, Glück und Ökonomie in der nordostdeutschen Uckermark. In allen drei Filmen wird sichtbar, was sich selten offenbart: Würde. Die Würde im Widerstand, müßte man hinzufügen, gegen die hegemonial gewordene Auffassung, daß es im Leben darum geht, den Nutzen zu maximieren, dem Leiden anderer gegenüber indifferent zu bleiben. Alle Erfahrung abzustoßen, die der Geldvermehrung nicht dienlich ist. Der Druck wächst, sich in eine Akkumulations- und Tauschwertmaschine zu verwandeln. Das ist auch der Grund, warum viele in ihrer Enttäuschung oder Verwirrung die falschen Schlüsse ziehen und, selber bedürftig, die Bedürftigen zu ihren Feinden erwählen. Anders die Helden, Heldinnen dieser Filme. Ihnen zuhören, sie ansehen zu können, auf der Leinwand, im Kinosaal, weckt in mir:
ZUVERSICHT die wenigstens für die Dauer der Vorstellung und einige Stunden, Tage danach anhält. Schwer zu sagen, ob das viel ist oder wenig, in dieser Zeit.
(2017)
Geschichte, die immer erst anfängt
Ein zweites Mal im Friedhof am Perlacher Forst. Nachprüfen einer verwehten Erinnerung, an eine Geschichte der Heimat. Die Öffnungszeiten sind gleichgeblieben: Oktober bis Februar 8–17 Uhr, März und September 8–18 Uhr, April bis August 8–19 Uhr. Das Mitnehmen von Hunden und das Radfahren sind untersagt. Neu ist der Grablichterautomat gleich neben dem Eingang. In einem Schaukasten wird das Münchner Totenadreßbuch angezeigt, es ist im Buchhandel oder direkt beim Verlag um 35DM erhältlich. Ferner ergeht die Bitte an alle Friedhofsbesucher, bei der Ermittlung von Blumen-, Blumenschalen- und Vasendieben zu helfen. »Für Hinweise, die der Überführung eines Täters dienen, wird eine Belohnung bis 2000DM ausgesetzt.«
Angrenzend an den Friedhof, die Justizvollzugsanstalt Stadelheim. Stahlbeton, Panzerglas, drei Wachtürme. Aber die Eingangstür, der Türgriff und die getönten Fensterscheiben, hinter denen Beamte in Zivil vor Monitoren sitzen, würden einer Bankfiliale gut anstehen. Vor dem Eingang die Haltestelle der Autobuslinie 39, Radweg, Papierkorb, Zeitungsständer. Bild: »Schulstreik gegen einen achtjährigen Tyrannen«. Abendzeitung: »Münchner TV-Skandal: Warum der ORF über Antenne kaum mehr zu empfangen ist«. tz: »Die Royals: Das neue Skandal-Buch im Vorabdruck«.
Tief im Heute. Aber wer den Kopf in den Nacken legt, kann hinter dem Verwaltungstrakt den Giebel der alten Zuchtanstalt sehen, braun-weiß angefärbelt, und wer auf dem Friedhof eine Runde dreht, findet das Massengrab, davor die Tafel, auf der steht, was lang vorbei ist und immer erst anfängt. »Hier sind 4092 Opfer nationalsozialistischer Willkür zur letzten Ruhe bestattet.« Karl Punzer zum Beispiel. Und Franz Draber? Und Sepp Bloderer?
Ende und Anfang
Die Nachtschicht in den Steyr-Werken dauerte von halb vier bis halb eins. Jemand hatte Draber einen Packen Flugblätter ins Magazin gebracht, gegen den Naziwahn, in einer Arbeitspause legte er sie neben das Montageband, in die Autos, neben die Maschinen. Gegen Mitternacht stolzierte ein Kollege an ihm vorüber, das Hakenkreuz am Kragen, und rief ihm zu: Jetzt ist es soweit! Spinnst, antwortete Draber. Dann wusch er sich, schlüpfte in die Jacke und fuhr mit dem Rad nach Hause. Auf der Ennsbrücke kamen sie ihm schon entgegen, jubelnd, mit Fahnen.
Acht Stunden später, als Draber die übriggebliebenen Flugblätter im Klo runterspülte, fuhr Bloderer auf einer Puch 200 durch das Steyrtal. Er war mit Genossen am Kasberg skifahren gewesen, dann hatte er mit dem schwarzen Betriebsratsobmann Riha das gemeinsame Vorgehen bei der von Schuschnigg angesetzten Volksabstimmung abgesprochen. In Grünburg sah er zu seinem Erstaunen junge Männer in weißen Stutzen herumlaufen. In Neuzeug war es schon ein ganzer Trupp, in militärischer Formation, mit Hakenkreuzbinden und Fahne. Ein Putsch? dachte er. In Steyr war ab der Promenadenschule kein Durchkommen mehr, also lehnte er das Motorrad an die Mauer der Stadtpfarrkirche und folgte dem Menschenstrom, der sich über den Pfarrberg wälzte. Am Stadtplatz stand er, eingekeilt in der Menge, in der er viele Bekannte sah, alte, brave Sozialdemokraten, die plötzlich den Arm in die Höhe rissen.
Draber war völlig überrascht.
Bloderer traute seinen Augen nicht.
Vorstellbar, was Punzer empfunden hat an diesem Märztag neunzehnhundertachtunddreißig.
Überwindung der Schwerkraft
Draber war der erste. Er zögerte kurz, als er vor sich den Acker sah, auf dem zehn oder zwölf Häftlinge arbeiteten, dann lief er nach rechts, die Mauer entlang über die Wiese. Punzer hinter ihm hielt sich weiter links, das war ausgemacht, jeder sollte seine eigene Linie finden. Bloderer hatte es am schwersten. Er rannte schräg hinüber zum Friedhof, man konnte ihm also den Weg abschneiden.
Vier oder fünf Häftlinge nahmen, auf Zurufen der Aufseher, die Verfolgung auf, einer holte Bloderer ein, stürzte sich aber nicht auf ihn, sondern stürmte vorwärts, Punzer hinterher.
Draber war schon weit voraus, als Punzer stürzte, Bloderer sah es aus dem Augenwinkel. Draber behauptete später, er habe Schüsse gehört, Bloderer konnte das nicht bestätigen. Er hechtete über den lebenden Zaun, der den Friedhof vom Gefängnisacker trennte, lief geduckt zwischen Grabsteinen, während er schon rufen hörte: Da ist er. Da drüben. Er fand zwei frische Gräber, warf sich zwischen ihnen zu Boden, zog Kränze über sich. Stimmen, ganz nah, er war überzeugt, sein Keuchen werde ihn verraten. Dann der Hund dicht neben seinem Ohr, endlos langes Schnüffeln, schon wollte Bloderer aufgeben. Hat eh keinen Sinn.
Punzer, inzwischen, wurde zurück in die Zelle geschleppt.
Das war am 30. November 1944, kurz nach neun Uhr morgens, die Temperatur betrug zwei Grad Celsius.
Aber wie, aber wo
Draber war damals einundzwanzig, gelernter Werkzeugmacher, Jungsozialist in einer roten Stadt. Im Februar vierunddreißig hatte er auf der Ennsleite gekämpft, aber als die Heimwehr kam, saß er im Keller eines Bekannten und spielte Schach. Es war ihm nichts nachzuweisen, außerdem hatte er so ein treuherziges Gesicht. Bubenlächeln, eine Haarsträhne fiel ihm in die Stirn.
Sein Freund Karl Punzer war ein Jahr älter, hoch aufgeschossen, dabei zaundürr, von daher rührte sein Spitzname Gandhi. Er hatte eine Tischlerlehre absolviert, dann als Laufrichter in den Steyr-Werken gearbeitet. Punzer war belesen, er hatte die Menschheitsgeschichte im kleinen Finger. Wenn sie Ausflüge im Faltboot machten, zu zweit oder mit ihren Freundinnen, legten sie an einer Sandbank an, und dann erklärte ihm Punzer die Welt.
Bloderer war Jahrgang 1914, Schlosser, nach der Lehre arbeitslos, zweimal aus politischen Gründen eingesperrt, ein drittes Mal in Wöllersdorf inhaftiert. Mitte der dreißiger Jahre bereiste er als Instruktor der verbotenen Kommunistischen Partei Kärnten und die Steiermark, als er an Kinderlähmung erkrankte, legten ihn Genossen vor ein Wiener Spital. Gleich nach dem Einmarsch wurde er von der Gestapo in die Berggassenschule gesperrt und auf die Transportliste nach Dachau gesetzt. Ein ehemaliger Schulfreund setzte sich für ihn ein, Bloderer kam in die Steyr-Werke, wurde u.k. gestellt, für drei Monate zur Wehrmacht eingezogen, dann war er wieder in Steyr. Der Parteiauftrag lautete, abtauchen, stillhalten, nichts riskieren.
Auch Draber war unabkömmlich. Er arbeitete an den hydraulischen Aggregaten für die Messerschmittmaschinen, erzeugte Öldruckschalter, Bloderer mußte jedes Werkstück kontrollieren. Mißtrauen des Älteren, als Draber ihn zu Bergtouren einlud, an denen auch Punzer teilnahm. Ende vierzig, Anfang einundvierzig fingen sie an, die Widerstandszellen zu reorganisieren. Sie sammelten im Auftrag der Roten Hilfe ein paar Mark für Wenzel Wagner, dessen Sohn in Spanien gefallen war, oder für die Mutter von Herta Schweiger, die von der Gestapo totgeschlagen worden war. Hertas Vater hatte sich aus Verzweiflung kurz danach das Leben genommen.
Immer noch das Mißtrauen, die Mischung aus Angst und Ethos: Und wenn wir etwas Schmirgel reingeben. Dann stürzt das Flugzeug ab. Und der Pilot? Oder, später, der Plan, den Erzzug im Ennstal entgleisen zu lassen. Und der Lokführer. Und der Heizer. Dann, als die ersten aus ihrer Gruppe hochgingen, die Überlegung: Noch ist Zeit unterzutauchen. Aber wie, aber wo.
Querfeldein
Am Abend des ersten Tages stand er an der Isar. Da wußte Draber, er war im Kreis gegangen. Einmal führte die Straße mitten durch eine Kaserne, und er hörte, wie links und rechts Alarm gegeben wurde. Einmal fand er eine weiche Birne. Einmal vergrub er seinen Abschiedsbrief. Einmal schneite es, und er deckte sich, zitternd, mit Reisig zu. Einmal lief ihm ein Hund nach. Einmal bat er eine Frau um einen Teller Suppe. Einmal sagten drei Männer, du bist verdächtig, du kommst mit. Einmal lief er mit letzter Kraft querfeldein. Einmal stürzte er. Einmal kam er nicht mehr hoch. Einmal wartete er, zerlumpt und durchnäßt, auf einem Bahnhof auf den Zug nach Ried, und draußen auf dem Vorplatz kontrollierte die Gestapo.
Verschärfte Einvernahme
Schuld war ein Genosse aus Bad Hall, der mit seiner Frau im schlechten Einvernehmen lebte. Der prahlte vor ihr, die Deutschen werden den Krieg verlieren, wirst sehen, dann bin ich hier Bürgermeister! Die Gestapo verlor keine Zeit. Zuerst holte sie sich den Riepl, dann Ulram, dann Palme, dann Koller. Bloderer und Punzer hatten zwei Zellen nebeneinander, mit Hilfe ihrer Trinkbecher, die sie gegen die Zwischenwand hielten, konnten sie sich absprechen: Sammeln für die Frauen, deren Männer im KZ sind, das geben wir zu. Mehr nicht! Bloderer wurde blutig geschlagen, Punzer so übel zugerichtet, daß ihn Draber nicht erkannte, als er ihm am Gang, auf dem Weg zu einem Verhör, begegnete. Der Gestapomann Neumüller renkte sich den Arm aus, nachdem er ihn gegen Draber erhoben hatte.
Angeordnet war: Verschärfte Einvernahme.
So spring doch
Bloderer folgte der Autobahntrasse. Einmal begegnete er einem Gendarmen. Einmal kam ein SS-Mann des Weges, und der Schäferhund ging mit gesträubtem Nackenfell auf Bloderer los. Einmal legte ein Flurwächter das Gewehr auf ihn an. Einmal suchte er bei einem Pfarrer Hilfe. Aber der alte Mann wies ihm die Tür. Einmal kroch er ins Heu. Einmal stahl er ein Fahrrad. Einmal ließ er jede Hoffnung fahren. Da stand er auf der Brücke über den Inn und hörte eine Stimme sagen: Spring, so spring doch.
Die Füße, zwei blutige Klumpen.
Das Verlangen
Die erste Verhandlung vor dem Volksgerichtshof, im August 1942, wurde vertagt, weil alle drei sagten, die Geständnisse seien aus ihnen herausgeprügelt worden. Sie saßen in Einzelhaft, drüben in Stadelheim, und rechneten sich gute Chancen aus. Die zweite Verhandlung, im Mai 1944, dauerte zwei Tage. Dann wurden sie in den Todestrakt überstellt.
Das Schafott, der Galgen und die Todeszellen befanden sich im zweiten Stock. Die Hinrichtungen fanden in der Regel zweimal pro Woche statt, dienstags und donnerstags. Um neun kam der Staatsanwalt, die Kandidaten wurden aus der Zelle geholt, das Urteil verlesen und bestätigt. Es gab eine Henkersmahlzeit. Der Scharfrichter traf um siebzehn Uhr ein. Einmal beobachtete Draber Zigeunerkinder, die in der Armensünderzelle tanzten und lachten. Denen hat man wohl gesagt, sie kommen frei. Und Bloderer hörte einen tschechischen Arbeiter von neun bis siebzehn Uhr singen, auch dann noch, als ihm die Zähne ausgeschlagen wurden, heiser, röchelnd, immer wieder die Internationale.
In den zweihundert Tagen, die sie in der Todeszelle zubrachten, unternahmen die drei Steyrer vier Ausbruchsversuche: Einmal sägten sie das Fenstergitter durch; einmal kratzten sie mit einem Nagel ein Loch zur Nachbarzelle; einmal planten sie, den Schließer zu überwältigen; einmal sprengten sie mit einem Eisenkübel das Türschloß. Draber, der im Zuchthaus viel herumkam, weil er für die Aufseher Bienenkörbe flickte und Fahrräder reparierte, wußte, daß es irgendwo eine Pforte gab, die nicht versperrt war.
Am 29. November 1944 wurde durch eine Fliegerbombe die Wasserleitung zerstört. Die Aufseher befahlen ihnen, Wasser in Eimern nach oben zu schleppen, damit das Blut unter dem Schafott weggespült werden konnte. Am Morgen des dreißigsten wurden sie noch einmal zum Wassertragen geholt. Plötzlich ließen sie die Eimer fallen und rannten los. Halt! rief ein Aufseher. Draber, Punzer, machts mich nicht unglücklich! Und für einen Sekundenbruchteil spürte Draber das unendlich große Verlangen stehenzubleiben.
Zwischenzeit
In der Furtmühle bei Bad Hall, in einer Kammer unter dem Dach, erholte sich Draber von den Strapazen. Während er für den Müller das Roßgeschirr flickte, lief die Müllnerin nach Steyr hinüber, in der Tasche eine Zwirnspule, in der Spule, unter der Vignette, den zusammengerollten Brief an seine Eltern. Von ihnen erfuhr er, daß Punzer am fünften Dezember geköpft worden war.
Bloderer versteckte sich in Leonstein, bei einem alten Freund der Familie. Bevor dessen Sohn, der ein fanatischer Nazi war, auf Fronturlaub nach Hause kam, brachte ihn ein alter Genosse auf Skiern hinüber ins Ennstal. In Kleinreifling, in der Dachkammer eines Trafikanten, hielt er sich bis Kriegsende versteckt.
Nach der Befreiung
Zuerst trennte sie die Demarkationslinie, die quer durch Steyr verlief: Draber befand sich diesseits, Bloderer jenseits der Enns. Im Westen die US-Amerikaner, im Osten die Sowjets. Der Stadtverwaltung West stand ein Sozialdemokrat vor, der Stadtverwaltung Ost ein Kommunist. Im Osten, im Stadtteil Münichholz, wurde gleich nach der Befreiung eine Straße nach Karl Punzer benannt.
Bloderer übernahm Parteiaufgaben, war Personalchef im Erdölgebiet Zistersdorf und im Böhlerwerk Waidhofen, wechselte später in die Privatwirtschaft. Als ich ihn Anfang der achtziger Jahre besuchte, fiel es mir schwer, die Umgebung – einen soliden Bungalow in einer besseren Wohngegend oberhalb Urfahrs – mit seiner politischen Biographie zusammenzubringen.
Draber arbeitete bis zu seiner Pensionierung im Magistrat Steyr. Er war freundlich, fleißig, verläßlich. Da er auch Kommunist war, wurde seinen Ansuchen um Beförderung nie stattgegeben. Mit der Zeit lockerte sich der Kontakt zwischen den beiden, aber pünktlich an jedem dreißigsten November telefonierten sie miteinander. Bloderer starb im August 1994, Draber überlebte ihn um zwei Jahre. Seit 2011 gibt es am nördlichen Stadtrand von Steyr, hinter dem Krankenhaus, eine Franz-Draber-Straße. Von ihr zweigt, in westlicher Richtung, die Josef-Bloderer-Straße ab.
Für und wider
Er habe einige Male nachstudiert. Ob sich der Kampf gelohnt hat. Ob er ihn noch einmal führen würde. Und er müsse zu seinem Bedauern sagen, nein. Denn er sei von den Menschen enttäuscht worden, die drehen sich – großteils!, es gibt schon Ausnahmen – nach dem Wind. Und wenn er, Bloderer, sie so meckern hört …
Draber sagte, er würde wieder so handeln. Er habe auch nicht viel getan, nur gegen den Krieg gekämpft, und er habe sich nicht geändert, sei auch heute noch für den Frieden, wir brauchen keine Waffen, und wenn mehr so denken würden, stünde es besser um die Welt.
(2000)
Steckbrief Rudi Strittich
Der Vater Hilfsarbeiter in den Steyr-Werken, nach Ausbruch der Wirtschaftskrise die meiste Zeit erwerbslos oder nur tageweise beschäftigt, als Gerbergehilfe und Schneeräumer. Zwei ältere Schwestern. Die Mutter geht als Bedienerin. Sie stirbt, als Rudi sechs ist, 1928, nach einer Abtreibung, wie er später erfahren wird. Nach fünf, sechs Jahren heiratet der Vater wieder, was Rudi freut, weil es mit dem Durcheinander zu Hause und mit dem Schuldenhaben vorbei ist. Aber die Stiefmutter, die eine Handstrickerei betreibt, hat ihn nicht lieb. Er soll ihr möglichst selten unter die Augen kommen. Oder brav sein und stillsitzen. Eine Tante, Schwester der leiblichen Mutter, ist Krankenschwester in Wien. Sooft sie im Urlaub nach Steyr kommt, bringt sie ihrem Neffen einen echten Lederball mit. Deswegen lassen ihn die älteren Buben auch mitspielen, auf einer Gstättn in der Fuchslucken, unterhalb der Ennsleite, die zur Stadt hin steil abfällt.
Dem Fleischhauer ein paar Häuser weiter schießt er einmal die Auslagenscheibe kaputt. Der ist zwar versichert, aber weil Familie Strittich nicht bei ihm einkauft, muß der Vater für den Schaden aufkommen. 70 Schilling, das ist die Arbeitslose für dreieinhalb Wochen und bedeutet einen Monat Hausarrest. Die Lehrerin Trauner in der Volksschule ist eine fanatische Schwarze. Drei Jahre hindurch hat er in Betragen einen Dreier. Sie lockt mit einer besseren Note für den Fall, daß er nicht länger bei den Roten Falken mitmacht. Auf den Tauschhandel läßt er sich nicht ein. Gemeinsam mit den anderen Buben von der Fuchsluckenpartie geht er zu Vorwärts. Mit acht debütiert er in der Jugendmannschaft, mit vierzehn in der Kampfmannschaft. 1936 beendet er die Hauptschule mit einem Vorzugszeugnis und beginnt eine Lehre als Bauschlosser in den Steyr-Werken.
Zuvor der Februaraufstand. Die Schutzbündler verschanzen sich auf der Ennsleite, vorn an der Rampe, in der Brucknerstraße, wo die Familie zur Miete wohnt. Als er zu Mittag von der Schule nach Hause kommt, hört er, sie haben einen Wachmann erschossen. Am Tabor gegenüber, jenseits der Enns, bringt das Bundesheer Feldhaubitzen in Stellung. Ein Geschoß trifft das Wohnhaus. Granateinschläge, Blindgänger, Maschinengewehrfeuer. Verletzte und Tote. Die Kinder sitzen im Keller, im Dunkeln, in der Kälte. Am übernächsten Tag, weiße Fahnen hängen an den Hausfassaden, marschiert die Heimwehr durch die Straßen, die Gewehrläufe drohend auf die geschlossenen Fenster gerichtet. Die Männer werden auf Schloß Lamberg getrieben, auch sein Vater, der nicht mitgekämpft hat. Es heißt, alle werden erschossen. Da rennen die Frauen und Kinder, erschreckt und schluchzend, hinterher. Nach ein paar Tagen wird der Vater entlassen.
Das Verbot aller sozialdemokratischen Organisationen trifft auch den Verband der Amateur-Fußballvereine Österreichs. Ein paar Wochen lang ruht der Spielbetrieb, ab Herbst macht Vorwärts in der Liga des Österreichischen Fußballbundes mit. Bis dahin haben es die oberösterreichischen Arbeitervereine abgelehnt, Sport mit Geldverdienen zu vermischen, und in einer eigenen Meisterschaft um den Pokal gespielt. Die politische Niederlage schmerzt Rudi weniger als das schreiende Unrecht, daß der bürgerliche Lokalrivale Amateure den angestammten Vorwärts-Platz zugesprochen erhält. Was die eigene Mannschaft betrifft, ändert sich kaum was; bis auf einen oder zwei sind die Mitspieler nach wie vor auf der Ennsleite daheim und sozialistisch gesinnt. Irgendwann in der Verbotszeit stänkert Rudi junge Männer an, die mit weißen Stutzen aufmarschieren und Nazilosungen brüllen. Nach ein paar Tagen oder Wochen passen sie ihn auf der Straße ab, schlagen ihn zusammen und schleppen ihn in ihr Versammlungslokal, wo er sich herauszureden versucht, schuld sei sein Übermut und er habe doch gar nichts gegen sie. Ihr Anführer Eigruber, der spätere Gauleiter von Oberdonau, läßt ihn laufen.
Er weiß noch, er ist am Abend des 11. März 1938 ins Biograph-Theater gegangen, einen Film anschauen, und als er gegen zehn rauskommt, ist der Stadtplatz gesteckt voll mit Leuten. Die Arme zum Hitlergruß hochgerissen. Endlich hat sein Vater wieder Arbeit, im Kugellagerwerk, in der Rüstungsproduktion. Der Katzenjammer kommt erst später. Im Jahr darauf, als Rudi ausgelernt hat, vermittelt ihn der Sektionsleiter von Amateure zur NSTG Graslitz. In der tschechischen Kleinstadt, die jetzt zum Reichsgau Sudetenland gehört, hat er zum ersten Mal nichts anderes zu tun, als Fußball zu spielen. Die Mannschaft wird Gaumeister und unterliegt in der Endrunde Rapid Wien. Als er nach Steyr zurückkehrt, wird er wegen unerlaubten Verlassens des Arbeitsplatzes drei Wochen lang eingesperrt. Er wäre ja in den Steyr-Werken dienstverpflichtet gewesen. Mit achtzehn soll er einrücken, wird aber irrtümlich als heimatverwendungsfähig eingestuft. Er kommt nach Wien, zur Bahnhofswache, die zu kontrollieren hat, ob die Wehrmachtssoldaten auf dem Perron und in der Halle einen Urlaubsschein bei sich tragen. An unangenehme Zwischenfälle vermag er sich nicht zu erinnern. Manchmal, sehr selten, hat einer keine Papiere, den liefert er dann im jeweiligen Wachzimmer ab. Ein Zubrot von sechs Reichsmark pro Aufführung verdient er sich als Statist in der Staatsoper. In der Tosca steht er mit einem Holzgewehr auf der Bühne, er wird zeit seines Lebens nie gezwungen sein, ein anderes, richtiges in die Hand zu nehmen. Im übrigen spielt er wieder Fußball.
Natürlich hat er schon früher versucht, bei einem Wiener Verein unterzukommen. Johann Luef, der Spielertrainer von Vorwärts und ehemalige Läufer des Wunderteams, hatte ihm einmal zugeredet: »Sie, gehen S’ zu Rapid, weil Ihre Spielweise paßt zu Rapid.« Er war nach Hütteldorf gefahren und hatte sich auf der Pfarrwiese einem Funktionär vorgestellt, der ihn kurz gemustert, dann weggeschickt hatte. »Kommen S’ ein anderes Mal, wenn die Jugendmannschaft trainiert.« Rudi probierte es noch bei Vienna, aber die hatte damals so viele gute Spieler, da sah er keine Chance, jemals in die Kampfmannschaft zu kommen. 1937 war er der Austria empfohlen worden. Er hatte mit den Profis trainieren dürfen und war mit Schulterklopfen weggeschickt worden. Jetzt, fünf Jahre später, fordert ihn NSTG Falkenau für das Hauptrundenspiel um den Tschammer-Pokal gegen Vienna an. Falkenau gewinnt 4:0. Nach dem Match redet ihn Fritz Gschweidl an, der Trainer der Vienna (und Rechtsverbinder des Wunderteams): »Hören S’, ich hab Sie doch einmal gesehen auf der Hohen Warte. Wollen Sie nicht bei uns spielen?« Eine Woche später tritt er zum ersten Mal für Vienna an, in einem Meisterschaftsspiel der Gauliga Ostmark. Nach drei, vier Spielen steht er schon in der Wiener Auswahl, die vor 90000 Zuschauern in Berlin 1:1 unentschieden spielt.
1942 bekommt er auch zum zweiten Mal den Einberufungsbefehl, als Soldat für die Ostfront. Er ist bereits einer Marschkompanie zugeteilt, als ihn ein Offizier aus der Reihe holt: »Strittich, Strittich … sind Sie nicht der Fußballer?«
»Nein«, sagt er vorsichtshalber, »das ist mein Bruder.«
»Tun S’ nicht lügen!«
Er wird nach Linz überstellt, dann auf zwei Jahre unabkömmlich geschrieben und in den Steyr-Werken beschäftigt, im Kugellagerwerk. Jetzt spielt er wieder für Vorwärts, das, kriegsbedingt, weil die meisten Stammspieler zur Wehrmacht eingezogen worden sind, mit Amateure zum FC Steyr fusioniert wird. In der Saison 1944/45, die nach sieben Runden abgebrochen wird, verlieren sie auswärts gegen Mauthausen, dessen Mannschaft sich fast ausschließlich aus Angehörigen des Wachpersonals zusammensetzt. Ein ungutes Gefühl nachher, bei der Bewirtung durch ausgemergelte Häftlinge. Beklemmung auch beim Rundgang durchs Konzentrationslager, das ihnen die Gastgeber stolz präsentieren. Zucht und Ordnung, Rudi schaut nicht richtig hin. Beim Rückspiel in Steyr will ein Scharführer aus Mauthausen den Schiedsrichter vom Platz weg verhaften, weil dieser nach einem Foul im Strafraum der Gästemannschaft auf Elfmeter entschieden hat. Wochen oder Monate später kommt ein amtliches Schreiben mit der Aufforderung, sich binnen Wochenfrist bei der SS in Graz einzufinden, zwecks Teilnahme am Endsieg. Rudi läuft damit zur Bezirksstelle des Wehrkreiskommandos, in der Johann Bloderer arbeitet, der Halbbruder des aus der Todeszelle geflüchteten Widerstandskämpfers. Bloderer nimmt das Schreiben, zerreißt es und steckt die Fetzen in die Jackentasche. Zwei Tage später ist der Krieg zu Ende. Beim Auftaktspiel gegen Bad Hall ist Rudi schon dabei.
Im Herbst 1945 kehrt er zur Vienna zurück. Offiziell arbeitet er als Bürodiener bei der Wiener Städtischen Versicherung. Ein Versorgungsposten, wie üblich für Halbprofis. Für Auswärtsspiele und Tourneen wird er freigestellt. Gschweidl stellt ihn an den rechten Flügel, neben Karl Decker, für den er lange nur »der Gscherte« ist. Bis ihm, bei einem Match in der Schweiz, der Kragen platzt. »Entweder der gewöhnt sich das ab, oder ich spiel nicht mehr weiter«, sagt er zu Gschweidl. Später verbringen Decker und er viel Zeit miteinander, auch ihre Frauen freunden sich an. Die Beziehung erkaltet erst, als Deckers Ehe zerbricht. Was Rudi damals, in der Schweiz, noch aufgefallen ist: daß Decker genug Geld hatte, um sich dort einen Anzug zu kaufen. Bis dahin hatte er in seiner Naivität angenommen, daß die Gage für alle gleich wäre.
Im Herbst 1946, beim 0:2 gegen Ungarn, steht er zum ersten Mal im A-Team der Nationalmannschaft. 1949 ist er beim 3:1 gegen die Tschechoslowakei und beim 5:2 gegen Jugoslawien dabei. Gegen Ungarn setzt es mit 3:4 erneut eine Niederlage. Auswärtsspiele sind bei den Spielern beliebt, man kann Waren über die Grenze schmuggeln, die auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen kosten, Seidenstrümpfe und Lippenstifte sind in Ungarn begehrt, an Salami, Speck, Käse fehlt es in Österreich. Als Vienna einmal in Budapest antritt, wird die Prämie in Naturalien ausgezahlt, drei Liter Öl, fünf Kilo Mehl, aber erst nach dem dritten Spiel und heftigen Protesten der Spieler.
Über seine Stärken redet er ungern. Es war halt ein Naturdrang in ihm. Kraft und Ausdauer, Schnelligkeit, ein gutes Auge und genaue Flanken. Im Länderspiel gegen die ČSR, fällt ihm ein, hat ihn, zehn Meter vor der Strafraumgrenze, der Verteidiger am Leiberl gehalten. Er ist trotzdem weitergelaufen, hat den andern mitgeschleppt, in den Strafraum hinein, was einen Elfmeter eingebracht hat. Er wurde oft abgeklopft. Eine Woche nach dem Match gegen Jugoslawien, im Spiel gegen Austria, trat ihm ein Verteidiger gegen das Knie, er mußte wegen einer Meniskusverletzung vom Feld getragen werden. Vienna hatte damals eine Spitzenmannschaft, mit Ferdl Schaffer in der Verteidigung, Ernst Sabeditsch als Läufer, Bruno Engelmeier im Tor, Karl Decker im Sturm. Decker war beidbeinig, schußsicher, im Dribbeln eine Klasse für sich. Sie waren »gut zusammengedreht«, also ist es weiters kein Wunder, daß Rudi viermal ins A-, sechsmal ins B-Team berufen wurde, trotz der Konkurrenz an Flügelstürmern vom Format eines Ernst Melchior, eines Robert Körner.
Die Teamkarriere endet, kaum daß sie begonnen hat, nach einer Nahosttournee der Vienna. Sabeditsch wird in Beirut 850 Gramm Rohopium angeboten, von bester Qualität, trotzdem spottbillig, und er fragt Rudi und Schaffer, ob sie sich am Geschäft beteiligen wollen. Ohne viel nachzudenken, sagen sie zu. In Wien versucht Sabeditsch, den Stoff in einem von Schleichhändlern frequentierten Café loszuwerden und gerät dabei an einen Konfidenten der Polizei.
»Nach einem halben Jahr«, sagt Rudi, »ist die Schmier vor meiner Tür gestanden.«
Er und Schaffer werden in einem Prozeß, der die Öffentlichkeit stark beschäftigt, zu drei Monaten Haft verurteilt, Sabeditsch zu fünf Monaten. Ein Bagatelldelikt, wie der Rechtsanwalt meint, die Sachverständigen stritten darüber, ob das Opium nicht doch hundsgewöhnlicher Mohn sei, normalerweise wäre die Anzeige nicht weiterverfolgt worden. Aber es handelt sich um bekannte Sportler, die ein Vorbild für die Jugend abgeben müssen, außerdem steht der Ruf des Fußballbundes auf dem Spiel, schon seit langem wird in den Zeitungen das Schmugglerunwesen bei Auslandsreisen angeprangert.
Die drei sitzen die Strafe im Gefangenenhaus Wiener Neustadt ab, werden für Außenarbeiten herangezogen, zum Umsägen von Bäumen, Anlegen von Blumenrabatten und dergleichen. Nach seiner Entlassung bleibt Rudi für ein Jahr gesperrt und arbeitet bei Triestina, unter Béla Gutmann, als Jugendtrainer. Der Klub will ihn als Spieler verpflichten, ist sogar bereit, die von Vienna geforderte Ablösesumme von 250000 Schilling zu bezahlen, aber der ÖFB beharrt auf seiner Sperre. Gerade da erreicht ihn eine Nachricht von Ernst Sabeditsch: »Rudi, ich hab ein Angebot aus Kolumbien. Fährst mit?« Er braucht nicht lange, um sich zu entscheiden. Dabei hat er sich in Triest wie zu Hause gefühlt, und mit Gutmann ist er gut ausgekommen. Aber Bananeros Santa Marta, das eigentlich Deportivo Samarios heißt und von Plantagenbesitzern finanziert wird, bietet ihm 5000Dollar Handgeld, das sind nach dem damaligen Wechselkurs immerhin 150000 Schilling. Der kolumbianische Fußballverband gehört der FIFA nicht an, die Sperre hat dort also keine Wirkung.
Nach vierzehn Tagen hat er sich an das feuchtheiße Klima an der Karibikküste gewöhnt. Dann läuft er zur Form seines Lebens auf. Man übersetzt ihm die Schlagzeile aus dem Heraldo: »Millonarios hat einen Di Stéfano, aber Santa Marta hat einen Strittich.« Die Mannschaft ist bunt zusammengewürfelt, außer ihm und Sabeditsch, der sich beim ersten Spiel den Knöchel bricht, hat Bananeros noch vier, fünf Ungarn und zwei Tschechen unter Vertrag genommen. Millonarios tritt überhaupt mit der halben argentinischen Nationalelf an, und Junior de Barranquilla hat sich mit Spielern aus Brasilien verstärkt. Sogar die Schiedsrichter sind Profis aus Großbritannien, unbestechlich, weil gut bezahlt. (Einem von ihnen, Sidney Donald Brower, widmet ein blutjunger Journalist namens García Márquez eine respektvoll-spöttische Glosse.) Die Heimspiele gegen Millonarios, die Meistermannschaft aus Bogotá, werden schon zu Mittag angepfiffen, in der Hoffnung, daß den Gästen aus dem Hochland die Hitze zu schaffen macht. Oben in der Hauptstadt, auf 2600 Meter Seehöhe, geht wiederum Rudi nach jedem Sprint die Luft aus. Freunde findet er in Santa Marta in der kleinen österreichischen Kolonie von jüdischen Emigranten, mit denen er am Ende der Saison auch Abschied feiert. Fast versäumt er die Abfahrt, im Hafen von Puerto Drummond wird schon der Steg eingeholt, mit einem Sprung schafft er es gerade noch, an Deck zu kommen. Zwei Wochen später geht der Frachter in Hamburg vor Anker.
Im Ruderleibchen, zwei Bananenbüschel geschultert, die Reisetasche in der Hand, trifft Rudi an einem trüben Novembermorgen im Wiener Westbahnhof ein. Er erfährt, daß er immer noch gesperrt ist, weil ihm der Österreichische Fußballbund die in Kolumbien verbrachte Zeit nicht angerechnet hat, und nimmt ein Angebot aus Zürich an, wo er in einer Fabrik arbeitet und in der Freizeit die Jugendmannschaft von Young Fellows trainiert. Bei seiner Rückkehr überredet ihn Joschi Walter, wieder bei Vienna zu spielen. Nach einem halben Jahr wird er um 250000 Schilling an Besançon RC verkauft. Kaum angekommen, erleidet er einen Bandscheibenvorfall und kann nur noch auf Krücken gehen. Der Klubpräsident, ein frommer Mann, schickt ihn auf Wallfahrt, in ein Kloster, beten. In Lyon wird er operiert, erfolgreich, aber nach einem Monat oder zwei wiederholt sich der Vorfall, worauf ihn der französische Klub vorzeitig entläßt. Er absolviert einen Trainerkurs und übernimmt, 1955, die Mannschaft von Sturm Graz. In Graz der dritte Bandscheibenvorfall. Die zweite Operation. Er zweifelt daran, ob er überhaupt noch als Trainer arbeiten kann.
Überrascht, ja schockiert war er vom niedrigen Niveau der zukünftigen Trainer: Es gab nur drei oder vier Kursteilnehmer, die sich mündlich wie schriftlich halbwegs verständlich ausdrücken konnten. Er hat ein gutes Zeugnis bekommen, und er glaubt in aller Bescheidenheit auch, daß er ein guter Trainer gewesen ist. Er hat viel gesehen: »Von jedem Trainer kannst du was lernen. Und du mußt die Besonderheit eines Spielers erkennen. Wissen, wie du mit jedem einzelnen umzugehen hast.« Menschlich, ohne Arroganz, nicht ungehobelt wie der Schreihals Max Merkel, der sich nur deshalb behaupten konnte, weil den Deutschen die Hitlerzeit noch in den Gliedern steckte. Béla Gutmann, Ernst Happel: klasse Burschen. Sympathisch auch der ruhige, bescheidene Leopold Štastný, der ihn einmal angesprochen hat: »Herr Strittich, wir haben vor vielen Jahren gegeneinander gespielt, können Sie sich erinnern?« (Städteturnier Preßburg gegen Wien, Štastný linker Verteidiger der einen, Rudi Rechtsaußen der anderen Mannschaft.)
Die zweite Station als Trainer, von Walter Nausch vermittelt, ist der FC Basel. Er hat sich dort nicht besonders wohl gefühlt. Die Schweizer, sagt er, sind ja irgendwie eigen. Eingebildet, erhaben, ohne Schmäh. »Seien Sie froh, daß Sie bei uns sein dürfen.« In Griechenland, bei Apollon Kalamaria, hat er das keinen sagen hören. Wenn er am Ende der Saison Saloniki verließ, dann nicht deshalb, weil der Verein mit ihm oder er mit der Mannschaft unzufrieden gewesen wäre, sondern weil die Klubkasse leer war. »Ich hab immer nur Klubs erwischt, die kein Geld hatten.« Zum Beispiel, Jahrzehnte später, Real Murcia, das damals in der Zweiten spanischen Division gespielt hat. Als Trainer war man immerhin in der Lage einzufordern, was einem zustand. Aber die Spieler waren arm dran. In Murcia haben sie sich vor jedem Spiel den Bauch vollgeschlagen. »Ich konnte es ihnen nicht verbieten, sie waren einfach hungrig.« Auch haben ihn welche angefleht, sie aufzustellen, wegen der Prämie, damit sie finanziell über die Runden kommen. Ansonsten war er in Murcia nicht unzufrieden. Zum Übersetzen stellte man einen Schüler für ihn ab, betreut wurde er von einer Familie, die sich um ihn wie um den eigenen Sohn gekümmert hat. Neu für ihn war, daß nach jedem Tor, mitten im Spiel, sofort drei, vier Journalisten auf ihn zugestürzt kamen, um seine Meinung einzuholen.
In Dänemark ist er heute noch unvergessen. Die Ära Strittich, die zwanzig Jahre gedauert hat, beginnt und endet in Esbjerg, einer Hafenstadt im Jütland, in der die meisten Leute außer dänisch auch deutsch sprechen, was die Verständigung von Anfang an leichtgemacht hat. Dazwischen Aalborg BK, ein großer Verein, und Viborg FF, ein kleiner. Und natürlich das Nationalteam, sechs Jahre lang. Den Esbjerg fB hat er viermal zum Meistertitel geführt. Er rechnet sich das nicht als Verdienst an, er hat halt gut reingepaßt. Verblüfft war er nur im ersten Moment, weil ihn gleich alle geduzt haben, die Vorstandsmitglieder, die Spieler, die Spielerfrauen und die Leute auf der Straße. Er hatte sofort einen guten Draht zu ihnen, ist mit ihnen Ski gefahren und hat sie zu Weihnachten oder am Ende der Saison mit Uhren beschenkt. Im Training wollten die Spieler immer noch eine Übung anhängen, obwohl sie reine Amateure waren und keinen Groschen bekamen. Es war selbstverständlich, daß auch ihre Frauen und Kinder Zutritt zum Klubhaus hatten. Dort haben sie Skat gespielt, sich miteinander unterhalten, wehe, wenn er ihnen das Trinken verboten hätte. Nach jedem Match wurde eine Kiste Bier hereingeschleppt. Als Nationaltrainer stand er vor dem Problem, daß alle Spieler einem Beruf nachgingen. Er konnte nie länger mit ihnen arbeiten, bekam sie erst kurz vor einem Spiel zu Gesicht. Außerdem war ihnen Treue wichtiger als Karriere. Kaum einer opferte dem Ehrgeiz, um den Titel mitzuspielen, die Verbundenheit mit seinem angestammten Verein. Da war es nur logisch, daß er sogar Spieler aus der Dritten Liga in die Mannschaft gestellt hat. Immerhin ist es ihm gelungen, einen dritten Trainingstag einzuführen. Bis dahin wurde nur zweimal pro Woche trainiert. Gegen den Beschluß des dänischen Verbands, am Amateurstatus streng festzuhalten, hat er hingegen nichts ausrichten können. Spieler, die als Profis ins Ausland gingen, wurden automatisch für die Nationalmannschaft gesperrt, blieben es sogar noch in den ersten zwei Jahren nach ihrer Rückkehr nach Dänemark. Erst angesichts der Niederlagen im Europacup dämmerte den Vorstandsmitgliedern, daß eine Umstellung angebracht wäre. Als das Verbot, Geld anzunehmen, schließlich aufgehoben wurde, war er nicht mehr im Land. Aber seine beste Zeit hat er zweifellos dort verlebt, wo er wenig verdient, vieles erreicht hat, zwanzig Siege, elf Unentschieden mit dem Nationalteam und die Endrunde bei den Olympischen Spielen in München, in der sie Brasilien ausgeschaltet haben, die Dänen liegen ihm einfach mehr als die Österreicher, sie sind offener, aufrichtiger, nicht zufällig war er ja auch in zweiter Ehe, siebzehn Jahre lang, mit einer Dänin verheiratet, und sie sind nicht im Unfrieden auseinandergegangen, sondern hauptsächlich deshalb, weil sie nicht in Österreich leben wollte und ihn alles hierher zurückgezogen hat. Nach Steyr, obwohl gerade Vorwärts sich ihm gegenüber einigermaßen schäbig benommen hat.
Noch während er die dänische Nationalmannschaft betreut hatte, war ihm der Posten des österreichischen Teamchefs angeboten worden. Er hatte die Einladung ausgeschlagen, wegen der Intriganten und Wichtigtuer hierzulande. Als er dann doch, 1980, einen Trainerposten in Österreich übernahm, bei Austria Salzburg, bereute er bald seine Entscheidung. Er wurde nach 105 Tagen gefeuert, mangels Erfolg, eigentlich deshalb, weil er die dänischen Verhältnisse verinnerlicht hatte. Aber die Einstellung der Spieler in Salzburg war grundverschieden, sie brauchten nicht einen Trainer, sondern einen Peitschenknaller, der er nie gewesen ist. Ein paar Jahre später bekam er noch einmal zu spüren, was es heißt, in Österreich Trainer zu sein. Von einem Freund, der bei SK Enns Sektionsleiter war, ließ er sich überreden, den Verein zu übernehmen. Am ersten Trainingstag kamen zwanzig Zuschauer. Am zweiten zehn. Am dritten ein Vater, um sich bei ihm zu beschweren: »Warum haben Sie meinen Sohn nicht aufgestellt?« Beim ersten Match saß er auf der Betreuerbank und hörte, wie einer hinter ihm sagte: »Da ist er ja, der alte Tepp.« Nach drei Monaten hat er aufgehört.
Trainieren oder spielen? »Spielen ist schöner. Hast ja keine Verantwortung. Spielst einmal schlecht, na gut, wirst das nächste Mal nicht aufgestellt. Aber wenn 20000 Zuschauer schreien: ›Hauts ihn aussi, den Strittich!‹, dann brauchst eine dicke Haut. Schuld geben sie immer dem Trainer. Ja, solange du Erfolg hast, ist es schön, Trainer zu sein.«
Er hat einiges von der Welt gesehen. Mit Vienna hat er in vielen Ländern und auf mehreren Kontinenten, sogar in Uruguay und in Brasilien, gastiert. »Eines muß ich aber schon sagen: Ich hab mir kein Museum von innen angeschaut. Weil wir waren immer zusammen, die Haberer und ich, und haben uns lieber irgendwo ein Viertel Wein gekauft.«
Der ewigen Debatte, ob früher besser oder schlechter Fußball gespielt wurde, kann er nichts abgewinnen. Heute