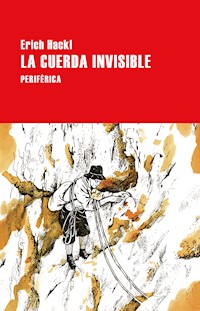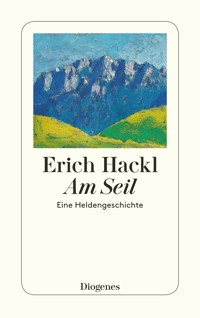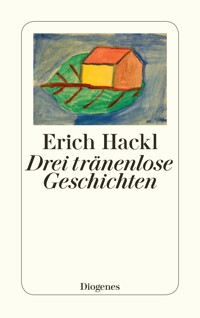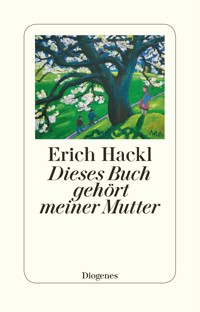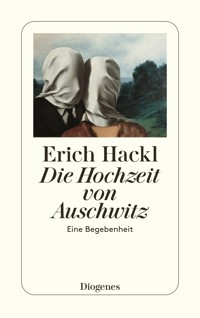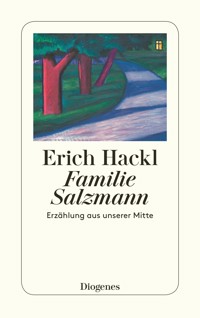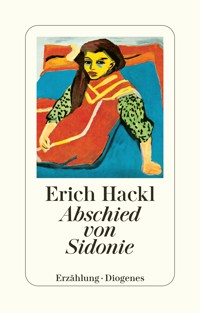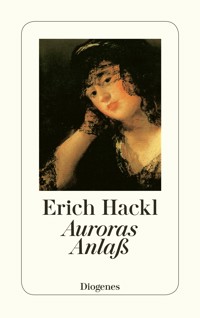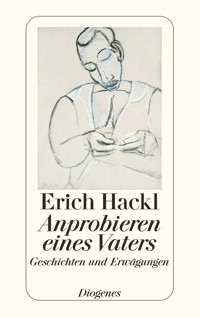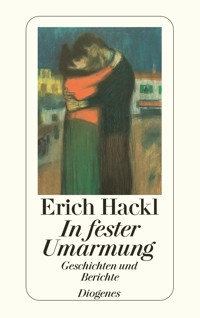
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten und Berichte: über ein Gelage und über die Winde, die dabei entschlüpfen; über Liebesbriefsteller und ihren zweifelhaften Nutzen; über die Entdeckung der Stadt Schleich-di; über die Wiederkehr des Che Guevara; über Gedichte einer Frau, die immer alles gewußt hat, und über Gedichte einer Frau, die sich nie überschätzt hat; immer wieder über Menschen, denen der Autor zugetan ist – ›in fester Umarmung‹.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Erich Hackl
In fester Umarmung
Geschichten und Berichte
Die Erstausgabe
erschien 1996 im Diogenes Verlag
Nachweis am Schluß des Bandes
Umschlagillustration: Pablo Picasso,
›Liebespaar auf der Straße‹,
1900 (Ausschnitt)
Copyright © 2012 ProLitteris, Zürich;
Succession Picasso, Paris
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23357 5 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60241 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
Gedenkblätter[7]
Kleine Stadt der Arbeitslosen [9]
Statt eines Ehrensaluts [24]
Herr Meisel und seine Söhne [40]
Verhinderte Heimkehr [58]
50 Jahre und ein Tag [67]
Stille Post für Spanien [79]
Führungszeugnisse[113]
Sommer in Madrid [115]
Die eisigen Weiten Alaskas [121]
Ein Nobelpreisträger, wie er Hexen jagt [132]
Im Dickicht der Einsamkeit [140]
Glückliches Guatemala! [153]
Mit und ohne Reue [173]
Sittenbilder[185]
Kurzgefaßter Bericht von der Entdeckung, Erkundung und freiwilligen Preisgabe der Stadt Schleich-di [187]
Das mitteleuropäische Abendmahl [209]
In der Republik des Geistes [218]
Alle Bücher meines Lebens [222]
[6] Liebeserklärungen[237]
In fester Umarmung [239]
Gedichte einer Frau, die immer alles gewußt hat [250]
Lauter Helden. Kein Engel [261]
Das Alphabet nach Henriette Haill [274]
[7] Gedenkblätter
[9] Kleine Stadt der Arbeitslosen
1. Ein möglicher Anfang
wäre, befänden wir uns noch in den dreißiger Jahren, und in Hollywood, die romantische Version vom Ende des Werksdirektors Herbst: Eine schwarze Limousine, ein Steyr 30 (6 Zylinder, 40 PS), fährt vom Direktionsgebäude auf das Werkstor zu; wir sehen sie durch das Fenster der Portierloge näher kommen, ein verschneites Wiesenstück im Hintergrund, unter den Rädern bricht das Eis gefrorener Pfützen. Vor den geschlossenen Schranken stoppt das Fahrzeug, der Lenker wirft einen prüfenden Blick herein, da erst sehen wir auf dem Boden den Pförtner liegen, vielleicht ein grauhaariger hagerer Mann mit scharfer Nase. Er zappelt, ist an Händen und Füßen gefesselt, um den Mund hat man ihm einen schmutzigen Lappen gebunden. Jetzt wird der Fahrer mißtrauisch, aber da tauchen sieben maskierte Gestalten neben dem Pförtnerhäuschen auf, zwei von ihnen springen blitzschnell hinter die Limousine, schießen mit Karabinern durch die Heckscheibe, die Projektile zerfetzen die ledergepolsterten Sitze, töten den großen, schweren, bleichen Mann.
Oder aber die Wirklichkeit war nüchterner, logischer [10] als der Bericht der Steyrer Zeitung, das Ergebnis freilich dasselbe: Als Direktor Herbst wie jeden Morgen kurz nach acht im Werk eintrifft, haben in Linz »die Vertragsverhandlungen begonnen« (Waffensuche der Polizei, Widerstand des Republikanischen Schutzbundes). Arbeiter aus St. Valentin oder Herzograd, die täglich herüberfahren, im Sommer mit dem Fahrrad, jetzt, im Winter, mit der Bahn, könnten die Nachricht als erste mitgebracht haben: Drüben wird geschossen. Dann, um halb acht, der Anruf, der das Gerücht zur Gewißheit werden läßt: die vereinbarte Parole und, als bräuchte es die Bestätigung, Schüsse im Hintergrund. Der Obmann, August Moser, am vorigen Tag noch bei Bernaschek, ruft die Betriebsräte zusammen; der Streik wird beschlossen. Die Arbeiter verlassen das Werk. Direktor Herbst hat sich seit seinem Eintreffen nicht mehr blicken lassen, versucht aber zu telefonieren. Das Mädchen in der Vermittlung ist nervös: Der Direktor ruft mich an! Na und, könnte der Schutzbündler sagen, der das Gebäude besetzt hält: Jetzt wird nicht mehr geredet.
Gegen Mittag verläßt Herbst ungehindert das Büro. Er steigt in sein Auto, um nach Hause zu fahren. Die Porsche-Villa, die er seit seiner Übersiedlung aus Wiener Neustadt bewohnt, liegt einen Kilometer oberhalb des Werksgeländes. Würde Herbst die kürzeste, und übliche, Route wählen, geriete er nicht in das Schußfeld. Aber er fährt, als wolle er die Arbeiter noch einmal demütigen, durch das Haupttor direkt in die Gefahrenzone. Vor der [11] Werkseinfahrt wird er erschossen. Im Leergang läuft der Motor weiter, bis der Treibstoff verbraucht ist: einen Tag und eine Nacht.
So beginnt der 12. Februar 1934.
2. Marktpreise
Direktor Herbst war nicht beliebt. Als man ihn auf die Not der Arbeiter ansprach, soll er geantwortet haben: Solange bei denen da oben noch Blumen vor den Häusern wachsen statt Kartoffeln, geht es ihnen nicht schlecht.
Von denen da oben kamen die Schüsse: von der Ennsleite, einer im Norden und Nordwesten steil abfallenden Terrasse am rechten Ufer der Enns, durch den Fluß von der Altstadt getrennt. Die Ennsleite ist ein Arbeiterviertel, ihre Sozialbauten, hart an den Rand der Rampe gebaut und weithin sichtbar, waren der Stolz der Sozialdemokraten. Hinter ihnen standen die Baracken; Vizebürgermeister Azwanger, Fürsorgereferent der Stadt, hatte dem jungen, zum Pathos neigenden Journalisten Ernst Fischer erzählt, wie sich da leben ließ: »In zwei Betten schlafen sieben Menschen; diese Betten bestehen aus aufeinandergetürmten Kisten. Durch eine Wand sikkert ununterbrochen Flüssigkeit; um die nassen Flecken nicht länger sehen zu müssen, verhüllte die Frau sie mit einer Wanddecke. Auf diese Decke hatte sie einen Spruch gestickt: ›Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.‹«
[12] Am 7. Februar veröffentlichte das Steyrer Tagblatt die neueste Statistik beschäftigungsloser Unterstützungsempfänger. Demnach erhielten im Jänner 1934 1271 Personen Arbeitslosengeld, 4969 Personen Notstandshilfe. In den Steyr-Werken, die noch 1929 sechstausend Beschäftigte aufwiesen, arbeiteten Anfang 1934 tausend Personen. Steyr hatte 22000 Einwohner, von denen in einem Jahr, 1932, 17770 öffentliche Hilfe in Anspruch nehmen mußten. 1934 veranschlagte die Gemeinde die Hälfte aller Einnahmen für Fürsorgezwecke. Hatte ein Arbeitsloser das zusätzliche Unglück, ein arbeitsloses Kind in der Familie erhalten zu müssen, so bekam er dafür einen Zuschuß von 20 Groschen. Das reichte, halten wir uns an die Steyrer Marktpreise vom 8. Februar, für ein halbes Kilo Kohl oder zwei bis drei Äpfel.
Zweimal die Woche kamen die Bauern in die Stadt. Den Arbeitslosen lief das Wasser im Mund zusammen, wenn sie die vollen Butterstriezel sahen, die saftigen Birnen, die abgebalgten Hasen. Vollbeladen, wie sie gekommen waren, fuhren die Karren wieder aufs Land.
Man sei hinaus fechten, das heißt, betteln, gegangen, sei froh gewesen, wenn man gegen Kost arbeiten durfte, ältere, unversorgte Frauen hätten sich bei Bauern als Schneiderinnen durchgebracht, andere, Schlosser, Werkzeugmacher, Tischler, seien als Pfuscher willkommen gewesen, die kleinen Bauern hätten sich ja auch nichts mehr leisten können, nur zum Essen sei immer was auf dem Tisch gestanden. Wenn in der Stadt einmal [13] Fleisch gekocht wurde, habe man Türen und Fenster geschlossen, um die Nachbarn nicht mit dem Geruch zu peinigen. Und jene, die damals noch Arbeit hatten, schauten sich erst einmal um, bevor sie im Wirtshaus eine Halbe Most bestellten, die Blicke von Arbeitslosen, die sich in der Gaststube bloß aufwärmten, seien unangenehm gewesen, da ist man lieber wieder gegangen. Um wenigstens Ordnung in die Not zu bringen, habe man dann einen Betteltag einführen müssen, das sei der Freitag gewesen.
Ganz schlimm wurde es im Winter, als die Saisonarbeit ein Ende hatte, da zogen die Leute mit Leiterwagen fünfzehn, zwanzig Kilometer weit vor die Stadt, um Brennholz zu sammeln. Am Vorwärts-Platz, wo zum Eislaufen aufgespritzt wurde, standen die Arbeitslosen Schlange; nur die ersten durften mit Eisentrümmern die Wellen, die der Wind ins Eis blies, begradigen. In den Schulen gab es oft nichts mehr zu heizen, glücklich, wer das Kind eines Arztes oder eines höheren Beamten zum Mitschüler hatte, dessen Vater spendete vielleicht Kohlen. In der Apotheke beim Bahnhof bettelten die Kinder von der Ennsleite um Medikamente für ihre kranken Eltern.
Für arbeitslose Burschen richtete die Stadt einen freiwilligen Arbeitsdienst ein. Essen und Trinken und die Pritsche seien gratis gewesen, außerdem habe man in der Woche 25 Groschen bekommen. Das Lager sei neben der Kaserne gelegen, so habe einer der Jungen, arbeitslos seit [14] dem Tag des Lehrabschlusses, von der anderen Seite der Planken die Befehle gehört.
Am 12. Februar gegen Mittag.
Erste Kompanie rauf auf die Ennsleite. Zweite Kompanie Stadtplatz sichern. Dritte Kompanie Schloß Vogelsang besetzen.
3. Rot und Schwarz
Die erste Kompanie lag bald im Straßengraben. Als die Soldaten gegen 13 Uhr unter dem Viadukt der Damberggasse auftauchten, über die man auf die Ennsleite zu gelangen hoffte, gab Hauptmann Fasching, ein stadtbekannter Haudegen, den Befehl zum Sturmangriff. Bevor die Truppe seiner Anordnung nachkommen konnte, hatte das Bundesheer sechs Verletzte. Faschings Hand, eben noch kühn zum Signal in die Höhe gestreckt, war durchschossen. Der Sturmangriff wurde verschoben.
Die zweite Kompanie konnte den Stadtplatz ohne Gegenwehr besetzen. Unangenehm war der Marsch durch die enge, abschüssige Gleinker Gasse, die von der Kaserne in die Altstadt führte. Einer, der mit Sturmgewehr, Stahlhelm und Tornister dabei war, wurde mit Abfällen, Steinen, altem Geschirr beworfen. Auch heißes Wasser hat man aus den Fenstern geschüttet. Das ist natürlich zu weit gegangen. Da hat man hinaufgeschossen.
Als Soldat habe man in Steyr früher genug [15] mitgemacht. Wenn man bei Zusammenrottungen gegen die Demonstranten mit aufgepflanztem Bajonett vorging, vorgehen mußte, sei man bespuckt worden, von oben bis unten bespuckt! Beinahe jedes freie Wochenende sei mit Waffensuchen draufgegangen, am schlimmsten habe man den Einsatz im Volkskino empfunden, wo jedes Jahr im Herbst die Kohlen umgeschaufelt wurden. Nichts habe man gefunden, rußgeschwärzt sei man unter dem Gelächter der Passanten wieder abmarschiert, zurück in die Kaserne. In Uniform sei man ungern ausgegangen, viele Gasthäuser habe man laut Dienstanweisung meiden müssen. Aber man sei, ein paar starke Burschen, doch hineingegangen, sei angestänkert worden und habe zurückgestänkert. Natürlich sei man politisch rechts gestanden, sonst wäre man gar nicht genommen worden; der Feind, so wurde einem gelehrt, steht links. Aber man habe nicht gezielt auf Menschen geschossen, auch wenn es später hieß, ihr seids Arbeitermörder, man habe große Angst ausgestanden, ehe, in der Nacht, ein Zug der Feldhaubitzenbatterie aus Enns und, am nächsten Vormittag, das motorisierte Feldjägerbataillon zu Rad aus Stockerau eintrafen. Ein paar, Alte, die schon bei der Volkswehr dabei waren, hätten sich geweigert, auf Arbeiter zu schießen.
Der Aufstand sei zu spät erfolgt, er, der ausgelernte, arbeitslose Werkzeugmacher, habe von seinem Bruder, der beim Bundesheer war, schon viel früher zu hören bekommen: Von uns könnt ihr nichts erwarten. Schon 1933 [16] wäre es zu spät gewesen. Und die Jungen hätten wieder und wieder gesagt, wann machts denn endlich was. Immer mehr Waffen seien weggekommen und immer mehr Rechte seien ihnen genommen worden, und nichts sei geschehen. Im Oktober 1933 habe Otto Bauer die Steyrer Vertrauensmänner beruhigen wollen: Wenn Dollfuß unsere Partei auflöst, dann schlagen wir los. Worauf einer aus Unterhimmel hinausschrie (so steht’s im Flugblatt der Nazis), dann seid ihr aber sicher nicht mehr in Wien! Die Erhebung sei auch nur spontan erfolgt, die Bahn habe nicht gestreikt, es sei ein taktischer Fehler gewesen, daß immer mehr Schutzbündler aus anderen Stadtteilen und aus der Umgebung auf der Ennsleite eintrafen, so daß man hier oben wie in einer Mausefalle saß.
4. Helden und Tode
Als Mausefalle empfindet sie auch ein arbeitsloser Verkäufer, der jeden Montag bei einer Eisenbahnerfamilie zum Essen eingeladen ist. Auch am 12. Februar steigt er am späten Vormittag zur Ennsleite hinauf, um rechtzeitig zu Mittag dazusein. Ich hab mich noch gewundert, daß die Arbeiter so früh aus dem Werk kommen, Schichtwechsel war ja erst um zwölf. Kaum sitzt er bei Tisch, da geht draußen die Schießerei los. Ein Drunter und Drüber, Männer laufen mit Gewehren vorüber, Leitern und Munitionskisten werden getragen, sogar den [17] Bürgermeister Sichlrader sieht er mit Plänen herumgehen.
Nach dem Essen lassen ihn die Schutzbündler nicht mehr in die Stadt hinunter. Mit seinem Hut wird er noch dazu für einen Hahnenschwänzler gehalten. Ich war ja nie nirgends dabei. Wenigstens diesen Verdacht können seine Gastgeber zerstreuen. Die Schießerei, das Knattern der Maschinengewehre hört erst gegen Abend auf. Strenge Verdunkelung. Auch von der Stadt herauf kein Licht. Im Kinderheim soll ein Wachmann mit einem Lungendurchschuß liegen. Tote in den Straßen.
In der Dunkelheit probiert er noch einmal, von der Ennsleite wegzukommen. Die Posten vorn an der Stiege lachen ihn aus. Weit wirst nicht kommen. Unten blitzt es auf, eine Kugel pfeift vorbei, da bleibt er lieber, wo er ist. Gegen drei Uhr früh hebt es ihn, in der Wohnung seiner Gastgeber, präzis einen halben Meter hoch von der Couch: die Ennser Artillerie beginnt sich einzuschießen.
Während des Tages konnte die Steyrer Garnison auf dem Tabor, einer der Ennsleite gegenüberliegenden, die Altstadt gleichfalls überragenden Plattform, wenig ausrichten. Die Zufahrten hatten die Arbeiter mit umgeschnittenen Bäumen verlegt, ein Angriff über den vereisten Steilhang (am Nachmittag begann es zu regnen, um Mitternacht zog es an) wäre aussichtslos gewesen. Gefährlich aber war die Maschinengewehrstellung der Polizei auf dem Turm von Schloß Lamberg.
[18] Neben einem arbeitslosen Jungordner erwischt es den Nachbarn aus demselben Haus in der Victor-Adler-Straße: Durchschuß mit Rückenmarksverletzung. Als der Bursch zwischendurch nach Hause geht, essen müsse man ja schließlich auch einmal, schaut er in die Nachbarwohnung. Der Verwundete klagt, unter zwei, drei Tuchenten, über so große Kälte. Wegen dem hohen Blutverlust habe der so gefroren. Ein paar Monate später sei er an den Folgen der Verletzung gestorben.
Andere sterben sofort, bei Volltreffern der Feldhaubitzen, obwohl den Geschossen, wie die Exekutive betont, die Zünder entfernt wurden. Einer wird erschossen, als er sich, nach dem Ende der Kampfhandlungen, bei offenem Fenster rasiert. Ein Heimwehrmann tötet den Gehörlosen, weil er dem Befehl, alle Fenster zu schließen, nicht nachkommt.
Am Faschingsdienstag, zehn Uhr vormittags, wird den Aufständischen ein Ultimatum gestellt: entweder ergeben sie sich, oder die Ennsleite wird dem Erdboden gleichgemacht.
Wir ergeben uns nicht.
5. Angst?
Da sei nur Verzweiflung gewesen und Wut.
Er habe nur einen Gedanken gehabt: Wir müssen siegen, und wir werden siegen.
[19] Natürlich. Um den Vater. Nur um ihn. Daß die Arbeiterklasse siegt, habe man ihr ja immer gesagt.
Es war keine Zeit, an so was zu denken.
Ganz ehrlich: Nein, keinen Augenblick lang.
Da ist nur gezittert worden.
Am Anfang nicht. Aber wie dann das Radio immer nur so dumm geredet hat und Militär gekommen ist…
6. Einbruch der Ordnung
Zu Mittag wird auf der Ennsleite die Munition knapp. Aus manchen Fenstern hängen schon weiße Fahnen. Um drei teilt Betriebsratsobmann Moser mit, daß die Verteidigung aufgegeben werden muß. Die Männer sollen ihre Waffen gebrauchsunfähig machen, dann wegwerfen. Die der Exekutive bekannt sind oder leitende Funktionen innehaben, mögen sich verstecken oder fliehen, in die Raming hinein oder auf den Damberg. Die anderen sollen alles abstreiten, die Geflüchteten belasten und die Gefallenen. Denen würde es nicht mehr weh tun.
Erst nach dem Bundesheer seien die Heimwehren gekommen, die, traut man einem Flugblatt, »so selbstlos sind und treu, / die bei den Sturmangriffen hint’ sind / und beim Plündern vorn dabei«. Vorn dabei ist auch Bundesführer Fürst Starhemberg. 1929 ließ er, bei einer Heimwehrfeier in Weyer, »den roten Führern gesagt sein, daß wir nicht zum letzten Mal in Steyr waren, wir [20] werden wieder kommen«. In seinen Memoiren erinnert er sich freilich nur mehr an »zumeist sympathische jüngere Leute, die alle etwas blaß und übernächtig aussahen«. Er habe sich sogar veranlaßt gesehen, einem seiner Leute, der einen Schutzbündler mit dem Gewehrkolben schlägt, eine gar nicht fürstliche, weil knallende Ohrfeige zu geben.
800 Gefangene werden mangels anderer Unterkünfte in die Stallungen von Schloß Lamberg getrieben, später auf zu Gefängnissen umfunktionierte Schulen, Kantinen und Fabrikshallen aufgeteilt. Vereinzelt hört man auch in den nächsten Tagen noch schießen. Aber es herrscht Ordnung.
7. Die Henkersmahlzeit
bestand aus einem Schweinsschnitzel und zwei Flaschen Bier. Der Delinquent, welcher h. a. als äußerst radikaler Schutzbündler bekannt ist, verzehrte es mit allem Appetit und rauchte bis zum Ablauf der dreistündigen Frist. Geistlichen Beistand lehnte er ab, obwohl ihm der Gefangenenhausseelsorger in gütigen Worten zusprach. Um 23 Uhr 28 Minuten wurde die Exekution von einem Landwirt, der sich freiwillig als Scharfrichter gemeldet hatte, vollzogen. Es läutete die Armensünderglocke. Im Hof des Kreisgerichtes hatte eine kleine Abteilung Militär Aufstellung genommen. Ohne jedes Zeichen von [21] Erregung trat der Delinquent unter den Galgen. Der Gerichtsarzt stellte um 23 Uhr 45 Minuten den Eintritt des Todes fest.
Das war am 17. Februar.
Ewig schade sei es um den Buben. Er, der arbeitslose Maurer aus dem nahen Sierning (immer ein schwarzes Nest gewesen), war dabei. Die Wärter hätten sie gezwungen, sich während der Hinrichtung auf den Boden zu legen. Vor seinem Tod habe Ahrer noch die Arbeiterklasse hochleben lassen.
Josef Ahrer, am 30. 8. 1908 geboren, ledig, Bauschlosser in Steyr, arbeitslos, ist schuldig, am 12. Februar 1934 in Steyr gegen Johann Zehetner und Josefine Nagelseder, in der Absicht sie zu töten, durch Abgabe von Pistolenschüssen auf eine solche Art gehandelt zu haben, daß daraus der Tod des Johann Zehetner und der Josefine Nagelseder erfolgte; er hat hierdurch das Verbrechen des Mordes begangen und wird zur Strafe des Todes durch den Strang und zum Ersatze der Kosten des Strafverfahrens verurteilt.
Bis heute halten sich Gerüchte, daß Ahrer unschuldig gehängt wurde. Angeblich war er zum Zeitpunkt des Vorfalls, in einer Baracke der Ennsleite, mit einem Gewehr bewaffnet, der Heimwehrmann Zehetner und dessen Freundin starben aber an Pistolenschüssen; in einem anonymen Schreiben an den »werten Herrn Polizeirat« von Steyr wurde behauptet, daß Ahrer für einen Familienvater mit fünf Kindern die Tat auf sich genommen [22] hat. Viele weisen darauf hin, daß einer gehenkt werden mußte. Zur Abschreckung. Da habe es eben in Ermangelung anderer Ahrer getroffen.
Die Urnen der toten Schutzbündler (Mitglieder des Bestattungsvereins »Die Flamme« ) durften nicht öffentlich verabschiedet werden. Die Leichen seien vor ihrer Einäscherung in einem Schuppen gelegen. Die Särge seien offen gestanden. Man habe die Pumphosen der Toten heraushängen sehen. Das sei kein schöner Anblick gewesen.
8. Sightseeing
Viele Besucher in Steyr. Der gestrige Sonntag wurde vor allem von der Bewohnerschaft der Umgebung Steyrs zu einem Besuch benützt, wo man in erster Linie den Kampfplatz, die Ennsleite, besichtigte. Auf der Ennsleite war manchmal alles schwarz von Menschen; auch die Steyrer selbst begaben sich, soweit sie dazu noch nicht in die Lage gekommen waren, auf die Ennsleite, um die Schäden zu besichtigen. Sehr angenehm wurde empfunden, daß die Verfügung des Standrechtes über die Sperre der Gasthäuser ab Sonntag bereits gelockert und bis 10 Uhr erstreckt wurde. Die Gasthäuser waren von Auswärtigen und Einheimischen sehr gut besucht.
[23] 9. Postskriptum: Anschluß an den Zeitgeist
[24] Statt eines Ehrensaluts
Wie Víctor Deutsch lernte
Am ersten Tag im Steinbruch sagte der Kapo zu ihm: Du Trottel, gib mir die Schaufel. Víctor kannte das Wort Trottel nicht, und er wußte auch nicht, was Schaufel bedeutete. Er blickte um sich, sah eine Büchse und brachte sie dem Mann. Du Trottel, wiederholte der andere und stieß ihm die Faust in den Rücken, das ist eine Blechdose. Ich hab dir gesagt, bring mir die Schaufel. Víctor sah sich wieder um, griff nach einem Krampen, reichte ihn dem Kapo. Der zog ihm mit dem Stiel eins über den Schädel. Du Trottel, das ist ein Krampen. Die Schaufel sollst du mir bringen.
So lernte Víctor den Grundwortschatz der deutschen Sprache.
Wie Pedro an einem Mittwoch leugnete, daß Sonntag sei
Als sich Pedro vom Urlaub zurückmeldete, wurde ihm beschieden, er möge sich etwas gedulden. Eine reine Formsache.
[25] Viel später sollte Pedro erfahren, daß während seiner Abwesenheit ein ungarischer Flüchtling bei Mr. Gidney vorgesprochen habe: Ihm sei zu Ohren gekommen, daß Pedro Gómez zurückkommen werde. Ja, sagte Mr. Gidney, Pedro kommt wieder. Aber dieser Gómez ist Kommunist! Pedro arbeitet schon seit sieben Jahren bei uns, erwiderte Mr. Gidney bedächtig, seit 1947. Pedro ist guter Mechaniker. Gómez ist Kommunist, wiederholte der andere.
Da bekam es Mr. Gidney mit der Angst zu tun, und er erstattete Meldung, und als Pedro aus Spanien zurück war, lud ihn der CIC vor und schloß ihn an einen Lügendetektor an. Keine Angst, hieß es, das tut nicht weh, nur ruhig Blut, sitzen Sie nicht so verkrampft, entspannen Sie sich, es ist bloß eine Formalität.
Dann sagte der Offizier: Heute ist Sonntag, und Pedro antwortete: Nein, heute ist Mittwoch. Und wieder der Offizier: Sie tragen Schuhe. Und Pedro: Ja, ich trage Schuhe. Ihre Hose ist blau. Ja, meine Hose ist blau. Sie sind ein russischer Spion. Nein, ich bin kein russischer Spion. Heute scheint die Sonne. Ja wirklich, die Sonne scheint. Sie spionieren für Franco. Nein, ich spioniere nicht für Franco.
So ging das dahin, und Pedro bekam eine Zigarette angeboten, und nach einer Stunde durfte er nach Hause gehen, man werde ihm schon Bescheid sagen. Eine Woche später tauchten graue Männer bei seinen Schwiegereltern am Bindermichl auf und erkundigten sich nach Pedros [26] Lebenswandel, seinen Lieblingsspeisen und politischen Vorlieben. Bis Mai wartete Pedro darauf, daß ihn die Amerikaner wieder in die Werkstatt ließen. Dann hatte er das Warten satt, ging aufs Arbeitsamt, ich brauch eine Arbeit, als Installateur, und der Beamte schickte ihn zu einer Firma, bei der er siebzehn Jahre lang arbeitete, gut verdiente und gut lebte.
Wie Víctor sein allererstes Wort Deutsch lernte
Víctor Cueto war in der Armee der spanischen Republik Leutnant gewesen. Nach der Niederlage floh er nach Frankreich, wurde interniert und meldete sich zu einer französischen Arbeitskompanie. Seine Gefährten und er hoben Schützengräben aus, legten Kasematten an, Waffen bekamen sie nicht. Als die Wehrmacht die Front überrannte, geriet Víctor in deutsche Gefangenschaft. Nach ein paar Tagen in Gewahrsam der Feldgendarmerie wurden die Spanier in ein Schiff verladen und in eine Kleinstadt an der belgisch-deutschen Grenze gebracht. Die Gestapo übernahm den Transport in ein Internierungslager außerhalb Hannovers. Es hieß, man werde sie zurück nach Spanien befördern. Zwei Tage Fahrt, dann stand der Zug. Das war am 6. August 1940.
Der Bahnhof hieß: Mauthausen.
Und das allererste Wort, das Víctor lernte, war: Gemmagemma.
[27] Wie Pedro Österreicher wurde
Nachdem Pedro aus Spanien zurück war, wollte ihn die Polizei aus Österreich abschaffen. Schauen Sie, sagte Pedro, meine Frau ist Österreicherin. Mein Sohn ist hier geboren. Und ich arbeite schon acht Jahre hier. Fünf Jahre bin ich im Konzentrationslager gewesen. Also rechnen Sie nicht damit, daß Sie mich loswerden.
Deswermaschoseen.
Pedro bekam die Aufenthaltsbewilligung für eine Woche. Dann ging er aufs Arbeitsamt.
Er suchte um die österreichische Staatsbürgerschaft an. Die Gendarmerie von Gusen beschied, gegen Pedro Gómez liege zwar nichts vor, aber dem Antrag könne man trotzdem nicht entsprechen. Und dann hin und her. Pedro ging wegen der Papiere zur Sicherheitsdirektion, dort schickte man ihn zur Landesregierung. Bei der Landesregierung hieß es: Der Akt liegt auf der Sicherheitsdirektion.
Ich bin verheiratet, sagte Pedro. Ich habe ein Kind zu ernähren. Ich habe es satt, daß Sie Katz und Maus mit mir spielen. Ich will endlich wissen, woran ich bin.
Sind Sie bei einer Partei?
Ich bin Ausländer. Nach den österreichischen Gesetzen darf ich keiner Partei angehören.
Dann suchen Sie sich jemand mit Beziehungen. Der soll beim Leiter der Sicherheitsdirektion anfragen, wo Ihr Akt geblieben ist.
[28] Pedro wandte sich an einen Funktionär der Sozialistischen Partei. Nach zwei Tagen erhielt er eine Verständigung, sein Ansuchen um Erteilung der österreichischen Staatsbürgerschaft sei genehmigt, er möge dem Finanzamt die offenen Gebühren entrichten.
Wie Víctor veranlaßt wurde, seine Unterschrift zu leisten
Vom Bahnhof wurden sie hinauf ins Lager getrieben, ein Spießrutenlauf, von links und rechts prasselten Schläge auf die Spanier nieder. Oben dann die Einvernahme auf deutsch, ein Dialog zwischen Tauben. Wie alt bist du, lautete die Frage, und die Antwort: Víctor Cueto. Wie heißt du? Zweiundzwanzig Jahre. Dann legten sie ihm ein Blatt Papier vor, unterschreib, Víctor sagte, ich unterschreib nicht, zuerst will ich wissen, was da steht, ohne Dolmetscher unterschreibe ich nicht.
Da schlugen sie ihn. Unterschreibst jetzt.
Ich unterschreib nicht.
Sie schleiften ihn hinaus, banden ihm die Hände auf dem Rücken zusammen und hängten ihn an die Klagemauer, die Fußsohlen dreißig Zentimeter über dem Boden. Sein ganzes Körpergewicht lastete auf den nach hinten gebogenen Gelenken.
Víctor wurde bewußtlos. Als er zu sich kam, fragten sie wieder.
[29] Jetzt unterschrieb er. Seinen Lebtag lang erfuhr er nicht, was er da eigentlich unterschrieben hatte.
Wie Pedro nach Spanien fuhr, und wie es ihm dort erging
Zwei Jahre nach der Befreiung stellten ihn die Amerikaner ein. Pedro arbeitete sich schnell hinauf, wurde Vorarbeiter, reparierte Panzer. Die Amerikaner schätzten ihn, Pedro hin und Pedro her, Pedro hier und Pedro da. 1952 heiratete er, nachdem er zwei Jahre gebraucht hatte, um alle Papiere zusammenzubringen, und im Jahr darauf beschloß er, nach Spanien zu fahren.
Ich will zurück nach Spanien, ich will meine Eltern wiedersehen, ich habe sie achtzehn Jahre lang nicht gesehen.
Bleib hier, Pedro.
Nein, ich fahre. Ich bin ein freier Mensch. Ich will sie wiedersehen.
Und Pedro fuhr, mit seiner Frau und dem Kind. Aber schon an der Grenze nahmen sie ihm den Reisepaß ab und händigten ihm bloß einen Passierschein aus, den er in Málaga bei der Kriminalpolizei vorweisen sollte. Dort erzählte er, was er schon den Beamten an der Grenze erzählt hatte, die halbe Wahrheit. Daß er während des Krieges Carabinero gewesen sei, daß er vor Madrid gekämpft habe, nach Frankreich geflohen und dort [30] den Deutschen in die Hände gefallen sei. Er erzählte nicht, daß er in der republikanischen Armee Offizier gewesen war, und auch nicht, daß er in einer Spezialeinheit für Gegenspionage seinen Dienst abgeleistet hatte.
Den Reisepaß bekam er nicht wieder. Arbeit fand er auch nicht. Er saß fest. Also schrieb er einem Kapitän der US-Army, der vor dem Krieg Diplomat gewesen war und der vor seiner Abreise zu Pedro gesagt hatte: Sie fahren nach Spanien. Das ist leichtsinnig, aber ich kann Sie verstehen. Verständigen Sie mich, wenn Ihnen die spanischen Behörden Schwierigkeiten bereiten sollten. Und der Mann half. Die US-Army forderte Pedro an, man würde seine Dienste benötigen, hieß es. Und seine Schwägerin schaffte es über Beziehungen, daß auf seinen Schein die Ausreisegenehmigung gestempelt wurde.
Wie Víctor seinen Hunger stillen konnte
Zu essen gab es: Am Morgen einen Schöpfer Kaffee-Ersatz ohne Zucker. Zu Mittag zehn Deziliter Wassersuppe, mit Spuren von Kartoffeln oder Runkelrüben. Abends ein Kilo Brot und einen Würfel Margarine, für jeweils zehn Schutzhäftlinge. Einen Teil der Margarine zweigte sich schon vorher das Blockpersonal ab.
Sein Leben verdankte Víctor SS-Oberscharführer Spatzenegger.
Der versetzte ihn 1943 in die Gärtnerei des [31] Steinbruchs, zu einem Bibelforscher und einem Kapo. Dort konnte Víctor Gemüse essen.
Spatzenegger war ein Bluthund, ein Ungeheuer, eine Mordmaschine. Víctor erschien er wie ein Vater.
Wie Pedro Fremdenführer wurde
Und es begab sich, daß eine Ambulanz dahergebraust kam und neben Pedro hielt.
You speak English?
No.
Parlez-vous français?
Qui, je parle français.
Et qui êtez-vous?
Ich bin Spanier.
Da ging die Tür auf, und es stieg einer aus, ein Puertoricaner, der sich freute, mit jemandem in seiner Muttersprache parlieren zu können. Mensch, ein Spanier. Warum trägst du dieses gestreifte Zeug? Pedro erklärte: Sträflingsgewand. Wir sind Spanier aus dem Konzentrationslager. Wir waren dort eingesperrt.
Genau das suchen wir. Ein Konzentrationslager. Steig ein.
Pedro stieg ein und zeigte ihnen den Weg nach Gusen. Und er führte sie durch das Lager. Der Puertoricaner übergab sich. Ein andrer fiel in Ohnmacht. Denn das Lager war voller Leichen, überall, auf dem Boden, in jeder [32] Ecke. Er zeigte ihnen das Krematorium, wo seit Ende 1944 jede Nacht acht-, neunhundert Tote verbrannt wurden, nicht nur aus dem Lager, auch aus Linz, Opfer der Luftangriffe, und dann die Neuzugänge, von den Judentransporten aus Ungarn, die Kinder, ihre Mütter, jede Nacht, ein entsetzlicher Gestank. Die Waschräume, die Vorratskammern. Überall Tote, überall dieser Gestank. Es gab kein Salmiak mehr, um den Leichengeruch wegzumachen.
Pedro sagte: Und jetzt gehen wir noch in die Baracke 29, dort sind die Tuberkulosekranken.
Nein, das interessiert uns nicht, sagten die Amerikaner. Wir haben schon genug gesehen. Tuberkulose nicht.
Wie Víctor in den Boxring stieg
1942 war Víctor so verzweifelt, daß er beschloß, hinaus in den Draht zu gehen. Es wäre eine Erlösung gewesen. Aber er war zu schwach dazu.
Das war auch die Zeit, in der er in den Ring stieg.
Jeden Sonntag mußten sie auf dem Appellplatz einen Boxring aufbauen und zum Gaudium der Wachmannschaften zwei Häftlinge gegeneinander hetzen. Ein Schwacher gegen einen Starken. Der Sieger bekam als Prämie den Napf zweimal angefüllt. Víctor boxte gegen einen Polen, der erst seit zwei Monaten im Lager war. Víctor verlor nach Punkten.
[33] Wie Pedro einmal Glück hatte
Ende 1943 wurde Pedro zu den Klempnern gesteckt. Von da an riskierte er täglich das Leben. Denn als Installateur durfte er das Lager verlassen und betreten. Er band sich die Hosenbeine unter den Waden zusammen und zog den Schlosseranzug über. Draußen hatten sie schon alles organisiert. Nahrungsmittel, die sie ihm zusteckten und die er sich in die Hose schob. Denn wer in ordentlichem Aufzug erschien, wurde respektiert. Wer abgerissen herumlief, bekam Prügel. Mit einem Teil des Schmuggelguts bestach er die Kapos im Krankenlager: Den läßt du hier, bis er gesund ist.
Pedros Aufgabe bestand also darin, Verpflegung aus der Küche ins Lager zu schaffen. Am Lagereingang erstattete er Meldung: Kommandoführer, Installateur. Spanier.
Was tun?
Arbeiten, Küche.
Weitermachen!
Höchstens, daß der Kommandoführer noch einen Blick in den Werkzeugkasten warf.
Manchmal wurde einer erwischt. Er wurde aufgehängt, an den Händen, die Arme nach hinten gedreht, und verhört. Gestohlen, ich hab’s gestohlen. Das ist unmöglich. Wer hat es dir gegeben? Ich hab’s gestohlen. Keiner wagte es, die Wahrheit zu sagen; er hätte dann nicht mehr lange gelebt. Blieb er bei seiner Version, [34] bestand die Möglichkeit, daß er das Verhör überstand. Dann kam er ins Krankenlager und wurde gesund gepflegt.
Einmal transportierte Pedro in seiner Hose eine Dose Fett, ein Glas Marmelade, zwei Würste, ein Stück Brot, ein paar Pfeifen und Rasierklingen. Da sah er schon von weitem eine Schar Offiziere beim Lagereingang stehen. Und aus der Tür trat der Küchenchef, der Kommandoführer: Spaniak! Komm mal her!
Die Offiziere sahen auf.
Was tust du hier?
Ich habe das Türschloß repariert.
Ein endlos langer Blick, dann das erlösende: Hau ab!
Schweißgebadet kam Pedro im Krankenlager an.
Wie Víctor sich fast zu Tode aß
Die Befreiung erlebte er im Lager Ebensee. Auf dem zweiten Panzer, der ins Lager rollte, saß ein Leutnant aus Texas, der Spanisch sprach und Víctor eine Schachtel mit Konservendosen schenkte, aus den Wehrmachtsbeständen. Und obenauf legte er ihm noch einen Laib Bauernbrot.
Víctor verschlang alles, zwei Kilo Fleisch, Blutwurst, das Brot. Dann kam er nicht mehr auf die Beine. Man mußte ihn schleunigst nach Gmunden schaffen, ins Krankenhaus, den Magen auspumpen. Kaum war er genesen, [35] setzte er sich auf ein Fahrrad und strampelte los, Richtung Spanien. In Lambach holten ihn amerikanische Soldaten vom Rad.
Wie Pedro schwarz sah
Drei Tage lang eingesperrt in einem Waggon. Und eines Tages, im Jänner 1941, wurde die Waggontür aufgezogen, und einer von der SS stand davor und schrie: Pronto, pronto! und schlug mit dem Gewehrkolben auf sie ein. Es war etwa vier Uhr, vier Uhr morgens, und die Spanier wurden zu Fünferreihen geordnet, SS links, SSrechts, so ging es die Straße ins Lager hinauf. Als es hell wurde, kam ihnen ein Lastwagen entgegen, vollbeladen mit Knochenmännern, kahlgeschoren, in gestreiften Jacken. Da flüsterte Pedro seinem Nebenmann zu: Hinein kommen wir. Aber ob wir je rauskommen?
Wie Víctor Gleiches mit Ungleichem vergalt
In Lenzing, in derselben Straße, wohnte er. Er war bei der SS gewesen und hatte Víctor in Mauthausen gepeinigt. Jetzt suchte er den Spaniaken auf, kleinlaut stand er vor der Wohnungstür, winselte um Gnade.
Bitte zeig mich nicht an.
Ich zeig dich nicht an.
[36] Schlag mich.
Schlag dich auch nicht.
Warum nicht. Schlag mich doch!
Wenn ich dich schlag, bin ich der gleiche Hund wie du.
Dann machte Víctor einen Vorschlag in aller Güte: Du kennst mich nicht, und ich kenn dich auch nicht. Brauchst mich nicht einmal zu grüßen.
Half aber alles nichts: Den andern sollte nachher der Herrgott bestrafen, in Gestalt eines Betrunkenen, der ein Automobil steuerte.
Wie Pedro in Gefangenschaft geriet
Als der Krieg ausbrach, am neunten September, waren die Spanier als Freiwillige an der Maginot-Linie mit Befestigungsarbeiten beschäftigt. Sie zogen Stacheldraht, bauten Betonbunker, hoben Gräben aus. Dafür erhielten sie fünfzig Centimes und freie Verpflegung. Ständig ging es zurück, immer zu Fuß. Bis es eines Tages hieß: C’est fini. Alles aus. Die Deutschen sind da. Macht, daß ihr wegkommt.
Als sie zurück ins Lager trotteten, wurden sie von deutschen Soldaten umstellt.
Franzosen?
Nein, Spanier.
Ah, Franco!
Nix Franco. Republik!
[37] Ein Major fragte: Wenn nicht für Franco, für wen habt ihr dann gekämpft?
Für Recht und Freiheit. Damit wir Arbeit haben. Damit wir leben können.
Da sah der Deutsche Pedro einen Augenblick lang nachdenklich an. Dafür kämpfen wir ja auch, sagte er. Die Welt ist verrückt.
Wie Víctor nach Spanien fuhr
Weil er die Demokratie verteidigt hatte, war sein Bruder unter Franco zum Tode verurteilt, dann zu siebzehn Jahren Haft begnadigt worden. Víctor hätte das gleiche Schicksal geblüht. Doch 1957, er hatte seine Mutter einundzwanzig Jahre lang nicht gesehen, riskierte er es. Da war er schon sechs Jahre österreichischer Staatsbürger, in Spanien galt er als vermißt. Also fuhr er zur Botschaft nach Wien und suchte um ein Visum an. Der Antrag wurde abgewiesen. Er dürfe nur mit spanischem Paß einreisen. Víctor lief ins Innenministerium, Minister Helmer intervenierte, man bestellte Víctor noch mal in die Botschaft.
Waren Sie in einem Exekutionskommando.
War ich nicht.
Haben Sie jemanden getötet.
Ich war Soldat an der Front, da wird geschossen, logisch.
[38] Unterschreiben Sie, daß Sie an keiner Hinrichtung beteiligt waren.
Víctor unterschrieb, bekam das Visum und fuhr mit seiner Frau nach Spanien. In Irún, an der Grenze, mußten sie auf den Zug nach Madrid warten. Drei Männer kamen auf sie zu. Geheimpolizei, Ausweis bitte.
Rotspanier, soso, kommt jetzt nach Hause.
Einer der drei Polizisten setzte sich ins selbe Zugabteil. Um drei Uhr früh stiegen Víctor und seine Frau in den Zug nach Gijón um; den haben wir abgehängt, sagte Víctor.
Drei Tage später gingen sie zum Stierkampf. Einmal drehte sich Víctor um, da sah er den Mann in der Reihe hinter sich sitzen.
Wie Pedro ein Wort nicht mehr hören konnte
Er konnte es schon nicht mehr hören. Überallhin verfolgte ihn das Wort. Es war ein ständiger Angriff. Ein pausenloser Krieg.
Ja, sagte Pedro. Ausländer. Ich bin Ausländer. Aber ich schäme mich deshalb nicht. Ich arbeite. Und ich war politischer Gefangener. Ich hätte nicht zu arbeiten brauchen. Ich habe eure Abflußrohre repariert. Hunderte, Tausende österreichische Abflußrohre. Reicht euch das nicht?
Heute, sagte Pedro, fühle ich mich hier wohl. Ich habe [39] Frau und Kinder und Enkelkinder. Aber nach dem Krieg hätte ich lieber unter Spaniern gelebt. Denn als Ausländer ist man in Österreich sehr allein. Ich konnte es nicht mehr hören: Sie sind Ausländer. Etwas Minderwertiges.
Wie Víctor in Österreich zurechtkam
Víctor konnte sich ein Leben in Spanien nicht mehr vorstellen. Du bist ja österreichischer als die Österreicher, sagten ihm seine Verwandten. Dabei, sagte Víctor, versteht man in Asturien besser zu leben als hier. Aber ich bin Österreicher, zu hundert Prozent. Ich bin beliebt, und ich bin zufrieden. Auch wenn mich die Leute einmal angespuckt haben. Aber nach der Befreiung war alles anders.
Was nachzutragen bleibt
[40] Herr Meisel und seine Söhne
Es war ein Vater, der hieß Jakob und hatte drei Söhne, Alexander, Paul und Josef. Jakob Meisel war Tischler, er liebte sein Handwerk, gerne auch saß er im Kaffeehaus und spielte Karten. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde er eingezogen und an die Front gejagt, er geriet in russische Gefangenschaft, erlebte die Revolution, eine Umwälzung von Grund auf, Verkehrung alles bisher Gültigen, wie ihm schien, tief beeindruckt kehrte Meisel 1918 zu seiner Familie zurück. Die Mutter unterdessen las den Söhnen aus der Kleinen Volks-Zeitung vor, Sensationsbericht von der Ermordung der Zarenfamilie, den Kindern schauderte, aber nur kurz.
Familie Meisel
wohnte in einem Zinshaus im Wiener Gemeindebezirk Brigittenau, Zimmer und Küche, Wasser und Klo auf dem Gang. Es gab keinen elektrischen Strom, nur Gaslicht im Stiegenhaus, in den Wohnungen beleuchteten Petroleumlampen den Schimmel an der Wand.