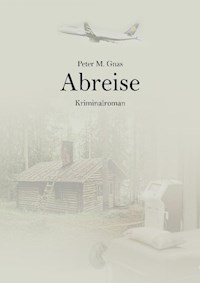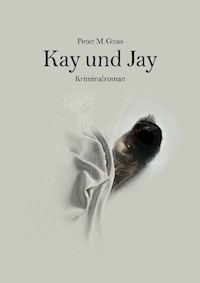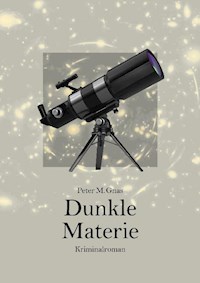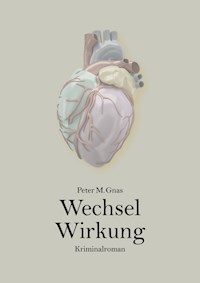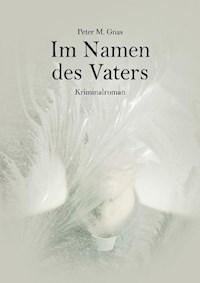
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Marie und Christian Parker sind frisch verheiratet. Auf einer Hochzeitsreise berichtet Marie ihrem Mann von ihrer schweren Kindheit als Tochter eines autoritären evangelischen Pastors. Als sie versucht, mit ihrem Vater Kontakt aufzunehmen, um sich aus seinem Einfluss zu befreien, droht er seiner Tochter. Christian Parker sucht seinen Schwiegervater schließlich auf und will ihn zur Rede stellen. Dabei kommt es zu einem Ereignis, das sein Leben und das von Marie ändern wird. Die Geschichte führt in die Schweiz, wo Oberstleutnant Marco Ravelli von der Kantonspolizei Graubünden auf die Geschehnisse aufmerksam wird. Über Interpol führen seine Ermittlungen zu Kriminalhauptkommissarin Sabrina Hamm und ihrem Team aus Bremen. Gemeinsam versucht man Licht in ein Familiengeheimnis zu bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Im Namen des Vaters
Kriminalroman von Peter M. Gnas
Peter M. Gnas ist 1955 in Bremen geboren und hat dort Kunst studiert. Seit Jahrzehnten arbeitet er selbstständig als Grafik-Designer und Texter in Stuttgart und jetzt bei Sigmaringen. Kreativität in Wort und Bild tragen ihn durch sein gesamtes Leben. Neben der zielgerichteten schöpferischen Tätigkeit im Marketing arbeitet er frei künstlerisch in Wort und Bild.
Impressum
Deutsche Erstveröffentlichung
© 2019 by Peter M. Gnas
Herstellung und Verlag: Peter M. Gnas
Umschlaggestaltung: Die Zeitgenossen GmbH, Stuttgart
Titelbilder: unsplash.com – Nikola Knezevic
und pixabay.com – Larisa-K
Die Morgensonne schien in das gediegene Hotelzimmer. Durch das gekippte Fenster drang das Gezwitscher unzähliger Vögel zu ihm herein. Christian Parker lag auf dem Rücken und lächelte. Er hatte die Arme hinter seinem Kopf verschränkt und lauschte den Vogelstimmen. Aus dem Bad hörte er die Dusche.
Marie war bereits aufgestanden. Sie waren in einer Dreiviertelstunde mit seinen und ihren Eltern zum Frühstück verabredet. Auch sie übernachteten im Hotel Landgut Bärenhof in Lilienthal. Am Abend zuvor war Maries und Christians Hochzeit im großen Festsaal des Hotels gefeiert worden. Seine Eltern hatten an nichts gespart.
Parker ließ Momente des Festes an seinem inneren Auge vorüberziehen. Er summte das letzte Lied, dass die Band gespielt hatte – es war ein Schlager von Beatrice Egli, Fliegen hieß er. Sie hatte ihn sich gewünscht, weil es im Text darum ging, um die Welt zu fliegen und er und Marie am nächsten Tag eine Hochzeitsreise antreten würden. Seine Eltern hatten sie ihnen geschenkt. Zuerst einige Tage nach Rom – das hatte er sich gewünscht. Er wollte einmal auf dem Petersplatz den Papst sehen. Dann sollte es weitergehen nach Mexiko: eine Rundreise zu den alten Maya-Städten, im Anschluss ein paar sonnige Tage am Strand in einem schönen Hotel. Und schließlich waren sie eingeladen worden, Freunde seiner Eltern bei Washington zu besuchen.
Parkers Eltern hatten sich großzügig gezeigt. Ihnen ging es finanziell sehr gut. Sie betrieben ein Geschäft für exklusive Stilmöbel in Bremen. Die Kundschaft war konservativ und wohlhabend. Nicht selten wurde eine Wohnung komplett eingerichtet und der Kunde legte dafür einen guten sechsstelligen Betrag hin. Seine Eltern reisten viel in der Welt umher, um nach interessanten Lieferanten Ausschau zu halten. Sie hatten auf ihren Reisen Freundschaften geschlossen, mit denen sie sich gegenseitig einluden.
Parker war häufig dabei gewesen. Besonders gut hatte es ihm in den Vereinigten Staaten und in Kanada gefallen. In der Nähe von Washington hatten seine Eltern Freundschaft zu einem Hersteller von Polstermöbeln geschlossen. Dort war er vor drei Jahren dabei. Jeff und Amy Hudson waren ebenso energiegeladen wie gläubig. Bei ihnen war es üblich, dem Herrn vor jeder Mahlzeit zu danken. Auch seine Eltern waren katholisch. Zu Hause wurde selten gebetet, der Besuch des Gottesdienstes war jedoch obligatorisch.
Es gab Zeiten im Leben, da war ihm der Glaube seiner Eltern zu viel gewesen. Ständig war Gott in der Nähe und kontrollierte, was man tat. In der Kindheit war es schön und warm mit der Religion, als er jedoch in die Pubertät kam, fingen die Probleme an. Seine Eltern hatten ihn stets zur Keuschheit vor der Ehe ermahnt. Sie selbst hätten es genauso gehalten.
Natürlich war die Welt für ihn ebenfalls voller Mädchen, so wie für die meisten Jungen in seinem Alter. Parker war ein attraktiver Junge gewesen und so blieb es nicht aus, dass das ein oder andere Mädchen auf ihn aufmerksam wurde. Aus Liebe und Respekt vor Mutter und Vater, ging er jedoch nie über einen Kuss hinaus.
Irgendwann begann es aufzufallen, dass er vor größerer Intimität zurückwich. Einmal hatte ein Mädchen aus seiner Klasse, die schon mit vielen Jungen der Schule und außerhalb sexuelle Erfahrungen gesammelt hatte, von seiner Zurückhaltung gehört und ihn angemacht. Sie hatte eine umwerfende erotische Ausstrahlung und eroberte jedes männliche Wesen, das sie wollte. Parker hatte nicht begriffen, dass sie ihn testete und war völligüberrascht, als sie beim zweiten Treffen unvermittelt an seine Hose griff und seine Erregung fühlte.
„Uih“, hatte sie gehaucht, „da freut sich aber jemand.“
Er hatte sofort ejakuliert. Sie fühlte, wie seine Hose nass wurde. Er war rot angelaufen, hatte ihre Hand fortgeschoben und war von ihr abgerückt.
„Sag’ mal, kannst du nicht ein bisschen warten, damit ich auch meinen Spaß habe?“
Ihr Ton war beißend ironisch.
„Ich glaube, du musst noch ein wenig allein an dir spielen“, hatte sie gesagt und ihre Hand an seinem Hosenbein trockengewischt.
„Oder bist du eine Schwuchtel?“, mit einem unverschämten Lächeln war sie gegangen.
Von diesem Tag an war es für ihn am Gymnasium unerträglich geworden. Ein halbes Jahr hatte er die Schmach ertragen – er hatte überlegt, durchzubrennen, ja sogar sich das Leben zu nehmen. Als seine Eltern schließlich seine Veränderung bemerkten, hatte er sich seinem Vater anvertraut. Bereits zwei Wochen später, im Alter von sechzehn Jahren war er Schüler eines katholischen Internats im Schwarzwald.
Dort hatte sein Leben eine andere Richtung bekommen. Es hatte viel Disziplin erfordert, den Erwartungen der Lehrer und der Philosophie des Internats gerecht zu werden. Er war dort unter Gleichen – der Unterschied zwischen der Weltsicht seiner Eltern und dem, was die Schule vermittelte, war viel weniger groß. Alle Mitschüler kamen aus gutsituierten katholischen Elternhäusern. Zum ersten Mal im Leben hatte er echte Freundschaften geschlossen – Freundschaften, die bis in die Gegenwart hielten.
Nach dem Abitur, das er beinahe mit einer glatten Eins gemeistert hatte, war er nach Bremen zurückgekehrt und hatte das Studium der Wirtschaftswissenschaften an einer privaten Hochschule begonnen und innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen.
Seine Eltern hatten den Wunsch, dass Parker später ihr Geschäft übernehmen sollte. Er hatte es sich gut vorstellen können. Er war jedoch unsicher, ob er schon reif genug war, zu den Kunden ein ebenso starkes Vertrauensverhältnis aufzubauen, wie es seinen Eltern gelang. Die Menschen kaufen bei uns kein Sofa, hatte sein Vater immer wieder betont, sie finden die Dinge, die zu ihrer Sicht auf die Welt passen.
Diese Kunden wollten das Beste: edle Hölzer und Stoffe, ein gediegenes Design und höchste handwerkliche Leistung. Parkers Eltern und auch er selbst hatten deshalb dazu tendiert, dass er zunächst in einem großen Möbelhaus Erfahrungen im Verkauf sammeln solle. In diesem Möbelhaus hatte er zwei Jahre gearbeitet und dann in ein kleineres Haus, das sich auf Designer- und Büromöbel spezialisiert hatte, gewechselt. Dort hatte er Marie kennengelernt.
Parker gefiel die familiäre Atmosphäre bei seinem neuen Arbeitgeber – sie erinnerte ihn an den elterlichen Betrieb. Auch dort waren die Kunden in der Regel finanziell besser gestellt. Er hatte sich zu einem guten Berater und Verkäufer entwickelt. Den Kunden imponierte, dass dieser junge Verkäufer so kompetent war und jedem den gleichen Respekt entgegenbrachte, unabhängig davon, ob sie eine komplette Einrichtung erwarben oder lediglich ein Accessoire.
Parker hatte sich gern mit Marie unterhalten, besonders nachdem er erfahren hatte, dass ihr Vater ein Pastor war. Damit war sie in seinen Augen jemand, die den Glauben an Gott und an Jesus Christus in ihr Leben integriert hatte. Trotzdem hatte es einige Monate gedauert, bis er den Mut fand, sie zu fragen, ob sie mit ihm einmal ausgehen wolle. Und dann ging alles verhältnismäßig schnell.
Jetzt, vier Monate später waren sie verheiratet.
Der Morgen nach der Hochzeitsnacht
Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als er hörte, dass Marie mit dem Duschen fertig war. Er setzte sich auf und reckte sich. Er schlug die Decke zurück, stand auf und sah durch einen Spalt des Stores auf die Landschaft hinter dem Hotel. Er sah sich im Spiegel an. Das ausgiebige Betrachten der eigenen Erscheinung galt in seinem Elternhaus als eitel. Trotzdem gab es keinen zweiten Menschen, der eitler war als seine Mutter. Parker lächelte als als daran dachte, wie oft er sie deshalb aufgezogen hatte.
In seiner Hochzeitsnacht hatte er nun zum ersten Mal Sex gehabt. Er drehte sich zu beiden Seiten und glitt immer wieder mit den Augen an seinem Körper herauf und hinab. Er sah auf seinen Penis und warf sich selbst einen anerkennenden Blick zu. Er stutzte und sah nochmals hin. Er hob ihn an und betrachtete ihn von allen Seiten. Dann drehte er sich um und sah mit kritischem Blick auf das Laken und die Unterseite der Bettdecke. In diesem Moment trat Marie aus dem Bad. Sie ging zu ihm, schlang die Arme um seinen Hals und küsste ihn.
„Mir geht es gut mit dir“, sagte sie mit liebevoller Stimme, „ich bin glücklich.“
„Mir geht es auch gut und ich liebe dich“, antwortete er, „vor allem, wenn ich daran denke, dass wir morgen schon in Rom sein werden.“
*
Als Christian und Marie Parker in den Frühstückssaal kamen, saßen die Eltern des Paares bereits an dem festlich gedeckten Tisch. Beiden entging nicht, dass sie freundlich, aber sehr förmlich miteinander umgingen. Parker dachte, dass es kein Wunder sei, weil sie sich vor der Heirat nicht öfter als dreimal begegnet waren. Er wusste, dass seine Eltern sehr geübt im Smalltalk waren, wenn eine Situation ins Stocken zu geraten drohte. Genau diese Art die Gesprächspartner anzusehen und dieses Lachen seiner Mutter erkannte Parker sofort, als er den Saal betrat.
Beate Parker stammte aus einer Familie, deren Vorfahre vor mehr als zweihundert Jahren im Dienst von Friedrich des Großen stand und eine wichtige Stellung in dessen Post- und Finanzwesen innehatte. Er hatte seine Aufgabe offenbar so gut erledigt, dass er in den Adelsstand erhoben wurde und beträchtliche Ländereien im Großraum Hannover erhalten hatte. Die Familie hatte auch im Privaten eine gute Hand für die Vermehrung des Geldes.
Ihr Mädchenname lautete Beate Louise Freiin von Hausenbrook. Sie hatte ausgezeichnete Umgangsformen und war gebildet. Sie hatte in Hamburg Kulturwissenschaften studiert, ihr Wissen jedoch, bis sie ihren Mann kennenlernte, hauptsächlich für die Katalogisierung der Familienschätze eingesetzt. Erstmals seit Jahrhunderten gab es eine Wertstellung für all die Gemälde, Möbel, Schmuck, Porzellan und alles das, was eine alte Familie anhäuft.
Sie hatte in Hannover für ihre Wohnung nach einigen Möbeln gesucht, die zu denen passten, die sie aus dem Familienbesitz mitgebracht hatte. In dem Geschäft für Stilmöbel wurde sie von dem jungen, aber sehr gut informierten Mitarbeiter Helmuth Parker beraten. Er hatte sie in ihrer Wohnung besucht und sich ihre Einrichtung angesehen, um gezielt Empfehlungen aussprechen zu können. Er hatte ihr gefallen, er war groß und sportlich und hatte perfekte Umgangsformen. Er hätte einer Kundin aus einer Adelsfamilie von sich aus niemals Avancen gemacht.
Nachdem die Lieferung an die hübsche Baronesse abgeschlossen war, hatte er mit ihr gemeinsam die endgültige Position für die Möbel festgelegt und sich danach zum Gehen gewandt. Er reichte ihr die Hand mit einem angedeuteten Diener. Sie hielt seine Hand fest. Er hatte gestutzt und ihr in die Augen gesehen.
„Gestatten Sie, dass ich Sie als Abschluss des Geschäfts zum Essen in den Kronprinzen einlade?“, hatte sie gefragt.
So begann die Beziehung der beiden zueinander. Beate Parker führte ihn in die Familie ein. Ihre Eltern hätten lieber einen Mann aus besserem Haus für sie gesehen – seine aufmerksame Art und sein gutes und sicheres Auftreten, hatten bei ihnen jedoch einen starken Eindruck hinterlassen.
Sie lebten zunächst in Hannover in ihrer Wohnung. Er wurde, trotzdem er noch sehr jung war Geschäftsführer des Möbelhauses. Bald schon reiste er in Europa umher, um neue interessante Lieferanten kennenzulernen und schaffte es, durch die langsame Umstellung des Sortiments, andere Käufergruppen zu gewinnen. Das Geschäft, das bereits dem Untergang geweiht war, erholte sich.
Irgendwann schlug ihm Beate Parker vor, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Sie bat ihre Eltern, sie mit einer Bürgschaft zu unterstützen. Weil er nicht in Konkurrenz zu seinem Arbeitgeber gehen wollte, hatten sie ihr eigenes Geschäft in Bremen eröffnet. Helmuth Parker führte es zum Erfolg.
Das Haus von Hausenbrook war von einem katholischen Pragmatismus geprägt. Sie zogen aus der Religion ihre Kraft, im Leben zu bestehen, aber verstanden es auch, dieses Netzwerk für ihre geschäftlichen Interessen zu nutzen. Beate Parker hielt es ebenso. Sie brachte ihren evangelisch getauften Mann dazu, sich zum katholischen Glauben zu bekennen, ging mit ihm regelmäßig zum Gottesdienst und arbeitete ehrenamtlich in Projekten ihrer Gemeinde. So kam es, dass sie innerhalb eines Jahres alle wichtigen Leute der Gemeinde und auch viele von deren Freunden kennenlernte. Nicht jeder kaufte bei den Parkers, aber viele.
Beate Parker hatte gleich gemerkt, dass Marie ihren Sohn nicht ebenso unterstützen konnte, wie sie es bei Helmuth Parker getan hatte. Letztlich aber liebte ihr Sohn sie und sie kam aus einem christlichen Haus – wenn auch nicht aus einem katholischen.
Es gab eine Seite, die mochte Beate Parker an Hans-Werner Lagerfeldt nicht. Er war zwar Pastor und führte ein ehrenwertes Leben, aber er schien herrisch und engstirnig zu sein. Seine Frau machte auf sie in seiner Gegenwart einen beinahe eingeschüchterten Eindruck. Und auch Marie war nicht zu einer freien und selbstsicheren Frau erzogen worden. Sie hatte an eine Redensart denken müssen, von der sie nicht mehr wusste, woher sie sie kannte: Pfarrers Kinder, Müllers Vieh geraten selten oder nie. Wahrscheinlich war es besser, wie es in der katholischen Kirche gehandhabt wurde, dort waren die Geistlichen unverheiratet und kinderlos – zumindest die meisten.
Ungeachtet dessen plauderte Beate Parker munter auf Maries Eltern ein. Niemand konnte hinter ihrer Fassade sehen, was sie wirklich dachte – außer Christian und ihr Mann.
„Ach, da ist ja unser Brautpaar“, rief sie überschwänglich und ging auf sie zu.
Sie hakte beide unter und begleitete sie an den Tisch. Sie platzierte Marie zwischen Helmuth und Christian Parker und nahm neben Sabine Lagerfeldt platz. Sie griff deren Hand und legte ihre andere obenauf.
„Jetzt können wir beide ein wenig plaudern“, sagte sie mit gekonnt guter Laune.
Lagerfeldt war Pastor im Ruhestand. Er kleidete sich zwar nicht mehr wie ein aktiver Pfarrer, wenn er jedoch in der Öffentlichkeit auftrat, achtete er darauf, dass man ihn als Geistlichen wahrnahm. Er trug schwarz. Unter dem Kragen des Hemds trug er eine Halsbinde mit einem kleinen weißen Stück Leinen, das an ein Beffchen – die Halsbinde der Pastoren – erinnerte.
Er stammte aus kleinen Verhältnissen. Sein Vater war Arbeiter bei der damaligen Bundesbahn gewesen. In dessen Augen galt der Besuch der Mittelschule bereits als höhere Bildung. Als Lagerfeldt die Grundschule besuchte, gab es in seiner Klasse ein einziges Mädchen, das den Sprung aufs Gymnasium geschafft hatte. Von den verbliebenen Schülern erreichte die Hälfte nach der sechsten Klasse die Mittelschule.
Kurz vor dem Abschluss, nach der zehnten Klasse der Realschule, forderte Lagerfeldts Vater seinen erst sechzehnjährigen Sohn auf, sich zu überlegen, welchen Beruf er ergreifen wolle. Er wusste nichts von irgendeinem Beruf. Sein Vater war mit ihm zur Berufsberatung des Arbeitsamtes gegangen. Und weil er gute Zensuren hatte, gab es die Empfehlung Kaufmann zu werden – als Industriekaufmann würde er später gutes Geld verdienen und hohes Ansehen genießen.
Lagerfeldtließ sich in die Ausbildung hineintreiben. Als er hörte, dass er Kaufmann werden sollte, hatte er sich vor seinem inneren Auge in einem weißen Kittel in einem Lebensmittelladen gesehen. Dass ein Kaufmann auch in einem Büro arbeitete und dabei einen Anzug trug, fand er überraschend. Er begann seine Ausbildung in einer Firma, die Waschmaschinen für Wäschereien entwickelte und baute. Bereits am ersten Arbeitstag hatte er gewusst, dass das nicht seine Lebensaufgabe werden würde. Trotzdem schloss er die Ausbildung ab.
Als er seinem Vater eröffnete, dass er das Abitur nachholen wollte, um später zu studieren, konnte der darin keinen Sinn ausmachen. Unter dem Zuspruch durch die Mutter, ließ sich der Vater erweichen und stimmte zu, ihm die zwei Jahre bis zum Abitur zu finanzieren.
Lagerfeldts Wille zu studieren, war so stark, dass er alles daran setzte, ein gutes Abitur zu erreichen. Am Ende reichte es nicht für anspruchsvolle Studiengänge wie Medizin oder Psychologie. Als er seinen Eltern schließlich eröffnete, dass er Theologie studieren wolle, begann sein Vater endgültig an seinem Verstand zu zweifeln.
Der Vater hatte ihm nie geholfen, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Er hatte ständig in dessen Kritik gestanden und wurde immer an der schweren körperlichen Arbeit gemessen, der sein Vater nachging. Lagerfeldt hatte, trotz seiner schon frühen, sehr männlichen Ausstrahlung, stets darunter gelitten, nicht genug für die Eltern zu sein. Seine Zurückhaltung in allem, was er tat, zeigte sich auch im Umgang mit dem anderen Geschlecht. Bis er am Ende des vierten Semesters seine spätere Frau Sabine kennenlernte, hatte er niemals näheren Umgang mit Frauen gehabt.
Sabine hatte er kennengelernt an der Universität Münster, an der er studierte. Sie hatte in der Verwaltung gearbeitet. Sie war noch zurückhaltender als Lagerfeldt. Als er sie das erste Mal bemerkte, saß sie auf einer Bank in der Sonne und aß ihr mitgebrachtes Brot. Nur weil die anderen Bänke besetzt waren, hatte er sich überwunden und auf derselben Bank Platz genommen. Er hatte mit ihr einige belanglose Sätze über das Wetter gewechselt. Schließlich waren sie nach der Pause wieder auseinandergegangen.
Lagerfeldt hatte am nächsten Tag aus der Ferne nachgesehen, ob sie wieder dort saß. Sie saß dort, es war jedoch kein weiterer Platz frei. Am dritten Tag schließlich saß sie wieder allein auf einer Bank und er ließ es wie Zufall aussehen, dass er vorbeikam. Dieses Mal hatte er sich einige Sätze zurechtgelegt. Er hatte sie gefragt, was sie studiere.
Es hatte schließlich drei Monate gedauert, bis er sich das erste Mal mit ihr verabredete. Sie waren ins Theater gegangen. Es wurde Galileo Galilei gegeben. Er hatte das Stück bereits drei Tage zuvor gesehen, um zu entscheiden, ob es das Richtige für eine erste Verabredung war. Danach hatten sie noch im Theater-Cafégesessen und über das Stück gesprochen. Kunst und Kultur wurde der Klebstoff ihrer Beziehung. Beide hatten in ihren Elternhäusern nicht gelernt, sich dafür zu interessieren und zu begeistern.
Und so war es nicht erstaunlich, dass die Eltern von Marie und Christian Parker im Thema Kultur ihren gemeinsamen Nenner fanden. Selbst die sehr zurückhaltende Sabine Lagerfeldt traute sich aus ihrer Komfortzone des Schweigens herauszutreten. Beate Parker war überrascht, wie klug und differenziert sich Christians Schwiegermutter zu Malern, Komponisten und Autoren äußerte. Ihr entging dabei nicht, dass es Lagerfeldt nicht recht war, dass seine Frau sich selbstständig äußerte – er nahm für sich in Anspruch, stets das Wort zu führen. Er war vom Schlag derer, denen das Wort Emanze als Schimpfwort mit Leichtigkeit über die Lippen glitt.
Es gab eine Seite, da tat ihr Sabine Lagerfeldt leid neben diesem Mann. Aber offensichtlich besaß er eine Seite, die ihr gefiel oder zumindest gefallen hatte. Vielleicht war sie aber auch nur eine dieser armen Frauen, die in eine Ehe gerutscht waren, weil sie nicht den Mut aufgebracht hatte, nein zu sagen. Es war schwer, aus Menschen klug zu werden, wenn sie schwiegen.
Rom
Das Hotel lag in der Nähe der Engelsburg. Parkers Mutter hatte einen Geschäftsfreund aus Rom gebeten, ihr ein schönes Hotel unweit des Vatikan zu empfehlen. Sie hatte es gebucht und bezahlt.
Parker hatte für die vier Tage, an denen sie in Rom sein würden, ein kleines Besichtigungsprogramm zusammengestellt. Der Höhepunkt für ihn würde die Mittwochsaudienz des Papstes auf dem Petersplatz sein.
Ihr Zimmer lag im oberen Stockwerk eines perfekt renovierten Gebäudes. Eine Glastür führte auf eine kleine Dachterrasse. Weil das Wetter drückend heiß war, nahmen sie eine Dusche. Er legte sich aufs Bett und wartete auf seine Frau. Draußen lief der endlose Strom von hupenden Autos und knatternden Motorrollern. Eigentlich hatte er sich vorgenommen mit ihr am Tiber entlang zu schlendern, einmal über die Engelsbrücke zu gehen und dann vielleicht ein Eis zu essen.
Als Marie jedoch aus dem Bad kam, betrachtete er ihren Körper. Er hatte sich, als sie sich kennenlernten, versucht auszumalen, wie sie wohl unbekleidet aussähe. Er hatte sie schon im Bikini gesehen und fand sie bezaubernd.
„Wollen wir noch ein wenig Zeit im Bett verschwenden?“, fragte er und verschränkte die Arme unter seinem Kopf.
„Wieso verschwenden?“, fragte sie und wirkte fast ein wenig gekränkt.
„Nein, das war blöd. Ich meinte genießen.“
Sie lächelte, kam ins Bett und legte sich in seine Arme, als suche sie Geborgenheit. Sie liebten sich und genossen ihre neue Freiheit. Parker war attraktiv – ein Sohn attraktiver Eltern. Marie ähnelte ihrer Mutter. Auch Sabine Lagerfeldt war eine schöne Frau. Parker bedauerte, dass seine Schwiegermutter nichts aus sich machte. Sie kleidete sich konservativ und hochgeschlossen und ihre Frisur ließ sie älter wirken. Sie war die Frau eines Pastors – aber musste sie deshalb so herumlaufen, als besäße sie keine eigene Persönlichkeit?
Er hatte seine Mutter einmal sagen hören, dass sie sich darüber ärgere, wie Lagerfeldt mit seiner Frau umspringe. Und sie habe den Verdacht, dass er auch für die Zurückhaltung von Marie verantwortlich sei.
Ich muss mich ja auch zurückhalten wegen eurer katholischen Weltsicht, hatte Parker Marie verteidigt. Seine Mutter hatte geantwortet, dass es nicht um Marie ginge, sondern um ihren kleinkarierten Vater. Parker musste von jenem Tag an, immer darauf achten, dass er seinen eigenen Blick auf Lagerfeldt bewahrte – wenn er seiner Mutter auch im tiefsten Inneren zustimmte.
Nachdem sie sich geliebt hatten, legte er sich auf die Seite neben sie. Mit dem Zeigefinger strich er ihr sanft über den Körper. Er folgte seinem Finger mit den Augen. Sein Blick wirkte nachdenklich. Es lag ihm etwas auf der Seele. Er musste mit ihr sprechen.
„Was hast du?“, fragte sie, als sie seine Nachdenklichkeit bemerkte.
Plötzlich sprang er aus dem Bett.
„Was war das?“, rief er erschrocken: „Irgendwas war an meinem Bein!“
Auch sie sprang aus dem Bett.
„Was ist denn gewesen?“, fragte sie beunruhigt.
„Ich weiß nicht. Mich hat etwas am Bein berührt.“
„Das kann doch nicht sein.“
„Die Tür zur Dachterrasse ist offen“, sagte er.
Marie Parker legte sich auf den Boden, um unters Bett zu sehen.
„Guck‘ mal was da ist“, sagte sie begeistert.
Auch er legte sich auf den Boden. Dann griff er unter das Bett, holte ein kleines Kätzchen hervor und streichelte es.
„Wie bist du denn hier rein gekommen?“, fragte er das Tier mit liebevoller Stimme.
Sie kamen zu dem Schluss, dass sie über die Dachterrasse gekommen sein musste.
„Bring‘ Sie lieber raus und wasch‘ dir die Hände. Wir wissen nicht, ob sie gesund ist.“
„Dann dusche ich gleich noch mal“, sagte er.
Jetzt war der Moment wieder ungenutzt verstrichen, in dem er mit ihr sprechen wollte. Er merkte, dass es eine Seite gab, die sich gern ablenken ließ, weil er sich vor dem Gespräch mit ihr scheute.
*
Sie hatten ihren Spaziergang entlang des Tibers etwas später angetreten, als geplant. Die Engelsburg war für Besichtigungen bereits geschlossen. Sie schlenderten über die Engelsbrücke und sahen sich die Burg immer wieder aus neuen Perspektiven an. Parker fotografierte mit seinem Smartphone – Engel vor blauem Himmel, Engel mit Engelsburg und natürlich Marie mit Engelsburg. Es gab für ihn nur noch einen wahren Engel und das war sie.
Auf der anderen Seite des Tiber suchten sie sich ein Eiscafé. Während sie auf ihre Eisbecher warteten, betrachteten sie die Bilder, die er geschossen hatte.
„Was wolltest du vorhin sagen?“, sprach sie in das Schweigen hinein.
Sein Herz begann sofort bis zum Hals zu klopfen. Er konnte es nicht mehr aufschieben. Und wollte es auch nicht.
„Du weißt ja, dass ich niemals vor dir mit einer Frau intim war ...“
Auf ihrer Stirn bildeten sich zwei senkrechte Falten – sie versuchte zu verstehen, was er dachte. Die Eisbecher wurden gebracht, beide rührten sie jedoch nicht an.
„... ich habe deshalb auch keine Ahnung, wie das bei Frauen ist, wenn sie erstmals intim werden.“
Ein solches Gespräch hatten sie nie geführt. Marie Parker wusste nicht, wohin es führen würde und sie begann sich anzuspannen. Er bemerkte es, beugte sich vor und ergriff mit beiden Händen die ihren.
„Ich will nicht kleinlich klingen. Trotzdem treibt es mich seit gestern Morgen um.“
„Was?“, sie wirkte nun ungeduldig, beinahe gereizt.
„Ich hatte dir gesagt, dass ich so erzogen wurde, dass ich mir die Intimität zu einer Frau bis zur Ehe aufhebe. Das habe ich getan“, er beugte sich vor und blickte ihr intensiv in die Augen: „Du hattest mir gesagt, dass du es auch so hieltest ...“
„Chris, was willst du mir sagen?
Er zögerte und blickte auf seine Hände, seine Finger verkrampfen sich.
„Dass ich gestern Morgen aufgestanden bin und ich weder an mir, noch auf dem Laken, noch an der Bettdecke irgendwelche Blutflecken gesehen habe“, rappelte er den Satz heraus und setzte nach einer Pause ruhig hinzu: „und ich habe nicht danach gesucht – mir ist es lediglich aufgefallen.“
Er sah sie an. Er bemerkte, dass sie verstört reagierte. Ihre Augen waren unruhig und wichen seinem Blick aus.
„Vielleicht gehört das ja auch in den Bereich der Mythen, die um die Jungfräulichkeit gesponnen werden. Wie ich gesagt habe: Ich kenne mich damit nicht aus“, fügte er in ruhigem Ton hinzu, weil ihm ihre Reaktion auffiel.
„Ich habe keine Liebe vor dir gehabt“, antwortete sie monoton. Ihr Blick war nun in die Ferne gerichtet: „Und ich weiß auch nicht, ob man beim ersten Mal grundsätzlich blutet.“
„Entschuldige.“
Er sah, dass irgendwas mit ihr geschehen war. Er bemühte sich, ihr gegenüber nicht mehr misstrauisch zu erscheinen, aber es gelang ihm nicht restlos. Sie aßen schweigend ihr Eis. Parker spürte, wie ihm dieser erste Konflikt die Kehle zuschnürte.
„Marie, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zu sagen, was ich denke, wird es trotzdem zwischen uns stehen.“