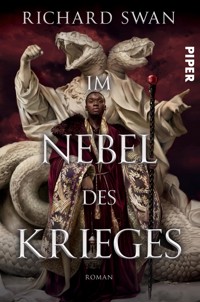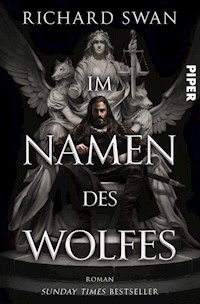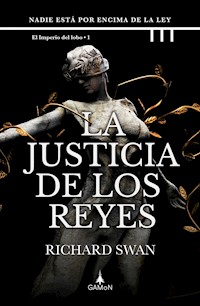9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im zweiten Band der epischen High-Fantasy-Reihe »Die Chroniken von Sova« zieht die Gruppe um Richter Konrad Vonvalt in die Hauptstadt Sova. Dort informiert der Kaiser persönlich Vonvalt darüber, dass das Oberhaupt des Richterordens ebenfalls zu den Verschwörern gehört, die das Reich bedrohen. Vonvalt soll die Leitung des Ordens übernehmen und dessen uraltes Magiewissen schützen. Bereits auf dem Weg nach Sova wurde er jedoch von einer mysteriösen Krankheit befallen. Er und seine Begleiter müssen schnellstens den Ursprung seines seltsamen Leidens herausfinden, bevor es zu spät ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Übersetzung aus dem Englischen von Simon Weinert
© Richard Swan 2022
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Redaktion: Uwe Raum-Deinzer
Karte: Tim Paul
Covergestaltung: Guter Punkt, München, nach einem Entwurf von Lauren Panepinto
Coverabbildung: Martina Fačková
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Karte
I
Auf der Straße nach Sova
II
Meister des Magistratums
III
Das Wolfstor
IV
Der Kaiser
V
Im Herzen der zivilisierten Welt
VI
Eine geräuschlose Säuberung
VII
Übungskampf
VIII
Ins Meistergewölbe
IX
Der Tempelorden
X
Eine Tür schließt sich, eine andere tut sich auf
XI
Eine Ablenkung zur Unzeit
XII
Der Leibwächter
XIII
Das Viertel der anrüchigen Handwerke
XIV
Die Fähigkeiten des Ordens
XV
Klingen kreuzen
XVI
Ein Licht im Dunkeln
XVII
Im Nematempel
XVIII
Der Muphraab
XIX
Der zweite Reichsstand
XX
Die Ermittlung gerät ins Stocken
XXI
Zur Kormondoltbucht
XXII
Die Falle wird gelegt
XXIII
Die Falle schnappt zu
XXIV
Heißblütig
XXV
Über die Reichsgrenze
XXVI
Lektionen über das Jenseits
XXVII
Rekaburg
XXVIII
An den Ufern des Ossianmeers
XXIX
Südenberg
XXX
Enthüllungen
XXXI
Eine Tochter Nemas
XXXII
Die Schlacht am Tor Agilmar
XXXIII
Keraq
XXXIV
Das Allerheiligste
XXXV
Verbotenes Wissen
XXXVI
Die Hoffnung stirbt
XXXVII
Eine Vermengung von Unglücksfällen
XXXVIII
Wiedervereinigung
XXXIX
Mehr Fragen als Antworten
XL
Unerledigte Angelegenheiten
Epilog
Der Verfall vor dem Untergang
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
I
Auf der Straße nach Sova
»Nichts geschieht einfach so.Ein jedes Ereignis ist der Kulminationspunktzahlloser Faktoren, deren tiefe Wurzeln biszum Ursprung der Zeit reichen. Man ist schnelldabei, eine Epoche großer Umbrüche als plötzliches Zusammentreffen verschiedener Unglücksfällezu beklagen – aber der kritische Blick der Geschichtelehrt uns, dass es kaum Zufälle gibt,wenn es um die Ränke der Menschheit geht.«
(Vormaliger) Richter Emmanuel Kane,Das Arsenal des Rechts:Verflechtung, Nekromantie und Weissagung
»Glaubst du, dass er sterben wird?«
»Junker Konrad?«
»Ja.«
»Man sollte es meinen, so wie er sich dahinschleppt.«
Es war ein warmer, vernieselter Frühlingsmorgen in der Südmark von Guelich, und Junker Radomir, Bressinger und ich standen fünfzig Schritt von der baufälligen Hütte eines Kräutersammlers entfernt. Vonvalt hielt sich schon über eine Stunde in der Hütte auf. Um uns gegenseitig zu provozieren, tauschten wir müde, gelangweilte Sticheleien aus.
»Es stimmt auf jeden Fall etwas nicht mit ihm«, sagte ich.
Die beiden wandten sich zu mir um.
»Du hast doch selbst gesagt, dass er schnell aufgeregt wird, wenn es um seine Gesundheit geht«, sagte Junker Radomir.
»Nema, sprich leise«, murmelte ich. Bressinger sah mich tadelnd an. Er hatte schon immer eine vorwurfsvolle Art gehabt, aber seit er seinen Arm verloren hatte, war er noch übellauniger geworden. Er war schnell gereizt, vor allem, wenn er den Eindruck hatte, dass Vonvalts Charakter infrage gestellt wurde. Früher hätten seine nonverbalen Rügen bei mir nagende Schuldgefühle ausgelöst. Doch inzwischen schenkte ich seinen stummen Vorwürfen kaum noch Beachtung.
»Es kann wohl niemand mit klarem Verstand das Gegenteil behaupten«, sagte ich und warf Bressinger einen Blick zu. »Aber das ist etwas anderes. So habe ich ihn schon ewig nicht mehr erlebt.«
»Ja«, murmelte Bressinger schließlich eines seiner seltenen Zugeständnisse. »Das ist anders als seine übliche Nervosität.«
Ich drehte mich wieder zu der Hütte um. Das Bauwerk aus Holz und Lehm war halb verfallen, eingesunken unter dem Gewicht des Strohdachs. Inmitten der kunterbunten Wiesenblumen und anderer Pflanzen war es fast nicht zu sehen, und in der Luft hing ein Kräuterduft, der im Nieselregen noch intensiver wurde und bei Mensch und Pferd zu endloser Nieserei führte.
Seit Ossica waren wir nun schon fast den ganzen Monat Sorpen über unterwegs, und von den Vorstädten Sovas trennten uns nur noch ein paar Tagesritte. Guelich war eines der Fürstentümer, die Sova umgaben wie das Eiweiß den Dotter. Regiert wurde es von Prinz Gordan Kzosic, dem dritten Sohn des Kaisers. Seine Residenz, die Festung Badenburg, war fern am Horizont zu erkennen. Die Sonne schien auf das hohe graue Gemäuer, sodass es auch in dreißig Meilen Entfernung ins Auge sprang.
Unsere Reise hätte nicht so lange dauern sollen. Hätte Bressinger in Galetal nicht einen Arm verloren, hätten wir Pferde und Ausrüstung dort gelassen und für die hundertfünfzig Meilen lange Strecke bis in die Westmark von Guelich die Kaiserliche Stafette genommen. Von dort wären wir dann auf der Badener Straße ostwärts direkt nach Sova gelangt. Bei gutem Wetter hätten wir für die gesamte Reise vielleicht eine Woche gebraucht, bei schlechtem Wetter zehn Tage.
Hätte Vonvalt nicht darauf bestanden, Oberpatria Fischer zu verfolgen und zu ermorden, hätten wir einfach ein Schiff anheuern und die Gale hinunterfahren können, die in den Sauber mündet, der wiederum direkt nach Sova fließt (und ein Nebenfluss der Kova ist). Doch schweife ich gerade genauso ab, wie es unsere Route tat.
Jedenfalls hatte Vonvalts schlechter Gesundheitszustand unseren Vorsatz, schnell voranzukommen, vereitelt. Über Nacht war er ganz plötzlich krank geworden. Erst hatte er über Benommenheit geklagt, die wir alle dem Wein zugeschrieben hatten, aber sie war auch am folgenden Tag noch geblieben. Vonvalt, der sich mit Gebrechen auskannte, schob es auf Schwindelgefühle – bis er anfing, auch noch an ernsthaften Angstzuständen zu leiden, die er nicht einordnen konnte. Dieses zweite Symptom hatte uns alle ratlos gemacht, denn er war wahrlich kein furchtsamer Mensch. Doch das nebulöse Bedrohungsgefühl wich nicht mehr, und bald darauf gesellte sich noch Müdigkeit hinzu, die rasch zu Anfällen lähmender Erschöpfung führte.
Im Kaiserreich wimmelte es von selbst ernannten Ärzten, und Vonvalt vermochte Quacksalber innerhalb von Sekunden zu erkennen – und strafrechtlich zu verfolgen, denn es war eine Straftat, den blauen Stern ohne entsprechende Qualifikation zu tragen. Dieser Kräutersammler hier hatte jedoch einen guten Ruf, weshalb wir nach einer zum Verzweifeln langwierigen Reise einen Umweg von ein paar weiteren Dutzend Meilen auf uns genommen hatten, um unseren Herrn und Meister medizinisch versorgen zu lassen.
»Was der braucht, ist ein ordentlicher Fick«, erklärte Radomir nach einigen Momenten der Stille mit großem Ernst. Er nahm einen langen Schluck aus seiner Flasche, die, wie ich wusste, mit verdünntem Wein gefüllt war.
Ich erwiderte nichts darauf. Ich mochte Radomir, aber auf solche Derbheiten wollte ich mich nicht einlassen.
Wir warteten. Außer unserem eigenen Zeitgefühl gab es keine Anhaltspunkte für das Verstreichen der Zeit. Selbst die Sonne war von Regenwolkentürmen verdeckt, die offenbar erpicht darauf waren, unsere Wachsmäntel auszutesten. Dann erschien Vonvalt endlich wieder. Er hatte ein Päckchen in der Hand, das bestimmt Pulver und Tränke enthielt. Er wirkte blass und abgehärmt, sein Aussehen und sein Auftreten waren ähnlich wie nach einer seiner Totensitzungen.
»Hat der Kräutersammler ein Heilmittel für dich gefunden?«, fragte Junker Radomir. Sein Ton war ruppig, aber es schwang eine Spur Optimismus mit. Vonvalts ausgeglichenes und vorhersehbares Temperament wirkte auf ihn, genau wie auf Bressinger und mich, beruhigend, doch die rasch einsetzende Krankheit hatte ihn verunsichert.
»Wir können es nur hoffen«, grummelte Vonvalt. Es war offensichtlich, dass ihm sein Leiden peinlich war, vor allem, da wir anderen selten krank wurden.
Er ging schnell an uns vorbei zu seinem Pferd Vincento und verstaute das Päckchen in einer Satteltasche. Dann stieg er auf.
»Kommt«, sagte er und richtete sich mühsam auf. »Mit Rückenwind schaffen wir es bis heute Abend nach Badenburg.«
Wir anderen sahen uns kurz an angesichts seines absurden Optimismus. Dann stiegen auch wir auf. Das schrille Krächzen einer Krähe auf dem klapprigen Zaun des Grundstücks des Kräutersammlers zog meine Aufmerksamkeit auf sich.
»Ein Vorbote des Frühlings«, bemerkte Junker Radomir.
»Es ist kein Vorbote, wenn der Frühling bereits da ist«, sagte Bressinger verächtlich. Er nickte zu dem Vogel. »Eine einzelne Krähe bedeutet Tod.«
Ich schnaubte. »Ich wusste gar nicht, dass du abergläubisch bist, Dubine«, sagte ich. Ich wollte es heiter klingen lassen, denn wir waren zu einem elenden Trupp geworden, niedergedrückt von der Last unseres Vorhabens und den düsteren Aussichten, die damit einhergingen.
Bressinger zeigte ein dünnes Lächeln und kickte Gaerwyn in einen leichten Trab.
»Nema«, murmelte Junker Radomir mir zu, als sein Pferd an meinem vorbeitrottete. »Der braucht auch mal einen ordentlichen Fick.«
Wir erreichten Badenburg erst kurz vor Mittag des nächsten Tages, was wir vor allem dem Herzog von Brondsey zu verdanken hatten, unserem Esel, und dem Wagen, den er zog, voll beladen mit richterlicher Ausrüstung und unserer persönlichen Habe. Aus der Rückschau war es eine Last, die wir nicht gebraucht hätten, aber ich glaube, Vonvalt ging wie Bressinger vor einem Monat noch davon aus, dass er ihn als Kranken- oder gar Totenbahre würde verwenden können. Schon längst hatte Vonvalt Boten in den kaiserlichen Farben ausgesandt, um die schlechten Nachrichten aus Galetal bekannt zu machen – und wir waren bei Weitem nicht die einzige Quelle für derlei Neuigkeiten.
Die Landschaft hier im äußersten Zipfel der Südmark von Guelich war hügelig, felsig und waldig. Das Gelände war zwar nicht so zerklüftet wie in den Tolsburger Marken, aber nichtsdestotrotz stark konturiert. Guelich hatte seit jeher den Ruf, eine außerordentlich schöne Provinz zu sein, voller duftender Kiefernwälder, klarer Flüsse und reichlich Wild, weshalb Adlige aus dem ganzen Kaiserreich hierher pilgerten und unvergessliche Jagdpartien abhielten. Burg Badenburg ragte wie ein Furunkel aus dieser Schönheit hervor, eine schartige, klobige, aber zweckmäßige Festung aus grauem Stein. Im fantasielosen Stil aus den Zeiten vor dem Kaiserreich gehalten, fehlte ihr alles moderne gotische Gepränge – was ihr jedoch an Schönheit abging, machte sie durch Unbezwingbarkeit wett, denn ihre Lage und Bauweise hatte die Hauner Armeen davon abgehalten, in die Grozodanische Halbinsel vorzudringen. Nach der Unterwerfung Haunersheims vor einem halben Jahrhundert und der darauf folgenden Verwandlung von Venland und Grozoda in Vasallenstaaten war die Burg als militärischer Stützpunkt obsolet geworden und diente nun nur noch als Residenz des dritten Kaisersohns.
Den Fahnen auf der Feste nach zu urteilen, war Prinz Gordan jedoch gerade nicht anwesend. Außerdem deuteten die aufgewühlten Felder vor den Toren, die Wildschweine und Füchse, die in dem Matsch nach Knochen suchten, und der unverwechselbare Gestank von Massenlatrinen darauf hin, dass hier bis vor Kurzem noch ein großes Heer gelagert hatte.
»Er ist nach Osten aufgebrochen, Exzellenz«, sagte der diensthabende Sergeant. »Ist noch keinen Tag her. Ist mit der Sechzehnten Legion losgezogen.«
»Mit der Sechzehnten Legion?«, fragte Vonvalt. »Nema. Wo war die denn stationiert?«
»Soweit ich weiß, Exzellenz, kam sie aus Kolsburg.«
»Wie stark?«
»Fast fünftausend Mann, Exzellenz. Ich glaube, der Prinz soll Belagerungsspezialisten in Aulen aufsammeln und dann die Kova hinaufsegeln.«
»Belagerungsspezialisten?«
»Ja, Exzellenz. Sie ziehen Richtung Rundstein in Haunersheim und von dort aus weiter nach Seewacht. Dem Kaiser wurde mitgeteilt, dass ihn einige seiner Lehnsleute im Norden verraten haben. Baron Naumov ist einer von ihnen. Ich glaube, der Markgraf Westenholtz gehört auch dazu.«
Vonvalt verzog das Gesicht. »Genau«, sagte er. Er klopfte sich auf die Brust. »Ich habe ihm die Nachricht gesandt. Wir kommen geradewegs aus Galetal.«
»Ich habe gehört, das Galetal sei geplündert worden«, sagte der Sergeant. »Dann stimmt es also? Der Prinz konnte es kaum glauben.«
»In der Tat«, sagte Vonvalt geistesabwesend. Er sah zu den Zinnen hinauf. »Ich muss ein paar Sachen hierlassen. Zunächst einmal meinen Esel und den Wagen.«
Der Sergeant nickte. »Was immer du brauchst, Exzellenz.«
»Und du sagst, der Prinz zieht nach Osten?«
»Ja, Exzellenz. Du reist nach Sova?«
»Mm.«
»Dann dürftest du ihn in ein, zwei Tagen einholen. Sie halten sich an die Badener Straße.«
Vonvalt nickte. »Danke, Sergeant«, sagte er, und wir zogen weiter.
Trotz Vonvalts Krankheit ritten wir nun stramm die Badener Straße hinunter. Überall trafen wir auf Spuren der Sechzehnten Legion: Speiseabfälle, in denen Aasfresser herumpickten, Exkremente von Menschen, Pferden und Eseln in großen Mengen, und natürlich waren die Straßenränder zu stinkenden Schlammgruben zertrampelt. Da wir nur zu viert waren und uns auf Pferden auf einer gepflasterten Straße bewegten, rechnete ich damit, dass wir die Nachhut des Heers innerhalb weniger Stunden erreichen müssten, spätestens aber innerhalb eines Tages, wie es der Sergeant geschätzt hatte. Fünftausend Mann – ungefähr viertausend davon zu Fuß, falls die Sechzehnte eine typische Legion war – waren ein schwerfälliger Haufen, der bei regnerischem Wetter mit Glück zehn oder fünfzehn Meilen am Tag zurücklegte.
Doch ich irrte mich. Vonvalt hatte mir oft von den Fähigkeiten der kaiserlichen Legionen erzählt, aber ich hatte es insgeheim für Übertreibungen gehalten. Sie mochten wohl den Ruf einer Elitestreitkraft haben, aber es waren dennoch nur Menschen mit allen Fehlbarkeiten, die damit einhergingen.
Aber wir ritten den ganzen Tag, schlugen ein Lager auf, das wir vor Morgengrauen wieder abbrachen, und ritten noch einen halben Tag weiter, bis wir die letzten Nachzügler des Trosses erreichten. Inzwischen war das Gelände um einiges offener, und wir befanden uns auf dem letzten Wegstück nach Sova.
Eine weitere halbe Stunde zu Pferd brachte uns an die Spitze der Armee, die anhand des Klüngels von Fahnenträgern, Musikern und Reichsgardisten – und natürlich dem Prinzen Gordan selbst – deutlich erkennbar war. Wir mussten von der Straße herunter und unsere erschöpften Pferde durch den Schlamm treiben, um an dem langen Zug aus abgestiegenen Rittern und Fußsoldaten vorbeizureiten. Ich staunte, dass sie so einheitlich mit guten Kettenpanzern und Wappenröcken in den leuchtenden Farben der Autunen – Rot, Gelb und Blau – ausgerüstet waren. Die meisten hatten auch Eisenhüte. Die Ritter, die nur einen Bruchteil des Heers ausmachten, besaßen unterschiedlich aufwendige Plattenharnische, trugen diese aber nicht auf dem Marsch, da sie weder vor Erschöpfung tot umfallen noch ihre Pferde überlasten wollten.
Prinz Gordan hatte das typische rote Haupt- und Barthaar der Haugenaten; Ersteres war von einem Topfhelm mit einer Krone darauf bedeckt, Letzteres kurz gestutzt. Er trug eine Kettenrüstung, darüber einen kostbaren Rock mit einem viergeteilten Muster in den Farben des Kaiserreichs, auf dem ein springender Autune prangte. Er hatte angenehme, schöne Gesichtszüge und schien gut gelaunt zu sein, als wir uns ihm näherten, denn er lachte gerade über den Witz eines seiner Gefolgsleute.
»Hoheit«, rief Vonvalt. Er zog nicht nur die Aufmerksamkeit von Prinz Gordan auf sich, sondern auch die aller Männer in dessen Nähe.
Der Prinz sah Vonvalt eine Weile verkniffen an, während Junker Radomir, Bressinger und ich uns schleunigst energisch verneigten. Dann zerteilte ein Grinsen seine Miene. »Das ist doch … Konrad, nicht wahr? Bei Nema!«
»Kein anderer, Hoheit«, sagte Vonvalt und berührte dabei mehr aus Hochachtung als aus Notwendigkeit die Stirn – denn schließlich stand ein Richter selbst noch über dem dritten Sohn des Kaisers. Nach Jahren des gemeinsamen Umherreisens, in denen ich sämtliche Aspekte seines Amtes kennengelernt hatte, vergaß ich nur zu rasch, wie viel Macht Vonvalt eigentlich innehatte.
»Meiner Treu, Mann, das ist ja nun schon, was, drei, vier Jahre her? Wann warst du das letzte Mal in Sova?«
»Das kommt ungefähr hin«, sagte Vonvalt und nickte in Richtung der Hauptstadt. »Aber nun bin ich dorthin unterwegs.«
»Und keinen Tag zu früh«, gab Prinz Gordan zurück. Er klang ernst, doch seine Miene behielt einen leichtfertigen Ausdruck. Wenn man sich schon lange kennt und mit den höchsten Adeligen des Reichs vertrauten Umgang pflegt, vergisst man leicht, wie viel Ehrfurcht sie einem zu Beginn eingeflößt hatten. Damals aber raubte es mir fast den Atem. Schließlich ritt nur zehn Schritte von mir entfernt, umgeben von den verschwenderischen Zeichen seines Standes und an der Spitze einer kaiserlichen Legion, einer der drei Prinzen des Kaiserreichs.
»Du bist auf dem Weg nach Rundstein?«
»Ja«, antwortete Prinz Gordan freundlich. »Baron Naumov will seinem Leben offenbar ein Ende setzen und hat eine eigentümlich langwierige und teure Methode gewählt, es sich zu nehmen.« Die Herrschaften und Gefolgsleute um ihn herum lachten, mancher aufrichtig, mancher weniger aufrichtig.
»Und dann weiter nach Seewacht?«
»Ja, du bist offenbar im Bilde.«
»Ich war derjenige, Hoheit, der den Verrat aufgedeckt hat«, sagte Vonvalt. »Und ich habe Seine Majestät darüber informiert.«
»Ah!«, sagte Prinz Gordan. »Mein Vater hat dich nicht namentlich erwähnt, er hat lediglich gemeint, ein Richter habe ihn von dem im Haunerschen geschmiedeten Komplott in Kenntnis gesetzt. Er ist dir gewogen, Junker Konrad. Du solltest das tunlichst ausnützen, denn seine Gunst ist sehr kurzlebig!«
Darauf war noch mehr aufgeblasenes Lachen zu hören. Ich fragte mich, ob es anstrengend war, Gefolgsmann des Prinzen zu sein.
»Ich habe fest vor, deinem Vater einen Besuch abzustatten.«
»Gut so«, sagte Prinz Gordan. »Ich frage mich jedoch, ob du mich nicht lieber begleiten solltest? Dein Ruf als fähiger Schwertkämpfer eilt dir voraus – und ich habe immer Platz für kluge Köpfe.«
Vonvalt verneigte sich ehrerbietig. »Wenn ich nur könnte, Hoheit. Aber ach, wie es scheint, herrscht ziemlicher Aufruhr im Orden – und ich selbst bin kein junger Hüpfer mehr.«
Prinz Gordan sah ihn abschätzend an. »Ja«, sagte er, »du wirkst ein wenig blass. Hast du etwas Schlechtes gegessen?«
»Ich weiß den Grund meines Leidens nicht, Hoheit – nur dass es nicht ansteckend ist.«
Dies setzte er hinzu, um den Prinzen und seine Männer zu beschwichtigen, denn Armeen hatten von einer Seuche mehr zu fürchten als von den Machenschaften des Feindes.
»Nun, dann sieh zu, dass du die kaiserliche Ärztin aufsuchst, Exzellenz, obwohl die vermutlich kaum mehr tun wird, als dir Unmengen Blut abzuzapfen und dir obendrein einen kräftigen Schluck Pisse zu trinken zu geben.«
Vonvalt verneigte sich erneut. »Vielen Dank, Hoheit! Darf ich fragen, ob sich deine Pläne damit erschöpfen? Hast du von weiteren Aufständen gehört? Westenholtz wurde gehängt, aber Naumov hat vielleicht noch mehr Rebellen unter seinem Banner geschart.«
Prinz Gordan zuckte mit den Schultern. In diesem Augenblick erkannte ich, dass er ein schlichter Mensch war, der zwar eine Legion in die Schlacht führen konnte, sich aber nicht die Mühe machte, allzu viele Fragen zu stellen oder die größeren Zusammenhänge verstehen zu wollen. Ich stellte mir vor, dass ihm die Jagd und das Zechen mit seinem engeren Freundeskreis mehr Spaß machte als der beschwerliche Regierungsalltag.
»Manchmal vergesse ich, dass ihr Richter im Inneren Gesetzeshüter seid, mit eurer Fragerei! Ich kenne die Entwicklungen und Pläne der Verräter nicht im Einzelnen, Exzellenz, ich weiß nur, dass ich sie töten und ihre Ländereien beschlagnahmen soll.« Er machte eine wegwerfende Geste, und nun sah ich zum ersten Mal während unserer Begegnung, dass sich unter seinen Gefolgsleuten Unmut regte – ein Blickwechsel, eine hochgezogene Augenbraue. »Darüber sprichst du besser mit meinem Vater. Ich fürchte, ich verfüge nicht über seinen Scharfsinn.«
»Ich bin überzeugt, dass dem nicht so ist«, sagte Vonvalt.
Prinz Gordan kicherte. »Tja, lass dich nicht weiter von mir aufhalten, Richter«, sagte er. »Bestell meinem Vater bitte Grüße. Ich vermute, ich werde erst in einem Jahr wieder in die Hauptstadt kommen, vielleicht sogar noch später.«
»Das werde ich, Hoheit«, sagte Vonvalt und berührte erneut seine Stirn. Der Prinz tippte im Gegenzug an seinen Helmrand, und dann ritten wir rasch auf der Badener Straße weiter, um etwas Abstand zwischen uns und die unerbittlich vorrückende Sechzehnte Legion zu bringen.
»Nun, das nimmt dem Ganzen den Stachel«, sagte Vonvalt, während wir unser Tempo etwas verlangsamten, um die Pferde zu schonen.
»Wie meinst du das?«, fragte Junker Radomir.
Vonvalt machte eine Bewegung nach hinten. »Eine Legion, die aufreibt, was von der Rebellion von Westenholtz und Naumov übrig ist, und in der Nordmark von Haunersheim wieder Ordnung schafft.« Ich sah gleich, wie sich diese gute Nachricht auf Vonvalt auswirkte. Er wirkte ruhiger und entspannter – und sogar gesünder. Ich fragte mich, ob sein Leiden vielleicht nur die Folge des unglaublichen Drucks gewesen war, der auf ihm gelastet hatte.
»Es überrascht mich, dass sie erübrigt werden kann«, murmelte Bressinger.
Vonvalt schüttelte den Kopf und tätschelte Vincentos Hals. »Haunersheim ist das Rückgrat des Kaiserreichs. Wäre es irgendeine Provinz, würde ich dir recht geben.« Er stärkte sich mit einem tiefen Atemzug. »Es gibt noch reichlich zu tun, aber darüber brauchen wir uns wenigstens keine Sorgen mehr zu machen. Auf ein derart entschlossenes Eingreifen hatte ich gehofft.«
Vonvalts plötzliche Zuversicht war ansteckend. Ich erinnere mich daran, wie ich auf das fünftausend Mann starke Heer aus Reichskriegsveteranen zurückgeblickt habe, mit ihren teuren Waffen und Rüstungen und angeführt vom Sohn des Kaisers. Ich gestattete mir, auch etwas von Vonvalts Zuversicht zu empfinden. Schließlich verfügte der Kaiser über ungefähr fünfzig Legionen in unterschiedlichen Bereitschaftszuständen auf das gesamte Reich verteilt. Was konnten Claver, die Mlyanarer, die Templer oder sonst irgendjemand gegen diese erdrückenden Zahlen ausrichten?
Tatsächlich haben wir – und nahezu der Rest der Welt – Prinz Gordan und die Sechzehnte Legion nie wieder gesehen. In nur wenigen Monaten sollten sie in den Wäldern von Haunersheim gleichsam vom Antlitz der Erde verschwinden.
Aber ich darf nicht vorgreifen.
II
Meister des Magistratums
»Sova ist ein Wunder, eine Augenweide,eine Stadt, die auf Erden ihresgleichen nicht hat.«
Oberpräfekt Ansgar Reinhold
Sova.
Ich könnte mehrere Bände schlicht mit ihrer Beschreibung füllen, und es würde immer noch nicht genügen. Ich habe Wandteppiche, Mosaike und Fresken gefeierter Künstler gesehen, habe hundert – nein, tausend – Geschichten und Lieder über Sova gehört, habe Buch um Buch über seine Geschichte, seine Baukunst, seine Kultur gelesen …
Aber sie mit eigenen Augen zu sehen, ist dennoch unvergleichlich. An einem Sommernachmittag ihre heißen Pflastersteine unter den Füßen zu spüren. In die Masse aus Menschen verschiedenster Völker und Glaubensrichtungen einzutauchen, die ohne Unterlass und ohne sich zu beschimpfen, ihr Leben leben, vereint durch die gemeinsame sovanische Staatsbürgerschaft. Das Brüllen der Menge in der Arena zu hören. Sich zu strecken, um die Turmspitzen der riesigen Tempel und Paläste zu sehen, die dem Licht zuzustreben scheinen wie die Wipfel der Bäume im Wald.
Wenn ich an diese meine erste Annäherung an Sova auf der Badener Straße zurückdenke, nachdem die gewaltigen Kiefernwälder Guelichs dem Grasland der Ebene gewichen waren, fällt mir ein, wie mich plötzlich eine überwältigende Ehrfurcht erfüllte. Selbst von der Böschung aus, auf der wir in zehn Meilen Entfernung standen, erschienen die Ausmaße der Stadt atemberaubend. Wie konnte etwas derart Mächtiges überhaupt bedroht werden? In Galetal war mir Westenholtz mit seiner Armee von fünfhundert Mann unbesiegbar vorgekommen, wie eine große und furchterregende Streitmacht, gegen die die Stadt wehrlos war. Um Sova zu stürmen, bräuchte man jedoch eine tausendmal größere Armee.
»Da ist es«, sagte Vonvalt. Er war schon oft in Sova gewesen – er besaß dort sogar ein Haus auf dem Präfektengipfel –, aber ich merkte, dass nicht einmal er sich vor Staunen beherrschen konnte.
Die sanft gewellte, gold-grüne Sovanische Ebene breitete sich nach allen Seiten aus, eine gewaltige Graslandhochebene, durchbrochen vom breiten, von der Sonne silbern übergossenen Sauber, einem halben Dutzend wichtiger Straßen, Ackerland und dem Häusermeer, das sich außerhalb der Stadtmauern wie eine riesige, rauchende Wunde ausdehnte. Überall herrschte Betrieb, ungeachtet der düsteren Regenvorhänge, die stoßweise über die Ebene fegten: Dutzende Handelsschiffe auf dem von Anlegern gesäumten Sauber, Bauernknechte auf den Feldern, Menschen auf den Straßen … Die Vorstellung, wie viele Nahrungsmittel jeden Tag in die Stadt geschafft werden mussten, machte mich schwindelig.
Die Stadt selbst türmte sich wie ein Bienenstock, in dessen Zentrum die größten Bauwerke der bekannten Welt standen. Die aufragenden Türme und Tempel und Paläste in der Ferne schienen … unmöglich hoch zu sein. Das höchste Gebäude des Kaiserreichs war der Turm des heiligen Velurian, der zum Tempel des Savare, des Gottvaters, gehörte, und ich sah ihn am westlichen Rand des Zentrums aufragen – tausend Fuß hoch. Eine Meile östlich davon stand der Kaiserpalast, eine pyramidenförmige Festung aus schwarzem Marmor mit Erkern und Statuen. Sein höchster Turm erreichte drei Viertel der Höhe des Turms des heiligen Velurian. Dies waren jedoch nur zwei der Kolossalbauten. Die übrigen reihten sich wie mächtige Grabmonumente der Fürsten des Universums auf.
»Bei Nemas Blut«, sagte Junker Radomir. Auch er hatte Sova nie zuvor erblickt. »Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch einmal zu Gesicht bekomme.« Er trank einen Schluck Wein. »Ich wusste nicht, dass Menschenhände solche Wunderwerke errichten können.«
»Heute können sie das auch nicht mehr«, sagte Vonvalt etwas kryptisch. Ich erinnerte mich vage, dass Vonvalt einmal von uralten, magischen Beigaben erzählt hatte, aus der Zeit, als derlei Zauberkunst noch gebräuchlicher gewesen war. Diese verankerten die riesigen Bauwerke im Fels. Aber eingehender hatten wir nie darüber gesprochen. »Natürlich existieren die Überlieferungen noch in Büchern, irgendwo in der Bibliothek des Rechts. Doch es erinnert sich schon lange niemand mehr an das Wissen und die Mittel, die man benötigt, um diese Kunst anzuwenden.«
Wir saßen auf unseren Pferden und sahen uns noch eine Weile an der Aussicht satt, bevor Vonvalt schließlich sagte: »Kommt. Lasst uns weiterreiten. Schwierige Aufgaben harren unser.«
Sova war von einer zwanzig Meilen langen Mauer umschlossen, die an der niedrigsten Stelle fünfzig Fuß hoch war, und es gab nur vier Zugänge – ein Tor in jeder der vier Himmelsrichtungen. Die Badener Straße führte von Norden in die Stadt durch die größte und eindrucksvollste Torbefestigung: das Wolfstor.
»Bei Nema«, murmelte ich, als wir durch das Tor ritten. Hier war die Mauer sogar noch höher, sechzig oder siebzig Fuß hoch, und war Teil einer bedrohlichen Torburg, die die meisten Burgen in der Provinz in den Schatten stellte. Das Eindrucksvollste daran war aber die kolossale Autunenstatue in schwarzem Stein, deren Pranken die Mauerkrone umklammerten. Ein Kopf des Wolfes sah nach Norden, der andere nach Osten. Mir war, als würde er mich anschauen, und ich konnte ein ehrfürchtiges Zittern nicht unterdrücken.
Es war Abend, als wir die Pferde durch das Wolfstor trieben, die Straße wurde vom Honiglicht der untergehenden Sonne und einem Dutzend signalfeuergroßer Kohlenpfannen beschienen. Geharnischte Wachen in den Farben des Kaiserreichs blickten mit Piken in den Händen von den Mauerzinnen herab, während sie zwischen Dutzenden kutschengroßer Steinschleudern hin und her schritten. Um uns und vor uns drängten sich geschäftig Hunderte Menschen aller Hautfarben und Glaubensrichtungen, die jede Art von Kleidung trugen – Gemeine, Adlige, Kaufmannssöhne und ihre Gefolge, Senatoren in ihren weißen Amtsroben, Südflachländer mit ihren fremdartigen Kleidern und Haartrachten, nemanische Mönche und Nonnen, Templer, Soldaten in Uniform und schlicht jeder Menschentyp, den man sich vorstellen konnte. Manche waren beritten wie wir, andere nicht. Am Hafen von Galetal hatte ich ein paar Leute gesehen, die nicht aus Haunersheim stammten, aber hier waren Fremde genauso häufig wie Sovaner. Es gab alle Hautschattierungen, alle Haarfarben, alle Kleidungstypen – und sie alle schwirrten umher wie Bienen im Bienenstock, ihre Zielstrebigkeit, ihre … Geschäftigkeit waren überwältigend. Ich kam mir vor wie Treibholz auf einem riesigen Ozean, das von Menschenströmungen mitgerissen wird.
»Ich … ich habe noch nie so viele Menschen an einem Ort gesehen«, lautete mein stockender Versuch, eine Unterhaltung zu führen. Keiner meiner Begleiter konnte mich hören. Der Lärm war unglaublich. Überall wurde gesprochen, dazu das Klappern der Hufe, das Rattern und Quietschen der Wagenräder, das Stapfen der Soldatenstiefel, das Rufen und Schreien Tausender Menschen.
»Haltet euch dicht bei mir«, rief Vonvalt über seine Schulter, während er sich durch die Menschenmasse drängte wie der Rumpf einer Karacke, die sich durchs Eis schiebt.
Hinter der Furcht einflößenden Festung des Wolfstors befand sich ein großer, mit abgewetzten Steinplatten gepflasterter Platz, eine Verlängerung der Badener Straße, die im Stadtzentrum, wo der Sauber sich in drei Arme teilte, über einen führte und dann vor einem gigantischen Bauwerk im Stil der saxanischen Gotik endete, das, wie ich bald erfahren sollte, den Kaiserlichen Gerichtshof beherbergte. Links lag der Hauptmarkt der Stadt, der zwar schon geschlossen hatte, auf dem aber immer noch viel Betrieb herrschte, während sich dahinter, in den Windschatten der Estrischen Mauer geduckt, ein stinkender Wirrwarr von Gebäuden und Lagerhallen erstreckte, der das anrüchige Handwerkerviertel beherbergte – Gerbereien, Gießereien, Schlachthöfe und Schmieden.
Rechts stieg das Gelände an und bildete einen natürlichen, eine Viertelquadratmeile messenden Hügel – an der Stelle war die Stadtmauer entsprechend höher –, auf dem prunkvolle Paläste aus Stein, Ziegeln und Holz standen. Dies war der Präfektengipfel, auf dem die Reichen und Herrschenden wohnten und wo Vonvalt selbst ein einigermaßen bescheidenes Anwesen samt Gesinde besaß.
Doch schlugen wir nicht die von Bäumen gesäumte Straße zum Gipfel ein, die wiederum von einem Tor bewacht wurde. Sondern wir folgten der Badener Hauptstraße – wie sie innerhalb der Stadt genannt wurde – in Richtung der Creusstraße, die uns schließlich zur Großen Loge führen würde, dem Sitz des Ordens des Magistratums.
»Du willst bei Meister Kadlec vorstellig werden?«, fragte Bressinger Vonvalt.
»Ja«, gab Vonvalt zurück. Ich merkte, dass seine Krankheit ihm wieder Beschwerden bereitete. Seine gute Laune infolge unserer Begegnung mit der Sechzehnten Legion schien sich wieder zu verflüchtigen. Das Gespräch mit Kadlec versprach schwierig zu werden.
»Fühlst du dich auch gut?«, fragte ich leise – aber nicht zu leise, denn ringsum herrschte ein Lärm, als stünde man direkt an einem Wasserfall.
Vonvalt sah zu mir herüber. »Nichts, was ich mit einmal Ausschlafen nicht loswerden würde«, antwortete er.
Wir ritten weiter, hatten den weiten Platz hinter dem Wolfstor überquert und gelangten in ein Dickicht aus Geschäften. Der Großteil des nördlichen Teils der Stadt schien dem Handwerk gewidmet zu sein, und über uns hingen so viele Ladenschilder, dass ich mir wie in einem Wald vorkam. Die schiere Menge und Verschiedenartigkeit der feilgebotenen Waren machte mich sprachlos. Vor einem Laden mit makellosen Fensterscheiben musste ich einfach stehen bleiben und mir die schönen farbenfrohen Kleider mit Goldstickereien, skandalös tiefen Ausschnitten und Schlitzen über den Schenkeln anschauen. Sie prangten an polierten Holzpuppen, doch es war keinerlei Kopfputz zu sehen – der in den Provinzen noch immer ziemlich verbreitet war, vor allem bei älteren Frauen.
»Helena!«, rief Bressinger schroff, da sich der Abstand zwischen uns rasch vergrößerte.
Ich eilte ihm nach, wurde aber bald schon von einem weiteren Schaufenster abgelenkt, in dem ebenfalls Kleider zu sehen waren, und dann von einem dritten, in dem kostbare Schuhe und Stiefel aus Leder aufgereiht waren, und dann von noch einem, das bis oben hin mit Reithosen angefüllt war. Qualität und Kunstfertigkeit der Waren schienen mir unvergleichlich zu sein. Sie ähnelten nichts, was ich je gesehen hatte. Selbst die teuren Kleider, die Vonvalt mir bei den Händlern in Haunersheim und Tolsburg gekauft hatte, konnten da nicht mehr mithalten.
Der Anblick der Schaufenster gemahnte mich sogleich an meine Kindheit in Muldau, wo ich im Dunkeln gezittert hatte mit schmerzhaft gefrorenen Füßen, weil ich in durchnässten Schuhen durch Schneewehen gestapft war. Und nun standen vor mir Hunderte Paar feinster Ledergaloschen, von denen ein jedes zehn Jahre oder länger gehalten hätte.
In mir entbrannte ein eigenartiger Widerstreit. Einerseits wollte ich zu dieser schlichten, ehrlichen Version meiner selbst zurückkehren, die ich in Tolsburg gewesen war. Aber mein Verstand erinnerte sich an das schreckliche Leben damals und hielt das Glück dagegen, das ich nun hatte. Doch obwohl ich mir das meiste, was in diesen Läden ausgestellt war, hätte leisten können, empfand ich aus irgendeinem Grund doch fast nur Verbitterung.
»Helena!«, rief Bressinger erneut. Sie waren schon weit voraus, jenseits der Badener Brücke, und bogen in die Creusstraße ein.
Ich eilte ihnen nach, schlängelte mich an den abendlichen Einkäufern vorbei und schloss auf der Creusstraße zu ihnen auf.
»Das ist der Philosophenpalast«, erklärte Vonvalt, als ich bei ihm anlangte, und zeigte auf ein gigantisches Gebäude im Stil der saxanischen Gotik – voller Strebepfeiler, Wasserspeier und sehr düster. Es ähnelte der Arena im Südosten, nur dass es nicht von einer großen Kupferkuppel überwölbt war und einem der großen sovanischen Bürgerideale diente: der Debatte.
»Was ist das?«, fragte ich und wies auf ein kreisförmiges Gebäude aus weißem Marmor, um das sich ein Ring aus Pfeilern zog, die allesamt von Statuen bedeutender sovanischer Adliger oder Wasserspeiern gekrönt waren.
»Das ist der Senat«, sagte Vonvalt.
»Und das da?«, zeigte ich über den Fluss nach Osten.
»Das ist der Nematempel, und das ist der Savaretempel – den werden wir noch besuchen, keine Sorge –, dort ist der Creustempel, und das ist die Große Loge«, erklärte Vonvalt, während er auf eine Reihe imposanter Bauwerke wies. »Das ist der Kaiserliche Gerichtshof, und dort ist der Kaiserpalast.«
Die letzten beiden erhoben sich direkt vor uns, und man konnte sie gar nicht in Gänze in Augenschein nehmen, ohne den Hals in den wolkigen, zwielichtigen Himmel zu recken.
»Was für ein Anblick«, murmelte ich. Seit meinen Kindertagen hatte ich mir die Stadt Sova vorzustellen versucht. Aber ich hätte nie gedacht, dass sie so … furchterregend war. Überwältigend und ehrfurchtgebietend, sicher, aber auch düster voller barscher, bedrückender gotischer Architektur. Ich kam mir vor wie auf einem gewaltigen Friedhof. Von lauter so erhabenen staatlichen Einrichtungen umgeben zu sein, war wundersam, aber auch erdrückend, als wäre die Stadt ein Eisenschuh, der sich auf meine Kehle stellte. Auch der beständige Menschenstrom vermochte dieses klaustrophobische Gefühl nicht zu lindern. Meine Sinne waren überreizt, ich bekam meine Gefühle nicht in den Griff, schwankte ständig zwischen Schwindel, Verbitterung und Angst.
»Ja, das ist es«, sagte Vonvalt, seufzte noch einmal und fügte hinzu: »Warte einen Monat, dann wirst du diese Stadt satthaben.«
Wir ritten weiter zur Großen Loge. Hier herrschte so viel Betrieb wie in Galetal zur geschäftigsten Stunde am Markttag, nur dass hier keine Gemeinen und Kaufleute herumwuselten, sondern Trauben von Rechtsgelehrten in ihren Gerichtshemden und -roben, die im Kaiserlichen Gerichtshof gerade Feierabend gemacht hatten, sowie Richter – auf diesem halben Morgen großen Vorplatz waren bestimmt mehr von ihnen als im gesamten Rest des Kaiserreichs zusammengenommen. Allerdings waren dies nicht die fahrenden Richter, wie ich sie von Vonvalt oder Richterin Edle August kannte. Vielmehr waren es Juristen, Richter, die zu alt oder gebrechlich fürs Reisen geworden waren oder diesen Aspekt ihres Amtes aus einem anderen Grund aufgegeben hatten. Nur wenige taten dies freiwillig, denn die fahrenden Richter bildeten den Kern des Ordens und genossen das größte Ansehen.
Die Große Loge war der Sitz des Ordens des Magistratums. Das riesige Gebäude bestand im Grunde aus einem einzigen, rechteckigen, mehrere Hundert Fuß hohen Turm, der auf einem kastenartigen Sockel aus weißem Stein saß. Diesen durchzogen wie Honigwaben die Wohn- und Arbeitsräume der Juristen. An der Spitze des Turms hing eine Glocke, und über ihr ragte eine Kolossstatue des Autunen auf, denn einer der Köpfe des Autunen stand für das Richterrecht. In schwarzem Eisen prangte die Inschrift »Niemand steht über dem Gesetz« auf Hochsaxanisch am Gebäude.
Mich durchlief ein Schauer, als ich diese achtungsgebietenden Worte las und die Statue und die Loge selbst erblickte. Dies war das Zentrum der Ordnung des Kaiserreichs, ein Monument des weltlichen Richterrechts, und es war ein Bauwerk, das Demut und Furcht einflößte. Es schien, als nähme es zwei Dimensionen ein, die Sphäre der Sterblichen, in der es lediglich ein Gebäude aus Stein war, und die Astralsphäre, in der in meiner Fantasie große Bögen von Elmsfeuer flackernd und knisternd von ihm wegstrebten. Dort war das Gesetz nicht nur ein abstraktes Konzept, sondern eine Naturgewalt, die die Bürger des Reichs mit Prügeln zu Gehorsam und Unterwerfung rief.
Das Gefühl verblasste nicht, als wir uns der festungsartigen Fassade näherten, sondern intensivierte sich eher noch. Angesichts seiner Zauberkräfte, seiner Fechtkünste und seiner Amtsbefugnisse konnte man Vonvalt durchaus fürchten. Und wir standen im Begriff, ein Gebäude zu betreten, das voll war mit solchen Menschen – außerdem rechneten wir mit einer Auseinandersetzung. Angeblich hatte sich Kadlec mit der Nemakirche zusammengetan und um eines ruhigen Lebens willen die Zauberkünste des Ordens veräußert. Dies barg das Potenzial für eine schwierige – ja gar gewalttätige – Konfrontation.
Wir traten durch eine in einem weitaus größeren Tor eingelassene Pforte. Jetzt erst fiel mir auf, dass die anderen Richter in ihrem Tun innehielten und uns – oder vielmehr Vonvalt – anschauten. Ich hatte Vonvalt noch nie in seiner angestammten Umgebung erlebt, und ich hatte keine Ahnung, wie seine Kollegen über ihn dachten. Diese ersten Reaktionen jedoch sprachen von keinem geringen Maß an Hochachtung oder gar Ehrfurcht.
»Junker Konrad scheint im Orden angesehen zu sein«, flüsterte ich Bressinger zu.
»Junker Konrad ist der führende Richter des Kaiserreichs«, antwortete Bressinger leise. »Du wirst gleich sehen, wie viel Macht er tatsächlich besitzt.« Mit diesen bedeutungsschweren Worten trat er ins Atrium der Loge.
»Die Halle der Gerechtigkeit«, sagte Vonvalt und blickte staunend in den Turm hinauf. Ich war nicht davon ausgegangen, dass der gigantische viereckige Pfeiler der Großen Loge innen hohl war, aber er war es. »Lange habe ich sie nicht mehr gesehen.«
Bressinger grunzte zerstreut. Ich vergaß nur allzu leicht, dass Dubine als Vonvalts altgedienter Vollstrecker all das schon einmal gesehen hatte. Ihm waren die Wunder Sovas genauso vertraut wie Vonvalt.
»Hier entlang«, sagte Vonvalt, und wir setzten unseren Weg über kalten Marmorboden zum anderen Ende der Halle fort, wo die vielen Büros und Kammern der Logenrichter begannen.
»Wer wohnt hier denn?«, fragte Junker Radomir. »Die ganzen Richter, wie du einer bist, Junker Konrad?«
»Erkläre es ihm, Helena«, sagte Vonvalt. »Dann sehen wir, wie viel du aus deinen Lektionen behalten hast.«
»Alle Richter haben hier ihre Kammer«, sagte ich, wobei ich in Sprüngen hinter Vonvalt herlief, um mit ihm Schritt zu halten. »Fahrende Richter wie Junker Konrad sind nur ein Teil der Loge. Diejenigen, die nicht mehr reisen, werden zu Rechtsgelehrten.«
»Büchermenschen«, bemerkte Junker Radomir abfällig.
»Wenn du meinst«, sagte Vonvalt.
»Hier befindet sich auch das Büro des obersten Sekretärs. Sekretäre sind für den Erhalt der Bibliothek des Rechts verantwortlich und zeichnen die Urteile der fahrenden Richter auf.«
»Noch mehr Büchermenschen«, sagte Junker Radomir.
»Ich fürchte, das Magistratum dürfte ein sehr langweiliger Ort für dich sein«, erwiderte Vonvalt.
Wenn sich das nur als wahr erwiesen hätte!
»Sitzt hier nicht auch die Kaiserliche Abfasserin?«, sagte ich etwas unsicher.
»Nein«, gab Vonvalt zurück. »Die ist im Palast.«
»Was macht die denn?«, fragte Junker Radomir.
»Sie verwandelt die Erlasse des Kaisers und des Senats in Gesetze«, erklärte Vonvalt.
»Dann ist sie also eine Schreiberin?«
Vonvalt gab zwar ein leises, fassungsloses Lachen von sich, aber keine Antwort.
Wir bewegten uns rasch durch dieses alte Gewirr aus warmen, holzvertäfelten Gängen, die mich an die Labyrinthtunnel des Klosters von Galetal erinnerten. Alles war prunkvoll, wie man es von einem reichen, erhabenen Ort des Rechts erwartete, überall standen Büsten und hingen goldgerahmte Ölgemälde.
»Die tragen nicht alle die gleichen Gewänder«, bemerkte Junker Radomir mit einem Anflug von Abscheu, nachdem er hin und wieder durch offen stehende Türen gelinst hatte. Der Wachtmeister schien Bressingers Verachtung gegenüber Amtspersonen zu teilen, was nicht der Ironie entbehrte, denn sie waren ja selbst welche.
»Hier hat auch die Laiengerichtsbarkeit ihren Sitz – die sovanische Justizgewalt. Nicht jeder Rechtsgelehrte ist ein Richter, vielmehr ist das Gegenteil der Fall«, sagte Vonvalt. »Kronanwälte sind ebenfalls Laienrechtsgelehrte. Von denen werdet ihr hier viele sehen, es gibt aber auch etliche, die Privatpraxen betreiben so wie die Verteidiger.«
»Und die leben nicht hier?«
»Die Verteidiger?«
»Ja.«
»Nein. Es gibt ein Justizviertel in Sova, dort findet man sie. Ursprünglich nur in Zobryvgarten, aber inzwischen ist es ein ganzer Stadtteil.«
Vonvalt führte uns in den hinteren Teil des Gebäudes. Hier öffnete sich ein weiterer Saal. Auf der gegenüberliegenden Seite, flankiert von zwei riesigen Fenstern, die nach Osten hinausgingen, wo der Kaiserpalast in den Himmel ragte, führte eine breite Treppe nach oben, teilte sich und knickte dann zweimal in die entgegengesetzte Richtung ab, bevor sie ein Mezzanin erreichte. Dort stiegen wir hinauf und gingen durch einen kürzeren Gang in entgegengesetzter Richtung zurück. Er endete an einer großen Tür, eingefasst von zwei Marmorsäulen und vom sovanischen Wappen bekrönt.
Vonvalt ging direkt darauf zu und klopfte energisch an. »Nathan. Ich bin es. Konrad.«
Wir warteten ein paar Sekunden. Spannung nagte an mir. Alle möglichen Szenarien liefen in meinem Kopf ab.
»Herein!«
Wir traten ein. Es war ein großes Zimmer mit Blick auf die Stadt. Gegenüber stand ein riesiger Schreibtisch aus poliertem dunklem Holz, und dahinter saß auf einem großen, thronähnlichen Stuhl der Meister des Magistratums, Nathanael Kadlec.
»Bei Nema, Konrad«, sagte Kadlec und erhob sich. Ein Lächeln zerknitterte sein runzliges Gesicht. Er war ein schrumpeliger alter Mann, untersetzt und von kräftigem Körperbau, aber unter der Last seines Alters und seiner Verantwortung – und seines Verrats – erschlafft. Er war in die schwarze Robe eines Richters gekleidet, allerdings mit kostbarem Hermelin besetzt. An seinen dicken Fingern glänzten Rubinringe, und das Silbermedaillon, das er trug – ein aufgeschlagener Kodex über dem springenden Autunen –, kennzeichnete ihn als einen Hochadligen und Oberpräfekten.
Das war nicht das, womit ich – oder die anderen – gerechnet hatte. Ich hatte mir Kadlec eingeschüchtert, nervös – vielleicht sogar furchtsam – vorgestellt und nicht als ein Muster vergnügter Hilfsbereitschaft.
Noch mehr aber überraschte mich Vonvalts Verhalten. Auch er lächelte und lief auf seinen Meister und vormaligen Lehrer zu und umarmte ihn.
»Nema«, sagte Kadlec und klopfte Vonvalt grob auf den Rücken. »Du stinkst wie ein Pferd. Reitest du noch immer dieses Schlachtross? Wie hast du ihn genannt? Vincento?«
»Genau den«, sagte Vonvalt und wies, sich umwendend, auf uns, um uns vorzustellen.
»Dubine Bressinger, bei meinem Leben«, sagte Kadlec. »Wie geht es dir, mein Sohn?«
Bressinger verneigte sich ein wenig steif. »Mir geht es gut, Meister. Einigermaßen.«
»Diesen Mann kenne ich nicht. Wer bist du, Junker?«
»Ich bin Junker Radomir Dragić«, gab dieser, ebenfalls ein wenig verlegen, zurück. Es ärgerte mich, dass Bressinger und er sich nicht besser verstanden. Sie waren sich in vielerlei Hinsicht so ähnlich.
»Junker Radomir ist der ehemalige Wachtmeister von Galetal und gehört nun zu meinem Stab.«
»Ah, natürlich«, sagte Kadlec und zeigte zum ersten Mal eine Spur Missfallen. Doch verflog es schnell wieder. »Und du musst Helena sein«, sagte Kadlec, und sein Blick ruhte auf mir.
Meine Nerven waren ein Knoten. »Woher …?«
»Du hast doch wohl nicht geglaubt, dass sich Junker Konrad ein Lehrmädchen nehmen – und es mit Magistratumsmitteln bezahlen! – könnte, ohne dass ich davon weiß, oder?« Er sprach mit einem Funkeln in den Augen, und ich fühlte mich von seiner Art vollständig entwaffnet. Es war bei Weitem nicht die schwierige Konfrontation, die ich erwartet hatte.
Kadlec lud uns ein, uns zu setzen, und schickte einen Diener nach Getränken.
»Nun, Konrad, du bist uns nun weit über zwei Jahre lang ferngeblieben. Ich habe von deinem Pech in der Südmark gehört«, sagte er, und seine Augen blitzten hinüber zu Junker Radomir. »Und ich habe vom Mord an Resi erfahren. Eine widerliche Angelegenheit und ein Zeichen der Zeit, wie ich fürchte.«
Hier bekam Vonvalts Miene feine Risse. »Widerlich ist der richtige Ausdruck«, bestätigte er. Ich sah zu ihm hinüber und erwartete, dass er erklären würde, dass Richterin August im Prinzip noch am Leben war, zumindest ihr Körper, und dass man sie in einem Hospiz in Galetal pflegte. Aber er tat es nicht.
»Resi hat mich gewarnt, dass der Orden in Schwierigkeiten sei. In politischen Schwierigkeiten«, spezifizierte er. »Ich habe allerhand Gerüchte gehört.« Er hielt inne. Es war seltsam. Trotz des Unterschieds an Jahren und Erfahrung fühlte es sich so an, als wäre Vonvalt der Meister. »Vieles davon hat mir Sorgen bereitet, aber ich bin überzeugt, dass sie nur wenig begründet sind«, fügte er mit einem affektiert herzlichen Lächeln hinzu.
Kadlec wollte etwas erwidern, nutzte dann aber die Ankunft der Getränke, um seine Gedanken zu ordnen. Gerne nahm ich den angebotenen Weinkelch, den ich etwas zu schnell austrank.
»Tja, nun«, sagte Kadlec, »das Leben in der Hauptstadt wurde im vergangenen Jahr ziemlich dornig.«
»Oha?«
Kadlec nickte. Ich fragte mich, über welche Zauberkräfte er verfügte. Vonvalt hatte erzählt, dass er ein versierter Nekromant sei, und die Kaiserstimme würde er wohl wie jeder andere Richter auch einsetzen können. Aber hatte er noch eine dritte Sehne auf seinem Bogen?
»Du hast bestimmt vernommen, dass sich der Senat und die nemanische Kirche gegen uns zusammengetan haben?«
»Du vergisst, dass ich Markgraf Westenholtz aufgehängt habe«, erinnerte ihn Vonvalt.
Kadlec kicherte düster. »Oh, ich weiß«, sagte er. Er machte eine ausladende Geste. »Die ganze Stadt weiß davon. Die Mlyanarer sind ganz schön ausgerastet. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Und die Allianz mit den Templern bestärkt sie zusätzlich.«
»Ich habe mit einem Kollegen aus dem Senat gesprochen. Er hat ein sehr … beunruhigendes Bild des Ordens gezeichnet. Er scheint weniger unparteiisch zu sein als während meines letzten Aufenthalts in der Stadt.«
Kadlec sah Vonvalt an. Die beiden schlichen um den heißen Brei herum und bemühten sich um Höflichkeit, so wie Juristen vor Gericht versuchten, sich gegenseitig mit professionellem Respekt zu behandeln.
»Welcher Senator war das?«, fragte Kadlec etwas schärfer, als er es meines Erachtens beabsichtigt hatte.
»Das spielt keine Rolle. Ich vertraue seinem Urteil.«
Es folgte wieder eine Pause.
»Wir haben Schwierigkeiten gehabt, ja«, sagte Kadlec. Seine Freundlichkeit hatte sich verflüchtigt. »Die Sekretäre haben es zuerst bemerkt. Unvereinbarkeiten bei den Urteilen. Unangemessene Nachsicht gegenüber Mlyanarern oder Leuten mit Verbindungen zu den Mlyanarern – vor allem in Haunersheim. Der Kaiser hat den Edlen Steuern auferlegt, um die Legionen für die Erweiterung am Ostufer der Kova zu finanzieren, aber du weißt genauso gut wie ich, dass dieses militärische Vorhaben gescheitert ist. Viele, die in der Provinz die Hochmark genommen haben, rechneten damit, dass sich ihre Besitztümer und Ländereien vergrößern würden, und nicht, dass sie ihr letztes Geld für einen weiteren Eroberungsfeldzug zum Fenster hinauswerfen müssten. Im Hinterland ist es wegen dieser Sache nicht mehr gut um die Kaisertreue bestellt, und Raubtiernaturen stürzen sich schnell darauf, um Vorteile daraus zu schlagen.«
»Und dann?«, fragte Vonvalt. »Haben sie beschlossen, ihr Geld stattdessen den savaranischen Templern zu geben? Das ist nicht gerade ein billiges Unterfangen.«
»Nein, hör mir zu«, schalt ihn Kadlec. »Viele Edle im Reich zahlen keine Reichssteuer mehr. Überhaupt nicht mehr. Dieses Geld finanziert einzig die Templer, und zwar nicht zusätzlich zu den Legionen. Sie stellen in den Grenzlanden eine Streitkraft zusammen – davon musst du doch wissen.«
»Das weiß ich auch. Zumindest in groben Zügen. Und die Nemaner lassen sich darauf ein, weil sie die draedischen Zauberkünste zurückerlangen wollen.«
Wieder huschte ein Anflug von Bangigkeit über Kadlecs Züge. »Die Mlyanarer haben gemerkt, dass sich ihre Kühnheit auszahlt. Vor der Invasion der Kovanischen Eidgenossenschaft war der Kaiser unantastbar gewesen. Jetzt vergrault er sich seine Legionen, und der Feind wird von Tag zu Tag stärker. Die nemanische Kirche hat den Erfolg der Mlyanarer beobachtet, und sie will daran teilhaben. Für sie hat sich eine Gelegenheit ergeben, ihre eigenen politischen Ziele zu erreichen: Wie du gesagt hast, die Rückführung der draedischen Zauberkünste.«
Vonvalt lehnte sich zurück und verschränkte die Hände. »Das alles hätte nicht passieren können ohne die Förderung durch das Magistratum.«
Kadlec seufzte. Er begriff nicht, dass er selbst unter Verdacht stand.
»Es gibt freilich Richter, die sie unterstützen, da bin ich mir sicher, aber du musst auch daran denken, Konrad, dass wir nicht mehr die vorrangigen Gesetzeshüter im Reich sind. Laien sind uns zahlenmäßig zehn zu eins überlegen. Und es ist an Provinzgerichten sehr viel einfacher, Laiengesetzeshüter und Vorsitzende zu bestechen als Richter. Das Reich hat sich zu schnell ausgedehnt. Die Reihen des Magistratums sind nicht schnell genug mitgewachsen.«
»Wer sind die Richter, die ihnen helfen?«
»Ich kenne sie nicht im Einzelnen. Aber du weißt sehr wohl, dass wir nicht über Parteinahmen erhaben sind«, sagte Kadlec. »Die Kyrillianer haben sich schon immer über das Richterrecht lustig gemacht.«
Vonvalt verabscheute Parteinahmen, aber sosehr er auch etwas anderes vorgeben wollte, so wusste er doch, dass sie existierten. Die Kyrillianer waren eine Gruppe von Richtern innerhalb des Ordens, die entgegen allen Lehrmeinungen glaubten, dass das Naturrecht dem Willen Nemas entsprang – also der Gedanke, dass ungeachtet menschengemachter Regeln und ethischer Vorstellungen bestimmte moralische Absolute existierten, die das Fundament des Richterrechts bildeten. Ich erinnerte mich, dass Senator Jansen uns in Haunersheim von Gerüchten über Richter erzählt hatte, die wegen Befangenheit Fälle ablehnten oder dem kanonischen Recht den Vortritt ließen. Nun wurde uns dies sogar vom Meister des Magistratums bestätigt. Der Orden fraß sich selbst von innen heraus auf.
»Glaubst du, dass sie der nemanischen Kirche geholfen haben?«
»Davon bin ich überzeugt. Sie pflegen hier in der Hauptstadt Umgang mit Patrias und Matrias. Sie besuchen die Tempeldienste. Sie treffen sich mit den Mlyanarern. Ich habe sogar gehört, dass sie unseren Feinden helfen, indem sie ihnen beibringen, wie sie der Kaiserstimme trotzen können, und an sie die Geheimnisse des Ordens weitergeben.«
Es folgte langes Schweigen. Das war der Kern der Sache. Davor hatte Richterin August uns gewarnt. Davor hatte Senator Jansen uns gewarnt. Es war derselbe Vorgang, wir hörten lediglich eine andere Version davon. Bei so vielen persönlichen Interessen wurde es zunehmend schwierig, mit Bestimmtheit zu wissen, wem man glauben sollte.
»Ich dagegen habe gehört, Meister«, sagte Vonvalt vorsichtig, »dass du persönlich für diesen … Betrug verantwortlich bist.«
Zu unserer Verblüffung schien Kadlec diese Enthüllung nicht sonderlich zu bekümmern. »Natürlich hast du das gehört! Unsere Feinde wollen die Leute das glauben machen. Deshalb haben sie das Gerücht verbreitet, mit Erfolg. Denn es wurde auf jeden Fall ein Keil zwischen das Magistratum und den Kaiser getrieben – und um nichts anderes ging es. Ich habe versucht, gegen diese Desinformation vorzugehen, aber unsere Macht schwindet, Konrad.« Er nickte in Richtung Tür. »Unsere besten und hellsten Köpfe sind da draußen, halten den Frieden, sorgen für Recht und Gesetz. Du selbst bist seit über zwei Jahren nicht mehr hier gewesen. Und wir sind Verkünder der Wahrheit. Wir handeln mit intellektueller Präzision, Ausgewogenheit und Gerechtigkeit. Unsere Feinde sprechen munter Unwahrheiten aus, selbst in den allerheiligsten Situationen. Sie lügen im Senat. Worte bedeuten ihnen nichts. Und sie haben Erfolg damit. Die einfachen Leute glauben ihnen. Kasivar, der Kaiser, glaubt ihnen.« Kadlec trank einen Schluck Wein. »Nema sei Dank, dass du zurück bist, Konrad. Du warst stets ein Liebling des Kaisers. Jetzt, da du da bist, können wir die Missverständnisse aus der Welt schaffen.«
Vonvalt lächelte, doch ich erkannte die Unaufrichtigkeit darin.
»Dass abtrünnige Richter die draedischen Geheimnisse verkauft haben, ist nicht einfach nur ein Gerücht, Nathan. Du hast doch von Patria Claver gehört.«
»Ja«, sagte Kadlec rasch und emotionslos.
»Es ist ihm gelungen, mich allein mit der Kraft seines Geistes zu packen.«
»Dich zu packen? Wie das?«
Ich beobachtete den Meister des Magistratums genau. Er schien wirklich überrascht zu sein, aber das hatte an sich noch nichts zu bedeuten. Gefühle konnte man überzeugend vortäuschen.
»Genau so, wie ich es gesagt habe. Als würde er mich festhalten, und zwar nur mit der Kraft seines Geistes. Ich konnte mich weder bewegen noch sprechen. Er konnte diese Macht über mich nur kurz ausüben, aber dass er es überhaupt fertigbrachte, das ist … problematisch.«
»Ich habe keine Ahnung, wie er an derartige Zauberkräfte gelangt sein könnte«, sagte Kadlec und wandte sich um, um durch das Fenster hinauszublicken. »Nema«, fügte er leise hinzu.
»Du und ich wissen natürlich, dass das Magistratum auf einer gewaltigen Sammlung von magischen Schriften sitzt. Die meisten davon sind seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt worden, die allermeisten werden nie wieder das Tageslicht erblicken. Wir sind Hüter dieser Mächte, und es gibt nur eine bekannte Quelle – das Meistergewölbe in der Bibliothek des Rechts.«
»Willst du mir Vorträge halten, Konrad?«, fragte Kadlec in plötzlich schroffem Tonfall.
»Nathan, ich versuche, dir zu schildern, wie es aussieht«, erklärte Vonvalt ernst. »Sollte es ein Missverständnis, einen Irrtum gegeben haben, dann werde ich alles tun, was in meiner Macht steht, um dir dabei zu helfen, das Ansehen des Ordens wieder aufzubauen. Sollte aber auch nur ein Körnchen Wahrheit an dem Gerücht über deine Beteiligung an diesem …«
Kadlec seufzte lediglich müde, als hätte man gar keine Drohung gegen ihn ausgesprochen. »Ich fürchte, ich kann dir die Antworten nicht geben, die du suchst«, sagte er.
Vonvalt runzelte verblüfft die Stirn. »Was willst du damit sagen?«
»Ich fürchte, dass der Orden und seine Machenschaften meiner Kontrolle entgleiten. Die Kräfte, die sich gegen uns gestellt haben, sind zäh und bösartig. Das zehrt an mir. Ich will die Bedeutung dieser Entwicklungen gar nicht herunterspielen, im Gegenteil. Doch ich fürchte, dass ich zu einem alten Narren geworden bin, der nicht mehr versteht, was um ihn herum geschieht. Aber wenn das, was du sagst, stimmt …«
»Das tut es.«
»… dann stecken wir in größeren Schwierigkeiten, als ich dachte.«
Vonvalt grübelte eine Weile darüber nach.
»Im Meistergewölbe fehlen keine Bücher?«
»Wie denn?«, blaffte Kadlec und ließ zum ersten Mal wirklich seine Maske fallen. »Ich bin der Einzige, der Zugang zu ihm hat.«
Vonvalt seufzte und täuschte noch einmal ein Lächeln vor. Das Problem würde sich heute Abend eindeutig nicht mehr lösen lassen. »Nun, wir werden das alles bald geradebiegen.«
»Ich hoffe es«, war alles, was Kadlec entgegnete.
III
Das Wolfstor
»Man sagt, Sova benutze jeden,der benutzt werden kann, aber wohlgemerkt:Nicht jeder kann benutzt werden.«
Aus Chun Parsifals Abhandlung Das Reuige Kaiserreich
Entgegen meiner Annahme verabschiedeten wir uns nicht von Kadlec. Sowohl er als auch Vonvalt bemühten sich um eine weitere Unterhaltung, suchten nach anderen Themen, als würden sie sich mit Gewalt einen Weg durch schwieriges Gelände bahnen – denn die Rückkehr eines fahrenden Richters brachte allen möglichen Verwaltungskram mit sich. Nachdem das Unangenehme erledigt war, einige unbequeme Wahrheiten unter den Teppich gekehrt waren und noch mehr Wein auf dem Tisch stand, fingen Vonvalt und Kadlec an, sich wie alte Freunde und Kollegen eine Zeit lang über alles Mögliche zu unterhalten.
Als das Licht aus dem Himmel wich, gingen wir hinunter zum Speisesaal, einer herkömmlichen Kantine für alle Mitglieder des Ordens, nicht nur die Richter. Hier wurde Vonvalt bald umlagert von Kollegen und anderen Mitarbeitern. Junker Radomir, Bressinger und ich saßen abseits, es wurde noch mehr Wein und Essen gebracht, und das Gespräch bewegte sich in die Abgründe versteckter Witze, Sticheleien und Anspielungen auf Fälle, Personen und kleinere Skandale, die uns nichts sagten. Wie es schien, konnte man Sova mit seinen finsteren Intrigen einen Abend lang vergessen.
»Hier«, sagte Bressinger und stupste grob meine Schulter, während ich der immer lauteren und beschwipsteren Unterhaltung zu folgen versuchte, bei der sich Richter, Rechtsgelehrte, Vorsitzende, Ankläger, Sekretäre und Abfasser allesamt bemühten, sich in die Diskussion zu drängeln und in den inneren Kreis zu gelangen. Nie hatte ich eine so wild lärmende Runde erlebt wie hier in einer der angesehensten staatlichen Institutionen.
Ich drehte mich zu Dubine.
»Komm«, sagte er, während er mit dem Kopf zur Tür ruckte.
Ich sah ihn fragend an. Ich brauchte gar nicht erst zu versuchen, mich in dem Lärm verständlich zu machen.
»Komm schon«, sagte Bressinger ein wenig genervt, worauf er, Junker Radomir und ich hinausgingen.
Sofort stürzte man sich auf unsere frei gewordenen Plätze.
»Das wirst einmal du sein, hast rote Backen von dem vielen teuren Wein und posaunst irgendwelches Zeug auf Hochsaxanisch in die Welt hinaus«, sagte Bressinger, während er Junker Radomir und mich aus der Großen Loge hinausführte. Es war ein warmer Abend, und obwohl es dunkel und spät war, waren noch viele Leute auf der Straße.
Mir war nicht klar gewesen, was ich von dieser Erfahrung halten sollte, aber ich konnte nicht leugnen, dass ich eine Art Begierde verspürt hatte, diesem Club anzugehören. Es hatte – buchstäblich – etwas Berauschendes, diese Gruppe gebildeter Menschen, die sich Wissen und Erfahrungen teilten, in so heiterer Ausgelassenheit zu beobachten. Doch weder Bressinger noch Junker Radomir würden jemals zu diesem inneren Kreis gehören, und ich stellte fest, dass ihre leicht verächtliche Haltung rasch auf mich abfärbte. Plötzlich wollte ich sie unbedingt mit meiner bodenständigen, tollischen Art beeindrucken.
»Wohin gehen wir?«, fragte ich.
Bressinger deutete grob in Richtung Stadt. »Dahinten ist ein Gasthaus, Wolfstor heißt es. Junker Konrad wird die Nacht über beschäftigt sein. Wir können uns ruhig ein wenig amüsieren, bevor wir von Staatsangelegenheiten erdrückt werden. Der wird uns nicht vermissen«, fügte er hinzu, als er meine Miene sah.
»Klingt gut«, grunzte Junker Radomir, und ich spürte, dass er es sehr ernst meinte.
Bressinger führte uns durch das Straßengewirr. In beinahe allen Städten und Dörfern, in denen ich bisher gewesen war, war mit Einbruch der Nacht alles geschlossen. Die einfachen Leute aßen rasch ihr Abendessen am Herd und legten sich schlafen. Die reicheren Bürger in der Stadt beleuchteten ihre Häuser vielleicht mit Kerzen und genossen eine längere Mahlzeit oder lasen noch ein wenig oder unternahmen etwas. Aber wenn die Tempelglocke Mitternacht schlug, herrschte in diesen Orten Grabesruhe.
Hier in Sova gab es kaum einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Überall war Betrieb, überall waren Leute. Ich hatte noch nie so viele Schenken gesehen wie hier. Ganze Straßen bestanden nur aus Schenken. Die Bevölkerung Sovas, zudem angeschwollen durch Reisende, war gigantisch, und eine solche Menschenmasse wollte ernährt werden, brauchte Ställe für die Pferde, Unterkünfte und zu trinken. Und wenn sich abends die ganzen Kammern, Gilden, Börsen, Handelshäuser, Gießereien, Gerbereien und Apotheken leerten, begann der Nachtzyklus eines scheinbar ununterbrochenen Jahrmarkts. Die Menschen in Sova, ob hier gebürtig oder nicht, schienen in einem mit Vermessenheit betriebenen Wasserrad gefangen zu sein, sie tranken, tanzten und hurten bei Nacht und arbeiteten am Tage.
Dabei zu sein, war fesselnd. Ich fand es faszinierend, auf dem Pflaster durch die warme Nacht zu gehen, den Duft exotischer Speisen und Getränke zu atmen, Unterhaltungen in allen möglichen Sprachen zu lauschen, den Sovanern zuzusehen, wie sie auf der Straße spielten und tanzten. Trotz meiner früheren Bedenken und zweifellos dank des Weins in meinem Blut war ich ganz entzückt von dieser Stadt. Anscheinend waren den Freuden und Vergnügungen hier keine Grenzen gesetzt.
Wir erreichten das Wolfstor, ein augenzwinkernd benanntes Gasthaus, über dessen Tür ein hölzernes Abbild des namengebenden Stadttors hing. Es stand an einem weiten Platz, auf dem ein hellhäutiger Hauner und ein dunkelhäutiger Südflachländer vor einer Menge begeisterter Zuschauer miteinander kämpften. Die Luft war erfüllt vom Klingeln der Münzen in Händen und Beuteln und auf den Pflastersteinen. Dazu Anfeuerungsrufe, das Bersten eines Glases und höhnischer Jubel.
Bressinger führte uns ins Gasthaus. Eine Wand aus Lärm und der Geruch von Menschen und abgestandenem Bier schlug uns entgegen. Das Gedränge hatte hier mehr geheizt als jedes Feuer, und dennoch fauchte ein brennender Holzscheit im Kamin, und es brannten Hunderte Kerzen. So riesig der Saal war, so vollgestopft war er, und über drei oder vier Stockwerke türmten sich überquellende Zwischengeschosse.
Wir zwängten uns durch die Menge. Bressinger führte uns ans andere Ende und dann die Treppe hinunter, wo er sich in eine frei werdende Nische stürzte, kaum dass die vorigen Gäste dort aufgestanden waren. Zu dritt quetschten wir uns hinein, und nach ein paar Minuten hatten wir alle einen großen Zinnkrug mit Bier und einen kleinen Becher mit Schnaps vor uns stehen.
»Sehr gut«, sagte Bressinger. Er hielt seinen Becher in die Höhe, und Junker Radomir folgte seinem Beispiel. »Auf Sova und den Doppelköpfigen Wolf, der euch verschlingen und anschließend eure Knochen kacken wird. Yura!«
Er kippte das Getränk hinunter, doch Junker Radomir zögerte. »Was zum Henker soll das sein?«, fragte er. »Yura?«
»Was glaubst du denn, was es heißt?«, blaffte Bressinger. »Es bedeutet: Trink!«
Auch ich schluckte den Becherinhalt hinunter, eine Art hoch konzentrierter Wein, den Kaufleute ersonnen hatten, um größere Mengen zu günstigeren Preisen transportieren zu können. Ich hatte noch nie einen getrunken und war auf den herben, im Rachen brennenden Geschmack nicht gefasst. Meine Augen schwammen, und ich musste husten, was Junker Radomir und Bressinger köstlich amüsierte und herzlich zum Lachen brachte.
»Bei Nemas Blut«, sagte ich und stellte den Becher auf den Tisch. Nach den zwei Weinkelchen aus der Großen Loge machte mich das rasant betrunken.
»Komm, Helena. Erzähl uns, welchen Eindruck die Stadt auf dich macht. Man sagt, niemand vergisst seine erste Begegnung mit Sova«, forderte Bressinger mich auf. Sein ohnehin schon starker grozodanischer Akzent wurde dank des Alkohols von Minute zu Minute ausgeprägter.
Ich zuckte mit den Schultern. Bei meiner Antwort lallte ich bereits ein wenig. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Es ist erdrückend. Überall sind Menschen. Und alles ist so groß und so hoch.«
»Das ist die Zauberkraft«, sagte Bressinger. Erstaunt sah ich, dass er seinen Krug leerte und bereits nach einem weiteren winkte.
»Halt«, sagte Junker Radomir zu dem Schankknecht und leerte auch seinen Krug. »Bring gleich zwei.«
Im törichten Bemühen, mit ihnen mitzuhalten, trank ich auch ein paar Schlucke von meinem Bier. »Das verstehe ich nicht, auch wenn ich mich entsinne, dass Junker Konrad mal davon gesprochen hat. Wie kommt die Zauberkraft in die Bauwerke?«