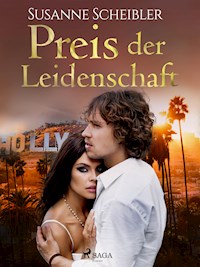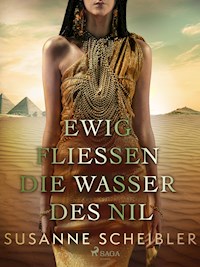Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hinter dem Titel "Im Palast der Sieben Sünden" verbirgt sich die Familiengeschichte des Grafen Lasarow. Während der Regierungszeit des letzten russischen Zaren Nikolaus werden die ältesten Lasarow-Töchter in die gehobene St. Petersburger Gesellschaft eingeführt. Vor dem Hintergrund der überkochenden Stimmung der russichen Revolution wirbelt die Liebe die Gefühlswelt der jungen Frauen gehörig durcheinander...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1120
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Scheibler
Im Palast der sieben Sünden
Saga
Im Palast der sieben Sünden
Im Palast der Sieben Sünden (Band 1, 2 und 3)
Copyright © 2021 by Michael Klumb
vertreten durch die AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Die Originalausgabe ist 2000 im Lübbe Verlag erschienen
Coverbild/Illustration: Shutterstoc
Copyright © 2000, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961164
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
DIE LASAROWS 1. Teil
Mazurka in St. Petersburg
1. Kapitel
Ihr erstes Ballkleid war aus meergrüner Atlasseide, auf die am Saum ein breites Band von silbernen und rosa Stoffrosen genäht war. Auch die Schleppe und der Cul de Paris waren damit besetzt.
Als Akulina Iwanowna, ihre alte Kinderfrau, Swetlana so sah, wie sie langsam die Treppe des Lasarowschen Stadtpalais an der Mojka hinunterkam, brach sie in Tränen aus. Es waren Tränen der Rührung, die Akulina oft und gern vergaß.
»Heiliger Dimitrij!« rief sie und wischte sich über die Augen. »Wie schön du bist, mein Schwänchen! Und so erwachsen wirkst du mit dem aufgesteckten Haar! Dabei kommt es mir vor, als wäre es erst drei oder vier Winter her, daß ich dich auf meinen Armen getragen und hin und her geschaukelt habe.«
Swetlana Pawlowna drehte sich einmal vor ihr im Kreis. »Weißt du was, Akulina? Ich gefalle mir selbst. Und ich bin schrecklich aufgeregt. Was meinst du, wird der Zar ein paar Worte an mich richten, wenn ich ihm vorgestellt werde? Oder die Zarin? Vermutlich nicht, denn sie redet ja kaum mit Leuten, die ihr fremd sind, heißt es. Sie soll sehr hochnäsig sein. Aber vielleicht ist sie auch nur schüchtern wie Irina, die nie den Mund aufbekommt, wenn sie in Gesellschaft ist. Statt dessen macht sie ein Gesicht, als würde sie sich zu Tode langweilen, und das legt man ihr dann als Arroganz aus. Dabei ist Irinenka ...«
Sie brach ab, weil die Uhr auf dem Kaminsims schlug. »Acht schon? Himmel, und Mama und Xenia sind immer noch nicht fertig! Keinesfalls dürfen wir zu spät ins Winterpalais kommen. Punkt neun Uhr erscheint die Zarenfamilie ...«
»Nur keine Aufregung!« rief eine dunkle, etwas spröde Mädchenstimme von der Galerie, die sich oben rings um die große Halle zog. »Wir können gleich fahren!«
Xenia Pawlowna, die um ein Jahr jüngere Schwester der siebzehnjährigen Swetlana, erschien am Treppenpodest und lief die Stufen hinunter.
Im Gegensatz zu der blonden Swetlana war Xenia brünett, mit dunklen Augen und bräunlicher Haut. Als sich ihr Fuß in der Schleppe ihres rosefarbenen Atlaskleides verfing, riß sie den Stoff recht undamenhaft hoch.
»Ich werde mir noch die Beine brechen in diesem verdammten Kleid! Ich glaube, die heutige Mode ist eigens gemacht worden, um jemandem wie mir die Freude am Tanzen zu verderben!«
»Laß das bloß nicht Madame Dufour, die Schöpferin unserer eleganten Kreationen, hören«, neckte Swetlana sie. »Sie bringt es fertig und schneidet dir vor lauter Empörung die Schleppe ab.«
Hinter Xenia erschien ihre Mutter, von der Swetlana das blonde Haar und den zarten, hellen Teint geerbt hatte. Allerdings war die Gräfin Wera Karlowna ein eher bläßlicher Typ mit hellen graublauen Augen und einem ständig wehleidigen Gesichtsausdruck, der seinen Ursprung in einem tyrannischen Vater und einem ebensolchen Ehemann hatte.
Wera Karlowna war zuerst von ihrem Vater – der ihr nie verziehen hatte, daß sie als sein einziges Kind kein Sohn geworden war – und später von ihrem Gatten Pawel Konstantinowitsch ständig gegängelt und bevormundet worden, und da sie sehr wenig Durchsetzungsvermögen besaß, hatte sie sich nie dagegen aufgelehnt. Vielmehr gehörte sie zu den Menschen, denen die Stärke anderer, selbst wenn sie Unterdrückung mit sich brachte, ein gewisses Maß an Sicherheit verlieh und die sie darum willig ertrugen.
Swetlana war anders, heiter und warmherzig. Darum war auch ihre Schönheit viel lebendiger als die der Mutter.
Ihre Blondheit hatte etwas sehr Gesundes, Ursprüngliches, und ihre Augen, goldbraun mit kleinen dunklen Pünktchen in der Iris, verrieten viel von ihrer Vitalität und ihrer unbändigen Neugier auf alles, was das Dasein für sie bereithalten mochte.
Sie besaß den starken Willen ihres Vaters, gepaart mit einer ungewöhnlichen Sensibilität für das, was in anderen Menschen vor sich ging, und der Bereitschaft, jeden, der es ihrer Meinung nach verdiente, mit ihrer offenen, ungekünstelten Zuneigung zu beschenken.
Swetlana konnte weich, lieb und verständnisvoll sein, aber wehe, wenn jemand ihren Zorn erregte! Dann reagierte sie wie eine gereizte Katze, die kratzend und fauchend auf ihr Opfer losging.
Die ruhige, besonnene Xenia amüsierte sich oft darüber. ›Vorsicht, meine Schwester hat Dynamit geschluckt‹, meinte sie dann wohl lachend. ›Gleich sprengt es sie auseinander, und man weiß nicht, was dabei alles zu Bruch geht.‹
Xenia war längst nicht so hübsch wie Swetlana. Sie war noch ein wenig pummelig, und ihr Gesicht wirkte etwas unregelmäßig mit den weit auseinanderstehenden lebhaften Augen und der eine Spur zu groß geratenen Nase. Aber wer sich länger als zwei Minuten mit ihr unterhielt, war von ihrer klugen, für ihr Alter erstaunlich ausgereiften Persönlichkeit gefesselt.
Im übrigen war sie nicht eitel und gönnte ihrer Schwester neidlos das Aufsehen, das sie durch ihre blonde Schönheit erregte.
Wera Lasarowa läutete nach einem Diener. »Unsere Mäntel«, befahl sie, als er die Halle betrat. »Sind die Schlitten schon vorgefahren?«
»Sehr wohl, Euer Gnaden«, erwiderte der ältliche Mann mit einer Verbeugung.
»Dann melden Sie Seiner Gnaden und meinem Sohn, daß wir fertig sind.« Wera Karlowna warf ihren beiden ältesten Töchtern einen mütterlich-prüfenden Blick zu. »Reizend seht ihr aus«, meinte sie zufrieden und ließ sich von Akulina in den bodenlangen Zobel helfen. »Habt ihr Irina schon gute Nacht gesagt?«
Die jüngste Lasarow-Tochter, gerade vierzehn geworden, lag mit einer fiebrigen Erkältung zu Bett. Aber natürlich hatte sie darauf bestanden, ihre beiden Schwestern vor ihrem Aufbruch ins Winterpalais zu begutachten.
»Haben wir«, bestätigte Swetlana. »Sie fand, ich sähe aus wie eine Portion Pistazieneis, mit Marzipan garniert. Und Xenia verglich sie mit einer Kissel aus Himbeeren und Schlagsahne.«
»Irina Pawlowna ist eine Schafsnase«, mischte Akulina sich grollend ein. »Warten Sie nur, bis sie zwei Jahre älter ist und ebenfalls in die Gesellschaft eingeführt wird. Dann wird sie sich aufputzen wie ein Paradepferdchen auf dem Marsfeld.«
Wera Karlowna unterdrückte einen Seufzer. Drei Töchter – und keine so sanft und fügsam, wie sie es gewesen war. Heilige Muttergottes, sie würde erst Ruhe haben, wenn sie die drei gut verheiratet hatte. Aber wer weiß – vielleicht wurde in dieser Petersburger Wintersaison ja der Grundstein dazu gelegt?
Zehn Minuten später saßen alle Lasarows – die kranke Irina ausgenommen – warm in Pelze verpackt in zwei Schlitten. Xenia fuhr mit ihren Eltern, und Swetlana hatte ihren ältesten Bruder Jurij, Leutnant bei der Preobraschenskijschen Garde, an ihrer Seite. Er war einundzwanzig, ein schneidiger junger Offizier, der schon seit drei Jahren in St. Petersburg lebte, während seine Schwestern in Kowistowo, dem Landgut der Familie in der Nähe von Kiew, aufgewachsen waren.
Graf Pawel Lasarow war Adelsmarschall der Provinz Kiew gewesen, aber zu Anfang des Jahres hatte Zar Nikolaus II. ihn in den Reichsrat berufen, so daß die Lasarows damals in ihr Petersburger Stadtpalais übersiedelt waren.
Nach Kowistowo würde man nur noch in den heißen Sommermonaten zurückkehren, um sich von dem feuchtschwülen Klima der Hauptstadt zu erholen.
Schlitten um Schlitten fuhr vor der von Fackeln hell erleuchteten Rampe des Winterpalais vor. Ordonnanzen und livrierte Diener halfen den Ankömmlingen beim Aussteigen und geleiteten sie auf Teppichen, die man über den Schnee gelegt hatte, in die große Eingangshalle. Währenddessen fuhren die Kutscher mit ihren Pferden in den für sie bestimmten Hof, wo die Tiere in den Stallungen untergebracht wurden und die Männer sich zu den anderen gesellten, die an großen Feuern saßen und sich am heißen Tee und einer Kascha wärmten.
Sie bereiteten sich auf eine lange Nacht vor, in der sie auf ihre Herrschaften warten mußten. Es sei denn, der gnädige Herr Graf oder die allergnädigste Frau Fürstin hatten ein Einsehen mit ihren Angestellten und schickten sie mit dem Befehl, pünktlich um zwei, drei oder vier Uhr morgens wieder hier zu sein, nach Hause zurück, wo es dann freilich auch nicht für einen erholsamen Schlaf reichte, weil man immer wieder hochfuhr, um nur ja nicht die vereinbarte Zeit zu verschlafen.
Aber was willst du machen, Brüderchen? Es sind lausige Zeiten im heiligen Rußland. Das Elend der Fabrikarbeiter und der kleinen Bauern, die für ein paar Kopeken schuften und damit kaum das Geld für ihre dürftige Behausung, für Holz und Kohlen und das Essen für sich und ihre Familien verdienen, die Not der Arbeitslosen, die oft nicht einmal ein Dach über dem Kopf haben, sind viel ärger.
Dagegen geht’s dir als Kutscher bei Seiner Gnaden, dem Fürsten Barjatynskij oder General Tscherewin, dem Grafen Lasarow oder Barschewskij und wie sie alle heißen mochten, doch hundertmal besser. Hast eine warme Stube und satt zu essen, und wenn du nicht säufst oder stiehlst, kann dir gar nichts passieren. Du kannst alt und grau werden, und wenn du einmal nicht mehr so schneidig herumkutschieren kannst, kriegst du Arbeit in den Ställen, bis du tot umfällst und das beschissene Leben hier gegen ein besseres bei Gott und seinen Heiligen eintauschen kannst.
Und immerhin bist du kein Leibeigener mehr, wie es dein Großväterchen und vielleicht sogar deine Eltern noch waren, bis der gnädige Zar Alexander II., Gott segne ihn dafür, die Leibeigenschaft aufgehoben hat. 1861 war das gewesen, also vor siebenunddreißig Jahren erst.
Also gib dich zufrieden, Brüderchen, setz dich zu den anderen ans Feuer und erzählt euch, was es so an Neuem gibt in den Palästen der feinen Herrchen. Oder fahr heim in deine Kammer, versorg die Pferdchen und droh deiner Frau eine Tracht Prügel an, wenn sie dich nicht rechtzeitig weckt, damit du zum Winterpalais fahren kannst.
Teufel auch, was für eine bitterkalte Dezembernacht! Und der Mond über der Newa hat einen Hof, was bedeutet, daß es wieder Schnee geben wird!
Die Lasarows hatten sich indessen in der Halle ihrer Pelze entledigt und stiegen nun die breite Treppe der Botschafter in den ersten Stock hinauf.
An den Wänden standen Kosaken, die mit ihren langen roten Mänteln einen prächtigen Kontrast zu den in Weiß und Gold gehaltenen Wänden und Statuen bildeten. Die Luft war geschwängert vom Parfüm der Damen und dem Geruch der aberhundert Kerzen, die an diesem Abend entzündet worden waren, obwohl das Winterpalais seit einiger Zeit über elektrisches Licht verfügte.
Da und dort begrüßten die Lasarows Bekannte, die mit ihnen dem St.-Georgs-Saal zustrebten, jener riesigen Prunkhalle, die mehr als fünftausend Gästen Platz bot.
Swetlana nahm alles mit wachen Sinnen auf: die eleganten Balltoiletten, die von Juwelen nur so strotzten, die farbenfrohen Uniformen der Eliteregimenter, die Fräcke mit den blitzenden, edelsteinbesetzten Orden.
Ihr Bruder Jurij winkte einem jungen Mann in der Galauniform der Preobraschenskij zu. »Hallo, mein Lieber, darf ich dich meiner Schwester Xenia vorstellen! Swetlana kennst du ja bereits, wie ich mich erinnere.«
»Ja, wir sind uns bei der großen Parade zum dritten Geburtstag der Großfürstin Olga in Krasnoje Selo begegnet«, erwiderte der Angesprochene und verneigte sich vor den beiden Mädchen. »Guten Abend. Schön, Sie wiederzusehen, Swetlana Pawlowna. Wie geht es Ihnen?«
»Oh, gut«, erwiderte sie mit glänzenden Augen. »Wie sollte es anders sein bei einem so phantastischen Fest.«
»Sie sehen auch ganz bezaubernd aus«, versicherte der junge Offizier galant und wandte sich dann Xenia zu. »Gestatten Sie: Boris Petrowitsch Barschewskij, Rittmeister der Garde.«
»Sie sind das also!« Xenia betrachtete ihn lächelnd und ungeniert. »Jurij hat schon viel von Ihnen erzählt.«
»Tatsächlich? Ich hoffe, nur Gutes.«
»Gäbe es denn auch etwas Schlechtes zu berichten?« erkundigte Xenia sich vergnügt, und Graf Barschewskij zwinkerte ihr zu.
»Ich sehe, vor Ihnen muß man sich in acht nehmen, Xenia Pawlowna. Sie sind eine Fallenstellerin im Fragen.«
Die Plauderei wurde unterbrochen, weil Graf und Gräfin Lasarow wieder zu der kleinen Gruppe stießen. Sie hatten sich in einer Fensternische mit Konstantin Pobjedonoszew, dem Generalbevollmächtigten des Heiligen Synod, unterhalten, einem hageren, finstergesichtigen Mann mit fanatischen Augen.
Swetlana und Xenia waren ihm vorgestellt worden, als er einmal zum Tee bei ihren Eltern gewesen war. Seitdem fanden sie ihn ›gräßlich‹, was den beiden eine harte Rüge ihres Vaters eingetragen hatte.
Pobjedonoszew, einer der Erzieher von Zar Nikolaus II., sei ein ungeheuer einflußreicher Mann, der glücklicherweise nicht mit den liberalen Bestrebungen gewisser politischer Wirrköpfe sympathisiere, sondern die gottgewollte autokratische Ordnung aufrechterhalten wolle – eine Einstellung, der er, Graf Lasarow, nur aus vollem Herzen zustimmen könne. Es sei ein Segen, daß Seine Majestät solch einen Ratgeber habe, der ihn von schädlichen Experimenten zurückzuhalten verstehe.
»Also ist er noch gräßlicher, als wir dachten«, hatte Swetlana später, als sie mit Xenia allein war, respektlos geäußert. »Puh – hoffentlich wimmelt es bei Hof nicht von solchen Mumien!«
Dieser Sorge wurde sie an ihrem ersten Ballabend in St. Petersburg enthoben.
Natürlich sah man da und dort ergraute Generäle und Minister, in enge Korsetts geschnürte Damen mit schlaffer Haut und gepuderten Gesichtern, was freilich nicht über die Falten und Runzeln hinwegzutäuschen vermochte. Es gab die Kriecher der Hofkamarilla, diese Emporkömmlinge, die unter zwei oder sogar drei Zaren ihr schmutziges Intrigenspiel betrieben hatten, genauso wie die ehrlichen Veteranen, für die das Zarentum etwas Heiliges und Unantastbares war, vor dem sie sich beugten.
Doch für Swetlana Lasarowa waren das an jenem Abend nur Randfiguren. Wirklich wichtig waren ihr die jungen Gardeoffiziere und Adligen, die ihr den Hof machten, ihr Komplimente sagten und mit ihr tanzten.
Pünktlich um neun Uhr flogen die breiten Flügeltüren des St.-Georgs-Saales auf, und das Orchester spielte die Nationalhymne: Bosche Zarja chranij ... Gott schütze den Zaren.
Seine Majestät Nikolaus II. von Rußland und seine Gemahlin, die Kaiserin Alexandra Fjodorowna, erschienen, gefolgt von den Mitgliedern der kaiserlichen Familie.
Die Herren trugen die Galauniformen ihrer Regimenter, die Damen über ihren weißen Satinkleidern mit roter Schärpe und goldbestickter Samtschleppe den traditionellen Kokoschnik, eine Art Diadem in Halbmondform mit langem Schleier.
Zarin Alexandra Fjodorowna sah an diesem Abend wunderschön aus in ihrer cremefarbenen Toilette und dem von Juwelen und Perlen strotzenden Goldschmuck, und sie schien strahlender Laune zu sein. Ihr Lächeln wirkte echt und herzlich, im Gegensatz zu dem wie aufgeklebt wirkenden Verziehen der Lippen, das sie für gewöhnlich bei offiziellen Anlässen zur Schau trug. Sie unterhielt sich lebhaft mit ihren Ehrendamen, und Swetlana dachte, als sie sie beobachtete: Man kann kaum glauben, was man über sie erzählt; daß sie kühl und hochmütig sein soll, von geradezu alberner Prüderie, und die Festlichkeiten bei Hof nur mit Widerwillen erträgt.
An diesem Abend war Zarin Alexandra eine junge Frau, die ihrem Gatten hin und wieder verliebt zulächelte und die Musik und die festliche Atmosphäre unbeschwert genoß.
»Vermutlich ist sie erleichtert, daß die Zarenwitwe heute nicht da ist«, sagte Boris Petrowitsch Barschewskij und nahm Swetlana das leere Champagnerglas ab, um ihr ein neues zu besorgen. »Maria Fjodorowna weilt zur Zeit in Moskau, wo sie Vorsitzende mehrerer Wohltätigkeitsvereine ist. Wäre sie hier, hätte sie den Vortritt vor der Zarin, und das mißfällt Alexandra Fjodorowna fast ebenso wie die Tatsache, daß ihre Schwiegermutter weitaus beliebter als sie selbst ist.«
»Außerdem soll Ihre Majestät wieder schwanger sein, wenn es auch noch nicht offiziell bekanntgegeben wurde«, mischte Xenia sich ein.
Swetlana warf ihr einen entsetzten Blick zu. Die Schwester war wirklich manchmal unmöglich! Wie konnte sie nur vor Boris Petrowitsch von einer Schwangerschaft reden!
Gut, daß Mama und Papa das nicht gehört hatten. Die beiden hatten sich zu Gräfin Lasarowas verwitweter Cousine gesellt, die eine der ›alten Damen‹ war, die zum Hofstaat der Zarin gehörten.
Die so Genannten trugen ein in Diamanten gefaßtes Miniaturbild der Zarin auf der Brust. Jekaterina Wladimirowna Karessowa war eine zänkische, altjüngferliche Person, schon seit dreißig Jahren verwitwet, aber Wera Karlowna erduldete bei jedem ihrer Petersburger Besuche deren Launen, weil die Cousine einflußreich und daher wichtig war.
Überhaupt teilte ihre Mutter zu Swetlanas Verdruß alle Menschen in wichtig, nützlich und darum zu hofieren und in unbedeutend und deshalb zu ignorieren ein. Und ihr Vater hielt es leider ebenso.
Xenia Pawlowna fuhr indessen fort, sich weiterhin ungeniert über eine mögliche Schwangerschaft der Zarin auszulassen.
»Hoffentlich bekommt sie dieses Mal einen Sohn, es wäre ihr zu wünschen«, sagte sie, erhielt daraufhin einen Fußtritt von Swetlana und betrachtete die ältere Schwester mit hochgezogenen Augenbrauen. »Warum trittst du mich denn?«
»Verzeihung, es war ein Versehen«, stammelte Swetlana verlegen, und Graf Barschewskij verbiß sich ein Lachen.
Der Oberhofmeister beendete das Geplänkel, weil die Debütantinnen dieses Winters dem Zarenpaar vorgestellt werden sollten.
Es waren zwanzig junge Mädchen, die nun zu Nikolaus II. und seiner Gemahlin geführt wurden. Swetlana und Xenia versanken in den vorgeschriebenen Hofknicks vor den Majestäten, nachdem der Oberhofmeister ihre Namen genannt hatte, nichts anderes als das übliche Tres enchanté des Zaren und ein freundlich-kühles Lächeln der Zarin erwartend. Doch zu ihrer Verwunderung wandte Alexandra Fjodorowna sich an ihren Gatten und sagte auf deutsch:
»Wie hübsch ihre Balltoiletten sind! Ich würde gern wissen, wer sie gefertigt hat.«
»Es war Madame Dufour in der Großen Sadowaja«, erwiderte Swetlana ebenfalls in Deutsch, und die Zarin hob erstaunt die Augenbrauen.
»Ach, Sie sprechen meine Muttersprache?«
»Ein wenig, Euer Majestät«, erwiderte Swetlana. »Mein Schweizer Erzieher, Maurice Selbmann, hat mich und meine Geschwister darin unterrichtet, ebenso natürlich im Französischen.«
»Und wie steht es mit Ihren Englischkenntnissen?« forschte die Zarin weiter, und Swetlana, wohl wissend, daß Alexandra Fjodorowna, obwohl deutscher Abstammung, den größten Teil ihrer Jugend am Hof ihrer Großmutter, der Queen Viktoria, verbracht hatte, erwiderte in bestem Oxford-Englisch: »Es ist mir fast so geläufig wie meine Muttersprache, da meine Eltern auch für eine englische Sprachlehrerin Sorge getragen haben.«
Alexandra Fjodorowna reichte ihr die Hand zum Kuß und sagte die traditionelle Formel der russischen Zaren: »Ich bin Ihre gnädige Kaiserin.« Dennoch hatte Swetlana das Empfinden, daß die Zarin dieses Mal ihre Worte beinahe herzlich und aufrichtig gemeint hatte.
»Sie ist eine wunderschöne Frau, finden Sie nicht?« fragte Swetlana später Graf Barschewskij, während sie einen Walzer mit ihm tanzte.
»Nun ja ...«, erwiderte er gedehnt. »Heute sieht sie wirklich gut aus. Aber das ist nicht immer so. Sie ist oft leidend, wissen Sie. Doch der Zar betet sie an.«
»Werden Ihre Majestäten die ganze Wintersaison über in St. Petersburg bleiben?« fragte Swetlana, und er zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung. Sie halten beide nicht viel von offiziellen Verpflichtungen. Am liebsten leben sie in Zarskoje Selo – und noch lieber wären sie wohl ein junges Ehepaar wie andere auch, das ein unbeobachtetes, zurückgezogenes Leben auf dem Lande führen kann. Nicht zu armselig natürlich«, fügte er mit einem Lächeln hinzu. »Ein gewisser Rahmen müßte schon da sein, sagen wir – gutbürgerlich, mit ein paar Dienstboten und in einem hübschen, geräumigen Haus, aber im übrigen unbelastet von allzu großer Verantwortung.«
Sie warf ihm einen verwunderten Blick zu. »Sie sagen das so verbittert. Fast so, als sähen Sie jemand anderen lieber an Zar Nikolaus’ Stelle.«
»Still ...« Für einen Moment zog er sie bei einer Drehung fester an sich. »So etwas darf man nicht einmal denken! Es gibt Leute, die Ihnen das schon als Hochverrat oder sogar Gotteslästerung auslegten. Schließlich ist Seine Majestät von Gott persönlich dazu ausersehen worden, über Rußland zu herrschen. Das macht ihn zu einer heiligen, unantastbaren Figur. Im übrigen sieht er sich selbst so und würde sich deshalb nie so ketzerischen Gedanken wie dem Zurückziehen in ein glücklicheres Privatleben hingeben. Nein, nein, er nimmt sein Gottesgnadentum sehr ernst und ist daher sorgsam darauf bedacht, zu tragen, was ihm auferlegt wurde, genau wie unsere allergnädigste Kaiserin. Sie sind beide davon durchdrungen, daß alles, was geschieht, Gottes Zulassung ist, die man hinnehmen muß. Es wäre nur wünschenswert ...«
»Was?« fragte Swetlana, als er abbrach. »Was wäre wünschenswert?«
Er schüttelte lächelnd den Kopf. »Da Sie glücklicherweise in St. Petersburg bleiben, Swetlana Pawlowna, werden Sie es wahrscheinlich sehr rasch selbst herausfinden. Verlangen Sie bitte nicht von mir, daß ich. Sie in Ihrer ersten Ballnacht einer wunderschönen Illusion beraube. Außerdem – müssen wir immer über den Zaren reden? Ich finde Sie viel interessanter und möchte gern mehr von Ihnen wissen. Erzählen Sie mir von sich. Sie sind siebzehn, hat Jurij mir verraten, und haben bis jetzt auf dem Landgut Ihrer Familie gelebt. Ist Ihnen der Abschied von dort schwergefallen? Gibt es vielleicht jemanden, dem Sie heiße Tränen nachweinen?«
»Ja«, erwiderte sie und freute sich darüber, daß sich sein Blick verdunkelte. »Peschko, unser alter Jagdhund. Als ich fünf war, hat er mich einmal aus dem Löschteich von Kowistowo gezogen. Peschko war damals zwei. Inzwischen ist er beinahe blind und sehr schwerhörig. Ich hätte ihn zu gern nach Petersburg mitgenommen, aber Mama war dagegen. Ich habe deswegen auf der halben Fahrt hierher geweint und gedacht, daß ich die hartherzigste und verständnisloseste Mutter der Welt hätte.«
Mit einer trotzigen Gebärde warf sie den Kopf zurück. »Und obwohl es hier natürlich himmlisch ist und ich sehr gern hier bin, trage ich die Sache mit Peschko meiner Mutter immer noch nach, auch wenn ich weiß, daß der Hund bei unserem Gutsverwalter Schterenko gut aufgehoben ist.«
Wieder zog er sie leicht an sich. »Wenn ich darf, werde ich Ihnen eines Tages einen neuen Hund schenken, Swetlana Pawlowna. Einen Barsoiwelpen vielleicht ... Und im übrigen gibt es in Kowistowo oder Kiew kein männliches Wesen, das Sie ins Herz geschlossen haben?«
Sie lachte. »Was Sie alles wissen wollen! Fragen Sie doch meine Schwester nach mir aus. Wie Sie gemerkt haben, ist sie sehr unbekümmert in ihren Äußerungen und wird Ihnen bereitwillig jede Auskunft geben.«
Das Orchester auf der Empore hörte zu spielen auf, und Boris Petrowitsch machte ein bedauerndes Gesicht. »Schade, ich hätte stundenlang mit Ihnen weitertanzen mögen. Geben Sie mir Ihre Tanzkarte, Swetlana Pawlowna, und ich trage mich überall ein.«
»Oh, viel ist da nicht mehr frei. Nur noch der Kotillon, die Mazurka und ein paar Tänze nach dem Diner ...«
»... die Sie alle für mich reservieren müssen«, fiel er ihr ins Wort. »Das heißt, natürlich nur, wenn Sie mögen.«
Swetlana nickte und wurde ein wenig rot. »Warum nicht? Sie tanzen sehr gut, Boris Petrowitsch.«
Er brachte sie zu ihren Eltern zurück, die sich immer noch mit der Karessowa unterhielten, und schrieb tatsächlich auf ihrer Tanzkarte überall seinen Namen hin, wo sich noch kein anderer Tänzer eingetragen hatte. Für den nächsten Tanz forderte er Xenia auf und zwinkerte Swetlana dabei vergnügt zu.
»Um Auskünfte einzuholen«, flüsterte er, während Xenia die Hand auf seinen Arm legte und sich dann von ihm zur Saalmitte führen ließ, wo die Paare Aufstellung für eine Polonaise nahmen.
Swetlana hatte diesen Tanz dem Fürsten Leonid Soklow versprochen, der sich gleich, nachdem sie und Xenia dem. Zarenpaar vorgestellt worden waren, recht hartnäckig an ihre Fersen geheftet hatte. Soklow war Mitglied des Reichsrates und, wie es hieß, ein besonderer Freund des Zarenonkels Großfürst Michail Nikolajewitsch, der ein jüngerer Bruder des verstorbenen Zaren Alexander III. und Vorsitzender des Reichsrates war.
Das jedenfalls hatte die Gräfin Lasarowa ihrer Tochter rasch erklärt, nachdem Soklow den ersten Tanz mit Swetlana getanzt hatte.
»Er ist ein sehr einflußreicher Mann«, hatte sie behauptet, »dazu immens wohlhabend. Er könnte jedes junge Mädchen aus guter Familie zur Frau bekommen. Aber er ist noch unverheiratet.«
Die Worte hatten Swetlana nicht sonderlich beeindruckt. Ihr gefiel Leonid Iwanowitsch Soklow nicht, und sie bedauerte insgeheim, daß sie ihm ein paar Tänze zugesagt hatte.
Zwar sah er ausgesprochen gut aus, groß, schlank, mit dunklem, leicht gelocktem Haar und einem scharfgeschnittenen Gesicht. Aber er hatte so merkwürdige goldbraune Augen, deren Blick ihr Unbehagen einflößte.
Jeder, der mit ihr tanzte, hatte Swetlana an diesem Abend Komplimente gemacht, aber Fürst Soklows Schmeicheleien empfand sie als aufdringlich und manchmal sogar zweideutig.
Sie mochte auch nicht, wie er sie beim Tanzen an sich zog und dabei über ihren Rücken strich, ihr mißfiel seine seidenweiche Stimme, mit der er ihr beteuerte, daß sie seit Jahren die schönste Debütantin der Petersburger Gesellschaft sei und daß er sich glücklich schätze, ihr begegnet zu sein.
Darum war sie erleichtert, daß der Tanzmeister während der Polonaise öfter einen Partnerwechsel ansagte, so daß sie ein paar Takte mit einem anderen Mann tanzen konnte.
Glücklicherweise saß Fürst Soklow während des Diners, das um ein Uhr nachts serviert wurde, weit entfernt an einem anderen Tisch, und Swetlanas Tischherr war ein junger Leutnant der Semjonowskijschen Garde, Grischa Sowtschenko, der sehr witzig zu plaudern verstand, so daß sie aus dem Lachen kaum herauskam.
Ach, es war herrlich, im Winterpalais zu dinieren, bewundert zu werden und all die Pracht und Eleganz um sich herum zu genießen!
Das Zarenpaar nahm nicht am Diner teil, sondern ging währenddessen in Begleitung des Oberhofmarschalls Graf Paul von Benckendorff und der Ehrendame Anna Wyrubowa von Tisch zu Tisch, um sich mit den Gästen zu unterhalten.
Zarin Alexandra sah nicht mehr so frisch und blühend aus wie zu Beginn des Balles. Feine Schweißperlen standen auf ihrer Stirn, und sie wirkte erschöpft. Dennoch lächelte sie wiederum mit der bei ihr so seltenen offenen Herzlichkeit, als sie noch einmal ein paar Worte mit Swetlana wechselte.
»Ich hoffe, Sie haben viel Freude heute abend«, sagte sie. »Vorhin habe ich Sie eine Zeitlang beobachtet, meine Liebe. Offenbar machen Sie Furore in der Petersburger Gesellschaft – zumindest, was die jungen Herren angeht.«
»Euer Majestät sind sehr gütig«, erwiderte Swetlana, und ein Schatten glitt über das Gesicht der Zarin.
»Nur aufrichtig. Aber seien Sie auf der Hut, Swetlana Pawlowna. Auch hier ist längst nicht alles echt, das wie Gold schimmert. Es verbergen sich viel Hohlheit, Eigennutz und Lasterhaftigkeit hinter der glänzenden Fassade. Lassen Sie sich nicht davon blenden.«
Swetlana wußte nicht recht, was sie darauf erwidern wollte, doch die Zarin erwartete offenbar auch keine Antwort, sondern nickte ihr noch einmal zu.
»Ich werde mich jetzt zurückziehen. Diese Festivitäten strengen mich immer sehr an. Aber ich hoffe, daß wir uns bald wiedersehen.«
Anna Wyrubowa, die hinter ihr stand, eine dickliche Person mit teigigem Gesicht und flinken schwarzen Augen, warf Swetlana einen finsteren Blick zu. »Kommen Sie, Euer Majestät«, sagte sie dann mit einer hellen, singenden Kinderstimme, die in seltsamem Kontrast zu ihrer massigen Gestalt stand. »Es ist spät, und Sie sind müde. Sie sollten sogleich zu Bett gehen.«
»Ja, meine Liebe«, erwiderte Alexandra Fjodorowna und stützte sich auf Annas Arm. »Das Stehen fällt mir schwer. Ich habe wieder Kreuzschmerzen.«
»Sehen Sie, sehen Sie ...« Die Wyrubowa warf einen abschiednehmenden Blick in die Runde. »Aber ich werde beten, daß es Ihnen bald bessergeht. Für meine liebste, teuerste Zarin werde ich die halbe Nacht auf den Knien liegen.«
Damit führte sie Alexandra fort, und Leutnant Sowtschenko stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich weiß nicht, wieso, aber die Wyrubowa kann angezogen sein, wie sie will – auf mich wirkt sie immer wie eine glitschige Nacktschnekke.«
Er hatte die Worte Swetlana zugeflüstert, und sie versteckte hastig ihr Gesicht hinter ihrem Fächer, um ihr Lachen zu verbergen.
Ihre Mutter warf ihr einen irritierten Blick zu. »Was ist, Kind? Hast du dich verschluckt?«
»Beinahe«, erwiderte Swetlana und fächelte sich Luft zu. »Aber es ist noch einmal gutgegangen.«
»Wie kann man sich verschlucken, wenn man nicht ißt«, tadelte Wera Karlowna, verstummte dann aber glücklicherweise, weil der Zar quer durch den Saal auf seine Frau zukam.
»Alix?« fragte er auf englisch. »Was hast du, mein Engel? Geht es dir nicht wohl?«
Alexandra lächelte zu ihm auf, und ihr eben noch angestrengtes Gesicht glättete sich auf wundersame Weise. »Ich bin nur müde, Nicky, weiter nichts. Darum werde ich mich zurückziehen.«
»Natürlich begleite ich dich.« Er wollte ihren Arm nehmen, aber sie winkte ab.
»Nicht nötig. Meine gute Anna Alexandrowna bringt mich in mein Schlafzimmer. Und vorher werde ich noch einmal nach unseren beiden kleinen Mädchen sehen.«
»Gib ihnen einen Kuß von mir«, trug er ihr auf, und sie nickte lächelnd.
»Aber nur, wenn du ihn mir nachher zurückgibst.«
Swetlana hatte das kurze Gespräch mitgehört und empfand Rührung. Es war ganz offensichtlich, daß die beiden einander zärtlich liebten. Es mußte schön sein, eine solche Ehe zu führen.
Bei ihren Eltern war das nicht so. Sie lebten nebeneinander her, ohne große Streitigkeiten zwar, aber auch ohne besondere Zuneigung, und Swetlana hatte sich oft gesagt: So will ich es später einmal nicht haben. Ich heirate nur, wenn ich einen Mann wirklich liebe und er mein Gefühl erwidert. Sonst bleibe ich lieber ledig.
Swetlana wußte, daß ihre Mutter vom heutigen Tag an nach einem geeigneten Ehekandidaten für sie Ausschau halten würde. Tun Sie das nur, Mama, dachte sie. Am Ende nehme ich doch nur den, der mir gefällt. Es ist mein Leben, und ich will es mit allem anfüllen, was schön und aufregend und voller Überraschungen ist.
2. Kapitel
Zwei Monate später war Swetlana mit Boris Petrowitsch Barschewskij verlobt.
Seit jener Ballnacht im Winterpalais war das Stadtpalais der Lasarows ein beliebter Treffpunkt der jungen Petersburger Adligen geworden. Die meisten kamen Swetlanas wegen, aber einige machten auch Xenia den Hof. Die jedoch fand das höchstens albern, sehr zum Verdruß ihrer Mutter, die am liebsten gesehen hätte, wenn beide Töchter noch in dieser Wintersaison eine gute Partie gemacht hätten. Aber Xenia hatte anderes im Kopf, als sich einen Mann zu angeln.
»Ich möchte Medizin studieren«, vertraute sie eines Abends Swetlana an, als beide Mädchen von einer Teegesellschaft bei der Generalin Bogdanowitsch zurückgekehrt waren. Ihre Mutter, die sie begleitet hatte, litt unter Kopfschmerzen und hatte sich schon in ihr Schlafzimmer zurückgezogen. Graf Lasarow war auf einer Sitzung im Winterpalais.
Xenia und Swetlana saßen im sogenannten chinesischen Salon, während ihre jüngste Schwester Irina im Schulzimmer mit ihrer Englischlehrerin Miss Sheldon über der Übersetzung von Charles Dickens’ Essay ›American Notes‹ brütete.
Swetlana blickte ihre Schwester verblüfft an. »Im Ernst? Und was willst du dann tun? Ärztin werden?«
Xenia nickte lebhaft. »Rußland braucht Ärzte. Und ich denke, daß ich eine sehr gute sein könnte.«
Swetlana erinnerte sich, daß ihre Schwester schon als Kind mit Vorliebe ihre Puppen verbunden und ihnen alle möglichen Krankheiten angedichtet hatte, die sie dann kurierte. Auch alle Hunde, Pferde und Katzen, die sich Verletzungen zugezogen hatten, wurden von ihr versorgt – und oft genug die Dienstboten ebenfalls.
Für alles, was krank war, brachte Xenia größtes Interesse und eine für ihr lebhaftes Temperament ungewöhnliche Geduld auf. Dennoch hätte Swetlana nie geglaubt, daß ihre jüngere Schwester eines Tages daraus einen Beruf hätte machen wollen.
»Das wird Papa nie erlauben«, sagte sie besorgt. »Deshalb schlag es dir lieber gleich aus dem Kopf.«
Xenia preßte die Lippen zusammen. »Dann tue ich es ohne seine Erlaubnis. Ich bin nicht sein Eigentum, und er kann nicht über meine ganze Zukunft verfügen.«
Sie lag bäuchlings auf dem Bärenfell vor dem Kamin und blickte in die Flammen. Draußen war es dunkel, nur der Schnee, der in großen Flocken vom Himmel fiel, verbreitete matte Helligkeit.
Swetlana legte das Journal zur Seite, in dem sie geblättert hatte, und kam zu ihrer Schwester. »He, Malenka, du bist ganz schön verrückt, weißt du das?«
Malenka ... Kleine, so hatte sie Xenia oft genannt.
Aber die Schwester erwiderte ihr Lächeln nicht. Ihr Gesicht war ernst und so entschlossen, wie Swetlana es selten gesehen hatte.
»Versprich mir, daß du weder den Eltern noch sonst jemandem etwas davon sagst. Ich werde es selbst tun, wenn es soweit ist.«
»Gut, gut. Aber du bist dir doch darüber im klaren, daß Papa dir Stubenarrest geben und Mama ihre Migräne bekommen wird.«
»Ich sage es ihnen ja auch jetzt noch nicht. Ich werde sie vorläufig nur darum bitten, daß ich ab dem Frühjahr die Xenia-Schule besuchen darf. Dagegen werden sie hoffentlich nichts einzuwenden haben; schließlich gehen Darja und Lara Nobokowa gleichfalls dorthin, und Staatsrat Nobokow ist neuerdings einer von Papas besten Freunden.«
Swetlana stützte den Kopf in die Hände. »Aber Mama wird trotzdem dagegen sein. Sie hat, seit wir in St. Petersburg sind, doch nichts anderes im Sinn, als mit uns Gesellschaften zu besuchen, neue Kleider bei der Schneiderin zu bestellen und spazierenzufahren.«
Xenia kicherte. »Sie will uns eben an den Mann bringen. Und wie es aussieht, hat sie bei dir mit ihren Bemühungen Erfolg.«
»Unsinn«, wehrte Swetlana ab und spürte zu ihrem Verdruß, daß sie rot wurde. »Bis jetzt hat mir jedenfalls noch niemand einen Antrag gemacht. Und überhaupt ...«
»Und überhaupt ist es Graf Barschewskij, der dir von deinen Bewunderern am besten gefällt!« trumpfte Xenia auf, nun wieder ganz der fröhliche Backfisch, der sie im allgemeinen war. »Er ist aber auch wirklich nett. Wenn du ihn magst, solltest du ihn heiraten.« Sie stieß die ältere Schwester freundschaftlich in die Seite. »Gib es ruhig zu, daß du ihn magst. Habt ihr euch schon geküßt?«
»Nein«, schwindelte Swetlana. »Was glaubst du denn?«
Dabei dachte sie daran, wie Boris Petrowitsch sie vorgestern während einer Abendgesellschaft bei den Bobrikows im Wintergarten für einen Augenblick umarmt und seinen Mund auf ihren gedrückt hatte. Es war nur ein sehr kurzer Kuß gewesen, weil im selben Moment jemand hereingekommen war und Boris sie hastig wieder losgelassen hatte, aber immerhin!
»Dann wird er es aber bei nächster Gelegenheit tun!« behauptete Xenia. »Man muß nur beobachten, wie er dich ansieht. Ich sage dir, Boris Petrowitsch ist unsterblich in dich verliebt.«
»Ach, das sind andere auch«, meinte Swetlana betont wegwerfend. »Leutnant Wasnjezow, zum Beispiel, oder Jewgenij Karsawin ...«
»Nicht zu vergessen Fürst Leonid Soklow«, setzte Xenia die Aufzählung lachend fort, und Swetlanas Miene verfinsterte sich.
»Hör mir nur mit dem auf! Der ist doch viel zu alt – zweiunddreißig soll er sein! Und überhaupt – ich mag ihn nicht. Wenn er mir nur die Hand küßt, bekomme ich schon Gänsehaut.«
»Und bei Boris Barschewskij nicht?« neckte Xenia sie.
»Ach, du!« Swetlana stand auf. »Ich finde deine Neugier wirklich albern!«
Sie ging zu den Fenstern und schloß die roten Seidenportieren.
»Gräfin Swetlana Pawlowna Barschewskaja«, murmelte Xenia. »Das klingt gut, finde ich! Ihr werdet ein sehr hübsches Paar sein.«
Swetlana drehte sich nicht zu ihr um. Sie dachte wieder an den Kuß, den Boris ihr gegeben hatte, und fragte sich, ob er sie beim nächsten Mal länger und intensiver küssen würde.
Morgen wollte er sie zu einer Schlittenfahrt abholen. Aber natürlich würden Miss Sheldon oder Akulina Iwanowna, ihre alte Kinderfrau, als Anstandsdame mitfahren. Ob sich da eine Gelegenheit zum Küssen bot? Recht unwahrscheinlich!
Wenn sie ehrlich war, mußte Swetlana zugeben, daß sie sich ganz gern von Boris Petrowitsch küssen ließe. Sie hatte sich zweifellos ein bißchen in ihn verliebt. Er sah gut aus und war schrecklich nett. Aber war er wirklich der Mann, den sie heiraten wollte?
»Willst du denn überhaupt nicht heiraten?« fragte Swetlana aus ihren Gedanken heraus. »Ich meine, es muß ja nicht gleich sein, aber später irgendwann ...«
Xenia setzte sich auf und legte die Arme um die angezogenen Knie. »Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe und mich ganz toll verliebe. Aber ich will in keinem Fall das typische nutzlose Dasein einer Dame aus unseren Kreisen führen – so wie Mama. Was tut sie denn schon? Die Dienstboten beaufsichtigen, ausfahren, Besuche machen, Gesellschaften geben, langweilige Konversation betreiben, sticken, musizieren, malen – nicht zu vergessen hin und wieder ein bißchen Wohltätigkeit ausüben, weil sich das so gut macht. Ich aber will selbst etwas leisten, auch wenn ich verheiratet bin, verstehst du?«
Swetlana runzelte die Stirn. »Ja – schon. Nur, es wäre ziemlich ungewöhnlich, findest du nicht? Ehrlich gesagt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, daß du irgendwann in einem Hospital arbeitest, vereiterte Wunden aufschneidest, schmutzige Verbände wechselst, Kindern auf die Welt hilfst oder bei Sterbenden wachst. Ich finde das so trostlos!«
»Ich nicht«, widersprach Xenia. »Immerhin würde ich ja vielen Menschen wirklich helfen können, und das würde mich sehr befriedigen. Und ich sage dir eines: Heute ist es vielleicht noch ungewöhnlich, wenn eine Frau einen Beruf ergreift, obwohl sie nicht darauf angewiesen ist, Geld zu verdienen. Aber eines Tages wird das anders sein. Warum sollen wir unsere Talente verkümmern lassen, nur um für einen Mann dazusein, der sich oft genug noch darüber beklagt, wie hart er arbeiten muß, um seiner Familie ein bequemes Leben zu bieten?«
Swetlana drehte sich um. »Ich fürchte, ich habe gar keine besonderen Talente«, meinte sie betrübt. »Deshalb wüßte ich gar nicht, was ich für einen Beruf ergreifen sollte, und wenn ich noch so versessen darauf wäre.«
»Oh, du bist mindestens so klug wie ich und könntest ebensogut studieren. Außerdem bist du sehr musikalisch und hast eine wunderschöne Stimme. Du könntest eine berühmte Sängerin werden.«
Swetlana lachte. »An der Kaiserlichen Oper, was? Und Mama und Papa sitzen in einer Loge und schämen sich zu Tode über ihre ungeratene Tochter.«
»Ich weiß nicht, vielleicht wären sie ja auch stolz, wenn der Zar sich erhebt und dir stehend applaudiert. Und am Ende bekommst du einen Orden verliehen.« Xenia betrachtete ihre Schwester. »Aber vermutlich wirst du ohnehin berühmt werden, weil du die Familienschönheit bist. Ehrlich, Swetlana, du siehst hinreißend aus, und ich bin sicher, daß du, falls du Boris Barschewskij nicht heiratest, eine noch viel phantastischere Partie machst, am Ende sogar jemanden aus der kaiserlichen Familie.«
»Und dann werde ich ein deiner Meinung nach ebenso nutzloses, ödes Leben führen wie Mama und Tante Agafja oder Großmama Natalja und alle anderen, die wir kennen.«
Xenia goß sich aus dem Samowar Tee ein. »Das glaube ich nicht. Dazu bist du zu lebhaft und energisch. Du würdest immer irgend etwas tun, was dich ausfüllt. Das mußt du auch, sonst würdest du verkümmern.«
Boris Barschewskij kam pünktlich am nächsten Vormittag um elf Uhr, um Swetlana und Miss Sheldon zu der verabredeten Schlittenpartie abzuholen. Er lenkte die Troika mit den drei Orlow-Trabern selbst, allerdings ließ er sich nicht dazu hinreißen, gewagte Überholmanöver oder Wettrennen mit anderen Pferdeschlitten zu veranstalten, sondern ließ die goldroten Tiere in einer zwar zügigen, aber gleichmäßigen Gangart laufen.
Sie fuhren über die zugefrorene Newa und die Kleine Newka zur Jelagin-Insel hinüber, wo Boris Petrowitschs verwitweter Vater eine Datscha besaß, unweit der Parkanlagen des Palastes, der einst von Jelagin, dem Hofmarschall Katharinas II., erbaut worden und später in den Besitz der Zarenfamilie übergegangen war.
»Inzwischen wohnt niemand mehr von der kaiserlichen Familie dort«, erklärte Boris Petrowitsch seinen beiden Begleiterinnen, als er die Troika vor der Datscha, einem bezaubernd bemalten Holzhaus im altrussischen Stil, zum Stehen gebracht hatte. »Der Palast dient zur Unterbringung illustrer ausländischer Gäste. Aber die Petersburger kommen in der wärmeren Jahreszeit gern hierher, um zu beobachten, wie die Sonne im Finnischen Meerbusen untergeht.«
Ein Diener nahm ihm das Gespann ab, um die Pferde zu versorgen, während in der Haustür eine dralle ältere Frau mit weißer Schürze erschien, um die Gäste willkommen zu heißen.
»Das ist Pelargeja Andrejewna«, stellte Boris Petrowitsch sie vor. »Sie hält das Haus in Ordnung und richtet alles her, wenn mein Vater für ein paar Tage herkommt oder wir Gäste mitbringen.« Er kniff sie freundschaftlich in die Wange. »Hast du Blinis gemacht, Pelargeja?«
»Sehr wohl, Euer Gnaden. Euer Bursche war gestern hier und hat mir alles ausgerichtet, was Ihr ihm aufgetragen habt. Es gibt heißen Tee, Blinis mit Lachs und feiner Pastetenfüllung und Kissel aus Sahne und gezuckerten Himbeeren. Außerdem habe ich noch Mandeltörtchen gebacken.«
Er schnalzte genießerisch mit der Zunge. »Pelargeja, du bist ein Juwel! Niemand im ganzen heiligen Rußland macht so gute Blinis wie sie«, setzte er hinzu, an Swetlana und Miss Sheldon gewandt. »Aber bitte, kommen Sie doch herein.«
Er führte sie in einen behaglichen Wohnraum, dessen Fenster auf die verschneite Gartenfront hinausgingen. In der Nähe des großen Kachelofens, der angenehme Wärme verströmte, war der Tisch gedeckt.
»Ihr Herr Vater ist nicht da?« erkundigte Miss Sheldon sich in ihrem etwas holprigen Russisch, als sie bemerkte, daß nur drei Gedecke aufgelegt waren.
»Nein, er ist im Augenblick im Auftrag von Minister Goremykin in Smolensk, um dort einige Unstimmigkeiten zwischen der Leitung der dortigen Waffenfabrik und den Arbeitern zu schlichten. Sie wissen ja, die Streiks und Demonstrationen nehmen überhand, und dabei ist es leider zu blutigen Ausschreitungen auf beiden Seiten gekommen.«
Graf Pjotr Barschewskij war Staatssekretär im Innenministerium, wie Swetlana wußte, und aus einigen Bemerkungen ihres Vaters hatte sie herausgehört, daß er ein sehr liberaler Mann sein sollte. Graf Lasarow mißfiel das. Er nannte solche Menschen Wirrköpfe und wirklichkeitsfremde Weltverbesserer. Man müsse jedes Aufbegehren der Arbeiter mit aller Härte im Keim ersticken, sonst brächen eines Tages Anarchie und totales Chaos über Rußland herein, pflegte er zu sagen.
Pelargeja Andrejewna füllte die Teetassen aus dem Samowar, brachte eine große Platte mit köstlich duftenden Blinis herein und legte noch ein paar Holzscheite in den Ofen, ehe sie knicksend verschwand.
Swetlana verrührte Honig in ihrem Tee. »Das ist sicher eine heikle Aufgabe, die Ihr Vater da übernommen hat, Boris Petrowitsch«, meinte sie. »Hoffentlich hat er Erfolg.«
Boris zuckte mit den Schultern. »Wenn die maßgebenden Direktoren auf ihn hören, bestimmt. Die Situation der Arbeiterschaft ist fast überall in Rußland unerträglich. Die Leute leben im größten Elend, trotz des gewaltigen industriellen Aufschwungs in unserem Land. Wir haben etwa drei Millionen Arbeiter, Swetlana Pawlowna, die zum allergrößten Teil in erbärmlichen Massenquartieren hausen. In den sogenannten Wohnheimen stehen aus rohen Brettern zusammengezimmerte Schlafgelegenheiten nebeneinander, ohne jede Trennwand, und sie sind niemals leer, da die Schläfer sich schichtweise abwechseln, je nachdem, wie ihre Arbeitszeit verläuft. Diese armen Teufel beneiden diejenigen, die wenigstens in einer Kamorka leben können. Aber auch dort sind mehrere Familien in einem einzigen Raum zusammengepfercht. Lediglich ein paar Lumpen, die von der Decke herabhängen, teilen die einzelnen Bereiche voneinander ab.«
Er schüttelte den Kopf, als könne er die Ungeheuerlichkeit eines solch armseligen Lebens nicht fassen.
»So vegetieren diese Menschen dahin, schlecht bezahlt, unterernährt und infolgedessen für Krankheiten eine leichte Beute. Und eine noch leichtere für die Verbreiter revolutionärer Ideen. Ein gewisser Uljanow hat schön vor drei Jahren die verschiedenen marxistischen Richtungen in unserem Land in einer ›Union des Kampfes für die Befreiung der Arbeiterklasse‹ zusammengefaßt. Überall kommt es seitdem zu organisierten Protestbewegungen und Streiks, von denen einige Unbelehrbare immer noch glauben, man müsse sie mit eiserner Strenge unterdrücken. Aber das geht nicht mehr. Die Autokratie ist eine überholte Regierungsform, die den Bedürfnissen des russischen Volkes nicht mehr gerecht wird. Was wir brauchen, ist eine Verfassung, die dem Volk mehr Rechte und mehr Sicherheiten gewährt – und vor allem mehr Gerechtigkeit. Sonst wird hier eines Tages alles in einem blutigen Umsturz enden.«
Er hatte sich in Eifer geredet, und Swetlana fühlte eine warme Welle der Sympathie für ihn in sich aufsteigen. Es gefiel ihr, daß er trotz seines adligen Standes und der Wohlhabenheit seiner Familie kein Hohlkopf war, der sich nur für ein vergnügliches Offiziersdasein interessierte. Er besaß Herz und Verstand, dieser Boris Petrowitsch Barschewskij, und hatte nur das ausgesprochen, was Swetlana zwar noch nicht so klar, aber doch immer deutlicher empfunden hatte, seit sie erwachsen genug war, um sich aus dem ein Bild zu machen, was um sie herum vorging und was sie den Tischgesprächen daheim entnommen hatte.
»Auf dem Land ist die Situation nicht viel anders, fürchte ich«, sagte sie nun. »Wie Sie wissen, haben wir bisher in der Nähe von Kiew gelebt. Dort, wie überall, geht es den Bauern immer schlechter, und es ist in verschiedenen Provinzen bereits zu Aufständen gekommen. Man hat wie zu Zeiten der Leibeigenschaft die Besitzungen der Großgrundbesitzer geplündert und angezündet.«
»Ich weiß«, entgegnete Boris düster. »Unsere russischen Muschiks sind nicht mehr gewillt, die Ungerechtigkeit der Landverteilung hinzunehmen, die ihnen nicht mehr als die dürftigste Existenzgrundlage gewährt, während wir Adligen den Löwenanteil besitzen. Von hundertdreißig Millionen Deßjatinten Land in den Kommunen befinden sich hundertundeine Million in privater Hand – ein Mißverhältnis, das dringend geändert werden muß. Wir brauchen eine neue Bodenreform ebenso nötig wie neue Sozialgesetze.«
Er bemerkte, daß Miss Sheldon verstohlen hinter der vorgehaltenen Hand gähnte, und lächelte entschuldigend. »Verzeihung, das ist sicherlich kein Thema für einen unbeschwerten Nachmittag mit zwei so reizenden Damen. Möchten Sie nicht noch eine von diesen ausgezeichneten Fleischpasteten probieren, meine liebe Miss Sheldon? Und eine Tasse Tee trinken Sie gewiß auch noch. Er stammt aus Ostindien, wie Sie wohl schon gemerkt haben. Mein Vater zieht ihn dem russischen Tee vor, deshalb haben wir immer welchen im Haus.«
»Ach ja«, sagte Elaine Sheldon. »Wie interessant. Nun, ich muß gestehen, daß mir dieser Tee, den wir vorzugsweise in meiner Heimat trinken, ebenfalls besser schmeckt als der hiesige. Er ist milder, finden Sie nicht?«
Swetlana empfand leise Enttäuschung, daß sich das Gespräch nun einem so banalen Thema zuwandte. Sie hätte sich gern noch länger mit Boris Petrowitsch über die sozialen Probleme und Schwierigkeiten in Rußland unterhalten.
Daheim war das nicht möglich, denn ihr Vater vertrat den Standpunkt, daß junge Mädchen, ja, überhaupt alle Frauen viel zu törichte Geschöpfe waren, um bei einem ernsten Gespräch über Politik oder ähnliches mithalten zu können. Boris Barschewskij war der erste, der Swetlana überhaupt in eine solche Unterhaltung verwickelt hatte, und das machte sie ein klein wenig stolz.
Während er nun mit Miss Sheldon plauderte und ihr von seinem Englandaufenthalt vor drei Jahren erzählte, dachte Swetlana immer noch an das, was er gesagt hatte, und wünschte sich sehr, das Gespräch irgendwann fortzusetzen. Es gab so vieles, was sie noch nicht wußte oder nicht verstand, und er würde es ihr vielleicht erklären können. Und gewiß würde er nicht ungeduldig dabei werden.
Nach dem Essen zeigte er ihr und der Engländerin das Haus. Es war wunderhübsch eingerichtet, mit Möbeln aus karelischer Birke, bunten Webteppichen und Fellen und einer Küche mit einem großen gemauerten Herd und rauchgeschwärztem Kamin, in dem Schinken und Würste hingen. Allerlei Kupfergerät stand auf Simsen und Wandbrettern.
»Sie müssen einmal im Sommer wiederkommen«, sagte Boris und öffnete die rückwärtige Tür, die in den Garten führte. »Dann ist es hier noch schöner. Unser Grundstück grenzt an das Jelaginsche Palais, und dort finden an allen Sonn- und Feiertagen Konzerte statt, die das Musikkorps der Garde veranstaltet. Dann sind die Palastgärten für alle geöffnet, und Sie treffen dort die interessantesten Leute, Universitätsprofessoren, Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler. Ich bin dort im vergangenen Sommer sogar einmal Leo Tolstoj begegnet, und wir haben uns am Abend sehr lange hier in der Datscha unterhalten.«
»Wirklich? Oh, davon müssen Sie mir mehr erzählen«, rief Swetlana. »Ich glaube, ich habe alles von ihm gelesen ... ›Kindheit‹, ›Drei Tode‹, ›Krieg und Frieden‹, ›Anna Karenina ...‹«
Sie unterbrach sich, weil Miss Sheldon, die vor ihr die Stufen zum Garten hinuntergegangen war, plötzlich ausglitt und mit einem Schreckensschrei zu Boden stürzte.
»Um Himmels willen, Miss Sheldon, haben Sie sich weh getan?«
Die Engländerin richtete sich auf. »Ich fürchte, ja. Mein Fuß ... Ich kann nicht auftreten.«
Boris Petrowitsch kauerte sich neben sie in den Schnee. »Darf ich einmal sehen?« Er untersuchte den Knöchel, bewegte ihn vorsichtig hin und her, was Miss Sheldon ein Aufstöhnen entlockte.
»Nun, gebrochen scheint er wohl nicht zu sein. Aber einen Bluterguß oder eine Verstauchung haben Sie sich sicherlich zugezogen. Kommen Sie ins Haus zurück, ich helfe Ihnen, sich niederzulegen. Und dann kann Pelargeja Ihnen kalte Kompressen machen.«
Auf ihn gestützt, humpelte Miss Sheldon die Treppe wieder hinauf und ließ sich zu einem Diwan führen. Boris läutete nach Pelargeja, die gleich darauf erschien und Miss Sheldon erst einmal die Stiefel von den Füßen zog.
»So ein Unglück aber auch«, jammerte sie. »Dabei habe ich meinem Mann noch gesagt: Iwan, habe ich gesagt, hast du auch ordentlich den Schnee von der Treppe gefegt? Aber was kann man von den Männern schon erwarten; sie erledigen selten eine Arbeit gewissenhaft.«
»Ich hätte besser aufpassen sollen«, sagte Miss Sheldon und betrachtete ihren Knöchel, der ein wenig angeschwollen war. »Aber es ist nicht so schlimm, denke ich. Wenn ich eine Weile ruhe, wird es sicherlich rasch besser werden.«
Trotzdem bestand Pelargeja darauf, ihr kalte Umschläge zu machen. Sie lief in die Küche und kehrte kurz darauf mit einer Schüssel und einem Tuch wieder.
»Ich habe Schnee ins Wasser getan, damit es recht kalt ist, und dazu einen Kräutersud zum Abschwellen«, erklärte sie und wandte sich an Boris. »Sie sollte aber ihren Strumpf ausziehen, Euer Gnaden. Vielleicht geht Ihr solange hinaus.«
Swetlana blickte Miss Sheldon mitleidig an. »Tut es sehr weh?«
Die Engländerin wehrte ab. »Nein, nein, ich kann es gut aushalten. Machen Sie sich keine Sorgen, liebes Kind. Wissen Sie was? Gehen Sie mit Graf Barschewskij ruhig in den Garten und lassen Sie mich hier ein Weilchen liegen. Pelargeja Andrejewna wird sich um mich kümmern.«
Swetlana fand, daß Miss Sheldons Lächeln ausgesprochen verschwörerisch wirkte, und spürte, wie ihr eine leichte Röte in die Wangen stieg. »Ja, wenn Sie meinen ... Aber dann werde ich mir meinen Mantel holen.«
Als sie und Boris das Haus verließen – diesmal half er ihr fürsorglich die Treppe hinunter –, begann es von neuem zu schneien. Weiche große Flocken waren es, die sich auf Swetlanas Pelzmütze festsetzten, so daß sie bald aussah, als sei sie aus sibirischem Feh.
Boris hatte ihr seinen Arm geboten, und so stapften sie nebeneinander zu dem schmiedeeisernen Gitter, das das Grundstück vom Jelaginischen Palais trennte.
Swetlana betrachtete die prächtige Gartenfront des imposanten Gebäudes. Es wies in der Mitte einen halbrunden, von Säulen umgebenen Vorbau auf und an beiden Seiten einen Portikus mit zweifach gekuppelten Säulen. Breite Treppen, auf denen riesige, jetzt allerdings dick verschneite Marmorvasen standen, führten zum Ufer der zugefrorenen Newka hinunter.
»Was sind das für Inseln dort drüben?« fragte Swetlana, und Boris antwortete:
»Die Kreuz- und die Steininsel. Übrigens war das Jelagin-Palais lange Zeit hindurch der Wohnsitz von Maria Fjodorowna, der Mutter von Zar Alexander I.«
Swetlana wandte ihm das Gesicht zu. »Das war die Gemahlin von Zar Paul, nicht wahr? Er ist ermordet worden.«
Boris nickte. »Aber seine Mörder haben Rußland mit ihrer Tat einen großen Dienst erwiesen. Dieser Zar war geisteskrank und unberechenbar. Zarin Katharina, seine Mutter, hat nie gewollt, daß er jemals den Thron bestieg. Sie hoffte, daß sie noch lange genug lebte, um ihren Enkel Alexander zum Zarewitsch zu machen. Paul sollte in der Thronfolge übergangen werden.«
Sie vergrub die Hände in ihrem Muff. »In unserer Geschichte hat es einige Zaren gegeben, die man umgebracht hat – oder auch ihre Söhne. Und heute hört man wieder soviel von Mordanschlägen und Attentaten ... Aber es wird doch wohl niemand wagen, die Person unseres Zaren und seine Familie anzutasten?«
Barschewskij hob die Schultern. »Man kann es nur hoffen. Und man muß andererseits hoffen, daß Seine Majestät die Zeichen der Zeit erkennt und endlich von dem Gedanken abrückt, Rußland könne heute noch wie vor zweihundert Jahren regiert werden. Wenn er es nicht tut – und zwar bald tut –, ist es sehr wohl möglich, daß es eines Tages zu einer Revolution kommt. Und was danach geschieht ... Ich fürchte, ich würde dann nicht mehr gern in diesem neuen Rußland leben.«
»Und warum nicht?«
»Weil dann vermutlich auch alles zerstört würde, was gut und schön ist an unserem Leben. Die alten Ideale, der Zauber, der jetzt noch über allem liegt, auch wenn sich viel Brüchiges darunter verbirgt ... Rußland ist krank, Swetlana Pawlowna, aber es kann wieder genesen, wenn der Zar es will. Er allein hat die Möglichkeit, Altes und Neues zu einem festen Gefüge zusammenzuschmieden.«
Er verstummte und drückte ihren Arm. »Aber das ist wirklich kein Gesprächsstoff für diesen wunderschönen Tag mit Ihnen. Ich bin so glücklich, daß ich einmal mit Ihnen allein sein kann, Swetlana Pawlowna. Ich möchte Ihnen so viel sagen und habe mir schon hundertmal die Worte zurechtgelegt. Aber jetzt sind sie wie fortgeweht aus meinem Kopf. Nur eines weiß ich noch: Ich habe Sie sehr lieb, und ich träume davon, Sie in die Arme zu nehmen und ganz festzuhalten.«
Während er sprach, hatte er ihr die Hände auf die Schultern gelegt. Nun glitten sie tiefer, umfaßten ihre Taille, und Swetlana fühlte sich an seine Brust gedrückt.
Es war ein gutes Gefühl; sie verspürte Wärme und Zuneigung und die Sehnsucht nach etwas, das sie noch nicht kannte, von dem sie aber ahnte, daß es wunderschön sein würde.
Mehr, dachte sie, ich will mehr ...
Unwillkürlich hob sie den Kopf und öffnete leicht die Lippen. Da küßte er sie und hielt sie noch fester an sich gepreßt. »Swetlana«, murmelte er, »meine Liebste ...«
Ihr Herz klopfte rascher. Es war schön, so geküßt zu werden, und die Zärtlichkeit in Boris’ Stimme überwältigte sie. Sie legte die Arme um seinen Hals und erwiderte seinen Kuß. Und in diesem Augenblick war sie ganz sicher, Boris Petrowitsch Barschewskij zu lieben.
Er kam schon am nächsten Vormittag in das Lasarowsche Palais, um bei ihren Eltern um ihre Hand anzuhalten.
Graf Pawel Lasarow reagierte zunächst ein wenig zögernd. Swetlana sei gerade siebzehn geworden, und überhaupt – sie und Boris kannten sich doch erst wenige Wochen. Ob er denn tatsächlich sicher sei ...
»Vollkommen sicher«, erwiderte Boris Petrowitsch. »So wie Sie, Graf Lasarow, es gewiß auch waren, als Sie Ihre Gattin heirateten.«
Wera Karlowna, die der Unterhaltung bisher schweigend gefolgt war, während sie überlegte, ob man der Bewerbung zustimmen oder noch auf eine bessere Partie für ihre älteste Tochter hoffen konnte, kicherte verschämt. »Das haben Sie reizend gesagt, mein lieber Boris Petrowitsch.«
Ihr Mann warf ihr einen irritierten Blick zu. »Wera, ich bitte Sie ...«
»Aber es ist wahr!« beharrte sie. »Es klingt wirklich hübsch. Die Frage ist nur, ob auch Swetlana ...«
»Ja!« sagte Boris glücklich. »Ich bin mir der Zuneigung von Swetlana Pawlowna gewiß. Wir haben uns gestern ausgesprochen.«
Diesmal wandte er sich mehr an Wera als an ihren Gatten. »Ich bitte Sie von ganzem Herzen, stehen Sie unserem Glück nicht im Weg. Ihre Tochter soll es nie bereuen, mich geheiratet zu haben. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, lebe ich in absolut gesicherten finanziellen Verhältnissen. Ich bin das einzige Kind meiner Eltern und somit auch ihr einziger Erbe. Meine Familie besitzt große Ländereien, Anteile an diversen Bergwerken im Ural, Papierfabriken in Woronesch und Tula, eine Porzellanmanufaktur in Moskau, Webereien in Kasan und Nischnij-Nowgorod und ...«
»Schon gut, schon gut!« unterbrach Graf Lasarow die Aufzählung. »Ihr Herr Vater ist als sehr vermögender Mann bekannt. In diesem Punkt hege ich absolut keine Bedenken. Allerdings fühle ich mich ein wenig überrumpelt, das will ich Ihnen nicht verhehlen. Ich war der Meinung, daß Swetlana erst einen oder zwei Winter in der Petersburger Gesellschaft verbringen sollte, ehe sie sich bindet.«
»Ach, Pawel Konstantinowitsch!« mischte Wera Karlowna sich wieder ein. Sie hatte sich entschieden, Swetlana diesem jungen und so angenehm reichen Mann zu geben. Außerdem war es sicherlich kein Fehler, wenn das Kind rasch in feste Hände kam. Dann war es keine Konkurrenz mehr für Xenia, die, Gott sei’s geklagt, längst nicht so viele Bewunderer hatte wie Swetlana. »Wozu noch warten? Die beiden lieben sich, und wir sollten ihnen unseren Segen geben. Vergessen Sie nicht, ich selbst war gerade achtzehn geworden, als Sie mich heirateten. Und die Hochzeit braucht ja auch in diesem Fall erst im Spätsommer zu sein. Swetlana hat nämlich im August Geburtstag«, wandte sie sich an Boris.
Er kam zu ihr und küßte ihre Hand. »Danke. Tausend Dank für Ihre Zustimmung, Gräfin.«
Er warf einen bittenden Blick zu Lasarow hinüber. »Und Sie? Nicht wahr, Sie sagen doch jetzt ebenfalls ja?«
Lasarow erhob sich aus seinem Ledersessel. »Nun, ich denke, wir sollten erst einmal Swetlana hereinrufen.«
Sie hatte in einem der Salons gewartet und kam sofort, als ihr Vater die Tür zur Bibliothek öffnete und nach ihr rief.
Sie trug ein goldbraunes Morgenkleid mit breiter Schärpe und das Haar mit einer Samtschleife zurückgebunden.
»Was höre ich denn da, mein Kind«, sagte Graf Lasarow mit einer bei ihm ungewohnten Rührung. »Du willst diesen jungen Mann hier heiraten? Hast du dir das auch gut überlegt?«
Sie wurde rot, nickte und lächelte. »Ja, Papa, ich glaube schon.«
»Ach, mein liebes, liebes Kind!« Wera Karlowna brach in Tränen aus. Sie liebte sentimentale Auftritte. Schluchzend zog sie Swetlana an die Brust. »Gott segne dich. Und Sie auch, mein lieber Sohn«, wandte sie sich an Boris, um ihn gleichfalls zu umarmen. »Machen Sie mein Kind glücklich.«
»Das werde ich«, versprach Graf Barschewskij und blickte so strahlend drein, daß Swetlana nicht anders konnte, als ihm beide Hände zu reichen, die er an sein Herz drückte.
Und wieder war sie ganz sicher, ihn zu lieben. Es gab überhaupt nichts, das sich zwischen sie stellen konnte.
3. Kapitel
Die Verlobung, die nach orthodoxem Ritus fast ebenso bindend wie eine Trauung war, wurde in der Auferstehungskirche vollzogen.
Es war Abend, noch immer herrschte eisige Winterkälte, und der Schnee knirschte unter den Hufen der Pferde, die die Schlitten mit der Verlobungsgesellschaft nach der kirchlichen Zeremonie zum Lasarowschen Palais brachten.
An den Straßenecken brannten große hellodemde Feuer, an denen sich die Passanten wärmen konnten, und die bunten Dächer und Kuppeln der Petersburger Kirchen waren dick verschneit.
Wie es Tradition war, wurden an jenem Abend im Lasarow-Palais auch die Armen gespeist, die sich im Hinterhof des Wirtschaftstraktes eingefunden hatten. In langer Reihe standen sie da, Bettler und Obdachlose, aber auch solche, die krank und elend waren und keine Arbeit hatten.
Es gab Kohlsuppe aus großen Kesseln, mit viel Fleisch darin, Kascha mit dicker Sahne, Brot, Kwass und heißen Tee, und die Diener hatten Anweisung, die mitgebrachten Töpfe der Leute reichlich zu füllen und ihnen nicht zu verwehren, sich auch noch für morgen oder übermorgen Brot und Speck in die Taschen zu stopfen.
Auch hier brannte ein prasselndes Holzfeuer in der Mitte des Hofes, und darum drängten sich viele, wenn sie etwas zu essen ergattert hatten, um die vom Frost erstarrten Glieder zu wärmen.
»Gott segne Seine Gnaden«, sagten die Leute, bevor sie mit ihren vollen Näpfen zum Feuer schlurften, um sich erst einmal gierig satt zu essen. »Er schenke ihm und seiner Familie ein langes Leben.«
»Gott segnet ohnehin nur die Reichen«, erhob sich plötzlich eine scharfe, helle Frauenstimme über das demütige Gemurmel. »Deshalb ist es unnötig, daß ihr ihn noch darum bittet. Fluchen solltet ihr ihm, weil er blind und taub geworden ist für eure Not. Oder ist jemals für euch Brot vom Himmel gefallen, wenn ihr am Verrecken wart, oder aus Wasser Milch geworden, wenn eure Kinder an der Schwindsucht krepierten?«
Die Frau stand in der Nähe des Feuers, und der Flammenschein beleuchtete ihr hageres Gesicht mit den tiefliegenden Augen. Sie war in einen schmutzigen, löcherigen Kutschermantel gehüllt, und noch während sie sprach, waren etliche, die in ihrer Nähe waren, zurückgewichen, so daß sich auf einmal ein kleiner freier Platz um sie gebildet hatte.
Aber die Frau ließ sich dadurch nicht abschrecken. Furchtlos blickte sie in die Runde und fuhr in der gleichen Lautstärke wie vordem fort:
»Was seid ihr doch für Dummköpfe! Für ein bißchen Fressen kriecht und winselt ihr und küßt noch den Fuß, der sonst nach euch tritt! Was ist es denn schon, was der allergütigste, allergnädigste Graf Lasarow und seinesgleichen euch zukommen lassen? Ein elendes Almosen! Dort drinnen fressen sie Kaviar und saufen französischen Champagner. Sie tragen Samt und Pelze, und von einer einzigen Kette, die so ein adliges Hürchen um den Hals hängen hat, könnten ein paar Dutzend von euch ein ganzes Jahr lang leben!«
»Halt’s Maul!« mischte sich ein alter Mann ein und drohte ihr mit der Faust. »Willst du, daß man die Polizei ruft und uns hinausjagt? Die Leute, die noch nichts gekriegt haben, stehen bis an die Straße hinunter. Sollen sie leer ausgehen nur wegen der Hetzreden eines verdammten Frauenzimmers?«
Die Frau lachte und zog ihren Mantel enger um sich. »Hast du Angst, Ziegenbart? Dann geh und mach dir in die Hose. Aber vergiß nicht, noch ein paar Segenswünsche für Seine Gnaden, den Grafen Lasarow, anzufügen. Vielleicht verwandelt das deinen Gestank in puren Weihrauch!«
Einige Umstehende fielen in ihr Lachen ein, und ein jüngerer Mann in einer abgerissenen Uniform, dem der rechte Arm fehlte, rief: »Sie hat recht. Es ist wirklich nur ein Almosen, das wir hier kriegen, und dafür muß man nicht in Dankbarkeit zerfließen. Sie haben so viel, die Herren, und können jeden Tag Tausende von Rubeln verprassen, während wir vor Hunger nicht in den Schlaf kommen. Man sollte ihnen ihre Kohlsuppe ins Gesicht schütten und den Palast stürmen, um zu sehen, wie sie dort fressen und saufen. Erbärmliche Ausbeuter sind es, die durch unsere Not reich und immer reicher werden!«
»Stopft ihm die Schnauze, dem Aufwiegler!«
»Jagt ihn und das Frauenzimmer zum Teufel!«
»Weg mit den beiden, bevor die Diener die Hunde auf uns hetzen!« So erhoben sich laute, aufgebrachte Stimmen, doch andere widersprachen:
»Nein, laßt sie weiterreden. Wir sind ein paar hundert, und wenn man uns fortjagen will, können wir uns wehren! Viel zu lange haben wir gekuscht und uns ducken lassen!«