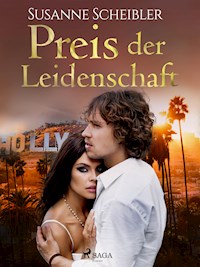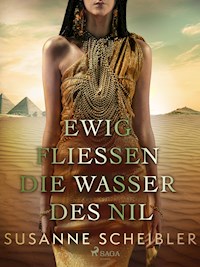Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tanja
- Sprache: Deutsch
Tanja, früher eine sibirische Leibeigene, nun die elegante Schönheit am Hof Katharinas der Großen, geht mit ihrer großen Liebe Andrej nach Amerika. Die Ungnade der Kaiserin zwingt Graf Andrej Russland zu verlassen. Während des blutigen amerikanischen Unabhängigkeitskrieges hofft das Paar in Virginia eine neue Heimat zu finden. Wird Tanja jedoch von ihrem Heimweh zurück nach Russland geleitet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Scheibler
Tanja - Geliebte und Rebellin
Saga
Tanja - Geliebte und Rebellin
Tanja Geliebte und Rebellin – Band 3 der Tanja Trilogie
Copyright © 2021 by Michael Klumb
vertreten durch die AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Die Originalausgabe ist 1984 im Goldmann Verlag erschienen
Coverbild/Illustration
Copyright © 1984, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961157
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1
Seiner französischen Majestät Fregatte ›Marie Floride‹ stampfte und gierte in der unruhigen See. Ein heftiger Wind orgelte in der Takelage und peitschte Regenböen über das Deck. In der Kapitänskajüte tranken sie Champagner. Es war Mitternacht –, Silvester des Jahres 1780. Kapitän Lamont, ein grauhaariger, breitschultriger Bretone, ging von einem zum anderen der zwei Dutzend Passagiere, die er an diesem Abend zum Souper geladen hatte. »Auf ein glückliches neues Jahr«, sagte er. »Möge es Ihnen Gesundheit und Gottes Segen bringen.«
Nach französischer Sitte küßte er die Damen auf beide Wangen. Aber auch unter den Männern gab es Umarmungen und Schulterklopfen. Die meisten waren nicht mehr nüchtern. Lärmend riefen sie einander ihre Neujahrswünsche zu: »Viel Glück, François! Mögest du mehr Rotröcke vor deinen Degen kriegen, als du Haare im Bart hast!«
»Guillaume, mon cher, es lebe das neue Jahr! Es lebe die Freiheit!«
»Tod allen Engländern! Wir werden die verdammten Rotröcke schon das Fürchten lehren!« So riefen und lachten sie durcheinander, die jungen Franzosen, die in Bordeaux an Bord der ›Marie Floride‹ gekommen waren, allesamt Adlige und keiner älter als fünfundzwanzig. Sie wollten nach Amerika, um unter George Washington und ihrem Landsmann General Rochambeau für die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Nordamerika in den Krieg zu ziehen.
Krieg . . . Tanja warf einen Blick zu ihrem Sohn Pawel hinüber, der aus ihrer ersten Ehe mit dem Prinzen Boris Tutscharew stammte, und ihr Herz tat ein paar rasche, harte Schläge. Wie Pawel an den Lippen dieser jungen Männer hing! Wie er glühte vor Begeisterung, wenn sie von der Freiheit sprachen, für deren Sieg sie kämpfen wollten! Aber Krieg bedeutete auch töten und getötet werden. Begriff Pawel dies nicht, wenn er mit so leuchtenden Augen den Reden des jungen Comte de Marville oder des Marquis de Bourac lauschte? Er war doch erst sechzehn, und Tanja hatte ihn so viele Jahre entbehren müssen, diesen so lange für tot gehaltenen, schmerzlich beweinten Sohn. Es war nicht möglich, nein, es war ganz und gar unmöglich, daß sie ihn jetzt schon wieder hergeben sollte – für einen Krieg!
Tanja sah, wie Gaston de Bourac Pawel zutrank. Was er sagte, konnte sie nicht verstehen. Sie beobachtete nur, wie Pawel dem jungen Franzosen strahlend zuhörte und mehrere Male nickte. In diesem Augenblick legte Andrej den Arm um Tanja. »Du machst ein Gesicht wie eine Hühnerglucke, der ihr Junges entwischt ist.«
Tanja wandte sich ihrem Mann zu, und ihre Miene entspannte sich. »Wie gut du mich kennst . . . Nicht wahr, du wirst nicht zulassen, daß diese jungen Franzosen Pawel Verrücktheiten in den Kopf setzen?«
»Tanja, du lieber Gott, der Junge ist sechzehn! Es ist ganz normal, daß ihn dieses Gerede von Krieg und Heldentum fasziniert. Aber bis er in das Alter kommt, wo er ernsthaft erwägen könnte, der Armee beizutreten, ist der Krieg längst zu Ende. Worüber machst du dir also Gedanken?«
Sie lächelte schuldbewußt. »Du hast es ja gesagt: weil ich eine Glucke bin.«
»Aber eine sehr hübsche, meine liebe Gräfin Dobrynina!« Andrejs Finger streichelten die samtige Haut ihrer Schultern. Sie trug eine tief dekolletierte, burgunderrote Robe mit dunklem Spitzenbesatz und Perlen im schwarzen, ungepuderten Haar. Im flackernden Licht der Talglampen sah sie sehr jung und sehr begehrenswert aus. Sie hatte prächtige, gesunde weiße Zähne und strahlend blaue Augen, und Andrej Dobrynin dachte, daß sie zu den glücklichen Frauen gehörte, deren Schönheit auch das Alter nicht würde zerstören können. Die Konturen dieses leidenschaftlichen Gesichts würden bleiben, die wie mit Tusche gezeichneten Brauen, die hohen Wangenknochen, die schmale, gerade Nase und der geschwungene Mund. »Tanjuschka, mein Herz«, flüsterte Andrej, und sie legte für ein paar Sekunden den Kopf an seine Brust.
Tanjuschka . . ., das klang nach dem, was sie vor vielen Jahren einmal gewesen war: das Mädchen aus Sibirien, eine entflohene Leibeigene und Andrejs Geliebte. Jetzt war sie seine Frau. Unten in einer Kajüte schliefen ihr kleiner Sohn Alexander, gerade ein halbes Jahr alt, und die zweijährige Olga, Tanjas Tochter, die Andrej an Kindes Statt angenommen hatte. Sie hatten Rußland verlassen, weil Zarin Katharina Pawel Tutscharew außer Landes verwiesen hatte und Andrej Dobrynin am Kaiserhof in Ungnade gefallen war.
Die Zwischen- und Unterdecks der ›Marie Floride‹ waren von Auswanderern überfüllt, die in Bordeaux an Bord gekommen waren. Von überall her kamen sie, aus dem von zahllosen Kleintyrannen beherrschten Deutschland, aus Frankreich, Polen und Österreich; politisch Verfolgte, solche, die um ihrer Religion willen fliehen mußten, und wieder andere, die wirtschaftliche Not zu dem Abenteuer Amerika trieb, weil man dort Land bekam und siedeln konnte, um sich und den Seinen ein besseres Dasein zu schaffen. Auch sie feierten den Beginn des neuen Jahres, das für sie gleichzeitig ein neues Leben bedeutete. Tanja und Andrej hörten ihr Lärmen aus dem Zwischendeck, als sie sich wenig später ohne großes Aufsehen empfahlen. Pawel blieb noch bei den Feiernden; der Champagner war ihm zu Kopf gestiegen, er hatte blitzende Augen und heiße Wangen, als er seiner Mutter die Hand küßte. »Schlafen Sie wohl, Maman«, sagte er in seinem holprigen Französisch, das er als Kind zu lernen begonnen hatte, bevor die Wirren des Pugatschew-Aufstandes ihn und Tanja auf Jahre hinaus trennten.
Die ›Marie Floride‹ ächzte und zitterte unter dem Zugriff des Windes, der merklich heftiger geworden war. Pawel hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten, und die Verbeugung, die er Andrej machte, fiel ziemlich unsicher aus. »Auch Ihnen eine gute Nacht, Andrej Petrowitsch«, wünschte er seinem Stiefvater. »Denken Sie nur, Kapitän Lamont meint, daß wir in sechs Tagen in Philadelphia sein werden. Nur noch sechs Tage! Was für ein Gefühl! Ich werde die amerikanische Erde küssen, nur weil sie nicht schwankt.«
»Möchtest du noch ein bißchen frische Luft schnappen?« fragte Andrej, als er und Tanja die Kapitänskajüte verließen. »Dann warte hier, ich hole dir einen Pelz.« Sie blieb am Niedergang stehen, bis er zurück war und ihr den Zobel um die Schultern legte. Auch er hatte einen Mantel übergeworfen, und als sie das Oberdeck erreichten, schüttete ihnen ein eisiger Wind Schauer von Schneeregen und aufsprühender Gischt ins Gesicht.
Der Himmel war von jagenden Wolken bedeckt. Tanja klammerte sich an einem der hölzernen Masten fest und blickte auf die aufgewühlte See. »In Rußland«, sagte sie und mußte fast schreien, um gegen den Lärm von Wind und Meer und der knatternden Segel anzukommen, »in Rußland liegt jetzt Schnee. Er knirscht unter jedem Schritt, und im Wald ächzen die Bäume unter der weißen Last. In Rußland, Andrej, würden wir jetzt in einer Troika über die Schneefelder jagen, und die Nacht wäre hell davon.«
Andrej nahm sie in die Arme. »Denk nicht daran, Tanjuschka, mein Herz. Rußland liegt hinter uns. Wir müssen nach vorn sehen.«
Sie kämpfte mit den Tränen. Den ganzen Abend hatte sie sie unterdrückt, aber nun ließen sie sich nicht aufhalten. »Ich weiß, daß es falsch ist. Aber manchmal muß man eben auch etwas Falsches tun. Ich habe Sehnsucht, Andrej, Sehnsucht nach Rußland.«
»Dann wärst du besser dort geblieben«, sagte er hart. »Du hättest Pawel allein fortgehen lassen müssen und alle Tage von neuem Angst haben um mich, ob Potemkin oder die Zarin oder beide gemeinsam mir einen Strick um den Hals legen.«
»Aber so meine ich das doch nicht.« Sie küßte ihn mit kalten, tränennassen Lippen. »Wir sind beisammen, und das ist so viel. Nur in Nächten wie heute . . . ach, Andrej, kannst du das nicht verstehen?«
»O ja«, erwiderte er leichthin. »Aber stell dir nur vor, wir wären wirklich in Rußland. Wir hätten die Mitternachtsmesse in der Isaak-Kathedrale gehört. Der Erzbischof von Nowgorod hätte sie gehalten. Danach Cour bei Ihrer Majestät. Sie fett und zu fest geschnürt wie immer, Potemkin betrunken und bösartig, dazu der ganze Rattenschwanz seines Anhangs. All die Lobhuldeleien, die verzuckerten Bosheiten, das falsche Getue . . . Dershawin wird eine fade Ode auf die Kaiserin vortragen, und alle werden sich vor Begeisterung fast die Hosen vollmachen. Lanskoj, der kaiserliche Liebhaber – oder ist es schon ein neuer? – wird neben Katharina sitzen, und sie wird ihm dann und wann Verliebtheiten zuflüstern.« Täuschend ähnlich ahmte er Katharinas Stimme mit dem Akzent der Deutschen nach, den sie nie ganz abgelegt hatte: »Mein Juwel, mein Goldfasan, wie reizend du heute wieder bist. Ah, ich brenne danach, dich zu umarmen . . .«
Tanja mußte lachen, und Andrej küßte ihr die Tränen fort. »Besser?« fragte er, und sie nickte. »Dann laß uns schlafen gehen. Solch eine Nacht auf See mag auf Bildern ungemein romantisch aussehen. Die Wirklichkeit ist naß und hundekalt. Ich möchte mir keinen Schnupfen einhandeln. Denn den könnte ich nur mit Brandy kurieren, und nach meinen bisherigen Erfahrungen ist der Schnaps auf diesem Schiff miserabler als der aus der schlimmsten Kaschemme im ganzen heiligen Rußland.«
Laila, Tanjas Zofe, und Andrejs Diener Ilja Semjonowitsch, ein stämmiger kleiner Ukrainer mit dem Gesicht eines Hamsters und der Gewitztheit eines Straßenköters gesegnet, die einzigen Dienstboten, die sie aus St. Petersburg mitgenommen hatte, waren noch auf. Laila half Tanja beim Auskleiden und bürstete ihr das Haar.
»Hol mir noch einen Krug Wasser«, bat Andrej, während Ilja ihm die Stiefel auszog. »Dieser Champagner war zu süß, ich habe Durst wie ein Kamel aus der Hungersteppe.«
Der Diener kam alsbald zurück und schenkte ihm einen Becher ein. Andrej roch angewidert daran. »Ich würde zehn Goldrubel für einen anständigen Schluck frischen Wassers geben. Ich glaube, das ist das erste, was ich tue, wenn wir in Philadelphia sind: mir eine Kanne Quellwasser bringen lassen.« Er zwinkerte dem Diener mit einem Auge zu. »Und du, Ilja, was würdest du tun?«
»Je nun, Euer Gnaden, von Wasser habe ich noch nie viel gehalten, außer zum Waschen. Trinken sollte ein anständiger Christenmensch nur Wodka oder Tee. Also werde ich den Hafen abklappern, ob ich irgendwo ein russisches Schiff vor Anker liegen sehe. Und dann werde ich, wenn’s sein muß, die Ikone des Heiligen Stepan, die mir mein letzter Herr vor seinem Tod geschenkt hat, gegen ein Fäßchen Wodka eintauschen, von dem ich an allen Feiertagen und an den Geburtstagen der Heiligen ein Schlückchen trinke.«
Andrej lachte und steckte ihm ein paar Goldmünzen zu. »Behalte deine Ikone und kauf den Wodka für mich, wenn wir in Philadephia sind. Ich werde nicht darauf achten, wenn du mich hin und wieder um ein Glas bestiehlst.«
Bald darauf war er mit Tanja allein. Er streckte sich auf dem Bett aus und beobachtete seine Frau, wie sie ihr Negligé auszog und zur Tür ging, um sie zu verriegeln. Zuvor öffnete sie sie noch einmal einen Spaltbreit und lauschte nach draußen. »Der Wind hat nachgelassen. Und oben in der Kapitänskajüte feiern sie noch immer. Hoffentlich betrinkt Pawel sich nicht.«
»Matuschka . . . Mütterchen!« sagte Andrej in zärtlichem Spott. »In Pawels Alter hatte ich schon mehr Räusche hinter mir als Weibergeschichten. Und das waren auch nicht wenige.« Er streckte den Arm aus und zog Tanja zu sich heran. »Habe ich vorhin wirklich gesagt, daß wir schlafen gehen sollten? Dann widerrufe ich das hiermit. Es wird noch eine Weile dauern.«
Mit einem Ruck warf er sie auf das Bett und begann sie zu küssen. Und es war wie immer –, ihr Körper gab fast augenblicklich Antwort auf seine Wünsche. Sie drängte sich in seine Umarmung und genoß sein zärtliches Verlangen. Andrej dehnte das Liebesspiel lange aus, fast zu lange für Tanjas wachsende Erregung. Sie bog sich ihm entgegen, und als er endlich zu ihr kam, stöhnte sie vor Lust.
»Meine Liebste«, flüsterte Andrej, »ach, meine schöne Liebste . . .«
Später, als ihr Atem sich wieder beruhigt hatte, legte er sich neben sie, ohne sie aus seinen Armen zu lassen. Sie spürte, wie sein Herz schlug, hart und schnell, und küßte die Stelle, wo es klopfte. »Mein lieber Andrej, du bist ganz schön verrückt . . . So spät in der Nacht sollte man längst schlafen.«
Er wickelte sich ihr langes schwarzes Haar um die Hand. »Verrückt – ja, nach dir! Und das ist wahrhaftig der Gipfel – ein Mann, der an den Röcken seiner Frau hängt, und das schon wer weiß wie lange. Seit ich dich kenne, habe ich kaum mehr Appetit auf andere Frauen gehabt – schrecklich!«
»Mein armer Liebster! Hättest du das früher gewußt, du hättest vermutlich die Finger von mir gelassen.«
»Vermutlich nicht.« Sie hörte, wie er in sich hineinlachte. »Du warst zwar sehr jung, aber so süß in deiner ängstlichen Unterwürfigkeit.«
»Ich war sechzehn. Heute bin ich weder ängstlich noch unterwürfig.«
»Aber du bist immer noch Tanjuschka. Ach, mein Herz, ich bin froh, daß es dich gibt.« Sie redeten russisch miteinander – welche Sprache könnte zärtlicher klingen! Tanja lag still und lauschte Andrejs Worten nach. Und sie dachte: Er ist mein Leben, dieser Mann. Er war es von Anfang an. Niemand außer ihm hatte jemals die Macht, mich so glücklich oder so unglücklich zu machen. Und bei Gott – er hat beides getan. Aber trotzdem – wenn ich noch einmal sechzehn Jahre alt wäre und ihm nein sagen könnte – ich würde alles wieder genauso geschehen lassen, wie es gewesen ist.
In sechs Tagen, hatte Kapitän Lamont gesagt, würden sie in Philadelphia einlaufen, wenn alles gut ginge.
Es ging nicht gut. Am 2. Januar des Jahres 1781 entdeckte auf der ›Marie Floride‹ der Matrose Jean Lemaître steuerbord voraus die Segel eines fremden Schiffes. Das Wetter hatte aufgeklart, es war eisig kalt, und die Sonne schien. Das Meer schimmerte grünlich, mit weißen Wogenkämmen, und eine kräftige Brise wehte.
Tanja stand an der Reling des Achterschiffs, das Gesicht gerötet von der frischen Luft, als sie Rufe vom Ausguck hörte. Gleich darauf ertönten mehrere scharfe Pfiffe, Kommandos wurden gebrüllt, und als Tanja zum Oberdeck lief, prallte sie mit den Matrosen der ›Marie Floride‹ zusammen, die den Niedergang heraufgepoltert kamen.
Kapitän Lamont stand neben dem Rudergänger und beobachtete durch sein Glas das fremde Schiff. Es war kleiner und wendiger als die ›Marie Floride‹ und näherte sich mit großer Geschwindigkeit. Bald konnte Tanja mit bloßem Auge schon den Rumpf und die Stückpforten erkennen.
»Ein Franzose ist das nicht, da gehe ich jede Wette ein«, sagte eine Frauenstimme neben Tanja. Florence Bellemonde, die eine Kajüte den Dobrynins gegenüber bewohnte, lehnte an dem hölzernen Treppengeländer zum Ruderhaus. Ihr feuerrotes Haar leuchtete in der Sonne. »Sieht ganz so aus, als bekämen wir Schwierigkeiten.«
»Wirklich?« fragte Tanja. »Wie kommen Sie darauf?« Sie mochte Florence Bellemonde recht gern. Zweifellos war die Französin nicht das, was man unter einer Dame verstand, obwohl sie sichtlich bemüht war, diesen Eindruck zu erwecken. Aber ihre Kleidung war eine Spur zu auffallend, um wirklich elegant zu sein, und sie trug zuviel Schmuck. Sie mochte um die Dreißig sein, eine schöne Person mit prachtvoller Figur und klugen, sehr wachen Augen.
»Oh«, sagte sie jetzt, »wenn man wie ich in einer Hafenstadt aufgewachsen ist, weiß man ein bißchen Bescheid mit Schiffen. Der Kahn dort vorn ist für ein Kriegsschiff zu klein und für ein Handelsschiff zu stark mit Kanonen bestückt. Also kann es eigentlich nur ein Kaperschiff sein, und da es inzwischen alle Segel gesetzt hat und auf uns zukommt, obwohl es unsere französische Flagge längst gesehen haben muß, handelt es sich vermutlich um ein englisches, und es hegt keine freundschaftlichen Absichten.«
Kapitän Lamont mußte zu derselben Erkenntnis gekommen sein, denn er gab den Befehl zu wenden. Während des Segelmanövers entdeckte er die beiden Frauen auf dem Deck und kam eilig auf sie zu. »Haben Sie die Güte, in Ihre Kajüten zurückzugehen, meine Damen. Ich habe Anweisung gegeben, daß alle Frauen und Kinder vorläufig unter Deck bleiben müssen.«
»Wegen dieses fremden Seglers?« fragte Tanja. »Fürchten Sie, daß wir angegriffen werden?«
»Es ist eine Vorsichtsmaßnahme«, entgegnete Lamont ausweichend. »Entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich muß mich um meine Leute kümmern.«
Es war in der Tat ein englisches Kaperschiff, und es war viel schneller als die robuste, etwas schwerfällige ›Marie Floride‹. Das Wendemanöver der französischen Fregatte nützte nichts, sie entkam ihren Verfolgern nicht; und während an Bord der ›Marie Floride‹ klar zum Gefecht gemacht wurde, holte der Engländer mit vollen Segeln auf, rauschte schließlich an der Fregatte vorbei und schnitt ihr den Weg ab. An Bord des Engländers drängten sich auf allen Decks die Mannschaften. Es waren schwer bewaffnete, abenteuerliche Gestalten, und das Schiff trug den Namen ›Glory of York‹. Der erste Kanonenschuß, den man dort abgab, schlug ins Wasser. Danach schrie einer in einem schwarzen Samtrock mit ebensolchem Federhut auf dem Kopf zur ›Marie Floride‹ hinüber: »Streicht die Flagge! Ergebt euch, ihr verdammten Froschesser!«
Als Antwort donnerten die Neunpfünder der ›Marie Floride‹ los. Eine Kugel schien die ›Glory of York‹ unterhalb der Wasseroberfläche in den Rumpf getroffen zu haben, eine zweite ging in die Takelage und erwischte die Vormarsrah, so daß das gereffte Segel herabfiel.
Im nämlichen Augenblick schossen sie auf der ›Glory of York‹ zurück. Drei, vier Einschläge richteten in den Rahen schwere Schäden an, zerfetzten die Segel und zerschmetterten Masten, so daß die Marie Floride‹ hart in den Wind schoß, während die ›Glory of York‹ dicht neben ihr, in einer Entfernung von höchstens einer Kabellänge, beidrehte, so daß die mittschiffs angebrachten Geschütze drohend auf sie gerichtet waren.
Wieder donnerten die Kanonen; diesmal zielten die Engländer auf das Deck der ›Marie Floride‹, und die Lücke zwischen beiden Schiffen wurde immer schmaler. Geschrei und Pulverdampf erfüllten die Luft, dazwischen knatterten die ersten Musketen, und die Kugeln richteten unter den Männern auf den Decks ein Blutbad an. Auf der ›Marie Floride‹ kämpfte nicht nur die Besatzung. Kapitän Lamont hatte an die Auswanderer Waffen ausgeben lassen; sie schossen, was das Zeug hielt, aber die meisten von ihnen waren im Kampf ungeübte Leute, die auf dem heftig schwankenden Schiff höchstens Zufallstreffer anbrachten. Anders war es auf dem Achterdeck, wo sich Andrej, Pawel und die jungen Franzosen aufhielten. Aber sie konnten die Niederlage ebensowenig aufhalten wie die Besatzung des Schiffes.
Nach einer neuen Detonation sah Andrej, daß der Rudergänger getroffen war und in seinem Blut lag. Das Ruderrad wirbelte von einer Seite zur anderen, steuerlos trieb das Schiff dahin. Fast gleichzeitig zerfetzte ein weiterer Treffer den Kreuzmast, und die ›Marie Floride‹ legte sich schwer auf die Seite, so daß die rauhe See einen Teil des Decks überspülte und etliche Männer in die Tiefe riß.
Mit einem häßlichen, kreischenden Geräusch schurrte die Bordwand der Fregatte längsseits gegen die ›Glory of York‹, und diesen Augenblick nutzten die Engländer, um die ›Marie Floride‹ zu entern. An langen Tauen schwangen sie sich auf die Decks, andere sprangen einfach in die Rüsten und zogen sich an den Wanten hoch.
Der Kampf Mann gegen Mann währte nicht lange angesichts der englischen Übermacht und der Zerstörungen, die der Beschuß auf der ›Marie Floride‹ angerichtet hatte. Zwar wehrten sich noch einige Männer mit dem Mut der Verzweiflung, unter ihnen Kapitän Lamont, aber schließlich drängten ihn zwei Engländer zum Hauptniedergang, und es gelang einem von ihnen, ihn die hölzernen Stufen hinunterzustoßen. Der andere schwang sich hinterher und erstach ihn.
Pawel Tutscharew hatte sich mit vier, fünf Franzosen nach vorn durchgeschlagen, wo das dichteste Getümmel herrschte. Andrej, der ihn nie ganz aus den Augen gelassen hatte, sah, wie er dem jungen Herzog von Beaumont zu Hilfe kam, der sich, schon aus mehreren Wunden blutend, mit drei Gegnern herumschlug. Pawel kämpfte wie der Teufel; es gelang ihm sogar, Charles de Beaumont zu befreien. Andrej wollte zu den beiden hin, geriet aber selbst in Bedrängnis, als sich ein riesenhafter Engländer mit einem Enterbeil auf ihn stürzte. Andrej konnte sich durch einen raschen Sprung retten, aber das Beil traf seinen Degen, der ihm in weitem Bogen aus der Hand flog. In der nächsten Sekunde hatte Andrej seine Pistole aus dem Gürtel gerissen. Er legte an und dachte: Heilige Mutter von Kasan, laß sie nicht naß geworden sein von den Brechern, die vorhin das Deck überspülten.
Er drückte ab, und der Schuß löste sich. Er traf den Engländer genau in die Brust. Andrej sah ihn stürzen und machte einen Satz zu seinem Degen hin. Dann kämpfte er sich weiter durch zu Pawel.
Als er ihn erreichte, schrillte gerade eine Bootsmannspfeife über das Deck und übertönte mit ihrem Gellen den Kampfeslärm. Es war der Bootsmannsmaat der ›Marie Floride‹, Henri Patou, der erhöht auf ein paar Kabelrollen stand. »Wir ergeben uns! Werft die Waffen weg, Männer, der Kapitän ist tot! Hört auf, wir ergeben uns!«
Der größte Teil der Besatzung tat sogleich, was er wollte, und entledigte sich aller Musketen, Pistolen, Degen oder Messer. Mit erhobenen Händen sammelten sie sich auf dem Vorschiff. Die Auswanderer taten es ihnen nach, und wer verwundet am Boden lag, versuchte aufzustehen und zu den Gesunden zu humpeln.
Die Engländer brachen in grölendes Triumphgeschrei aus. Erstaunlicherweise hing immer noch die französische Flagge an der Gaffel der ›Marie Floride‹, und einer der Seeräuber schwang sich in die Wanten und holte sie unter dem Beifall seiner Kumpane herunter.
Vier Engländer kamen mit gespannten Pistolen auf die Gruppe der französischen Adligen um Pawel und Andrej zu. »Die Waffen her, ihr Scheißkerle!« brüllte einer. Er sprach englisch, aber natürlich verstand jeder, was gemeint war. Der Herzog von Beaumont war der erste, der seinen Degen zu Boden warf. Dann folgten die anderen, der junge Bressou, der schwarzbärtige Gilbert de Masset, der Vicomte de Cleronde, der Chevalier d’Auriac. Auch Andrej entledigte sich seiner Waffen. Übrig blieb nur Pawel Tutscharew, der mit einem wilden, haßerfüllten Gesichtsausdruck seinen Degen umklammert hielt.
Als einer der Engländer auf ihn zutrat und die Hand ausstreckte, vollführte Pawel eine blitzschnelle Bewegung und hätte dem Mann mit der flachen Klinge einen wütenden Hieb auf die Finger versetzt, wenn Andrej ihm nicht in den Arm gefallen wäre. »Sei vernünftig, Junge! Man muß wissen, wann man verloren hat. In einem solchen Fall ist Heldenmut nur Dummheit.«
»Diese Teufel!« knirschte Pawel. »Andrej Petrowitsch, wir können doch nicht . . .«
Andrej preßte ihm das Handgelenk zusammen. »Laß den Degen fallen! Oder willst du dich umbringen? Eine falsche Bewegung, Söhnchen, und du wirst von ihren Kugeln durchlöchert.«
Langsam öffnete Pawel seine Finger, und der Degen fiel scheppernd auf die Decksplanken. »Laß mich los!« würgte der Junge hervor, und Andrej sah, daß er den Tränen nahe war. Ihm war nicht viel besser zumute. Was würde mit ihnen geschehen?
Sie erfuhren es, als James Preston, der Kapitän der ›Glory of Yörk‹, an Bord der ›Marie Floride‹ kam.
James Preston stammte – der Name seines Schiffes verriet es – aus York. Seine Eltern waren angesehene Leute, seine fünf Geschwister ebenfalls. James, der Jüngste, war der berühmte morsche Ast an einem sonst gesunden Baum. Er war es schon im zarten Alter von fünf Jahren, als er den Jagdhund seines Vaters, des Ehrenwerten William Stewart Preston, königlicher Handelsrichter in der Grafschaft York, mit einem brennenden Holzscheit erschlagen wollte, weil der Hund auf einen Fußtritt mit einem wütenden Knurren reagiert hatte. Glücklicherweise gelang es ihm nicht, weil der Hund schneller laufen konnte und weil Jamie’s Kräfte mit fünf Jahren noch nicht ausreichten, einen ausgewachsenen Setter zu töten.
Aber mit neun Jahren vergnügte sich das vielversprechende Kind bereits damit, die Katzen der Nachbarschaft im Regenfaß zu ertränken, mit elf trieb er sich auf den Märkten herum und stahl den Hausfrauen ihre Geldbeutel, und mit vierzehn hätte er die Magd seiner Mutter vergewaltigt, wenn nicht sein älterer Bruder Richard zufälligerweise dazugekommen wäre und die Tat verhinderte. James Preston hatte Freude am Bösen, und wenn seine Mutter weinte, spuckte er auf den Boden und sagte: »Heul nur, dann pinkelst du weniger.«
Als er fünfzehn war, nahm er seinem Vater den Stock fort, mit dem dieser ihn züchtigen wollte, und erklärte: »Wenn du mich noch einmal anrührst, bringe ich dich um.« Es war eine Drohung, die den ehrenwerten William Stewart Preston so erregte, daß er einen Herzanfall bekam, und die Ärzte sich um ihn kümmern mußten.
Glücklicherweise verschwand James in der Nacht darauf auf Nimmerwiedersehen. Er wollte zur See fahren, nahm den Schmuck seiner Mutter und seiner beiden Schwestern mit sowie alles Bargeld, das im Hause war. Die Prestons hörten nie wieder etwas von ihm.
Wie gesagt, damals war James fünfzehn, und als er an jenem Januartag des Jahres 1781 die ›Marie Floride‹ betrat, zählte er zweiundvierzig Jahre. Es lagen also 27 Jahre zwischen seiner Flucht aus dem Elternhaus und diesem Augenblick. 27 Jahre, die angefüllt waren mit Gemeinheit und Niedertracht, Betrug, Gewalt und allen sieben Todsünden.
Bis vor wenigen Jahren hatte er sich mit Sklaventransporten befaßt. Sklaven, ob von weißer, schwarzer oder brauner Hautfarbe, brachten guten Verdienst, die Nachfrage blieb sich immer gleich und überstieg bei weitem das Angebot, so daß man die Preise diktieren konnte. Dann aber brach der Krieg zwischen den dreizehn amerikanischen Kolonien und dem englischen Mutterland aus, und James Preston witterte eine neue Chance.
Sklaventransporte hatten auch Tücken, die Verlustquote war hoch, da viele der armseligen Kreaturen während der Reise starben. Aber Frankreich schickte Schiffe mit Waffen und Munition nach Amerika; später, nachdem es offiziell in den Krieg gegen England eingetreten war, auch Soldaten, und Seiner britischen Majestät George III. waren nicht nur Generale, Hauptleute und Kanonenfutter von Nutzen – nein, ebenso wichtig war es, die feindlichen Operationen im Keim zu ersticken. Und das bedeutete, daß man die Schiffe König Ludwigs XVI. aufbrachte, bevor sie in Philadelphia, Boston oder New York landeten, um die Rebellenarmee zu unterstützen.
Der Himmel mochte wissen, wie es James Preston angestellt hatte, einen Kaperbrief zu erhalten. Ohne Bestechung und Erpressung war es gewiß nicht abgegangen, aber England war weit. Wer konnte dort wissen, welcher Methoden sich Preston bediente, sobald er ein französisches Schiff in seine Gewalt gebracht hatte!
In der Regel ging das Kapern feindlicher Schiffe auf recht kavaliersmäßige Weise vor sich. Man setzte ein paar Kanonenschüsse vor den Bug, und dann schickte man ein Prisenkommando an Bord des Gegners, um die Übergabe zu vollziehen. Das Schiff wurde ins Schlepptau genommen und in den nächsten sicheren Hafen gebracht. Feindliche Soldaten kamen in ein Lager, das Schiff selbst und seine Ladung gingen in den Besitz der Gegenseite über.
Es war das persönliche Unglück der Passagiere und der Besatzung der ›Marie Floride‹, daß sie von der ›Glory of York‹ und von James Preston gekapert wurden.
Und so kam er nun an Bord der ›Marie Floride‹, ein rothaariger, hagerer Mann mit steingrauen Augen, die soviel Gefühl verrieten wie die Augen eines Hais. Wenn er lächelte, gefror einem Menschen das Herz. Und wenn er fluchte, bekamen selbst die abgefeimtesten Galgenvögel seiner Mannschaft Krämpfe in den Eingeweiden und sahen zu, daß sie aus seiner Reichweite kamen.
Die ›Marie Floride‹ war das zehnte Schiff, das die ›Glory of York‹ gekapert hatte. Ihre Mannschaft wußte also, was zu tun war, nachdem sich die französische Fregatte ergeben hatte. Mit Fußtritten und Schlägen trieben sie Frauen und Kinder die Niedergänge hinauf. »Los, vorwärts, ihr Scheißweiber! Nehmt eure Bälger auf den Arm, wenn sie nicht laufen können! Das ist kein Spaziergang!«
Sie hatten es eilig, nicht nur, weil Saumseligkeit James Prestons Zorn reizte, sondern weil sie anschließend das Schiff durchsuchen wollten. Zwar hatten sie Befehl, Geld und Wertsachen ihrem Kapitän auszuhändigen, der die Beute später verteilte. Aber außerdem gab es auf einem Schiff Wein und Schnaps, und davon konnte jeder behalten, soviel er wollte. Die ›Glory of York‹ war seit sieben Tagen auf See, und die Brandyrationen, die James Preston ausgeben ließ, waren schmal bemessen. Wer betrunken oder verkatert ist, hat keine sichere Hand beim Schießen.
Aber jetzt war der Kampf vorüber. Man würde die ›Marie Floride‹ ausplündern und ins Schlepptau nach Louisiana nehmen. Das war noch in britischer Hand, und während der Fahrt dorthin konnte man sich mit den Weibern, sofern sie jung und ansehnlich waren, vergnügen. Über die Männer mußte von Fall zu Fall entschieden werden. Das würde der Kapitän tun. Wer aus reicher Familie stammte, für den konnte man von seinen Angehörigen Lösegeld verlangen. Und die anderen – nun, König George brauchte Soldaten. Diese verdammten französischen Froschfresser sollten zufrieden sein, wenn man sie am Leben ließ und ihnen die Ehre verschaffte, den Rock Seiner britischen Majestät anziehen zu dürfen. Falls sie widerspenstig waren, konnte man immer noch einige aufknüpfen, um die anderen gefügig zu machen.
Tanjas Kabine lag nahe dem Hauptniedergang. Sie war eine der ersten, in die vier Männer der ›Glory of York‹ hereinstürmten. Tanja hatte ihren jüngsten Sohn Alexander auf dem Arm. Er war in eine Felldecke gewickelt, die ihm gleich einer der Kerle fortriß. Ein weiterer rascher Griff, und Tanjas Halsschmuck aus Gold und Türkisen wanderte in den Beutel des Burschen, der sein schwarzes Haar zu einem festen Zopf im Nacken geflochten hatte. – Olga klammerte sich an Lailas Röcken fest und schrie vor Angst.
»Los, raus hier! Macht, daß ihr an Deck kommt!« befahl einer mit einem wilden blonden Bart, der ihm bis zum Gürtel reichte.
Tanja entdeckte Andrej sofort, als sie nach oben kam. Die Männer der ›Marie Floride‹ waren auf dem Vorschiff zusammengetrieben worden. Andrej und Pawel standen in der vordersten Reihe. Tanja durchflutete eine Welle der Erleichterung, als sie der beiden ansichtig wurde. Mit ihrem Kind auf den Armen wollte sie zu ihnen hin, aber ein Engländer riß sie zurück und deutete auf die gegenüberliegende Seite. »Nichts da – die Weiber dort drüben hin!«
Es dauerte keine Viertelstunde, bis alles, was sich an Bord der ›Marie Floride‹ befand, auf das Vorschiff gebracht worden war, die Frauen und Kinder backbords, die Männer steuerbords, jeweils von einer Gruppe Bewaffneter bewacht.
James Preston stand mit verschränkten Armen in der Mitte und musterte seine Gefangenen aus zusammengekniffenen Augen. Gekleidet war er in einen violetten, pelzgefütterten Mantel, und auf dem Kopf trug er einen Hut mit weißen Federn. Er war von schmächtiger Statur mit schlechter Haltung; dennoch ging etwas ungeheuer Furchteinflößendes von ihm aus. Seine Stimme war hell und durchdringend, ohne daß er besonders laut sprach. »An die Arbeit, Freunde. Ihr wißt, was ihr zu tun habt. Und beeilt euch, denn ich liebe es nicht, wenn jemand unnötig lange leidet. Vor allem nicht bei einem derart miserablen Wetter.«
Und dann geschah etwas so unvorstellbar Grausames, daß es sich jedem, der dabei war, für immer in die Seele brannte: Die Verwundeten wurden über Bord geworfen. Manche waren zu schwer verletzt, um sich zu wehren. Sie schrien nur –, ein hohles, kraftloses Schreien, das erstarb, wenn sie in der eisigen See versanken. Andere wehrten sich, man mußte sie zur Reling schleifen, und sie kämpften noch eine Weile im Wasser, ehe sie untergingen. Es waren Ehemänner und Väter dabei, und ihre Frauen und Kinder mußten das Entsetzliche mitansehen.
»Jetzt die Alten«, sagte James Preston.
Es gab nicht viele alte Leute auf der ›
Marie Floride‹. Wer auswandert, muß jung und kräftig sein, um sich in der Fremde ein neues Leben aufbauen zu können. Es waren nur fünf, die ihre erwachsenen Söhne und Töchter hatten begleiten wollen, weil ihnen die Einsamkeit in der alten Heimat zu drückend erschien. Fünf, die nun starben, weil man sie wie unnützen Ballast ins Meer warf.
Doch das Schlimmste kam noch. Tanja glaubte es nicht, als sie es hörte. Sie dachte: Das ist nicht wahr! Das kann nicht wahr sein . . .
James Preston sagte: »Und nun die Kinder.«
Tanja hielt immer noch den kleinen Alexander auf dem Arm. Und sie stand in der vordersten Reihe, Laila neben sich, an der sich Olga festklammerte.
Mit roher Gewalt griffen die Männer der ›Glory of York‹ nach den Kindern und rissen sie ihren Müttern fort. Die versuchten, die Kleinen mit ihrem Leib zu schützen, andere wandten sich zur Flucht, die Säuglinge an die Brust gepreßt. Auch Tanja versuchte fortzulaufen, sich irgendwo zu verkriechen, wo niemand sie und ihre Kinder fand. Aber da waren schon zwei Männer bei ihr und warfen sie zu Boden. Im Fallen preßte sie Alexander an sich. Sie trat nach ihren Angreifern, kämpfte wie ein in die Falle geratenes Tier, aber sie schüttelten sie ab wie eine lästige Katze, so daß sie auf die Planken zurückfiel. Und dann sah sie, wie ihr Sohn in den Fluten ertrank . . .
Mit einem Schrei wollte Tanja ihm nachspringen, doch jemand packte sie und hielt sie zurück. Sie fuhr herum und erkannte Andrej. Ihm und einigen anderen war es gelungen, sich an ihren Bewachern vorbeizudrängen und zu ihren Frauen durchzukämpfen. Tanjas Kopf fiel gegen seine Brust. »O Andrej . . ., sie haben Alexander . . ., sie haben unseren kleinen Sascha . . .«
Andrejs Gesicht war so voller Schmerz, daß es ihr, ungeachtet ihrer eigenen Verzweiflung, wie mit Messern die Brust zerschnitt. Im nächsten Augenblick warf er sich mit einem unartikulierten Laut auf einen dicken Engländer, der sich mit Olga auf den hocherhobenen Armen durch das Gewühl zur Reling drängte. Der Aufprall war so heftig, daß der Kerl das Gleichgewicht verlor. Noch bevor er zu Boden ging, war Andrej über ihm. Olga schrie nicht mehr. Sie war schlaff wie eine Puppe. Andrej bekam sie zu fassen und stieß das kleine reglose Bündel mit dem Fuß zu Tanja hin. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sie sich über das Kind warf, es unter ihren Röcken verbarg und versuchte, fortzukriechen. Dann war sein Gegner wieder auf den Beinen und drang mit einem Dolch auf ihn ein.
Kalter, mörderischer Haß erfüllte Andrej. Er unterlief den Angriff des Fetten, riß das Knie hoch und trat ihn mit aller Gewalt zwischen die Beine. Der Dolch flog irgendwohin, und als der Kerl sich schreiend zusammenkrümmte, legte Andrej die Hände um seinen Hals und drückte zu. Er erwürgte ihn, von blanker Mordlust besessen. Sie hatten seinen Sohn getötet, diese Bestien. Man mußte sie ausrotten.
Andrej warf sich zur Seite, als ein Schatten über ihn fiel. Ein anderer Engländer war es, der einen Säbel schwang. Das Metall bohrte sich in Andrejs linken Arm. Aber er spürte den Schmerz kaum und nicht das Blut, das über seinen Ärmel lief. Er sprang seinen neuen Gegner an, versuchte vergeblich, ihn zu Fall zu bringen, und wäre wahrscheinlich im nächsten Augenblick von dessen Säbel durchbohrt worden, wenn nicht plötzlich vom Hauptniedergang her aufgeregte Schreie zu hören gewesen wären: »Die Pocken! Rettet euch! Sie haben die Pocken an Bord!«
Vier Engländer stürmten mit schreckverzerrten Gesichtern auf das Deck. Eine Frau in einem weißen, langen Nachtgewand folgte ihnen. Sie ging schwankend, und ihr Gesicht, der Hals und die bloßen Arme waren von roten Flecken und Pusteln übersät.
Es war Florence Bellemonde, und sie wirkte, als sei sie nicht mehr bei Verstand. »Einen Priester!« lallte sie. »Um Christi Barmherzigkeit willen, holt einen Priester! Ah, es zerreißt mir die Eingeweide! Ich kann nicht mehr, ich sterbe . . .«
Es war plötzlich totenstill geworden. Der Engländer, der Andrej bedrängt hatte, wich zurück, als habe er den Leibhaftigen erblickt. Florence taumelte über das Deck. Eine Gasse bildete sich, die sie ungehindert durchließ. Als sie James Preston erreicht hatte, stieß Florence einen schauerlichen Schrei aus und fiel zu Boden. »Einen Priester . . . ich sterbe«, wiederholte sie röchelnd und versuchte, die Stiefel des Kaperkapitäns zu umfassen.
Auch er fuhr zurück, als habe er auf eine Giftschlange getreten. »Schlagt sie tot!« kreischte er und wandte sich zum Achterdeck, wo die Boote der ›Glory of York‹ im Wasser lagen. Aber diesmal gehorchte niemand seinem Befehl. Seine Männer empfanden die gleiche Panik wie er. Wer ist einem Feind gewachsen, den man weder niederschlagen noch erschießen, noch erstechen kann? Ein Feind, der in der Luft liegt, den man einatmet, der sich auf die Haut setzt und den man, ohne es zu wissen, mitschleppt wie einen unsichtbaren, gespenstischen Mörder. Die Pocken . . .
Wo ein Kranker war, gab es mit Sicherheit noch mehrere, die sich angesteckt hatten und in wenigen Tagen genauso aussahen wie diese Frau. Jetzt war ihnen noch nichts anzumerken, aber am Abend oder am nächsten Tag, ganz plötzlich, würden sie zu fiebern beginnen . . .
James Preston war der erste, der die ›Marie Floride‹ verließ. Die anderen folgten, so schnell sie konnten. Ein Schiff, auf dem die Pocken waren, mußte man fliehen wie die Hölle.
Sie ruderten zur ›Glory of York‹ zurück, als sei ihnen der Tod schon auf den Fersen, setzten die Segel, und bald darauf verschwand das Kaperschiff in der heraufziehenden Abenddämmerung.
Tanja lag hinter einem Gewirr aus heruntergefetzten Segeln und Masten, das Kind noch immer unter den Röcken verborgen, und rührte sich nicht. Sie befand sich in einem Zustand zwischen Wachen und Bewußtlosigkeit, zu erschöpft, um noch mit allen Sinnen wahrzunehmen, was sich um sie herum abspielte.
Mein Kind . . . Sie haben meinen Sohn getötet, war das einzige, was sie klar denken konnte. Als jemand sie an der Schulter berührte, hob sie langsam den Kopf. Alles schien in milchig-weißen Nebel gehüllt, der auf und ab wogte und aus dem sich nur allmählich Konturen herausschälten.
»Maman . . . Mutter . . .«, sagte eine Stimme, von der sie nur allmählich begriff, daß sie Pawel gehörte. »Bist du verletzt?« Er kniete neben ihr, das Gesicht von Pulver geschwärzt, und weinte.
»Nein«, sagte sie, »nein, ich glaube, nicht.« Sie versuchte sich aufzurichten, fiel aber gleich wieder zurück. »Das Kind«, flüsterte sie. »Pawel, ich habe Oljuschka bei mir. Sie dürfen sie nicht finden.«
»Es ist vorbei, Mutter. Sie sind fort. Wir haben die Pocken an Bord. Da sind sie geflohen.« Er umschlang Tanja mit beiden Armen und zog sie auf die Knie. »Gib mir Olga.« Das Kind war noch immer stumm und ohne Bewußtsein. Aber es lebte. Pawel drückte es an die Brust, und seine Tränen flossen heftiger. »Diese Schweine«, schluchzte er, »diese gottverfluchten Schweine!«
Mühsam kam Tanja auf die Beine. Sie fühlte sich so schwach, als hätte sie alles Blut aus dem Körper verloren. Pawel stützte sie. »Komm. Andrej Petrowitsch ist verletzt. Keine Angst, es ist nur eine Fleischwunde. Aber sie hätten ihn getötet, wenn nicht gerade Madame Bellemonde aufgetaucht wäre.«
Florence lehnte an einer der Deckaufbauten. Sie hatte sich hochgesetzt, gleich nachdem die Beiboote der ›Glory of York‹ davongerudert waren. »Die kommen nicht wieder«, hatte sie gesagt. »Beim Himmel, wenn der Anlaß nicht so traurig wäre, würde ich schwören, das sei der beste Spaß, den ich mir jemals geleistet habe. Ha, wie die Kerle gerannt sind! Als hätten sie Feuer unter dem Hintern.«
Andrej und der Chevalier d’Auriac wollten ihr zu Hilfe kommen, als sie aufstand. Aber sie kam ohne jeden Beistand auf die Füße, und abgesehen von den roten Flecken und Pusteln, die ihre Haut bedeckten, sah sie erstaunlich gesund aus. Trotzdem meinte d’Auriac: »Sie sollten zu Bett gehen, Madame. Auch wenn Sie sich im Augenblick etwas besser zu fühlen scheinen – Sie sind sehr krank.«
»Nonsens!« Florence schüttelte die roten Locken. »Alles, was ich habe, ist dieser scheußliche Ausschlag, aber erfahrungsgemäß verschwindet er nach kurzer Zeit von allein.« Sie unterbrach sich, weil sie Tanja und Pawel kommen sah. »Gräfin Dobrynin . . ., ist Ihnen etwas passiert?«
Tanja schwankte und wäre gefallen, wenn Andrej sie nicht aufgefangen und mit seinem gesunden Arm an sich gedrückt hätte. »Sie haben unseren Sohn ertränkt«, sagte er und preßte Tanjas Gesicht an seine Brust.
Florence Bellemonde schossen Tränen in die Augen. »Jetzt wünschte ich, ich hätte wahrhaftig die Pocken und sie alle angesteckt, diese dreckigen Bastarde! Möge Gott sie krepieren lassen!« Sie deutete auf Olga. »Aber die Kleine ist doch in Ordnung, oder?«
Als sie dem Kind die Haare aus der Stirn streichen wollte, wich Pawel, der sie trug, zurück. Florence lachte auf. »Keine Angst, junger Freund. Ich habe so wenig die Pocken wie Sie oder sonst jemand hier. Es war eine List, die mir einfiel, als wir angegriffen wurden.«
»Eine List?« Henri Patou, der Bootsmannsmaat der ›Marie Floride‹, kam zögernd näher. »Wie das, Madame?«
»Ich weiß nicht, wieso, aber jedesmal, wenn ich Fisch esse, bekomme ich diesen Ausschlag. Das ist kein Vergnügen, deshalb meide ich das Zeug wie die Pest. Das erste Mal ist es mir als vierjährigem Mädchen passiert. Damals habe ich sogar Fieber bekommen, und meine Mutter schickte nach einem Arzt, der nichts anderes zu sagen wußte, als daß ich vielleicht die Pocken hätte. Nun, nach zwei Tagen war ich wieder gesund und so frech wie zuvor, und der Doktor mußte zugeben, daß er sich geirrt hatte. Meine Mutter hat mir die Geschichte oft erzählt, denn ich selbst erinnere mich natürlich nicht mehr daran. Ich weiß nur, daß ich jedesmal wieder diese Pusteln bekam, wenn man mir Fisch vorsetzte, so daß schließlich der Dümmste begreifen mußte, daß es nur daran lag. Also habe ich das Fischessen bleiben lassen – bis heute.«
Sie zitterte vor Kälte in ihrem dünnen Nachtgewand und bat, man möge ihr doch eine Decke geben, in die sie sich wickeln könne. Dann berichtete sie weiter. »Als wir angegriffen wurden, war mir ziemlich klar, daß es sich entweder um ein Piraten- oder ein Kaperschiff handelte. Und da fiel mir die Sache mit dem Fisch und meinem Ausschlag ein. Ich habe mir also in aller Eile ein großes Stück Stockfisch in der Kombüse geben lassen, es hinuntergeschlungen und mich dann ins Bett gelegt, um auf die Wirkung zu warten. So fanden mich die Plünderer, und es gelang mir, sie glauben zu machen, daß ich an den Pokken erkrankt sei und in der nächsten Stunde daran krepieren würde. Es tut mir leid, wenn ich auch Sie damit erschreckt habe, aber immerhin habe ich uns allen mit dieser Komödie eine Menge erspart, schätze ich.«
»Das war ungeheuer mutig von Ihnen, Madame«, sagte Henri Patou. »Immerhin haben Sie riskiert, daß man Sie sofort über Bord warf.«
»Ach, ich war ziemlich sicher, daß mich wegen der Ansteckungsgefahr niemand anrühren würde. Natürlich – sie hätten mich erschießen können, aber darauf mußte ich es ankommen lassen, denn es stand zehn zu eins, daß sie uns später sowieso den Fischen zum Fraß vorwerfen, nachdem sie sich eine Zeitlang mit uns vergnügt hatten. Im nächsten Hafen hätten sie genug williges Weiberfleisch gefunden, als daß sie sich noch länger mit uns belastet hätten. Ich gehöre zwar nicht zu den Frauen, die um ihrer geschändeten Ehre willen sterben wollen, aber gestorben wären wir so oder so. Also war mein Wagnis gar nicht so groß.«
In diesem Augenblick regte sich Olga in Pawels Armen. Ihre Augenlider flatterten, und der kleine Mund verzog sich zu einem Wimmern. Das riß Tanja aus ihrer dumpfen Erschöpfung. Sie beugte sich über ihre Tochter und nahm sie Pawel ab. »Nicht weinen, Herzchen«, sagte sie auf russisch. »Ich bin bei dir, alles wird gut.«
Das Kind schlug die Augen auf. Sein Blick erfaßte Tanjas Gesicht, glitt weiter. »Papa . . .«, sagte es leise.
»Ich bin hier, Oljuschka.« Andrej umfaßte die kindliche Hand. »Entschuldigen Sie uns, Madame Bellemonde. Aber meine Frau und die Kleine müssen zu Bett.«
»Und Ihre Wunde, Graf?« fragte d’Auriac.
»Das hat Zeit bis nachher.« Andrej wollte Tanja das Kind abnehmen, aber sie schüttelte den Kopf, und so stützte er sie nur, als sie davongingen.
Sie brauchten Tage, um das Schiff wieder manövrierfähig zu machen und die Lecks zu dichten, die die Kanonen der ›Glory of York‹ der ›Marie Floride‹ beigebracht hatten. Bis dahin trieben sie hilflos auf der immer noch stürmischen See. Henri Patou hatte das Kommando übernommen. Er ließ Trinkwasser und Lebensmittel rationieren, für den Fall, daß sie länger unterwegs waren, als sie glaubten.
Er verstand nicht viel von Navigation, so daß es zunächst nicht einmal sicher war, ob er den Kurs, den er einschlug, richtig berechnet hatte. Von der Crew war mehr als die Hälfte umgekommen. Die übrigen arbeiteten Tag und Nacht, unterstützt von den Passagieren, die handwerklich geschickt genug waren, um Segel zu flicken und die zerschossenen Masten und die Takelage zu reparieren.
Auch Andrej versuchte mitzuhelfen, indem er abwechselnd mit anderen die Pumpen bediente, um das eingedrungene Seewasser abzupumpen. Die Wunde in seinem Arm heilte verhältnismäßig gut, und er brauchte die körperliche Arbeit, um müde zu werden und des Nachts schlafen zu können.
Es waren viele auf dem Schiff, die um einen Toten trauerten – den Mann oder das Kind, um Bruder, Vater oder Mutter, und jeder versuchte auf seine Art, damit fertig zu werden. Die einen, indem sie weinten und Gott verfluchten, die anderen, indem sie in stumpfer Verzweiflung ihre Stunden verbrachten, unfähig, etwas anderes zu denken als: Der Mensch, den ich liebte, ist tot, ermordet . . . Es gab welche, die sich betranken, bis sie umfielen, und andere, die beteten, um darin Kraft zu finden. Es gab die Tapferen und die Schwachen, die sich selbst Bemitleidenden und die Verbitterten. Und es gab solche, die bis ins Mark getroffen waren und denen kein Beten und Fluchen, kein Klagen und Trinken half.
Zu ihnen gehörte Andrej. Er hatte sich immer schwer damit getan, ein Gefühl zu zeigen, weil sein scharfer, ironischer Verstand in stetem Widerstreit mit seinem Herzen lag. Er war verletzlich, aber er schämte sich dessen, als sei es etwas Anstößiges. Er konnte spotten über Dinge, die ihn tief bewegten, um nur ja nicht bei einer weichen Regung ertappt zu werden, und fluchen wie ein russischer Iswostschik, wenn etwas ihm naheging.
Aber diese Fähigkeiten versagten angesichts des Schmerzes, den er bei dem sinnlosen, grausamen Tod seines kleinen Sohnes empfand. Da lag Andrejs Seele bloß, und er war unfähig, sich in irgend etwas hineinzuretten, das seine Qual erträglicher machte. Er wußte, daß auch Tanja litt, aber ihr war die Gnade des Weinens gegeben; auch konnte sie sprechen über ihr totes Kind, aber er ertrug es nicht einmal, davon reden zu hören. Des Nachts, wenn er neben ihr auf dem Bett lag und Tanja an seinen Atemzügen hörte, daß auch er nicht schlief, wünschte sie so sehr, in seine Arme zu kommen, um von ihm getröstet zu werden und ihrerseits ihn zu trösten. Aber Andrej wollte keinen Trost.
Es gab nur eines, an das er sich manchmal klammerte und das die bohrende Verzweiflung um ein geringes linderte: der Gedanke an Rache. Rache an den Mördern seines Kindes und stellvertretend an jedem Engländer, der in diesem Krieg kämpfte.
Andrej war im russisch-türkischen Krieg gewesen. Er war schwer verwundet worden und später in Konstantinopel auf die Galeere gekommen. Vier Jahre hatte er das Joch der Sklaverei ertragen, angekettet an die Ruderbank eines türkischen Schiffes, bevor ihm die Flucht gelang. Er war nach Rußland zurückgekehrt, wo jedermann, auch Tanja, ihn für tot gehalten hatte.
Was hinter ihm lag, hatte ihn verändert. Es war schwer gewesen, sich in seinem alten Leben zurechtzufinden, einem Leben, in dem es keine Bedrohung mehr gab, in dem man wieder ein Barin war, ein Herr, und keiner, der sich unter Peitschenhieben ducken mußte. Vieles in diesem Leben war ihm dennoch fragwürdig geworden, denn Gewichtung und Perspektiven hatten sich verschoben. Darum hatte er damals seinen Abschied von der Garde genommen. Er hatte den Krieg gesehen, wie er wirklich war, deshalb hatte er nicht mehr daran zu glauben vermocht, daß irgendeine Sache oder Idee dieses gegenseitige Töten rechtfertigen könne. Jetzt dachte er anders darüber.
Es waren blutgierige Wölfe gewesen, die seinen Sohn gemordet hatten. Und wie Wölfe mußte man sie jagen.
Fünf Tage nach dem Überfall wurden die Wasserrationen auf der ›Marie Floride‹ gekürzt. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, ließ Henri Patou erklären. Man habe durch die Reparaturen am Schiff viel Zeit verloren, so daß sie vermutlich nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt in Philadelphia einlaufen würden. Er wolle gegen alle Risiken gesichert sein.
Unter den Passagieren machte sich Unruhe breit. Wer wußte schon, was ihnen auf dieser Reise noch alles zustoßen mochte! Ein Unwetter konnte genügen, um das notdürftig reparierte Schiff zum Sinken zu bringen, meinten die einen. Die anderen bezweifelten, daß Henri Patou und die so arg zusammengeschrumpfte Mannschaft überhaupt imstande waren, den Kurs richtig zu berechnen und sie nach Philadelphia oder in sonst einen Hafen zu bringen. Und wie die Menschen sind, nämlich kurzsichtig und schnell vergeßlich, machten etliche Florence Bellemonde für die Situation verantwortlich. Wäre es nicht klüger gewesen, sich den Engländern zu überlassen? Ganz Schlaue meinten sogar, es sei falsch gewesen, dem Angriff der ›Glory of York‹ überhaupt Widerstand entgegenzusetzen. Hätte man sich gleich ergeben, wäre die Wut der englischen Crew gar nicht erst angestachelt worden, und alle Gewalttaten wären unterblieben.
An einem klaren, kalten Vormittag kam es deswegen zu einem Zwischenfall. Florence Bellemonde war an Deck gekommen, um frische Luft zu schöpfen. Als sie Tanja in einiger Entfernung an der Reling entdeckte, wollte sie zu ihr hin und mußte dabei an ein paar Frauen vorbei, die im Windschatten der Deckaufbauten saßen und ein Segel flickten. Florence hatte einen grünen Schal um ihr Haar gebunden und die Hände in einem Pelzmuff versteckt. Ihre Haut war wieder in Ordnung, sie sah hübsch und elegant aus in ihrem langen, pelzbesetzten Samtmantel. »Was für ein phantastischer Tag!« rief sie den Frauen zu. »Sogar die Sonne scheint. Da hat man doch gleich eine bessere Stimmung.«
»Sie vielleicht«, erwiderte eine Frau gehässig. Sie mochte um die Vierzig sein, mit einem groben Gesicht und schlechtem Teint. Wütend stieß sie das Segel von sich. »Sie brauchen sich ja auch nicht die Finger blutig zu schinden mit dem verdammten Ding hier!«
Eine zweite spuckte vor Florence aus. »Ein wirklich phantastischer Tag!« äffte sie sie nach. »Weißt du was, Süße? Ich scheiß’ auf dein Gequatsche. Halt die Luft an und geh mir aus den Augen.«
Florence blieb stehen. »Heh«, sagte sie angriffslustig, »sucht ihr Streit? Den könnt ihr haben! Aber ich warne euch, ich bin schon mit anderem Gesindel fertig geworden.«
Die, die eben gespuckt hatte, wollte aufspringen. Ein mageres junges Ding mit blonden Zöpfen hielt sie fest. »Gib Ruhe, Gilberte. Und Sie, Madame, gehen besser weiter. Sie werden’s schon ertragen, daß eine Menge Leute hier nicht besonders auf Sie zu sprechen ist. Nur sollten Sie nicht in Ihren feinen Kleidern vor uns herumstolzieren und so tun, als ob alles in bester Ordnung wäre und Sie das meiste Verdienst daran hätten. Einen Dreck haben Sie, Madame! Sie haben uns doch erst in diese verdammte Lage gebracht!«
»In was für eine Lage?« erkundigte sich Florence in aufsteigender Wut. »Was, zum Teufel, meint ihr überhaupt?«
»Wir meinen«, schrie eine vierte, die eine große weiße Haube auf dem Kopf trug, »daß wir jetzt schon in Louisiana sein könnten, wenn Sie nicht dieses idiotische Theater gespielt hätten. Dann brauchten wir uns keine Sorgen zu machen, ob wir jemals lebend von diesem elenden Kahn herunterkommen! Daran haben Sie mit Ihrem Hühnerverstand wohl nicht gedacht, was? Wahrscheinlich hat man Ihre Wasserration noch nicht gekürzt, und Sie werden auch dann noch satt zu essen haben, wenn wir schon vor Hunger nicht mehr in den Schlaf kommen. Hätte uns das englische Schiff ins Schlepptau genommen, wäre das alles nicht passiert.«
Florence war rot vor Zorn. »Du dämliche Schlampe!« sagte sie mit zusammengebissenen Zähnen. »Wenn du nicht auf der Stelle dein ungewaschenes Maul hältst, gebe ich dir eins drauf, daß du drei Tage weder essen noch trinken kannst. In Louisiana wärt ihr? Kann schon sein, daß es euch dahin angeschwemmt hätte, mit dem Bauch nach oben und von den Fischen angefressen. Oder was glaubst du sonst, hätten die englischen Schweinehunde mit dir und deinesgleichen gemacht? Ein paar Tage lang hättet ihr ihnen als Matratzen gedient – und dann ab ins Meer. Die wollten doch nur das Schiff und die gesunden jungen Männer, sonst nichts. Weiber wie ihr hätten ihnen im Bett viel zu wenig Vergnügen gemacht, als daß sie sich auch noch an Land damit belastet hätten. Oh, Gott möge es mir verzeihen, daß ich für euch hirnlose Puten auch nur einen Finger gerührt habe!«
Ihre letzten Worte gingen in dem wütenden Gekreisch der Weiber unter, und zweifelsohne hätten sie sich im nächsten Augenblick auf Florence gestürzt, wenn Tanja nicht dazwischengetreten wäre.
»Rührt sie nicht an!« rief sie, und in ihrer Stimme und ihren blitzenden blauen Augen lag soviel Autorität, daß die Frauen in der Tat verstummten und die Fäuste sinken ließen. »Schämt ihr euch nicht? Sie hat recht, mit jedem Wort, das sie sagt. Ihr seid hirnlos, wenn ihr nicht begreift, was Madame Bellemonde für uns alle getan hat.«
»Gräfin«, sagte Florence erschrocken, »ich bitte Sie, lassen Sie das. Ich werde schon allein mit denen fertig. Es ist dieselbe Sorte, mit der ich mich schon als Kind auf der Gasse herumgeprügelt habe. Aber es schickt sich nicht, daß eine Dame wie Sie . . .«
»Schon gut, meine Liebe.« Zum ersten Mal seit Saschas Tod lächelte Tanja. »Wir wollen uns nicht über unsere Herkunft auseinandersetzen. Kommen Sie, gehen wir in meine Kajüte. Sie haben eine so hübsche Frisur, und ich wollte schon lange, daß Sie mir einmal zeigen, auf welche Weise Sie Ihr Haar aufstecken.«
Olga hockte in der Kajüte der Dobrynins am Boden und war damit beschäftigt, einer Porzellanpuppe ein rotes Band um die Zöpfe zu schlingen. Laila saß daneben und stichelte an einem Unterrock. Bei Tanjas Eintritt stand sie auf und knickste.
Olga ließ die Puppe fallen und marschierte auf ihren kleinen festen Beinen auf ihre Mutter zu. Äußerlich hatte die Zweijährige die Aufregung des Überfalls überwunden, sie war rosig und lebhaft wie vordem. Aber des Nachts quälten sie Angstträume, aus denen sie schreiend hochfuhr. Auch war sie schreckhaft geworden und brach rasch in Tränen aus.
Tanja nahm ihre Tochter auf den Arm und rieb ihre Wange an den flaumig-weichen braunen Locken. Für ihr Alter sprach Olga schon sehr gut, allerdings nur russisch, deshalb verstand sie auch nichts, als Florence Bellemonde zu ihr sagte: »Hallo, Püppchen, wie geht es dir denn? Hübsch siehst du aus und wieder ganz gesund.«
Olga strahlte sie mit ihren blauen Augen an. Sie fand, daß Französisch lustig klang, so, als ob jeder Schnupfen hätte. Tanja übersetzte ihr Florences Worte, und das kleine Mädchen antwortete bereitwillig auf russisch: »Mir geht’s gut. Und dir?«
»O Gott, wie süß das klingt, wenn sie redet!« Florence tätschelte ihr die Wange. »Du bist wirklich ein kleiner Schatz. Und für Sie, Gräfin, muß sie doch ein rechter Trost sein.«
»Das ist sie auch.« Tanja drückte Olga noch einmal an sich, bevor sie sie auf den Boden stellte. »Ich würde Ihnen gern einen Tee anbieten, Madame Bellemonde, aber leider ist unser Samowar von den Plünderern mitgenommen worden – wie fast alles hier, was einigermaßen wertvoll aussah.« Sie wandte sich an die Zofe. »Laila, sei so gut und sieh zu, daß du Ilja findest. Er soll uns einen heißen Gewürzwein machen. Monsieur Patou erzählte mir, daß es noch ein paar kleine Fässer Roten auf dem Schiff gibt.«
»Soll ich Oljuschka mitnehmen, Euer Gnaden?« fragte die Zofe, und Tanja nickte.
»Aber gib gut auf sie acht, hörst du? Laß sie nicht von der Hand.« Am liebsten hätte sie Olga seit Alexanders Tod jede Stunde bei sich gehabt. Sie lebte ständig in der Furcht, auch dieses Kind könne ihr noch genommen werden. Aber sie sagte sich, daß sie die Kleine mit dieser übertriebenen Fürsorge nur verstören würde. Deshalb bemühte sich Tanja, sie nicht anders als vor dem Unglück zu behandeln, auch wenn es ihr schwerfiel.
»Setzen Sie sich doch«, bat sie Florence, als sie mit ihr allein war. »Ich hoffe, Sie haben sich den häßlichen Auftritt von vorhin nicht allzusehr zu Herzen genommen.«
»Ach was, ich bin nicht besonders empfindlich, und mit manchen Leuten streite ich mich sogar ausgesprochen gern herum. Aber von Ihnen, Gräfin, war es mächtig anständig, daß Sie sich eingemischt haben.«
»Unsinn. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Madame Bellemonde, denn ohne Sie wären mein Mann und meine Tochter heute mit Sicherheit nicht mehr am Leben. Außerdem kann ich Ungerechtigkeiten nicht vertragen.«
»Trotzdem . . .« Florence kicherte. »Himmel, Sie waren ganz schön in Rage. Einen Augenblick habe ich gedacht, jetzt kriegten wir beide Prügel. Ihr Gatte hätte mich schön angesehen, wenn Sie meinetwegen ein blaues Auge davongetragen hätten.«
»Vielleicht, vielleicht auch nicht. Allerdings ist es schon etliche Jahre her, daß mich jemand geschlagen hat. Sehen Sie mich nicht so entsetzt an, Madame, aber ich habe nicht immer das Leben einer vornehmen Dame geführt. Mein Mann entstammt zwar einer alten russischen Adelsfamilie, aber ich bin eine ehemalige Leibeigene.«
Florence bekam runde Augen. »Das ist doch ein Scherz?«
»Nein, nein. In St. Petersburg weiß jeder, der mich kennt, über diese Geschichte Bescheid, und ich sehe keinen Grund, sie zu verheimlichen.« Tanja unterbrach sich, weil Ilja eintrat und einen Krug mit dampfendem Gewürzwein brachte. Er stellte ihn auf den Tisch und holte zwei Becher aus einer Truhe. »Danke, Ilja«, sagte Tanja. »Weißt du, wo Seine Gnaden ist?«
»Unten in der Bilge. Pawel Borissowitsch und der Comte de Cleronde sind bei ihm. Es ist wieder Wasser eingedrungen, das sie herauspumpen. Irgendwo muß noch ein gehöriges Leck sein, und ich hörte vorhin, daß ein Mann unter dem Schiff durchtauchen soll, um es herauszufinden. Soll ich Seine Gnaden holen? Ich wollte ihn vorhin schon beim Pumpen ablösen, aber er sagte, ich solle mich zum Teufel scheren.« Man merkte dem Diener an, wie unpassend er es fand, daß sein Herr eine solche Arbeit verrichtete.
Tanja schüttelte den Kopf. »Laß ihn tun, was er mag. Achte nur darauf, daß er trockene Sachen anzieht, sobald er fertig ist. Und mein Sohn auch.«.
»Sehr wohl, Euer Gnaden. Ich habe schon alles bereitgelegt, wenn es auch die schlechtesten Kleider sind, die uns die verdammten Engländer gelassen haben.«
Tanjas Blick wurde leer. »Kleider sind nicht wichtig, man kann irgendwann neue kaufen. Nur das Leben ist nicht zu ersetzen.« Als der Diener gegangen war, starrte sie eine Weile vor sich hin. Dann zwang sie sich zu einem Lächeln. »Trinken wir, Madame Bellemonde, bevor der Wein kalt wird.« Sie nahm einen Schluck und behielt den Becher in der Hand, um sich die Finger daran zu wärmen.
Florence beugte sich nach vorn. »Ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wie leid mir das tut mit Ihrem kleinen Jungen . . .«
»Lassen Sie’s gut sein, meine Liebe. Ich fürchte, ich kann noch nicht darüber sprechen, ohne in Tränen auszubrechen. Trotzdem sage ich mir immer wieder, daß mir im Leben so unwahrscheinlich viel geschenkt worden ist, viel mehr als den meisten anderen Menschen, daß ich mich nicht in meinem Kummer vergraben darf. Mein Mann, fürchte ich, sieht das nicht so. Er ist sehr verzweifelt, auf eine schrecklich hoffnungslose Art.«
»Aber Sie haben doch noch Ihre kleine Tochter«, meinte Florence. »Allein ihr Anblick muß Ihren Gatten doch ablenken.«
»Olga ist nicht sein leibliches Kind. Ich war nie mit ihrem Vater verheiratet, und Andrej Dobrynin hat sie adoptiert. Ja, und Pawel stammt, wie Sie vielleicht schon wissen, aus meiner ersten Ehe.«
»Ach . . .« Florence verstummte, weil draußen gelärmt wurde. Eilige Schritte kamen den Niedergang herunter, und jemand rief:
»Ein Schiff! Sie haben ein Schiff gesichtet!«
Es war nicht nur eines, es waren fünf, deren Segel der Ausguckposten von der Vorbramsaling als erster auf der wogenden See entdeckt hatte. Während alles an Deck der ›Marie Floride‹ zusammenlief und auf die winzigen weißen Punkte starrte, bis die Augen schmerzten, mußte man auf den fremden Schiffen ebenfalls die französische Fregatte gesichtet haben, denn sie änderten ihren Kurs und hielten auf die ›Marie Floride‹ zu.
Tanja stand neben Florence auf dem Achterdeck. Auch Laila war herzugelaufen und trug Olga auf dem Arm, und wenig später drängten sich Andrej und Pawel zu den Frauen durch. Tanja blickte ihren Mann an. Er mußte, genau wie Pawel, bis zu den Oberschenkeln im Wasser gestanden haben, es lief an ihren Beinkleidern hinunter, quoll aus den Stiefeln und bildete kleine Rinnsale auf den Decksplanken. Sie sahen beide durchfroren und müde aus, trotzdem dachte keiner daran, sich umzuziehen.
»Was glaubst du?« fragte Tanja und hörte selbst, daß ihre Stimme hoch und fremd vor Aufregung klang. »Sind es amerikanische Schiffe?«
»Wir werden es bald wissen«, entgegnete Andrej. Er sprach ruhig, aber an seiner Schläfe pochte eine kleine Ader, und die Narbe auf seiner linken Wange hob sich scharf und rot von der übrigen Haut ab, wie immer, wenn er sehr erregt war. Ilja tauchte von irgendwoher auf, zwei Mäntel über dem Arm.
»Legt sie um, Euer Gnaden, es ist kalt, und Ihr seid durchnäßt!«
»Laß mich in Ruhe«, knurrte Andrej, ohne den Kopf zu wenden.
Aber Ilja, weit davon entfernt, dem Befehl Folge zu leisten, warf ihm und Pawel die Mäntel einfach über die Schultern. »Ihr wollt Euch wohl den Tod holen! Habt Ihr nie gehört, daß man die Langmut Gottes nicht strapazieren darf? In weniger als zehn Minuten werden Eure Hosen steifgefroren sein, und die Kälte wird Euch in die Lungen kriechen! Was soll Gott dagegen tun, wenn Ihr nicht selbst etwas unternehmt? Er kann kein Lungenfieber verhindern, wenn Ihr naß herumlauft.«