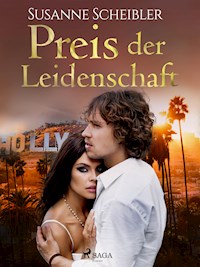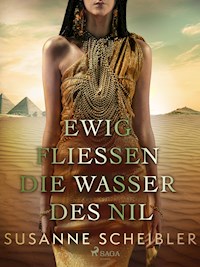Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lasarows - Eine russische Familien-Saga
- Sprache: Deutsch
Scheibler gelingt es, eine fesselnde Liebesgeschichte sowie spannende historische Fakten in einem wunderbaren Roman zu vereinen. Russland Anfang des 20. Jahrhunderts. Die wunderschöne Svetlana Lasarow hat es geschafft, eine angesehene Persönlichkeit innerhalb der feinen Gesellschaft zu werden. Wie berauscht von dem prunkvollen Leben begeht sie einen Fehler, indem sie sich mit dem Rittmeister verlobt. Ein Mann, dem es Freude bereitet, sie zu demütigen. Svetlana fürchtet, dass ihr Schicksal besiegelt ist. Erst als sie auf Georg, Großfürst und Bruder des Zaren Nikolaus II, trifft, scheint sich das Blatt zu wenden. Doch wird diese Liebe bedroht von Intrigen und der nahenden Revolution…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Scheibler
Toska heißt Sehnsucht
DIE LASAROWS 3. Teil
Saga
Toska heißt Sehnsucht
Toska heißt Sehnsucht – Band 3 der Lasarows Trilogie
Copyright © 2021 by Michael Klumb
vertreten durch die AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Toska heißt Sehnsucht ist der 3. Teil der Lasarow-Trilogie. Die Originalausgabe ist 20
Copyright © 2000, 2021 Susanne Scheibler und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726961195
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
1. Kapitel
Zarin Alexandra Fjodorowna malte ihrem Sohn das Kreuzzeichen auf die Stirn. Es war eine Geste, die für sie fast etwas Magisches hatte und gleichzeitig Trost schenkte. Trost aber hatte die Kaiserin von Rußland bitter nötig.
Kein Tag verging, an dem sie nicht um ihren Sohn weinte und sich mit stummen Selbstvorwürfen das Herz zermarterte. Sie hatte ein krankes Kind geboren. Der Thronfolger von Rußland litt an der verhängnisvollen Bluterkrankheit, die sie, seine Mutter, an ihn weitergegeben hatte. Frauen blieben davon verschont, aber sie trugen den Keim dieses unseligen Leidens in sich und vererbten ihn ihren Söhnen.
Es waren schon Alexandras jüngerer Bruder und zwei Neffen daran gestorben, und wenn man nicht eines Tages ein Mittel gegen diese Erbkrankheit fand, würde auch ihr Alexej deswegen sein Leben verlieren.
Grigorij Rasputin freilich behauptete, Alexej werde ein großer, guter und vom Volk vergötterter Zar werden. Alexandra klammerte sich an diese Worte ebenso, wie sie sich an Rasputin klammerte, diesen von Gott gesandten Heiligen, wie sie meinte, der es als einziger fertigbrachte, die Blutungen zu stillen, die Alexej erlitt und die ohne die Hilfe des Staretz jedesmal zum Tode führen konnten.
Trotzdem verließ Alexandra Fjodorowna niemals die Angst um ihren Sohn.
Sie strich dem bildhübschen Kind die blonden Locken aus der Stirn und küßte es. »Vater Grigorij wird gleich kommen, um mit dir das Nachtgebet zu sprechen, Baby. Dann wirst du gut und ruhig schlafen.«
Alexej lächelte ihr zu. »Gewiß, maman. Vater Grigorijs Gebete helfen immer. Ich bin sehr froh, daß er bei uns ist, denn ich habe ihn lieb.«
»Wir alle haben ihn lieb«, erwiderte die Zarin, »und wir müssen Gott über alle Maßen dankbar sein, daß er ihn uns geschickt hat.« Sie schaltete die Deckenbeleuchtung aus und ließ nur zwei kleine Wandlampen am Bett brennen.
»Wo ist Vater Grigorij jetzt?« fragte Alexej, als seine Mutter sich zur Tür wandte. Sie ging mühsam und wie immer in der letzten Zeit auf einen Stock gestützt, weil sie unter schmerzhaften Ödemen in den Beinen und einer Erkrankung der Wirbelsäule litt.
»Er sagt deinen Schwestern gute Nacht. Aber ich werde ihm ausrichten, daß du auf ihn wartest. Dann kommt er sicher sofort.«
Aus dem Schlafzimmer ihrer jüngsten Töchter Maria und Anastasia erklang lautes Gelächter, als die Zarin auf den Korridor trat. Sie erkannte auch die Stimmen ihrer beiden Ältesten, der knapp sechzehnjährigen Olga und der vierzehnjährigen Tatjana, ebenso den Baß von Grigorij Jefimowitsch Rasputin.
Ein Lächeln glitt über Alexandra Fjodorownas Gesicht. Wie schön, daß auch ihre Mädchen Vater Grigorij so liebten! Wenn er bei ihnen war, verbrachten sie immer fröhliche Stunden, denn Rasputins Erzählungen von seinen Reisen und aus seinem Heimatdorf Pokrowskoje waren in der Regel recht lustig, manchmal auch von derbem Witz.
Als die Zarin eintrat, fand sie Rasputin auf Marias Bett sitzend. Er hatte den Arm um ihre Schultern gelegt, während Anastasia auf einem Schemel zu seinen Füßen hockte und sich vor Lachen bog. Ihr rundes Gesicht mit den funkelnden Augen war rot und erhitzt.
Sie und Maria trugen lange weiße Rüschennachthemden mit bunter Stickerei. Olga und Tatjana waren ebenfalls für die Nacht angekleidet und hatten seidene Kimonos über ihre Hemden geworfen. Sie saßen auf Anastasias Bett, zwei bildschöne junge Mädchen mit feingezeichneten Gesichtern und üppigem Haar.
Die sonst so prüde Zarin nahm keinen Anstoß an dem Aufzug ihrer Töchter in Rasputins Gegenwart. Vielmehr gehörte es zum allabendlichen Ritual, daß er ihnen gute Nacht sagte, wenn er in Zarskoje Selo war. In Alexandras Augen war ihr ›Heiliger‹ über jeden Verdacht erhaben. Daß indessen bei Hof und in St. Petersburg die wildesten Gerüchte kursierten, was Rasputin und die beiden ältesten Zarentöchter betraf, wußte sie nicht. Und wenn sie davon erfahren hätte, wäre sie über alle Maßen empört gewesen, daß man den Staretz mit Schmutz bewarf, und hätte eine strenge Bestrafung der Urheber verlangt.
»Was ist denn? Worüber amüsiert ihr euch so?« fragte die Zarin, und Tatjana erwiderte: »Ach, Vater Grigorij hat uns eine urkomische Geschichte erzählt – von einem Mann aus Pokrowskoje. Wie heißt er noch gleich?«
»Wissarjon Andrejewitsch Bulagin«, erwiderte Rasputin. Er stand auf und küßte die Zarin auf beide Wangen. »Guten Abend, Mama ...«
So nannte er sie seit geraumer Zeit, und sie lächelte ihm zu. »Guten Abend, Vater Grigorij.«
Anastasia hopste zu ihrer Schwester Maria auf das Bett und schlug mit der Hand auf den freien Platz neben sich. »Kommen Sie, maman, setzen Sie sich und lassen Sie sich von Vater Grigorij noch einmal die Geschichte von diesem Wissarjon Bulagin erzählen. Sie ist wirklich zum Totlachen!«
»Je nun, das war so ...« Rasputins graue Augen funkelten vor Vergnügen. »Wissarjon Bulagin war ein Nachbar von uns. Er betrieb eine Korbflechterei, und eines Tages kam er zu mir und meinem Weib Praskowja und jammerte darüber, daß ihm ständig Brennholz gestohlen würde, das er in einem Anbau seines Hauses für den Winter gestapelt hatte. Er hätte sich schon auf die Lauer gelegt, um den unverschämten Dieb zu erwischen, aber ausgerechnet in den Nächten, in denen er auf den Empfang des Halunken wartete, sei dieser nicht aufgetaucht. Doch sobald Wissarjon in seinem Bett lag und schlief, verschwand prompt wieder ein großer Korb voll dicker Holzscheite. Der Arme wußte schon gar nicht mehr, was er tun sollte; schließlich konnte er sich nicht ständig bestehlen und seine Familie im Winter frieren lassen.«
Anastasia prustete los. »Und da hat Vater Grigorij ihm einen famosen Rat gegeben! Erzähl es, Väterchen!«
Rasputin strich über seinen dunklen, von grauen Strähnen durchzogenen Bart. »Also eigentlich lag es auf der Hand, was zu tun war. Ich habe dem guten Wissarjon geholfen, in ein paar Holzscheite, drei oder vier nur, ein tiefes Loch zu bohren, in das man Schießpulver gab. Danach haben wir die Löcher säuberlich mit Harz und Holzspänen wieder verschlossen. Es war Ende September, und die Nächte wurden schon empfindlich kalt, so daß man ein Feuerchen im Ofen brauchte. Wissarjon mußte nur warten, bis der Dieb wiederkam und die präparierten Scheite mitnahm. Es hat keine vierzehn Tage gedauert, da gab es in Pokrowkoje plötzlich eine gewaltige Detonation, weil der Kachelofen von Stepan Werechnow in die Luft flog. Dieser Stepan aber war Wissarjons bester Freund, den er nie im Leben verdächtigt hätte, ihn zu beklauen.«
Die Mädchen lachten wieder, und Maria wollte wissen: »Und was hat Wissarjon dann mit seinem Freund gemacht?«
»Er hat ihm eine gewaltige Tracht Prügel verabreicht«, erwiderte Rasputin. »Aber danach haben sie sich wieder vertragen, denn Stepan war durch die Explosion in seinem Ofen schon gestraft genug. Das Haus sah aus, als wäre eine Kartätsche eingeschlagen, und Stepan hat mit seinen Söhnen wochenlang geschuftet, um es wieder in Ordnung zu bringen.«
»Geschieht ihm ganz recht«, meinte Anastasia und baumelte mit den Beinen. »Warum hat er auch gestohlen! So etwas tut man nicht – und schon gar nicht bei seinen Freunden.«
»Und warum nimmst du Fjodor Soklow dann immer seine Zinnsoldaten weg?« fragte Tatjana neckend. »Er ist doch auch unser Freund.«
»Die klaue ich nicht, die schwatze ich ihm ab«, widersprach Anastasia. »Oder ich tausche sie gegen etwas anderes, was Fjodor haben will.«
Zarin Alexandra drohte ihrer Jüngsten lächelnd mit dem Finger. »Das ist aber auch nicht in Ordnung, Kobold, jemandem etwas abzuschwatzen.«
»Ach ...« Anastasias Augen blitzten. »Warum ist er so dumm und geht darauf ein? Er brauchte ja nur nein zu sagen.«
»Und dann wirst du wütend und nennst ihn einen stinkenden Geizhals!« rief Maria dazwischen.
»Das stimmt nicht. Das habe ich nie gesagt!« behauptete Anastasia und knuffte ihre Schwester in die Seite.
»Hast du wohl! Ich habe es selbst gehört!«
Die Zarin legte den beiden die Arme um die Schultern. »Kinder, streitet euch nicht. Und du, Anastasia, versprich mir, daß du nie wieder solche häßlichen Worte benutzt.«
Die jüngste Zarentochter schob die Unterlippe vor. »Immer ich! Alexej sagt noch viel schlimmere Sachen. Heute vormittag hat er Derewenko nachgerufen, er wäre ein schielender Kretin, weil Alexej unbedingt mit uns im Park radfahren wollte und Derewenko das für zu gefährlich hielt. Aljoschka hat einen richtigen Wutanfall bekommen. Aber er darf eben alles, weil er krank ist und einmal Zar von Rußland sein wird.«
Alexandras Gesicht hatte sich verdunkelt. »Niemand darf alles, und Aljoscha am allerwenigsten. Denk doch daran, wieviel ihm durch seine Krankheit versagt ist. Da ist er eben manchmal schlecht gelaunt.«
»Ich würde ihm gar nicht so viel verbieten, maman«, wandte Olga ein. Sie warf Rasputin einen vertrauensvollen Blick zu. »Solange Vater Grigorij hier ist, kann Aljoscha doch nichts passieren, selbst wenn er sich stößt oder hinfällt und eine Blutung bekommt. Vater Grigorij macht ihn wieder gesund.«
»Das hast du schön gesagt, mein Täubchen.« Rasputin strich ihr über das Haar und wandte sich zur Tür. »Und ich verspreche euch: Mit Gottes Hilfe werde ich immer imstande sein, eurem Bruder beizustehen. Aber nun gute Nacht, meine Lieben. Ich will noch auf ein Viertelstündchen zu Alexej und mit ihm beten.«
»Gute Nacht, Vater Grigorij«, erscholl es ihm vierstimmig nach, als er hinausging. Die Zarin küßte ihre Töchter, ermahnte sie, ihr Gute-Nacht-Gebet nicht zu vergessen, und folgte Rasputin.
Sie fand ihn neben dem Bett des Thronfolgers kniend, wie er mit einer Hand sein großes silbernes Brustkreuz umklammerte und mit der anderen Alexejs blasse Finger auf der seidenen Decke umschloß. Rasputin betete flüsternd, und die Zarin verstand nur einzelne Sätze. »Der Herr segne dich ... Schlaf ohne Schmerzen und ohne Furcht ... Allmächtiger Gott, erhöre das Flehen deines unwürdigen Dieners ... Gib ihm deine Hilfe.«
Alexandra blickte auf Rasputins leicht gebeugten Rükken, und ein paar Tränen liefen ihr über die Wangen. Welch ein Mann, dachte sie. Welch ein großer, guter Mensch! Wir müssen sehr glücklich sein, daß er zu uns gekommen ist.
Rasputin blieb über Nacht in Zarskoje Selo. Er bewohnte eine Datscha in dem riesigen Parkgelände, ganz in der Nähe des Hauses von Anna Wyrubowa, der Ehrendame der Zarin.
Es war eine milde Nacht in diesem Sommer des Jahres 1911, und Grigorij Jefimowitsch verspürte noch keine Lust, zu Bett zu gehen. Natürlich hätte er bei Anna Wyrubowa vorbeischauen können, sie wäre darüber überglücklich gewesen, aber so nützlich sie ihm auch war, so wenig konnte er manchmal ihre kuhäugige Anbetung ertragen.
Wenn sie wenigstens reizvoll gewesen wäre! Aber ihr teigiges Gesicht und der fette Körper übten keinerlei Anziehungskraft auf ihn aus. Seit er in St. Petersburg und bei Hofe war, hatte Rasputin mit vielen Damen der Gesellschaft geschlafen, ebenso mit Hausmägden, drallen Kellnerinnen und Huren. Er hatte einen unbändigen Appetit auf Frauen und war dabei nicht wählerisch, doch Anna Alexandrowna ließ ihn kalt.
Nein, dachte Rasputin, während er den Weg zum Großen See einschlug. Ich glaube, so besoffen kann ich in meinem ganzen Leben nicht werden, daß ich über dich herfiele, meine liebe Anna.
Und dann dachte er plötzlich an die beiden ältesten Zarentöchter Olga und Tatjana. Wie reizend sie waren – und so ganz und gar unschuldig! Es hatte ihn in den Fingern gejuckt, ihre Haare zu berühren, seine Hände um ihre jungen Brüste zu schließen, die schmalen Schenkel und den unschuldigen Schoß zu streicheln ...
Aber Rasputin wußte, daß er dies niemals tun durfte. Es wäre das Ende seines Aufstiegs bei Hof gewesen. Und er wußte auch, daß seine Feinde nur auf so etwas lauerten, um seinen Sturz herbeizuführen.
Der derbe sibirische Muschik war ihnen ein Dorn im Auge, den adligen Herrchen und Offizieren. Sie haßten ihn wegen seines Einflusses auf das Zarenpaar, und er zahlte es ihnen heim, indem er ihnen mit aller Unverschämtheit und Verachtung begegnete, die er aufbringen konnte.
Doch das beschäftigte Grigorij Jefimowitsch heute wenig. Deutlicher war die Erinnerung an die beiden Zarentöchter und besonders an Olga. Noch keine siebzehn war sie und doch bereits eine fertige, sehr verführerische junge Frau. Oder nein – ein Mädchen, dessen Unberührtheit Grigorij geradezu magisch anzog.
Aber sie war unerreichbar für ihn, ebenso wie Tatjana.
Ich sollte nicht mehr abends zu ihnen in ihre Schlafzimmer gehen, dachte er und blickte einem Nachtvogel nach, den er aufgeschreckt hatte. Ein Steinkauz war es, der mit fast lautlosem Flügelschlag davonflog und in den Weidenwipfeln am See verschwand.
Gleichzeitig aber wußte Rasputin, daß er es immer wieder tun würde. Zu verführerisch war der Anblick der beiden jungen Mädchen in ihren Negligés und den offenen Haaren. Wenn er dann, so wie heute, in Hitze geriet und eine Frau brauchte, mußte er sich eben bei einer anderen schadlos halten.
Und da fiel ihm plötzlich Irina Lasarowa ein, die jüngste Tochter des verstorbenen Grafen Lasarow. Sie war ein schmales, mädchenhaftes Ding mit brennenden Augen. Und sie würde Wachs in seinen Händen sein, das wußte Rasputin. Eigentlich verrückt, daß er sie noch nicht in sein Bett geholt hatte. Das Schwänchen wartete doch nur darauf.
Ein lüsternes Grinsen umspielte seinen bärtigen Mund. Wenn er Irina Lasarowa verführte, so würde es ihre ältere Schwester zutiefst empören. Die schöne Swetlana Soklowa mochte ihn nicht, das wußte Rasputin, und wenn sie gekonnt hätte, hätte sie ihren ganzen Einfluß auf die Zarin geltend gemacht, um ihn in Ungnade fallen zu lassen. Aber das schaffte niemand, weil niemand außer ihm in der Lage war, den Thronfolger zu heilen.
Rasputin schlug nun doch den Weg zum Haus von Anna Wyrubowa an der Srednaja Allee ein. Er sah zwischen den Bäumen Licht aus den Fenstern im Parterre fallen, und das bedeutete, daß die Wyrubowa Gäste hatte. Vielleicht war auch Irina Lasarowna darunter. Sie und die Wyrubowa hatten heute keinen Hofdienst gehabt, und so war es gut möglich, daß sich die hübsche kleine Gräfin bei Anna Alexandrowna aufhielt. Die beiden steckten oft zusammen.
Ein Diener öffnete Rasputin, nachdem er den bronzenen Türklopfer betätigt hatte. Aus einem Salon war Klavierspiel zu hören. Ein junger Leutnant der Chevaliersgarde zu Pferde, an dessen Namen Rasputin sich nicht erinnern konnte, spielte Rachmaninow. Der Leutnant tat es recht stümperhaft, gleichwohl hörten die Anwesenden höflich zu und applaudierten, als er die Hände von den Tasten nahm.
Rasputin war in der Tür zum Salon stehen geblieben. Sein stechender Blick glitt über die Gästeschar. Es waren nur neun Personen, zwei Priester waren darunter – wie könnte es bei der frommen Anna anders sein –, dazu Oberst Datjuschkin, ein älterer Offizier der Palastgarde, und fünf Damen, unter ihnen Irina Lasarowa.
Sie saß neben der Wyrubowa auf einem Récamiersofa und entdeckte Rasputin zuerst. Er sah, wie ihre Augen aufleuchteten, und ging auf sie zu. Die Wyrubowa sprang mit einem Entzückensschrei hoch, als sie ihn gewahrte.
»Vater Grigorij, was für eine Freude, daß Sie noch zu so später Stunde bei mir vorbeischauen! Willkommen, willkommen!« Sie klatschte in die Hände und befahl dem Diener, der gerade mit einem Samowar und Teegläsern hereinkam: »Bring etwas zu essen für den Staretz. Und eine Karaffe grusinischen Wein. Er wird hungrig und durstig sein.«
»Nicht hungrig«, wehrte Rasputin ab. »Mama und Papa hatten die Freundlichkeit, mich zum Abendessen einzuladen. Aber einen Schluck Wein trinke ich gern, meine liebe Anna Alexandrowna.« Er küßte sie nach russischer Sitte auf beide Wangen und schlug das Kreuz über sie. Dann grüßte er in die Runde und setzte sich neben Irina. Sie rückte ein Stück weiter, um ihm Platz zu machen, und er lachte: »Hast du Angst vor mir, Töchterchen?«
Ihr blasses Gesicht rötete sich. »Aber nein, Vater Grigorij. Sie sollten nur bequem sitzen.«
Er sah eine kleine Ader an ihrem Hals pochen und hörte, daß ihr Atem schneller ging, als er seine breite Hand auf ihre legte.
»Das mußt du auch nicht, Irinenka – Angst vor mir haben. Du weißt doch, daß ich euch alle liebe – im Sinn und Geiste unseres Herrn Jesus Christus.«
Er sagte meist du zu seinen Anhängerinnen, und niemand fand etwas dabei. Wenn Ihre Majestäten dem Staretz gestattet hatten, sie Papa und Mama zu nennen – wer wollte da noch gegen eine vertrauliche Anrede protestieren? Im Gegenteil, man fühlte sich geehrt.
Die Wyrubowa ließ es sich nicht nehmen, Rasputin selbst den Wein einzuschenken. Er trank ihn rasch und ließ sich das Glas erneut füllen. »Das tut gut«, sagte er und wischte sich den Mund ab. »Ich bin ein wenig erschöpft, denn ich habe lange mit den Großfürstinnen und dem Zarewitsch gebetet. Ach ja, meine Lieben, in dieser Zeit tut es not, sehr viel zu beten. All das Böse, das sich um uns ausbreitet, liegt wie eine Last auf mir. Aber man muß mit Gott ringen, damit er nicht zuläßt, daß das ganze heilige Rußland ein Spielball des Teufels wird.«
Es blieb nicht bei der einen Karaffe Wein an diesem Abend. Rasputin trank und redete, und Anna Wyrubowas Gäste hingen verzückt an seinen Lippen. Lediglich der junge Leutnant der Chevaliersgarde wirkte etwas verstimmt, weil er sich gern noch weiterhin am Klavier produziert hätte, doch darauf achtete niemand.
Rasputin spürte, wie er betrunken wurde, aber nicht betrunken genug, um die Hitze in seinem Leib loszuwerden. Verdammt, er mußte sie haben, diese Irina Lasarowa, und das noch heute! Wie konnte er es nur bewerkstelligen?
Den Anstoß dazu gab sie selbst, indem sie – es war weit nach Mitternacht – erklärte, sie wolle nun in den Alexanderpalast zurückkehren, wo sie ein Appartement bewohnte. Andere schlossen sich ihr an, so daß plötzlich eine allgemeine Aufbruchstimmung herrschte.
Rasputin küßte die Wyrubowa auf beide Wangen. »Gott segne dich, meine liebe, treue Anna! Und er vergelte dir, was du für mich tust.«
Sie dankte ihm mit einem verklärten Lächeln. »Es ist meine ganze Freude, Ihnen, Vater Grigorij, ein wenig dienlich zu sein.«
Er tätschelte ihr die Wange. »Gute Nacht, meine Liebe. Der Herr schenke dir angenehme Träume.«
Die Gäste der Wyrubowa wohnten ausnahmslos im Alexander-Palais, wo auch die Zarenfamilie lebte. Irina ging zwischen einer Hofdame der Zarin und der Gesellschafterin der montenigrinischen Prinzessin Militza. Wera Lwowna, so hieß sie, hatte Irina untergehakt, doch Rasputin holte sie rasch ein.
»Auf ein Wort noch, Irina Pawlowna«, sagte er, und sie blieb mit ihm ein paar Schritte zurück.
»Was gibt es, Vater Grigorij?« fragte sie, und er umfaßte mit einer Hand ihre Brust und griff mit der anderen in ihr Haar.
»Du bist in großer Gefahr, meine Schöne, weißt du das? Du sehnst dich nach der Sünde und hast immer noch nicht begriffen, daß man sie zuerst begehen muß, um danach echte Büßfertigkeit aufzubringen und dadurch rein gemacht zu werden.«
Irina wich seiner Berührung aus. »Ich sehne mich nach keiner Sünde, Vater. Sie irren sich.«
Er strich mit dem Daumen über ihre aufgerichtete Brustwarze, die er unter der dünnen Bluse deutlich ertastete. »Lüg nicht, ich weiß es besser. Dein Körper verrät dich. Aber ich werde dich reinigen.«
Irina wußte, wie er das meinte, und sie spürte, wie ein Prickeln sie erfaßte. Ach, sie hatte so lange davon geträumt, daß er sie berührte und jene Gefühle in ihr weckte, die sie nur stillen konnte, wenn sie sich vorgaukelte, in seinen Armen zu sein. Es half nichts, daß Irina sich einzureden versuchte, Rasputin sei ein abstoßender, ungepflegter Mann, unersättlich in seinem Verlangen nach immer anderen Frauen, der auch sie nur benutzen würde, um seinen Trieb zu befriedigen.
Irina war es seit langem bewußt, daß sie nichts so sehr ersehnte wie die Umarmung dieses Mannes, der sie gleichzeitig abstieß und anzog.
Trotzdem riß sie sich von ihm los. »Lassen Sie mich, ich bitte Sie! Ich will das nicht.«
»Und ob du es willst, meine Schöne«, murmelte er an ihrem Ohr, und sein Atem streifte ihre Haut. »Also wehr dich nicht. Du und ich, wir können uns viel Freude schenken.«
Er zog sie von dem breiten Hauptweg fort in einen schmalen Pfad, der, wie er wußte, zu einem der Pavillons im Park führte. Dort gab es Marmorbänke und im Inneren weiche samtbezogene Sofas.
Irina Lasarowa war fünfundzwanzig Jahre alt und noch Jungfrau. Darum empfand sie Angst, als Rasputin die Tür zu einem der Pavillons aufdrückte und sie zu einer Ottomane drängte, deren Umrisse sie in dem matten Nachtlicht erkennen konnte, das durch die Fenster fiel. Er warf sich über sie und begann sie zu küssen und zu betasten.
»Nein, nicht ...« flehte Irina. »Was sollen die anderen denken, weil wir uns von ihnen entfernt haben!«
»Was gehen sie uns an?« sagte Rasputin und riß ihre weiße Spitzenbluse auf. »Vergiß sie, mein Schwänchen, und denk nur noch daran, daß ich bei dir bin. Das wolltest du doch schon lange, und du hast sehnlich darauf gewartet. Oh, ich weiß es wohl, daß du verrückt nach mir bist, aber ich will es nun von dir selbst hören. Los, sag es! Sag, daß du mich haben willst!«
Es war, als hätte sein Wille von ihr Besitz ergriffen. Ihre Gegenwehr erlahmte, und sie erwiderte seine Küsse. Rasputin schlug ihr die Röcke hoch und berührte ihre Scham. Unwillkürlich hob sie sich ihm entgegen.
»So ist es recht, meine kleine heiße Stute!« stieß er hervor, während er sie betastete. »Und nun sag mir endlich, daß du nach mir brennst.«
»Ja«, brach es da aus ihr heraus. »Ja, ja! O mein Gott, ich halte es nicht mehr aus!«
Er keuchte. »Gut ... gut so!« Als er sie losließ, um ihr Rock und Wäsche abzustreifen und sich dann selbst seiner Kleidung zu entledigen, zitterte sie und streckte die Arme nach ihm aus. Da kam er wieder zu ihr, und sie spürte seine Erregung.
Irina warf den Kopf zurück und öffnete ihre Schenkel. »Komm«, flehte sie. »Komm endlich! Und wenn es tausendmal Sünde ist – ich muß es haben.«
»Es ist keine Sünde.« Rasputins Lippen glitten über ihren Hals, während er ihre Brüste knetete – auf eine Art, die sie halb wahnsinnig machte vor Verlangen. »Es ist der Vorhof zum Himmel!«
Sie schrie auf, als er in sie eindrang, und verkrampfte sich, weil sie Schmerzen empfand. Doch sie waren nur kurz, dann fühlte Irina, wie Rasputin sich in ihr bewegte, und antwortete ihm mit allem Verlangen, das sich in ihr aufgestaut hatte, seit sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Es war so gut, was er mit ihr tat, und sie würde es nie mehr in ihrem Leben missen können.
Als es vorüber war, weinte Irina ein wenig, aber nicht aus Scham, sondern vor Glück. Rasputin legte die Hände unter ihren Rücken und half ihr, sich aufzusetzen. Dann wiegte er sie in seinen Armen und wischte ihr den Schweiß von der Stirn. »Siehst du«, sagte er, »jetzt fühlst du dich besser, nicht wahr?«
Sie nickte stumm, und ein Schauer lief über ihren Körper, als er sie an sich drückte. Rasputin lachte leise. »Du hast noch nicht genug, was? Ich auch nicht. Ich werde dich die ganze Nacht lang lieben, bis du vor Erschöpfung keinen Finger mehr rühren kannst. Komm, Irinenka.«
»Wohin?« fragte sie, als er sie hochzog, und er antwortete:
»Zu mir, was sonst?«
Während er sich anzog, betrachtete sie ihn. Sein Körper war stark behaart, und er roch nach Schweiß und den Ausdünstungen der Liebe. Eben noch hatte Irina das erregt, doch auf einmal stieß es sie ab. Es war ernüchternd, zu sehen, wie er seine Kosakenhose anzog und die Knöpfe schloß. Dann stieg er in die Stiefel und warf den Russenkittel über, den er meistens trug. Irina sah, daß der Stoff voller Flecken war, und sie erinnerte sich daran, wie Grigorij zu essen pflegte. Mit seinen behaarten Händen riß er ein ganzes Huhn auseinander und wischte sich die fettigen Finger an seinem Kittel ab.
»Was ist?« fragte Rasputin. »Warum ziehst du dich nicht an? Beeil dich, um so eher kannst du alles wieder ausziehen.«
Mechanisch griff sie nach ihrer Unterwäsche. Dabei sah sie die Flecken auf dem Überwurf der Ottomane. »Das ist Blut«, sagte sie erschrocken, und Rasputin lachte.
»Du warst eben noch Jungfrau. Wußtest du nicht, daß ihr beim ersten Mal blutet?«
Er schloß seinen Gürtel und kam zu ihr. Sie senkte den Kopf, und heiße Röte schoß ihr ins Gesicht. Sie hatte gar nichts gewußt. Ihre Mutter hatte ihr nie etwas gesagt, und wenn die Dienstboten oder Mägde in Kowistowo manchmal zweideutige Reden geführt oder sich kichernd ihre Erlebnisse erzählt hatten, war Irina davongelaufen. Sie hatte nie etwas von solchen Dingen hören wollen, weil sie ihr anstößig und peinlich erschienen.
Und jetzt hatte sie sich Rasputin hingegeben, wie besessen von der Begierde, die er in ihr entfacht hatte, nicht anders als eine Magd in einer Ackerfurche.
Rasputin umfaßte ihr Kinn und hob ihr Gesicht an, damit sie ihn ansehen sollte. Aber Irina hielt noch immer die Lider gesenkt. Dennoch konnte sie es nicht hindern, daß seine bloße Berührung ihr von neuem einen prickelnden Schauer über die Haut jagte. Sie spürte seinen Blick und erwartete, daß Rasputin sie wieder umarmte. Doch er sagte nur: »Sieh mich an, Irinenka«, und diesmal gehorchte sie. Ein seltsames Leuchten schien von seinen grauen Augen auszugehen, in denen die Pupillen eng und schwarz und stecknadelgroß waren.
Irinas Mund wurde trocken, und sie versuchte, ihre Scham und ihren Widerwillen von eben zurückzurufen. Es gelang ihr nicht mehr.
Rasputin fuhr mit dem Zeigefinger über ihre Lippen. »Es war doch schön, was wir miteinander getan haben. Es hat dich befreit, und du sollst es immer wieder haben, nicht nur heute nacht. Nicht wahr, das wünschst du dir doch?«
Und Irina antwortete: »Ja, Vater Grigorij.«
Sein Mund verzog sich zu einem Grinsen. »Sag: Grigorij, mein Geliebter! Vater Grigorij bin ich für die anderen, nicht mehr für dich, meine Schöne.«
Sie nickte bebend, und das Leuchten in seinen Augen war wie ein magisches Feuer, das allen eigenen Willen in ihr verbrannte – bis auf den heißen Wunsch, diesem Mann zu gehören.
Ende August bereitete der Hof seine Abreise nach Kiew vor, wo Zar Nikolaus II. ein Denkmal zur Erinnerung an seinen Großvater einweihen wollte, den von Terroristen ermordeten Alexander II., der die Leibeigenschaft, jene ständig schwärende Wunde am Leib Rußlands, aufgehoben hatte.
Das Zarenpaar reiste mit großer Begleitung, auch Swetlana und Leonid Soklow gehörten dazu.
Kiew empfing Nikolaus und Alexandra mit strahlend blauem Himmel, gegen den sich die Zwiebeltürme der zahlreichen Kirchen in Rot und Gold, Grün und Blau schillernd abhoben.
Swetlana hoffte, während der Festlichkeiten für ein paar Tage vom Hofdienst beurlaubt zu werden, um Kowistowo, dem Landgut, auf dem sie ihre Kinderjahre verbracht hatte, einen Besuch abzustatten und ihre Mutter wiederzusehen, die sich nach dem Tod ihres Mannes dorthin zurückgezogen hatte.
St. Petersburg jagte der Gräfin Wera Lasarowa Angst ein, seit dort Attentate, Streiks und Demonstrationen an der Tagesordnung waren und ihr Mann an den Folgen einer Bombenexplosion gestorben war. Aber Leonid Soklow vereitelte Swetlanas Vorhaben, indem er erklärte, daß er sie dann nach Kowistowo begleiten wollte.
»Wie du weißt, meine Teure, habe ich gute Gründe, dich nicht unbeaufsichtigt zu lassen«, erklärte er mit einem perfiden Grinsen. »Deine momentane Tugendhaftigkeit ist in meinen Augen keine Garantie, daß du mich eines Tages nicht wieder zum Hahnrei machst. Vielleicht hast du dich sogar hinter meinem Rücken mit deinem verflossenen Liebhaber in Kowistowo verabredet. Wie ich hörte, hat Herr Masslejew St. Petersburg bereits vor zehn Tagen verlassen, um auf Reisen zu gehen.«
»Dann wissen Sie mehr als ich«, erwiderte Swetlana. »Also machen Sie sich nicht lächerlich. Rodja Masslejew und ich – das ist ein seit langem abgeschlossenes Kapitel.«
Er trat hinter sie und faßte in ihr weizenblondes üppiges Haar, das sie noch offen trug, weil sie sich am Nachmittag ein wenig niedergelegt hatte. Am Abend sollte im Kiewer Alexander-Theater die Borodin-Oper ›Fürst Igor‹ aufgeführt werden, und Swetlana war gerade in ihr Boudoir gekommen, um nach ihrer Zofe zu läuten, damit sie ihr beim Ankleiden und Frisieren half.
Es tat Swetlana weh, als Leonid ihren Kopf an den Haaren nach hinten riß. »Dann sieh zu, daß es ein abgeschlossenes Kapitel bleibt«, sagte er grob. »Oder ich knalle deinen Rodja Masslejew ab wie einen tollwütigen Fuchs.«
»Lassen Sie mich los«, preßte sie hervor, und er gehorchte zu ihrer Erleichterung. Meist machte es ihm Freude, sie noch länger zu quälen. Swetlana brachte ein kühles Lächeln zustande. »Ich habe Rodja Masslejew seit langem nicht mehr gesprochen. Genau gesagt, seit der Zeit, als Sie von den Toten wieder auferstanden sind.«
Er war schon in voller Galauniform für den Abend und betrachtete sich in dem bodenlangen Spiegel. Während er sein Portepee zurechtrückte, lachte er. »Das war ein herber Schlag für dich, nicht wahr? Die schöne Witwe Swetlana Soklowa, die mit ihrem Liebhaber im Bett liegt, und auf einmal steht der totgesagte Ehemann in der Tür. Äußerst lebendig aus dem japanischen Krieg und der Gefangenschaft heimgekehrt.«
Swetlana stand auf und läutete nach ihrer Zofe. »Sie erzählen diese Geschichte ein wenig zu oft. Sie langweilt mich indessen. Abgesehen davon halte ich Ihnen Ihre zahllosen Affären ja auch nicht vor.«
Er lachte und wandte sich zur Tür. »Schon gut, meine Teure. Ich weiß ja, daß es dir nicht das Herz bricht, wenn ich mich außerhalb des ehelichen Bettes amüsiere. Vermutlich ist es dir sogar sehr willkommen. Allerdings werde ich in keinem Fall dulden, daß du mich noch einmal betrügst. Ich lasse mich von dir nicht lächerlich machen!«
Swetlana wurde durch den Eintritt ihrer Zofe einer Antwort enthoben. Jeanette knickste vor Leonid. »Guten Abend, Euer Gnaden.«
Er winkte ihr lässig zu. »Mir scheint, du wirst alle Tage hübscher, Kleine. Wieso bist du eigentlich noch nicht verheiratet? Sind die Männer blind?«
»Das nicht«, gab Jeanette zur Antwort. »Aber ich bin wählerisch.«
Er lachte. »Wartest du auf einen Prinzen? Dann sieh zu, daß du keine alte Jungfer wirst.«
»Lieber das, als unglücklich verheiratet«, erwiderte die junge Französin keck, und Leonid kniff sie in die Wange.
»Schlagfertig bist du, das muß man dir lassen. Und nun sieh zu, daß du Ihre Gnaden besonders schön herrichtest für diesen Abend. Ich möchte, daß man mich um sie beneidet.«
Damit ging er, und Jeanette seufzte erleichtert auf. Sie mochte Leonid Soklow nicht – wie die meisten, die in Swetlanas Diensten standen. Dienstboten wissen immer, was hinter den Türen ihrer Herrschaft vor sich geht, und die unglückliche Ehe der Fürstin Soklowa war seit langem kein Geheimnis, am allerwenigsten für Jeanette.
»Sie sehen blaß aus, Euer Gnaden«, sagte die Zofe nach einem Blick in Swetlanas Gesicht. »Fühlen Sie sich nicht gut?«
»Ich habe immer noch ein wenig Kopfweh. Sei so gut, Jeanette, und bring mir ein Pulver – und dazu einen sehr starken türkischen Mokka. Dann wird mir besser werden.«
»Sofort, Euer Gnaden«, erwiderte die Zofe und verschwand.
Als sie allein war, stützte Swetlana den Kopf in die Hände. Es war dumm und unsinnig, aber die Erwähnung von Rodjas Namen genügte immer noch, um den alten Schmerz wieder auferstehen zu lassen. Verblaßten denn die Erinnerungen nie?
Swetlana spürte, wie sich Tränen hinter ihren Lidern sammelten, und die weichen Hämmer des Schmerzes in ihren Schläfen pochten heftiger.
»Euer Gnaden!« Swetlana schrak hoch, als Jeanette zurückkam. »Sie haben doch nicht etwa geweint? Das dürfen Sie nicht, denn man könnte es Ihnen ansehen, und der Fürst wäre sehr ärgerlich darüber.«
Swetlana wischte sich über die Augen. »Schon gut, Jeanette. Leg mir die neue Abendrobe heraus, du weißt schon, die aus rotem Duchesse mit der Perlenstickerei und der langen Courschleppe.«
Sie hatte das Kleid bei Madame Paquin in Paris in Auftrag gegeben, die im letzten Winter mit einigen Mannequins nach Rußland gereist war und deren exquisite Abendroben in der Petersburger Gesellschaft Furore gemacht hatten. Seitdem gehörte Swetlana zu den Kundinnen des Salons Paquin in der Pariser Rue de la Paix. Madame hatte nach Swetlanas Maßen eine Schneiderpuppe anfertigen lassen. Das Kleid, dessen Entwurf sie Swetlana zugeschickt hatte, war sündhaft teuer gewesen, aber es gab manchmal Dinge, die Frauen sich aus purer Verzweiflung kauften – oder um die Leere in ihrem Inneren mit irgend etwas zu übertünchen.
Und verzweifelt war Swetlana. Sie haßte sich manchmal selbst wegen der Hartnäckigkeit, mit der sie Rodja immer noch liebte und sich nach ihm sehnte.
Im Foyer des Kiewer Theaters und den Wandelgängen drängten sich die Opernbesucher. Aus dem Orchestergraben drang das Stimmen der Instrumente und schuf zusammen mit dem Geplauder des Publikums jene unvergleichliche Atmosphäre, wie sie jeder festlichen Opernaufführung voraufgeht.
Das Zarenpaar war bereits eingetroffen, die Zarin wie zumeist in weißen Chiffon gehüllt, zu dem sie einen herrlichen Schmuck aus Saphiren und Brillanten mit passendem Diadem trug. Während Nikolaus II. in der Galauniform des Oberkommandierenden des Kürassierregiments ›Ihre Majestät, die Kaiserin‹ zwischen seinen Gästen umherging und da und dort ein paar Worte mit jemandem wechselte, saß Alexandra Fjodorowna in einer Fensternische auf einem Sofa, neben sich die Wyrubowa und Irina Lasarowa. Die Miene der Wyrubowa verfinsterte sich, als die Zarin Swetlana entdeckte und zu sich heranwinkte.
»Ich glaube, Sie sind die eleganteste Dame heute abend«, sagte Alexandra Fjodorowna mit einem neidlosen Lächeln. »Was für ein wunderschönes Kleid, meine liebe Swetlana Pawlowna. Wo haben Sie es arbeiten lassen?«
»In Paris bei Madame Paquin«, erwiderte Swetlana. »Ihre Kreationen sind wirklich einmalig, finde ich.«
»Und Sie können sie tragen«, bestätigte die Zarin. »Dieses Rot wäre für viele etwas gewagt, aber an Ihnen sieht es phantastisch aus, meinen Sie nicht auch, Irina Pawlowna?«
Swetlanas Schwester nickte. »Sie ist eben unsere Familienschönheit, neben der alle anderen verblassen.«
»Was für ein Unsinn!« widersprach Swetlana und lächelte ihrer jüngsten Schwester zu. »Du kannst mit deinem Aussehen mindestens ebenso zufrieden sein.«
Swetlana war nicht ganz aufrichtig in diesem Augenblick, denn sie fand, daß Irina in letzter Zeit viel von dem zarten Schmelz ihrer bisherigen Mädchenhaftigkeit verloren hatte. Sie war immer schmal gewesen, doch jetzt war sie überschlank, fast knochig, und das dunkle Haar und die großen dunklen Augen ließen sie doppelt blaß erscheinen.
»Was ist los mit dir?« hätte Swetlana am liebsten gefragt, »Geht es dir nicht gut, Irinenka?« Aber sie verschob das auf einen späteren Zeitpunkt, wenn sie mit ihrer Schwester allein sprechen konnte.
Leonid Soklow trat zu der kleinen Gruppe und verneigte sich vor Alexandra. Sofort setzte sie ihr übliches maskenhaftes Lächeln auf, das sie immer bei offiziellen Anlässen zur Schau trug und das ihr den Ruf eingetragen hatte, hochmütig und übertrieben auf Distanz bedacht zu sein. Aber Swetlana wußte, daß die Zarin dahinter viel mehr ihre tiefe Unsicherheit und Schüchternheit verbarg.
»Fürst Soklow, wie angenehm, Sie zu sehen! Ich habe gerade Ihrer Gattin ein Kompliment zu ihrer exquisiten Garderobe gemacht.«
Leonid musterte seine Frau mit einem breiten Lächeln. »Ja, Swetlana Pawlowna hat Geschmack. Sonst hätte sie mich auch nicht geheiratet.«
Peinlich berührt schob die Zarin die Augenbrauen zusammen. Es dauerte nur einen Sekundenbruchteil, dann hatte sie sich wieder in der Gewalt. Aber Swetlana und auch Leonid hatten es dennoch bemerkt, und sie wußten beide, was Alexandra Fjodorowna dachte.
Sie und der Zar gehörten zu den wenigen Menschen, denen es bekannt war, daß Zar Nikolaus’ verstorbener Bruder Georg der leibliche Vater von Fjodor Soklow war und daß Swetlana Leonid nur geheiratet hatte, weil die Umstände sie dazu zwangen.
Alexandra Fjodorowna wandte sich Swetlana zu. »Ich habe noch gar nicht nach Ihrem Sohn gefragt, meine Liebe. Wie geht es ihm? Ist er wohlauf?«
»Heute nachmittag haben wir miteinander telefoniert«, erwiderte Swetlana. »Fjodor war ein wenig traurig, daß er uns nicht nach Kiew begleiten durfte. Aber für ein Kind von elf Jahren wäre diese Reise mit all den offiziellen Empfängen und Paraden kaum das Richtige. Fjodor hätte sich vermutlich bald gelangweilt.«
»Und er hätte einiges an Unterrichtsstunden versäumt«, warf Leonid ein. »Mein Sohn ist leider immer noch recht verspielt und braucht eine gewisse Disziplin. Aber ich denke, der neue Hauslehrer, den ich im Frühjahr eingestellt habe, ist der geeignete Mann, sie ihm beizubringen. Jedenfalls lassen weder Herr von Solln noch seine anderen Lehrer ihm etwas durchgehen.« Er lachte. »Fjodor ist schon jetzt ein ausgezeichneter Reiter und ein noch besserer Pistolenschütze und Degenfechter. Darin tritt er ganz in meine Fußstapfen.«
»Überfordern Sie ihn nur nicht«, sagte die Zarin. »Ein Kind braucht auch Zeit zum Spielen und Herumtollen. Allzuviel Strenge kann aus sensiblen Naturen leicht Duckmäuser oder Heuchler machen, die jeden Widerspruch scheuen und lieber lügen und schmeicheln, um nur ja kein Ärgernis heraufzubeschwören.«
»Oh, ich werde schon dafür sorgen, daß aus meinem Sohn kein Duckmäuser, sondern ein richtiger Mann wird«, antwortete Leonid. »Es ist ja leider unser einziges Kind. Deshalb kümmere ich mich besonders um seine Erziehung.«
Die Zarin erhob sich ein wenig mühsam und stützte sich dabei auf die Wyrubowa, die ihr mit einem beflissenen Lächeln ihren Stock reichte. »Ich glaube, es wird Zeit, unsere Plätze einzunehmen. Soweit ich weiß, haben Sie die Loge neben uns, meine liebe Swetlana Pawlowna. Kommen Sie doch in der ersten Pause zu mir. Ich würde gern noch ein Weilchen mit Ihnen plaudern.« Mit einem äußerst zurückhaltenden Lächeln nickte sie Leonid zu. »Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, Fürst.«
»Ergebensten Dank, Euer Majestät«, erwiderte er mit schmalen Lippen und vollführte eine Verneigung, die in ihrer Devotion fast schon übertrieben wirkte. Swetlana sah ihm an, daß er wütend war, und verspürte wenig Lust, schon jetzt mit ihm ihre Loge aufzusuchen. Darum wandte sie sich um und ging auf Peter Stolypin zu, den sie bei der Treppe entdeckte, die vom Foyer nach oben führte.
»So allein?« fragte Swetlana und streckte dem russischen Premierminister die Hand entgegen, auf die er einen Kuß hauchte.
»Neuerdings fast immer«, entgegnete der stämmige Mann mit einem schiefen Lächeln. »Sollte es Ihnen entgangen sein, Fürstin, daß ich seit einigen Wochen nicht mehr die Gunst Seiner Majestät genieße und mich gewisse Kreise bei Hof deshalb meiden, als hätte ich eine ansteckende Krankheit?«
»Ich habe davon gehört, daß Sie einige Differenzen mit dem Zaren hatten. Aber doch hoffentlich nicht ernstlicher Art?«
Stolypins bärtiger Mund verzog sich bitter. »Ich habe Seine Majestät um meinen Rücktritt gebeten, weil ich mit einigen meiner Reformpläne beim Reichsrat keine Unterstützung gefunden habe. Der Zar hat dem nicht stattgegeben, und ich bin unter der Bedingung darauf eingegangen, daß er mein Hauptanliegen – die Einführung der Semstwos auch in den westlichen Provinzen – per Dekret in Kraft setzt. Außerdem habe ich bei Seiner Majestät erreicht, daß er meinen entschiedenen Widersachern, den Herren Durnow und Trepow, für eine Zeitlang die Teilnahme an den Sitzungen des Reichsrates untersagt hat.«
»Aber das ist doch ein großer Erfolg für Sie«, sagte Swetlana, die Peter Arkadjewitsch Stolypin als außerordentlich fähigen Politiker schätzen gelernt hatte. Seit er im Amt war, war es ihm gelungen, die ständigen Unruhen, Streiks und Attentate einzudämmen, freilich, indem er mit aller Härte gegen die Rädelsführer vorging, andererseits aber eine Reihe vernünftiger Reformen durchgeführt hatte.
Stolypins Ziel war, ein für Rußland neues parlamentarisches System zu entwickeln, das die Lage des Volkes einerseits verbessern, gleichzeitig aber die kaiserliche Macht festigen sollte. Dabei war der Premierminister allerdings ständig gezwungen, gegen die sozialistische Linke zu kämpfen, die jede Teilreform ablehnte und statt dessen den völligen Umsturz predigte. Andererseits mußte er den stockkonservativen Anhängern der kaiserlichen Autokratie paroli bieten, für die jegliche Veränderung der Regierungsform bereits ein Sakrileg war.
Stolypin schüttelte den Kopf. »Seine Majestät hat mir zwar nachgegeben, weil er im Augenblick keinen geeigneten Nachfolger für mich weiß. Aber er trägt es mir nach, daß ich ihn quasi zu diesem Schritt gezwungen habe. Mein schlimmstes Verbrechen allerdings besteht darin, daß ich Rasputin eine Zeitlang überwachen ließ und Seiner Majestät ein Dossier über dessen skandalöses Doppelleben vorgelegt habe. Ich hoffte, der Zar würde sich bewegen lassen, Rasputin zum Teufel zu schicken, zumal alle Welt sich indessen über sein unverschämtes Benehmen und seinen fast unbegrenzten Einfluß auf die Zarenfamilie empört. Aber zum Teufel schicken will Seine Majestät vermutlich nur mich, weil ich es gewagt habe, Rasputins Stellung anzutasten.«
»Das ist doch nicht möglich«, erwiderte Swetlana betroffen, und Stolypin zuckte mit den Schultern.
»Es ist bereits ein offenes Geheimnis, daß ich nach unserer Rückkehr in die Hauptstadt nicht mehr im Amt bleiben werde. Die Folgen bekomme ich schon jetzt zu spüren. Man schneidet mich, man hat mir hier im Gegensatz zu sonst keinen Staatswagen zur Verfügung gestellt und mich auch nicht im kaiserlichen Palast untergebracht. Das alles sind untrügliche Anzeichen.«
»Aber wer, um Himmels willen, soll denn Ihr Nachfolger werden?« fragte Swetlana, während ihre Bestürzung wuchs. »Es gibt doch weit und breit niemanden, der Ihnen das Wasser reichen kann.«
Sein bitteres Lächeln verstärkte sich. »Ich habe darüber vor kurzem mit Seiner Majestät gesprochen. Wenn er eine stabile Macht wünscht, so habe ich ihm gesagt, die weitere Reformen nicht ausschließt, bin ich sein Mann. Wenn er die Reformen beenden will oder sogar eine Rückentwicklung erstrebt, müsse er sich an Durnow halten. Und wenn er es vorzieht, auf der Stelle zu treten, sei Finanzminister Graf Kokowzow der Richtige.«
Er blickte sich um und gewahrte, daß das Foyer sich inzwischen geleert hatte. Alles war in den Zuschauerraum und auf die Ränge geströmt. »Lassen Sie uns ebenfalls hineingehen, Fürstin«, sagte Stolypin und bot Swetlana den Arm. »Wir sind die Letzten, wie mir scheint. Die Ouvertüre wird jeden Augenblick beginnen.«
Er begleitete sie zu ihrer Loge, küßte ihr zum Abschied die Hand und suchte dann eilig seinen Sitzplatz im Parkett auf. Daß man ihm keinen Logenplatz zugewiesen hatte, war ebenfalls ein ziemlich sicheres Zeichen der kaiserlichen Ungnade.
Swetlana hätte sich gern in der Pause weiter mit Stolypin unterhalten, nicht zuletzt, um zu demonstrieren, wie abscheulich sie das Verhalten der Hofschranzen fand, aber die Zarin winkte sie in ihre Loge, in der sich auch die beiden Großfürstinnen Olga und Tatjana befanden, die Swetlana sogleich in ein Gespräch verwickelten.
Die jungen Mädchen sahen reizend aus in ihren weißen Spitzenkeidern und den aufgesteckten Haaren, in denen sie als Schmuck roséfarbene Rosen trugen. Sie hatten glühende Wagen und glänzende Augen. Tatjana und Olga liebten diese offiziellen Festivitäten, waren sie doch eine willkommene Abwechslung in dem eher bescheidenen, zurückgezogenen Leben, das die Zarenfamilie in Zarskoje Selo und den anderen Residenzen außerhalb von St. Petersburg führte.
Olga forderte Swetlana auf, bei ihnen in ihrer Loge zu bleiben, und sie setzte sich neben sie.
In der nächsten Pause sah sie Peter Stolypin unten im Parkett stehen. Er winkte einem Lakaien, der ein Tablett mit Champagnergläsern trug, und der Mann wollte sich gerade zu ihm durchdrängen, als plötzlich mehrere Schüsse fielen. Etliche Leute schrien auf, und die Ersten stürzten voller Panik zu den Ausgängen. Stolypin stand ein paar Sekunden lang völlig isoliert in seiner Sitzreihe. Swetlana sah, daß er sich verfärbt hatte und sich an die Brust griff. Seine Hand war blutig, als er sie hob und sich zur Zarenloge umwandte, um ein Kreuz zu schlagen. Dann kippte er nach vorn.
Er lebte noch fünf Tage, bevor er seinen schweren Schußverletzungen erlag.
Der Attentäter hieß Bogrow und war ein Agent der Geheimpolizei. Er hatte Stolypin noch am Vortag die Meldung zukommen lassen, daß Terroristen nach Kiew eingeschleust worden seien, die eine Verschwörung planten. Aus diesem Grunde hatte Bogrow auch eine Eintrittskarte für die Oper erhalten.
Was Stolypin nicht gewußt hatte, war, daß Bogrow als Doppelagent arbeitete und seit längerem geplant hatte, den Premierminister umzubringen. In einem Verhör gestand Bogrow später, er habe Stolypin aus Rache ermordet, weil jener ihn veranlassen wollte, seine revolutionären Gesinnungsfreunde ans Messer zu liefern. Bogrow wurde zum Tode verurteilt.
Zarin Alexandra war durch das Attentat auf Stolypin völlig außer Fassung geraten. Sie hatte ihre Töchter weinend umarmt und ihnen die Augen zugehalten, damit sie das Schreckliche nicht sahen. Nikolaus II. war aufgesprungen, als die Schüsse fielen. Bleich, mit starrem Gesicht stand er an der Logenbrüstung, selbst eine Zielscheibe für jeden, der ihn töten wollte. Das war ihm in diesem Augenblick nicht einmal bewußt.
Die Opernvorstellung wurde abgebrochen, und im Zuschauerraum riefen einige Beherzte, die die Nerven behalten hatten: »Die Hymne! Spielt doch um Gottes willen die Zarenhymne!«
Es dauerte eine Weile, bis die Orchestermitglieder sich so weit gefaßt hatten, daß das ›Boshe Zarja Chranij‹ aufklang. Im Zuschauerraum und auf den Rängen erhob sich alles, was nicht im ersten Schrecken geflüchtet war, während der bewußtlose Stolypin hinausgebracht und in ein Kiewer Krankenhaus überführt wurde.
2. Kapitel
Wie so oft in seinem Leben nahm der Zar Zuflucht zum vorgesehenen Protokoll, um seine innere Unsicherheit zu übertünchen und durch die im voraus festgelegten Zeremonien eine trügerische Festigkeit zu demonstrieren.
So verließ er wie geplant am nächsten Tag die Stadt, um einem Manöver in Tschernigow beizuwohnen. Seine Frau und seine Töchter blieben in Kiew zurück, und die Zarin, noch immer in einem desolaten Zustand, ließ Rasputin kommen, der eilends aus St. Petersburg anreiste, um ihr beizustehen.
»Keine Wache konnte Stolypin schützen«, sagte Alexandra mit Tränen in den Augen zu Swetlana. »Und keine Wachen werden den Kaiser schützen können. Das Heil kann man nur von den Taten und Gebeten Vater Grigorijs erwarten.«
»Wie wahr, wie wahr!« murmelte die Wyrubowa ergriffen. »Fürchten Sie nichts, meine Kaiserin. Wenn Vater Grigorij bei Ihnen ist, kann Ihnen nichts geschehen. Seine Gebete werden Sie umgeben wie ein Panzer, den keine Kugel, keine Bombe, kein Schwerthieb zerbrechen kann.«
Nach Rasputins Ankunft besserte sich Alexandra Fjodorownas Zustand zusehends. »Mama, Ihr müßt ganz ruhig sein«, sagte er und schlug das Kreuz über sie. »Der Teufel kann allen, die ich liebe, nichts anhaben. Jetzt ist es allerdings wichtig, für Stolypin einen geeigneten Nachfolger zu finden. Laßt uns darum beten, daß Gott uns erleuchten und unseren Sinn auf den Mann lenken möge, den der Allmächtige für dieses Amt ausersehen hat.«
Daß er danach stundenlang mit der Zarin in einem Zimmer verschwand, gab den üblen Gerüchten neuen Auftrieb. Die einen behaupteten überzeugter denn je, die Zarin sei Rasputins Geliebte; andere hielten ihre beiden ältesten Töchter dafür, doch Swetlana war weit davon entfernt, so etwas zu glauben. Niemals hätte Alexandra Rasputin erlaubt, sich ihr oder ihren Kindern auf solche Weise zu nähern. Sie vergötterte ihren Mann, und sie war eine gute, liebevolle Mutter.
Am 5. September erlag Peter Arkadjewitsch Stolypin seinen Verletzungen, und die Nachricht seines Todes rief nicht nur in Kiew, sondern auch in anderen russischen Städten die Nationalisten und Konservativen auf den Plan. Es war bekannt geworden, daß sein Mörder Bogrow, obwohl orthodoxen Glaubens, jüdischer Herkunft war, und der alte, immer wieder neu geschürte Antisemitismus brach sich Bahn.
»Die verfluchten Juden haben Stolypin umgebracht!« riefen die Demonstranten, die in heller Empörung auf die Straße gingen und auf die jüdischen Viertel zumarschierten. »Schlag das Judenpack tot!«
Polizei und Militär konnten allerdings neue Pogrome verhindern, doch der Haß schwelte weiter.
Zar Nikolaus kehrte aus Tschernigow zurück, und Swetlana, die ihn indessen recht gut kannte, war sicher, daß er im Grunde seines Herzens erleichtert war, daß Stolypin, dieser unnachgiebige Mann, nicht mehr lebte, der ihn in letzter Zeit zu Maßnahmen veranlaßt hatte, die Nikolaus unangenehm waren.
Stolypin war in der Kiewer Verkündigungskirche aufgebahrt, und der Zar genügte seinen protokollarischen Pflichten, indem er mit großem Gefolge dort erschien und sich mit bleichem Gesicht vor dem Katafalk verneigte. Die Beisetzung wartete er allerdings nicht ab, sondern reiste mit seiner Familie und dem Hofstaat am Vorabend nach Liwadja, dem kaiserlichen Sommersitz auf der Krim.
Für Swetlana war es jedesmal schmerzlich, das Schloß und die bezaubernde Umgebung wiederzusehen, in der sie Rodja kennengelernt hatte. Sie würde nie vergessen, wie glücklich sie hier für eine kurze rauschhafte Zeit gewesen war, und oftmals fragte sie sich, ob das wirklich alles an Glück gewesen sein sollte, was das Leben für sie bereithielt.
Leonid kam ebenfalls nach Liwadja, obwohl er nicht zum Hofstaat gehörte. Auf irgendeine Weise hatte er es bewerkstelligt, von Fürst Felix Jussupow, der mit Irina, einer Nichte des Zaren, verheiratet war, auf die Krim eingeladen zu werden. Die Jussupows besaßen dort das Gut Koreis, ganz in der Nahe von Liwadja.
Als das Zarenpaar von Leonids Anwesenheit erfuhr, ließ es sich nicht umgehen, ihn ebenfalls in die kaiserliche Residenz einzuladen, zumal die Jussupows nach zwei Wochen wieder abreisten, weil der Fürst wegen einer dringenden Familienangelegenheit nach St. Petersburg zurückkehren mußte.
»Ich weiß, Sie wären lieber allein hier, meine Liebe«, sagte die Zarin zu Swetlana. »Aber es wäre doch über alle Maßen unhöflich, Ihren Gatten, wenn er so in der Nähe ist, nicht zu uns zu bitten.«
»Gewiß, Euer Majestät«, erwiderte Swetlana, und Alexandra warf ihr einen unsicheren Blick zu.
»Ich wünschte sehr, daß Sie beide ... Nun ja, es wäre auch für Sie alles einfacher, wenn Sie in einer glücklicheren Beziehung lebten. Mein Eindruck ist, daß Fürst Soklow sich auffallend darum bemüht, seit er hier ist.«
»O ja, das tut er«, entgegnete Swetlana, »weil er sich in keinem Fall den Unwillen Eurer Majestät zuziehen möchte.«
»Ach, das glaube ich nicht«, widersprach die Zarin. »Sie sind eine so schöne, liebenswerte Frau – warum sollte ausgerechnet Ihr Mann dafür blind sein! Nein, nein, ich bin überzeugt, daß es ihm in der Hauptsache um Sie selbst geht. Aber es ist schade, daß er Ihren Sohn in St. Petersburg zurückgelassen hat.«
»Das ist wahr.« Swetlana seufzte. »Aber Leonid Iwanowitsch besteht darauf, daß Fjodor seinen Unterricht nicht vernachlässigt, und behauptet, hier würde er zu sehr abgelenkt.«
»Aber er hätte hier doch gemeinsam mit dem Zarewitsch und den Großfürstinnen Anastasia und Maria unterrichtet werden können. Sie haben ausgezeichnete Lehrer. Andererseits ist es wohl zu spät, Ihren Sohn noch herzuholen. Allzu lange bleiben wir ja nicht mehr hier.« Die Zarin rieb die Hände gegeneinander. »Ich finde, die Krim ist in diesem Herbst wesentlich kühler als sonst.«
»Ein wenig«, stimmte Swetlana zu. »Trotzdem ist es wie immer wunderschön hier.«
Alexandra Fjodorownas Gesicht nahm einen niedergeschlagenen Ausdruck an. »Mir graut schon vor der Ballsaison in St. Petersburg. Ich mag diese ewigen Galadiners, Bälle und Paraden nicht, und sie werden mir von Jahr zu Jahr verhaßter. Aber Seine Majestät hat mir versprochen, daß wir gleich im Frühjahr wieder herfahren. Das wird mir helfen, die ungeliebten Pflichten während des Winters zu ertragen.«
Sie beugte sich nach vorn. »Es ist zwar noch nicht offiziell, aber ich erzähle es Ihnen jetzt schon: Der Nachfolger von Herrn Stolypin wird Graf Kokowzow. Vater Grigorij hat innig darum gebetet, daß Gott die Gedanken Seiner Majestät auf den richtigen Mann lenken möge, und so ist es auch geschehen. Wladimir Kokowzow ist gewiß der Geeignetste, die Geschicke Rußlands mit zu lenken. Er war immer ein treuer Diener der Krone.«
Swetlana erinnerte sich daran, was Stolypin vor seinem Tod über den bisherigen Finanzminister gesagt hatte: »Wenn der Zar es vorzieht, auf der Stelle zu treten, so ist Kokowzow der Richtige.«
Hoffentlich hatte Stolypin sich geirrt! In Rußland war kein Auf-der-Stelle-Treten mehr möglich. Alles drängte auf eine Eskalation des Widerstandes hin: Widerstand der Konservativen gegen jedwede Beschneidung der zaristischen Macht. Widerstand der Radikalen, die den Zaren stürzen wollten. Widerstand der gemäßigten Sozialisten und Liberalen, die nicht mehr gewillt waren, die bestehenden Verhältnisse zu tolerieren.
Aber der Zar sah es nicht so. Abgesehen von seiner Frömmigkeit, durch die er alles, was geschah, ohnehin als Gottes Zulassung betrachtete, die man hinnehmen mußte, war er felsenfest davon durchdrungen, daß er das Erbe, das er von seinen Vätern erhalten hatte, unversehrt weitergeben mußte an die, die nach ihm kamen.
Doch wer kam nach ihm, wenn die revolutionären Elemente siegten?
All das hätte Swetlana der Zarin gern gesagt. Aber sie wußte, daß Alexandrea viel mehr noch als ihr Gatte vom Gottesgnadentum der Zarenwürde überzeugt war und jede Schmälerung als ein Verbrechen ansah. Sie waren beide von einer beängstigenden Weltfremdheit.
»Sie sagen ja gar nichts«, unterbrach die Zarin ihre Gedanken. »Dabei glaubte ich immer, Graf Kokowzow sei ein Freund Ihres Gatten und häufiger Gast bei Ihnen. Finden Sie nicht, daß er Herrn Stolypin ausgezeichnet ersetzen wird?«
»Alles, was ich von ihm weiß, ist, daß er ein guter Finanzminister war«, entgegnete Swetlana zurückhaltend. »Also kann man nur hoffen, daß er als Premierminister ebenso gewissenhaft und umsichtig handelt.«
Auf der Stelle treten, hatte Stolypin gesagt ... Der Winter des Jahres 1911 schien dem zu entsprechen. Die allseits flakkernden revolutionären Feuer schwelten momentan nur, und im Winterpalais und den Adelspalästen an der Bolschaja Newa, der Fontanka, und der Mojka wurde Champagner getrunken, getanzt, gefeiert, und man warf die Rubel mit vollen Händen aus dem Fenster.
Die finanziellen Schwierigkeiten, die der russisch-japanische Krieg mit sich gebracht hatte, waren längst überwunden, und Rußland erlebte gerade in diesem Jahr einen grandiosen wirtschaftlichen Aufschwung.