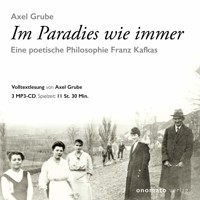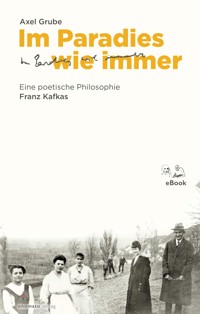
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: onomato
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist schwer die Wahrheit zu sagen. Denn es gibt zwar nur eine. Aber sie ist lebendig und hat daher ein ständig wechselndes Gesicht. - Franz Kafka (In einem Brief an Milena Jesenská) Als Philosoph ist Kafka bisher nicht in Erscheinung getreten; er selbst hätte sich wohl kaum als ein solcher verstanden. Kann man trotzdem von einer Philosophie, d. h. vom Zusammenhang eines Denkens sprechen, das auch Kafka selbst – spätesten nach Zürau – klar vor Augen stand? Unter Berücksichtigung meist ausgeblendeter Motive erscheint bereits bei einer unkommentierten Sortierung der Zürauer Texte, der Zusam- menhang eines Denkens in schöner Sinnfälligkeit. In den Anklängen zur Prosa, nach Hinweisen im Tagebuch und vor allem im Licht der Selbstaussagen über den persönlichen Grund seines Denkens, erscheint eine ungemein hoffnungsvolle Philosophie in poetischer Plausibilität. Um das Paradox von Unabschließbarkeit und Gewissheit kreist das Denken Kafkas. Wahrheit ist ihm dabei kein unmöglicher Begriff, vom Glauben zu sprechen nicht fremd. Die Entdeckung des Zweifellose[n] in sich, zu dem er gar nicht viel an [sich] verändern, sondern nur die alten, engen Umrisse [seines] Wesens nachziehen musste, scheint dabei das Agens einer praktischen Philosophie zu sein, bei der es Kafka letzthin um die nächsten Bedürfnisse des Lebens geht, vor allem in der Frage zur Bildung eines Verantwortungsgefühls, einer ethischen Musikalität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
ISBN 978-3-949899-35-5
ISBN der Buchversion 978-3-949899-15-7
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Cover-Foto: © Archiv Kritische Kafka-Ausgabe, Wuppertal© onomato Verlag Düsseldorf 2023Alle Rechte vorbehaltenonomato.de
Axel Grube
Im Paradies wie immer
Eine poetische Philosophie Franz Kafkas
Vorwort
Im Verweis von Denkbildern, Reflexionen und Aussagen in den Formen und Redeweisen Kafkas erscheint eine poetische Form von Philosophie. Aus jüdischer wie universaler Überlieferung gestaltet Kafka dabei eine neue Tradierbarkeit, eine universale Kabbala in der Moderne.
In einer Zeit in der, wie es im Märchen heißt, »Die Sonne schon hoch am Himmel steht«, inmitten einer Ratlosigkeit der Moderne, erneuert Kafka die weit ausgreifende, kontinuierliche, dabei allerdings eher hintergründige Ambition einer über zweitausendjährigen Überlieferung und stellt sie einer offenen Anverwandlung anheim.
Mit der Methode eines Komplements von Unabschließbarkeit und Gewissheit sowie dem Hinweis auf ein Lebensgefühl im Zusammenfallen von Teilnahme und Verantwortung, erweist sich das Denken Kafkas in seinen grundlegenden anthropologischen Motiven als Hindeutung auf die Möglichkeit eines Weltethos.
Zur Darstellung in diesem Buch bedarf es einer erläuternden Sprache. Wie aber Friedrich Hölderlin die Existenz als »excentrische Bahn«, als Bogen und Rückkehr zu einer gleichsam ›vermittelten Unmittelbarkeit‹ beschreibt, so mag auch der Leser wieder zu einem unmittelbaren, möglicherweise aber tieferen Erlebnis der Prosa Kafkas zurückkehren.
Richtiges Auffassen einer Sache und Missverstehen der gleichen Sache schließen einander nicht vollständig aus. 1
Humor als Moment von Unabschließbarkeit im Denken war Kafka aus Überlieferungen vertraut. Beim talmudischen Dialog, zu dessen Übung er sich mit dem Schulfreund Hugo Bergmann verabredete, handelt es sich, wie auch beim sokratischen Gespräch, um Verabredungen zum gemeinsamen Denken »ohne Geländer«, zum »Sprachspiel« mit offenem Ende. Alle denkbaren Perspektiven gilt es, meist ausgehend von einem Motiv der Überlieferung, aufzufinden und bis zur Erschöpfung aller denkbaren Sichtweisen abzuwägen. Perspektiven werden probeweise eingenommen, durchgespielt und variiert, auf den Kopf gestellt, ins Paradoxe, Aberwitzige, Groteske gekehrt. Eine bewusste Übung im ›wilden Denken‹. Die Aporie, das Aufsuchen des Zweifelhaften, die immer noch mögliche, letzte Wendung ins Offene ist charakteristisch für die Musikalität dieser jüdisch-hellenischen Überlieferung. »Sich für eine Sache tausend Augen einsetzen«, heißt es bei Nietzsche. Kafka, der, im Gegensatz zu seinem Freund Max Brod, Nietzsche schätzte, notierte in Zürau: Der Geist wird erst frei, wenn er aufhört Halt zu sein.2
Halt auf allen Seiten haben …3, schien für Kafka jedoch ebenso von vitalem Interesse zu sein, im zügelloseste[n] Individualismus des Glaubens 4 wie auch kommemorativen Formen einer Tradierbarkeit.
Um das Paradox von Unabschließbarkeit und Gewissheit kreist das Denken Kafkas. Wahrheit ist ihm dabei kein unmöglicher Begriff, vom Glauben zu sprechen nicht fremd. Die Entdeckung des Zweifellose[n] in sich, zu dem er gar nicht viel an [sich] verändern, sondern nur die alten, engen Umrisse [seines] Wesens nachziehen musste,5 scheint dabei das Agens einer praktischen Philosophie zu sein, bei der es Kafka letzthin um die nächsten Bedürfnisse des Lebens geht, vor allem in der Frage zur Bildung eines Verantwortungsgefühls, einer ethischen Musikalität.
Im Sinne einer Schulphilosophie ist Kafka nicht als Philosoph in Erscheinung getreten, eine systematische Philosophie nicht zu erwarten. Theorien und Lehrgebäude lagen ihm nicht. In den Bezügen der gleichnishaften Motive aber, im Verweiszusammenhang der Denkbilder in allen Schriftformen und Redeweisen, erscheint sein Denken als beispiellose Form einer poetischen Philosophie. Im Geflecht von korrespondierenden und sich gegenseitig erhellenden Bildern, offenbart sich, verwoben im gesamten Werk, in Briefen, der Kurzprosa, den epischen Texten und ausdrücklicheren Formen wie den Zürauer Schriften, ein Denken, das wohl nur in einem solchermaßen offenen Beziehungsgeflecht seinen Ausdruck, seine ›Entsprechung‹ finden konnte.
In einer Gestalt, wie man sie sich unsystematischer kaum denken kann, erscheint der Zusammenhang doch als Gewebe in gleichsam plastischer Evidenz. Die Form vermag dem komplementären Charakter in dem Paradox von Unabschließbarkeit und Gewissheit zu entsprechen. Wenn von einer Philosophie Kafkas die Rede ist, wird es vor allem um seine Methodik des Humors, der Beweglichkeit im Komplement von Unabschließbarkeit und Gewissheit gehen:
Besondere Methode des Denkens. Gefühlsmäßig durchdrungen. Alles fühlt sich als Gedanke selbst im Unbestimmtesten.6
Die Texte selbst, vor allem aus der Zürauer Zeit, lassen keinen Zweifel darüber, dass Kafka der Zusammenhang und seine Quellen klar vor Augen stand. Auf Transformationen mystischer Überlieferungen fußend, richtet sich sein Denken – besonders auch im Hinweis auf die »erfüllte Zeit« – vor allem auf die Frage einer ethischen Musikalität und Verantwortlichkeit in einem uneingeschränkt bejahenden und weltzugewandten Geschmack.
Bei der Darstellung in diesem Buch werden Stücke einbezogen, die bisher wenig wahrgenommen, wenn nicht gar ausgeblendet und professionell übersehen wurden. Texte, in denen Kafka von dem Einen, Absoluten und Allerheiligsten, vom Zweifellosen sowie vom sündhaften Stand 7, von der christlichen Lehre, von Christus und immer wieder vom Glauben spricht. Es ist wohl allzumenschlich, wenn Betrachter, Motive die ihnen nicht geheuer sind, auszublenden wissen und nicht wahrnehmen, nicht wahrnehmen wollen. Andererseits wäre es unangebracht, Kafka aufgrund weniger, womöglich suchender, tastender Äußerungen, für eine Tendenz zu vereinnahmen. Wenn aber die Motive in ihrer geistigen Atmosphäre, im Geschmack und der Musikalität des Denkens nicht zusammenhanglos erscheinen, sondern sich in der Korrespondenz von Wiederholungen und Varianten als grundlegende Perspektiven erweisen, ist doch geboten, sie einmal herauszuarbeiten und zu erinnern.
Wie etwa sein Hinweis auf einen sündhaften Stand,7 sind es oft Motive, die im »Erwachsenenalter der Menschheit« (Kant), im Zeitalter der ›reinen Vernunft‹ und Säkularisierung, in breitem Einverständnis und nach den Stereotypen der aufgeklärten Moderne als für alle Zeiten überwunden und abgetan gelten. Sie kommen nicht mehr in Frage, ja erregen Affekte der Abwehr und Ärgernis.
Im Sinne des oben erwähnten Gesprächs mit offenem Ausgang aber mag doch zugebilligt werden, diese Motive, wenn auch nur vorübergehend oder als obskure Gehalte, zuzulassen und nicht unbesehen und im gewohnten Affekt von sich zu weisen, zumal sie doch unleugbar von Kafka selbst stammen und nicht vereinzelt, sondern wiederholt und in einem schlüssigen Zusammenhang erscheinen. Denkbar wäre doch, dass gerade diese ›belasteten‹ Motive, auch in der Resonanz, die Kafka in seinem Ausgreifen in die Jahrhunderte, ja in jahrtausendealten Transformationen aufruft, noch einmal in einem unerwarteten, annehmbaren Licht erscheinen. Für die Entdeckung einer Philosophie Kafkas oder die Menschheitsfrage, was es mit dem beispiellosen Werk Kafkas auf sich habe, erscheinen womöglich gerade diese Hinweise, bald nach der ›Zulassung‹, als unverzichtbar.
Auch wenn das Denken Kafkas mit seiner Perspektive auf das Unerklärliche, Züge jahrtausendealter mystischer Traditionen trägt, zielt es doch zuletzt immer auf das Hier und Jetzt, das nächste Leben, auf jeden Augenblick und die Frage, was die Haltung in dieser Perspektive, was ein »Verhältnis zum Verhältnis« mit dem Leben macht. Kafka ist kein Dualist. Das Leben wird nicht der Transzendenz übergeben oder auf ein Jenseits verwiesen. Wie in den Reisebeschreibungen der Hekhalot-Erzählungen der frühen jüdischen Mystik geht es bei der Reise zu dem Unerklärlichen immer vor allem um den Rückweg, den seelischen Niederschlag, die sich einstellende Veränderung der Lebenswelt in der Wahrnehmung des ›Ganz Anderen‹ und zugleich Einen: Ein Denken in einem anderen Licht, gefühlsmäßig durchdrungen, als Erlebnis – im Zusammenfallen von unendlicher Teilhabe und Verantwortung.
Die Entwicklung einer ethischen Musikalität, die sich, anders als Moral und Tugend, in der Unmittelbarkeit des Handelns äußert, ist das Grundanliegen Kafkas bei dem Gehe hinüber 8, dem Hinweis auf das Unfassbare. Der Eros seiner diesseitigen Mystik liegt im Hinweis auf die Eudämonie im Zusammenfallen von unermesslicher Verantwortung und Teilhabe. Es ist Befreiung in die Verantwortung, die Soteriologie eines zügellosesten Individualismus, in welchem die Angst, als Intuition einer ewigen Verantwortung, im Denken und Auf-sich-nehmen, umschlägt – in jedem Augenblick umschlägt, ja eins wird, im Fühlen einer unendlichen, unverbrüchlichen Teilnahme.
Wird dir alle Verantwortung auferlegt, so kannst du den Augenblick benützen und der Verantwortung erliegen wollen, versuche es aber dann merkst Du, dass dir nichts auferlegt wurde, sondern dass du diese Verantwortung selbst bist, 9
Als »philosophischen Glauben« beschreibt auch Karl Jaspers dieses Bild Kafkas einer Eupathie, der Koinzidenz von Teilnahme und Verantwortung:
»Aus der Erfahrung des Nichts, angesichts der Grenzerfahrung erst eigentlich beschwingt, vertraue ich mich, von neuem glaubend, der Weite an im Aufhellen aller Weisen des Umgreifenden, das ich bin und in dem ich mich finde.«
Es ist eine andere sprachliche Form im Vergleich zu den bildhaften Betrachtungen Kafkas, aber ein erster Hinweis auf die Verwandtschaft eines Denkens, das sich, oft auch als unterschwellige ›Geschmacksrichtung des Geistes‹, quer zu den historischen Zuschreibungen als ein »Wärmestrom«10 universaler Menschlichkeit, als Grundmotiv eines »Werde der du bist«11 verfolgen lässt.
Unter dem Eindruck des Bruchs der autoritativen, kanonischen Traditionen und der spürbaren Anbahnung der katastrophischen Kumulation von Gewalt und Zerstörung in den nihilistischen Ersatzformen, zwischen, ja inmitten der Großkatastrophen der Moderne, ruft Kafka alte, monistisch-archetypische Perspektiven auf, denkt sie neu, bereichert und erweitert sie um das Gewicht der Individualität und Pluralität in der Moderne und versteht es, all dies im lebendigen Zusammenhang verschiedener Schriftformen, im Wechsel von Prosa, reflexiven und gleichnishaften Texten in eine in dieser ›Dichtung‹ nie dagewesenen Form einer poetischen Philosophie zu bringen.
Die »moralische Zartheit«, die Robert Musil (zu seiner Zeit als Mitarbeiter des Rowohlt Verlags) bereits aus den wenigen, ersten Veröffentlichungen Kafkas heraus zuhören vermochte, deutet auf den wesentlichen Beweggrund Kafkas in der Frage nach der Möglichkeit einer radikal-individuellen aber ebenso tradierbaren Entwicklung einer Verantwortlichkeit und ethischen Musikalität in der Moderne.
Ist die Tatsache der Religionen ein Beweis für die Unmöglichkeit des Einzelnen dauernd gut zu sein ? 12
Es kann nicht darum gehen den zahlreichen Vereinnahmungen Kafkas in der nun schon beinahe einhundertjährigen Rezeptionsgeschichte eine weitere hinzuzufügen, indem Äußerungen nach einer Tendenz gewählt und sortiert werden, um lediglich die eigene Vorstellung oder vielmehr Gemütslage nachzugestalten. Gerade bei höchst widersprüchlichen Autoren oder ›freien Geistern‹, wie z.B. Friedrich Nietzsche, bei denen, wie Karl Jaspers hervorhebt, zu beinahe jeder Aussage eine kontrastierende Perspektive aufzufinden sei – oder besser: Bei Autorinnen und Autoren, deren Arbeit erst aus dem Wechsel von Perspektiven erwächst – ist es leicht möglich, das Material so zu wählen dass ein längst vorgesehenes Bild oder der »durchgesiebte Herzenswunsch« (Nietzsche) der Deuterin oder des Erklärers in Kohärenz erscheint.
Aus der Kritik der Lesarten hat sich allerdings inzwischen selbst eine Lesart entwickelt. Entsprechend dem Vergleich von Kafka-Deutungen mit einem Rorschach-Test, wonach die Interpretationen mehr über die Deuter aussagen als über das zu Deutende, hat sich inzwischen die Auffassung der grundsätzlichen Unausdeutbarkeit Kafkas als ein akademischer ›common sense‹ durchgesetzt: Dass die umfassende Aporie, die wesentliche Rätselhaftigkeit das Werk Kafkas ausmache, ist, auch als Hinweis auf eine menschliche Ausweglosigkeit, zur beherrschenden Lesart geworden.
Aber käme es – auch in Betracht der Ausblendung vieler Aussagen Kafkas – nicht einer Fälschung gleich, wenn man es sich versagen wollte, aus dem Zusammenhang in allen Textformen, in behutsam-poetischer Plausibilität, einen Horizont Kafkas hervor zu arbeiten. Was bedeutet es, wenn man nicht aufhörte zu fragen, was es besage, wenn Kafka in einem Brief an Felice Bauer von der inneren Wahrheit 13 spricht, ohne welche die Geschichte (die ihr gewidmete Erzählung Das Urteil) nichts wäre.
»Nichts ist wahr, alles ist erlaubt.« Auch bei Nietzsche steht der öfters wiederholten Formel des unwiderruflichen Bruchs der kohärenten Traditionen, das »Verlangen nach Gewissheit als [der] innerste[n] Begierde«14 gegenüber. Ähnlich bei Wittgenstein. Und wie bei Nietzsche steht für Kafka das »inmitten der ganzen wundervollen Ungewissheit und Vieldeutigkeit … trotz aller Rücksichten Wahre«15 – stets im Verhältnis zu einer ethischen Musikalität.
Zürau
Zürau. Ein böhmisches Dorf, das heutige Siřem, etwa siebzig Kilometer südwestlich von Prag gelegen. Acht Monate, vom September 1917 bis April 1918, lebte Kafka hier auf einem kleinen Gutshof, den seine Schwester Ottilie etwa eineinhalb Jahre bewirtschaftete. Gegen den Widerstand des Vaters hatte Ottla den Hof von ihrem Schwager Karl Hermann gepachtet. Hermann Kafka, der wohl berühmteste Vater der Literaturgeschichte, kam aus armen, ländlichen Verhältnissen und hatte sich, gemeinsam mit seiner Frau July Löwy, einen mittleren Wohlstand erarbeitet. Dass seine Tochter diesen Weg nun gleichsam wieder zurück gehen wollte, war ihm ganz unverständlich. Franz aber hatte, in der für den Vater berüchtigten Komplizenschaft, seine Schwester in dem Vorhaben unterstützt.
Von der beste[n] Zeit [seines] Lebens 1 sprach Kafka etwa zwei Jahre nach dem Aufenthalt über die acht Monate in Zürau. Dabei lebte er dort in der ersten Zeit des Wissens um seine lebensbedrohliche Krankheit. Im Sommer 1917, Anfang August, wenige Wochen vor der Reise nach Zürau hatte er, nach einem nächtlichen Blutsturz und der Konsultation zweier Ärzte, die Diagnose seiner Lungen-Tuberkulose erhalten. Zum Erstaunen der Freunde in Prag zeigte sich Kafka jedoch wenig bestürzt über die Nachricht. Ja, er erschien ermutigt, befreit. Im Schutze der Krankheit 2 waren nun lang ersehnte Veränderungen möglich: Die Beurlaubung vom Brotberuf in der Versicherungsanstalt, eine Beendigung der für beide Seiten quälenden Verbindung mit Felice Bauer und – mit der Möglichkeit des Rückzugs auf den Hof der Schwester – die Gelegenheit, für eine längere Zeit der Enge der elterlichen Wohnung zu entkommen.
Am 15. September reiste Kafka nach Zürau. Max Brod hätte sich eher ein komfortables Sanatorium im südlichen Europa zur Genesung seines Freundes vorgestellt; Kafka aber entschied sich für den ärmlichen Hof der Schwester im winterlichen, böhmischen Dorf. Er bezog ein kleines, ebenerdiges Zimmer, in das kaum Licht fiel und in dem Mäuse hausten. Für die Aufgabe, die ihm mit dem Ausbruch der agonalen Erkrankung deutlicher denn je vor Augen stand, schien ihm die Gesellschaft der Schwester und der Bauern des Dorfes, Wirkliche[n] Erdenbürger[n]…3 wie er notierte, förderlicher, als die Umgebung eines mondänen Sanatoriums. Am 28. September, etwa zwei Wochen nach der Ankunft in Zürau, notiert er im Tagebuch:
Dem Tod also werde ich mich anvertrauen. Rest eines Glaubens. Rückkehr zum Vater. Großer Versöhnungstag.4
Kafkas Beschäftigung mit dem Tod in dieser Zürauer Zeit mag zunächst von der nähergerückten Wahrnehmung im Wissen um die lebensbedrohliche Krankheit zeugen. Was aber nun besonders zum Ausdruck kam, war je schon ein Leitmotiv: Die stets präsente Intuition vom Tod als Signatur der Begabung zum Überzeitlichen. Hier erwächst in jedem Augenblick das Aufgabe-Sein des Menschen (Du bist die Aufgabe) als Herausforderung in seiner transzendenten Begabung, in seiner bereits somatischen Transzendenz. Die Angst ist die »bildende Angst« (Kierkegaard), die Herausforderung zur Versöhnung, ja zur Überwindung des Todes in der Erfahrung des Augenblicks unverbrüchlicher, ewiger Teilnahme und zugleich zur intrinsischen Verantwortlichkeit, einer anarchischen Gefühls-Moral und ethischen Sensibilität.
Die Menschheitsentwicklung – ein Wachsen der Sterbenskraft.5
Eine andere Gewichtung in Kafkas Arbeit deutet sich an. Wenige Tage vor dem Eintrag vom 28. September, ebenfalls schon in Zürau, schrieb er:
Zeitweilige Befriedigung kann ich von Arbeiten wie »Landarzt« noch haben, vorausgesetzt dass mir etwas derartiges noch gelingt (sehr unwahrscheinlich) Glück aber nur, falls ich die Welt ins Reine, Wahre, Unveränderliche heben kann.6
Die ungeheure Welt die ich im Kopfe habe. Aber wie mich befreien und sie befreien ohne zu zerreißen. Und tausendmal lieber zerreißen, als sie in mir zurückhalten und begraben. Dazu bin ja hier, das ist mir ganz klar.7 Seiner Aufgabe war Kafka sich, verstärkt seit dem Schreiberlebnis in der Nacht vom 22. September 1912, der nächtlichen Niederschrift der Erzählung Das Urteil schon länger bewusst. Nun aber schien die Zeit gekommen, das Entscheidende, den Horizont seiner Arbeit hervorzuarbeiten. Es galt für ihn jetzt mehr denn je, sich über die letzten Fragen seiner Arbeit zu vergewissern und der Prosa in besonderer Form zur Seite zu stellen. Am 10. November notierte er im Tagebuch:
Das Entscheidende habe ich bisher nicht eingeschrieben, ich fließe noch in zwei Armen. Die wartende Arbeit ist ungeheuerlich.8
Es war der vorletzte Eintrag, bevor Kafka sein Tagebuch für beinahe zwei Jahre zu Seite legen sollte. Auch der Niederschrift von Prosa enthielt er sich in der Zürauer Zeit. Im Schutze der Krankheit 9 und einem gnadenweise(n) Überschuss der Kräfte 10 schien er sich ganz dieser Aufgabe widmen zu wollen. Was bisher in zwei Armen 11 verlief, die reflexive Beschäftigung im philosophischen und religionshistorischen Interesse einerseits und der implizite Ausdruck in der Prosa andererseits, wollte er nun in einer expliziten Form zusammenführen. »Was ich zu tun habe, kann ich nur allein tun, Über die letzten Dinge klar werden«, sagte er zu Max Brod, bei dessen Besuch in Zürau am 26. Dezember 1917.«
Das ungeheuerliche der wartenden Arbeit 12 lag, neben der Vergewisserung auch darin, einen adäquaten Ausdruck zu finden. Ein ›klassischer‹, theoretischer Duktus oder gar eine systematische Philosophie lagen Kafka nicht und hätten der Musikalität und dem Humor des Kafka´schen Denkens nicht entsprochen. Es zeigte sich aber bald, dass Kafka in der Form der Zürauer Betrachtungen an bildhaft-reflexive Eintragungen in den Tagebüchern sowie gleichnishafte Wendungen in der Prosa anknüpfen konnte.
Schon als Schüler beschäftigte sich Kafka mit philosophischen und religionshistorischen Fragen. Durch Emil Gschwind, den Ordinarius der Gymnasialzeit, über dessen lange nachklingende Anregungen im Unterricht Kafka seiner Verlobten Felice Bauer berichtet, durch Verabredungen zur gemeinsamen Lektüre mit den Freunden, die Teilnahme am philosophischen Salon Berta Fantas und die Mitarbeit an den Schriften seines Freundes Felix Weltsch, war Kafka mit philosophischen Fragen vertraut. Seine besondere Neigung galt dabei einer poetischen Philosophie. Die platonischen Dialoge, Texte Kierkegaards und Nietzsches, auch Meister Eckhart und Eberhard Fechner, Fundstücke aus der jüdisch-christlichen Gnosis, die Philosophie der russischen Erzähler Tolstoi und Dostojewski, lagen ihm näher als eine Systemphilosophie, etwa im Stil des deutschen Idealismus. Auch die erwähnten Übungen im talmudischen Gespräch und die gemeinsame Lektüre der platonischen Dialoge mit Max Brod zeugen von der Neigung Kafkas zu Überlieferungen einer poetisch-aporetischen und dialogischen Philosophie.
Dass Kafka bei seiner Vergewisserung die Form eines, wie er einmal nach einer Dostojewski-Lektüre im Tagebuch notierte, gefühlsmässig durchdrungen[en] Denken[s] 13 suchte, mag also kaum verwundern. Die Zürauer Texte entstehen in einer bildstarken, mitunter verrätselten Form, unsystematisch notiert, in denkbar kürzesten Sentenzen. Der gleichnishafte Charakter und die verstreute, fragmentarische Form scheinen eher dazu gemacht, das Rätselhafte hervorzuheben und sich gegen Erklärungen zu verwahren. Eingetragen in zwei Notizhefte, die Kafka zu Beginn des Aufenthalts in Zürau neu anlegte, den später so genannten Oktavheften G und H, verstreut zwischen Beobachtungen und tagebuchartigen Notizen, lassen die Betrachtungen einen Zusammenhang oder das Bild einer kohärenten Philosophie kaum erkennen. Auch bei der Auswahl und eigenhändigen Edition Kafkas etwa zwei Jahre nach Zürau – er redigierte und übertrug 109 Stücke der Zürauer Hefte handschriftlich auf einzelne, durchnummerierte Blätter – verbleibt der Eindruck des aphoristischen Charakters. So ist es kaum verwunderlich, dass die Zürauer Schriften von nahezu allen Kommentatoren in ihrer geheimen Bedeutsamkeit wohl gewürdigt, ein innerer Zusammenhang ihnen jedoch weitgehend abgesprochen wurde. Auch mit der späteren Bezeichnung der Kafka´schen Auswahl als ›Aphorismen‹ wird ein Zusammenhang des Denkens oder gar eine Philosophie Kafkas eher verneint.
Musikalität des Zweifellosen
Kafka allerdings war mit dem Ergebnis offensichtlich zufrieden, ja glücklich. Er hatte etwas erfahren, das weit über die thematische Vergewisserung hinausging. Etwa zwei Jahre nach Zürau schreibt er in einem Brief an Milena Jesenská in Form einer Selbstansprache:
Und darum sagen meine 38 jüdischen angesichts Ihrer 24 christlichen Jahre: (…) »Denke auch daran, dass vielleicht die beste Zeit deines Lebens, von der du eigentlich noch zu niemandem richtig gesprochen hast, vor etwa 2 Jahren jene 8 Monate auf einem Dorf gewesen sind, wo du (…) Dich nur auf das Zweifellose in Dir beschränktest, (…) und dabei gar nicht viel an dir verändern sondern nur die alten engen Umrisse Deines Wesens fester nachziehn mußtest (…) « 1
So liegt Kafkas Zufriedenheit über die Zürauer Zeit wohl in der Erfahrung des Zugangs zum Eigensten als der alles bestimmenden Resonanz. Die Erfahrung des Zweifellosen als der persönliche Grund, als Kern der gesamten Arbeit und des philosophischen Zusammenhangs erscheint ihm bewusster denn je.
»Die Intelligenz muss nichts finden, sie muss den Weg freiräumen«, schrieb Simone Weil. Und Kafka ergänzt: Jedenfalls muss man sich nun zu diesem seinem eigenen Grund-Ja erst durcharbeiten …2
Das Gewicht der persönlichen Vergewisserung über das letztlich alles bestimmende Selbstgefühl ist tragend für die ganz andere philosophische Form Kafkas. Was in einer Philosophie der ›reinen Vernunft‹ keinen Platz hat, sie jedoch stets, so Nietzsche, als »durchgesiebter Herzenswunsch« prägt: die Gestimmtheit, das seelische Grundklima, die Herzensbildung, die geistige Atmosphäre eines Menschen, sein Grundgefühl und Humor, seine Musikalität – erscheint bei Kafka als der eigentliche Quellgrund des Denkens und das Unhintergehbare des Einzelnen in jedem Augenblick der »erfüllten Zeit«
Philosophie erscheint hier nicht als ein autochthones Gebilde der Vernunft und vom persönlichen unabhängiges System oder Gedankengebäude, sondern als gefühlsmässig durchdrungen,3 als ein komplementäres Wechselspiel von Denken und Fühlen. In Kafkas diatribischer Form einer Philosophie spiegelt sich seine ausdrückliche Methodik wieder. Im stets offenen Komplement von Allgemeinem und zügelloseste[m] Individualismus 4 erscheint die Möglichkeit einer neuen Überlieferung, einer offenen Form von Tradierbarkeit:
Diese ganze Litteratur ist Ansturm gegen die Grenze und sie hätte sich, wenn nicht der Zionismus dazwischen gekommen wäre, leicht zu einer neuen Geheimlehre, einer Kabbala entwickeln können. Ansätze dazu bestehen. Allerdings ein wie unbegreifliches Genie wird hier verlangt, das neu seine Wurzeln in die alten Jahrhunderte treibt oder die alten Jahrhunderte neu erschafft und mit dem allen sich nicht ausgibt, sondern jetzt erst sich auszugeben beginnt.5
Bis auf die schon erwähnte eigenhändige Edition im Jahr 1919 unternahm Kafka keine weiteren Schritte zur Vermittlung der Zürauer Betrachtungen, sei es durch eine Kommentierung, Zuordnung oder Sortierung der verstreuten Motive.
Möglich dass er, wie Robert Musil schrieb, »schließlich mit indianischer Eitelkeit zu tragen vermochte, dass vieles ihm nicht zu sagen gelingt und mit ihm zugrunde gehen wird«. Wahrscheinlicher aber ist, dass Kafka, im Glück der Vergewisserung über das Zweifellose 6 , als den Grund seiner Arbeit und Persönlichkeit, sowie im Zuge der Bewältigung der wartenden Arbeit 7, des Gelingens in der Form, dem adäquaten Ausdruck, fortan in dem Vertrauen lebte, dass diese Arbeit in der Welt war und wirksam ist; und dass er sich, in diesem Gefühl, um eine weitere Vermittlung nicht mehr bemühte.
Schon bei einer einfachen Sortierung der Texte aus Zürau, aus Briefen, Tagebuch und Prosa aber, offenbart sich in den gegenseitigen Verweisen, Varianten und Wiederholungen, der Zusammenhang eines Denkens. Schon in einer ersten Zuordnung vermögen die Texte für sich zu sprechen. Neben der philosophischen Perspektive selbst, zeigt sich, dass Kafka sich über den Zusammenhang dieses Denkens durchaus bewusst gewesen sein muss.
Eine poetische Philosophie Kafkas
Grenze und Küste. Die Begabung.
Die Begabung des Menschen in seinem Verhältnis zum Unfassbaren ist ein anthropologisches Grundmotiv Kafkas.
Diese ganze Litteratur ist Ansturm gegen die Grenze …1
Die Grenze ist wohl eine Grenze der Erkenntnis, nicht aber des Erkennens. Gerade im Verhältnis und in der Hinwendung zum Unerklärlichen liegt essenzielle Erfahrung:
An der Küste ist die Brandung am stärksten, so eng ist ihr Gebiet und so unüberwindlich.2
Im Komplement von Unfassbarkeit und Erfahrung, Unabschließbarkeit und Gewissheit eröffnet sich – im Bild der Küste – ein Übergangsraum und Wechselspiel:
Die Sage versucht das Unerklärliche zu erklären; da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden.3
Im Paradox von Hinwendung und Loslassen liegt ein musisches Erkennen als Vertrauenserfahrung.
Dieses Gefühl: »Hier ankere ich nicht« und gleich die wogende, tragende Flut um sich fühlen.4
Kafka spricht ausdrücklich von einer Methodik in der gegenseitigen Durchdringung von Unfassbarkeit und Erfahrung, im Komplement von Zweifellosigkeit und Unabschließbarkeit des Denkens.
Alle Wissenschaft ist Methodik im Hinblick auf das Absolute. Deshalb ist keine Angst vor dem eindeutig Methodischen nötig. Es ist Hülse, aber nicht mehr, als alles außer dem Einen.5
Als Medium in diesem polaren Umgang erscheint die Form einer Musikalität des Denkens.
Besondere Methode des Denkens. Gefühlsmäßig durchdrungen. Alles fühlt sich als Gedanke selbst im Unbestimmtesten.6
Das Nichtwissen im Verhältnis zum Unfassbaren ist nicht lediglich ein Noch-nicht-wissen. Es ist ein von Natur aus ewiges Geheimnis:
Es gibt Fragen über die wir nicht hinwegkommen könnten, wenn wir nicht von Natur aus von ihnen befreit wären.7
Ein Lebensgefühl des Alles-Erfassen-Könnens deutet Kafka als ein eigentliches Unvertrauen, die geistige Atmosphäre einer Feststellbarkeit als eigentliche Depravation. Es wäre ja der Verlust der Glaubens- und Freiheitsmöglichkeit im Erlebnis des Unfassbaren. Es ist, wie Walter Benjamin schreibt, der Verlust des Geheimnisses: »Wahrheit ist nicht Enthüllung die das Geheimnis vernichtet, sondern Offenbarung die ihm gerecht wird.«
Im Bild des Tatsachenmenschen – in den Prosatexten in der Figur des Rechners – erscheint dagegen bei Kafka eine ratioide, dogmatisierende Kultur, im Abbrechen des Methodischen 8.
Er läuft den Tatsachen nach wie ein Anfänger im Schlittschuhlaufen, der überdies irgendwo übt, wo es verboten ist.9
Alle menschlichen Fehler sind Ungeduld, ein vorzeitiges Abbrechen des Methodischen, ein scheinbares Einpfählen der scheinbaren Sache.10
Der Geist sei die Spielfläche oder »Tanzfläche« (Kierkegaard) nicht aber Sphäre eines Halts.
Der Geist wird erst frei, wenn er aufhört Halt zu sein.
Halt … haben aber, ist für ihn andererseits essenziell.
(…) Halt auf allen Seiten haben. Gott haben.12
Nur in einem Halt als Erlebnis eines Glaubens, im Komplement von Unabschließbarkeit des Denkens und dem Geheimnis einer Zweifellosigkeit scheint das offene, ›haltlose‹ Spiel des Geistes, scheint Humor erst möglich. Kafka betont die Fülle der Erfahrung stets in einem Atem mit dem Hinweis auf die Unabschließbarkeit. Im folgenden Stück ergänzt um die Entschiedenheit, den entschiedene[n] Bedacht auf die Unabschließbarkeit in dieser Konstellation und Methode.
Die Kunst fliegt um die Wahrheit, aber mit der entschiedenen Absicht sich nicht zu verbrennen. Ihre Fähigkeit besteht darin in der dunklen Leere einen Ort zu finden, wo der Strahl des Lichts, ohne dass dies vorher zu erkennen gewesen wäre, kräftig aufgefangen werden kann. 13
In dialektischer Zuspitzung, einem Vexierbild von enthusiastischer Erfahrung und Unbeholfenheit, spielt Kafka mit dem Verhältnis von Erfahrung und Übertragung.
Die Kunst ist ein von der Wahrheit Geblendetsein: Das Licht auf dem zurückweichenden Fratzengesicht ist wahr, sonst nichts. 14
Mit dem unbedingt Einzelnen erfüllt sich, im immer wieder offenen Augenblick, die Unabschließbarkeit des Denkens. In einem Brief an Felice Bauer schreibt er zu der ihr gewidmeten Erzählung Das Urteil:
Aber du kennst ja noch gar nicht deine kleine Geschichte. Sie ist ein wenig wild und sinnlos und hätte sie nicht innere Wahrheit (was sich niemals allgemein feststellen lässt, sondern immer wieder von jedem Leser oder Hörer von neuem zugegeben oder geleugnet werden muss) sie wäre nichts. 15
Zunächst erscheint hier wieder die Methode, das Komplement: die Erzählung ist einerseits wild, sinnlos und unausdeutbar, andererseits aber hat sie eine innere Wahrheit, ohne die sie nichts wäre. Sie kann nicht festgestellt werden und ist immer von neuem auf die Ahnungsweise jedes Einzelnen in jedem Augenblick angewiesen.
Somatische Transzendenz. Soma und Glauben
Nun weist Kafka aber darauf hin, dass die Wahrheit in diesem Verhältnis nicht nur erfahren oder nicht erfahren werden könne, sondern zugegeben oder geleugnet werden muss.
Es ist demnach nicht nur ein Erfahrungs- sondern ein Kräfteverhältnis; eine unverbrüchlich wirkende Kraft im gegebenen Verhältnis wie auch mittels der Hinwendung zum Verhältnis. Der Mensch steht als eine »Synthese von Unendlichkeit und Endlichkeit, Zeitlichem und Ewigen, Freiheit und Notwendigkeit« (Kierkegaard) immerzu in diesem Verhältnis, dieser Wirksamkeit, einer theurgisch-somatischen Wirksamkeit. Sein Dasein ist dies Verhältnis, ob wir es hier wissen oder nicht – und sein Verhältnis zu diesem Verhältnis. Immerwährend, als Tatsache des Lebens ist diese Kraft als Glauben wirksam:
Dass es uns an Glauben fehle, kann man nicht sagen. Allein die einfache Tatsache unseres Lebens ist in ihrem Glaubenswert gar nicht auszuschöpfen.Hier wäre ein Glaubenswert? Man kann doch nicht nicht-leben.Eben in diesem »kann doch nicht« steckt die wahnsinnige Kraft des Glaubens, in dieser Verneinung bekommt sie Gestalt. 16