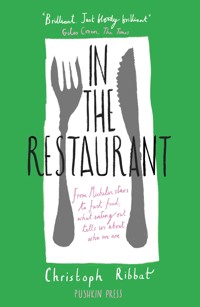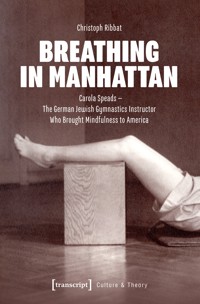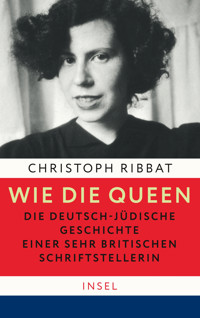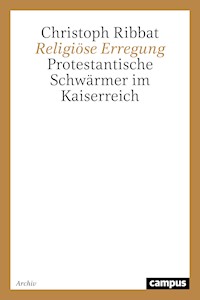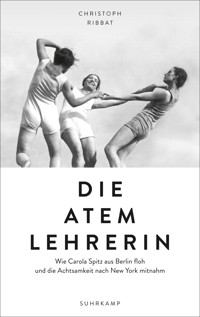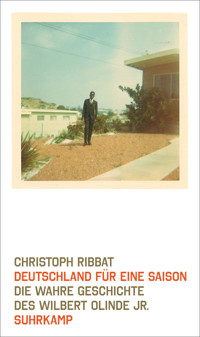11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit im Paris des 18. Jahrhunderts die ersten »restaurierenden« Etablissements eröffneten, geht es im Lokal immer auch ums Sehen und Gesehen-Werden, um das Zeigen von Stil und Distinktion – und um das Gefühl, bei Fremden und doch zu Hause zu sein. Die ungeduldigen Gäste halten das Personal mit ihren Extrawünschen auf Trab. Doch es sind die Kellnerinnen, Ober und Köche, die das Geschehen insgeheim kontrollieren und den Herrschaften bisweilen buchstäblich in die Suppe spucken. In der Küche, an der Theke, bei Tisch kollidieren Genuss und Schwerstarbeit, Eleganz und Ausbeutung, kulturelle Diversität und Rassismus. Ob edel oder schmuddelig: Restaurants sind ein Spiegel der Gesellschaft.
Christoph Ribbat montiert die packenden gastronomischen Erfahrungen von Küchenarbeitern und Kochgenies, Kellnerinnen und Philosophen, Feinschmeckern und Soziologinnen. Er blickt hinter die Kulissen und spannt dabei den Bogen von den ersten Pariser Gourmettempeln über den Aufstieg des Fast Food bis zu den innovativsten Köchen unserer Zeit. Doch er präsentiert nicht nur eine kosmopolitische Geschichte des Restaurants, sondern auch ein temporeiches Erzählexperiment zwischen Kulturwissenschaft und Doku-Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Im Restaurant wird nie nur gegessen. Seit im Paris des 18. Jahrhunderts die ersten »restaurierenden« Etablissements eröffneten, geht es im Lokal immer auch ums Sehen und Gesehen-Werden, um das Zeigen von Stil und Distinktion – und um das Gefühl, bei Fremden und doch zu Hause zu sein. Die ungeduldigen Gäste halten das Personal mit ihren Extrawünschen auf Trab. Doch es sind die Kellnerinnen, Ober und Köche, die das Geschehen insgeheim kontrollieren und den Herrschaften bisweilen buchstäblich in die Suppe spucken. In der Küche, an der Theke, bei Tisch kollidieren Genuss und Schwerst-arbeit, Eleganz und Ausbeutung, kulturelle Diversität und Rassismus. Ob edel oder schmuddelig: Restaurants sind ein Spiegel der Gesellschaft.
Christoph Ribbat montiert die packenden gastronomischen Erfahrungen von Küchenarbeitern und Kochgenies, Kellnerinnen und Philosophen, Feinschmeckern und Soziologinnen. Er blickt hinter die Kulissen: in den ersten Pariser Gourmettempeln, an Fast-Food-Theken und bei den innovativsten Köchen unserer Zeit.
Christoph Ribbat
Im Restaurant
Eine Geschichte aus dem Bauch der Moderne
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2016.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: ErlerSkibbeTönsmann / Johannes Erler
Kalligrafie: freiesgrafikdesign
Inhalt
1. Öffnungszeiten
2. Nachkriegshunger
3. In die Gegenwart
1.Öffnungszeiten
Durch Chicago, durch die Massen, läuft Frances. Sie sucht einen Job als Kellnerin. In ihren Ohren quietschen die Straßenbahnen, gellt die Trillerpfeife eines Polizisten, donnert die Hochbahn. Siebenunddreißig ist sie und eigentlich Lehrerin. In einer Dorfschule mit nur einem Raum hat sie angefangen. Das war in der Nähe von St. Clair in Michigan, draußen an der kanadischen Grenze. Sie hat in einem Vorort von Detroit gelebt, in einem Vorort von Chicago, dann in Great Falls, Montana, für seine Wasserfälle bekannt. Sie hat William geheiratet und mit dem Unterrichten aufgehört. Dann brach die Wirtschaft in Great Falls zusammen. Sie zogen nach Chicago zurück. Und William wurde unheilbar krank. In ihrem abgetragenen schwarzen Kleid kämpft sich Frances durch die Menge in die dunkle, schmale Van Buren Street. In der Chicago Daily News hat sie eine Stellenanzeige gesehen. Jetzt steht sie vor dem Restaurant. Durch die Scheiben betrachtet sie die hellen, gedeckten Tische, gemächlich essende Damen und Herren, weiß beschürzte Mädchen mit Tellern in den Händen. Frances schwankt. Soll sie hinein oder nicht? Ihr Herz schlägt so schnell, schreibt sie später, dass sie fast nicht atmen kann. Dann aber tritt sie ein und fragt den Mann hinter dem Zigarrentresen, ob sie hier eine Kellnerin bräuchten. Ja, sagt der. Brauchten sie. Aber gestern hätten sie eine eingestellt. In Ordnung, sagt Frances. Sie flieht zurück auf die Straße, in den Lärm des Jahres 1917.1
*
Die Hauptstadt ist für ihre Restaurants berühmt. Fisch und Meeresfrüchte sind hier exzellent, ebenso Rindfleisch, Geflügel und Nudeln. Das Angebot ist vielfältig, weil die Lokale nicht nur alteingesessene Stadtbewohner zufriedenstellen wollen, sondern auch die Kriegsflüchtlinge, die hier seit einiger Zeit zu Hause sind. Ihre Traditionen und Speisevorschriften – etwa die der Muslime – bereichern die Diversität der Küche. Die süße Sojasuppe am Markt ist zu empfehlen. Sehr gut sind auch die Fischsuppe und der Reis mit Hammel bei Mutter Song. In Asche gegartes Schwein gibt es vor dem Palast der Langlebigkeit und des Mitgefühls. Das gekochte Fleisch bei Wei-das-große-Messer an der Katzenbrücke ist hervorragend, und die Honigkrapfen bei Zhou-Nummer Fünf am fünfbogigen Pavillon ganz vorzüglich. Das berichtet ein Feinschmecker. Er schreibt im Jahr 1275 über die beeindruckende gastronomische Szene in Hangzhou, der chinesischen Hauptstadt während der Song-Dynastie.2
*
Die Geschichte des europäischen Restaurants beginnt damit, dass Menschen keinen Hunger haben. Oder so tun, als hätten sie keinen. In Paris mit seinen Unterernährten entspricht es um 1760 nicht dem elitären Zeitgeist, sich in einer Taverne, einem Gasthof, den Bauch vollzuschlagen. Wer etwas auf sich hält, ist sensibel. Er verträgt nicht viel, isst also kaum, nimmt sich dafür aber sehr viel Zeit. Die vornehme Kundschaft wird von luxuriös möblierten Gaststätten neuen Typs angelockt. An ihren Wänden hängen große Spiegel, in denen man sich und andere bewundern kann. In dekorativen Porzellanschälchen dampfen die »restaurativen« Bouillons, die den neuen Lokalen ihren Namen geben. Die Brühen auf der Basis von Geflügel, Wild oder Kalb sollen denen ihre Kraft zurückgeben, die für andere Nahrung zu empfindsam sind.
Aber nicht die Bouillons machen den Erfolg des Restaurants aus, sondern die Konzentration auf das Individuum und seine Wünsche. Anders als in einer Taverne müssen Kunden hier nicht mit allen möglichen Unbekannten an einer langen Tafel sitzen. Sie bekommen ihren eigenen Tisch. Sie können sich aussuchen, zu welcher Uhrzeit sie bedient werden. Von einer Speisekarte wählen sie aus. Nach der Revolution kommen die Abgeordneten der Nationalversammlung aus allen Provinzen nach Paris. In Restaurants gehen sie gemeinsam essen. Die Pariser tun es ihnen nach. Und bald eröffnen Lokale, die ebenfalls den neuen modischen Namen führen, aber günstiger sind und weniger nobel als die Prototypen. In der revolutionären Ära beginnt sich das Zunftwesen zu lockern. Gastronomen haben mehr Freiheiten, ihren Gästen differenzierte Wünsche zu erfüllen. Und von Anfang an hat der Service immense Bedeutung für den Erfolg des Restaurants. Zumindest gilt das für den Aufklärer Diderot. Im Jahre 1767 preist dieser nach einem Lokalbesuch die Bouillon und das Eiswasser und die wunderschöne .
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!