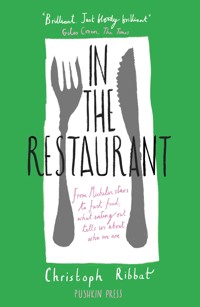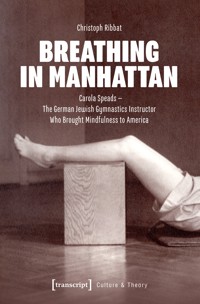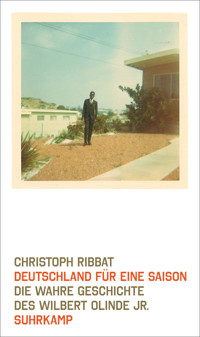Wie die Queen. Die deutsch-jüdische Geschichte einer sehr britischen Schriftstellerin E-Book
Christoph Ribbat
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ilse Groß ist vierzehn, als sie aus Deutschland flieht. Ihre Familie bleibt zurück. In Großbritannien findet sie eine Anstellung als Dienstmädchen. Und sieben Jahre nach Kriegsende erlebt sie ihren Durchbruch als englischsprachige Schriftstellerin. Ihr Pseudonym: Kathrine Talbot.
Wie die Queen erzählt die wahre Geschichte einer fast perfekten Assimilation – von Ilses Rettung ins Vereinigte Königreich und ihrer Deportation in ein Lager für „feindliche Ausländer“, von ihrem Hunger und ihrer Freiheit und ihrem flüchtigen Erfolg auf dem Buchmarkt der Fünfzigerjahre. Es geht um Anerkennung, Fehlschläge, Freundschaft und Kreativität. Und es geht darum, wie eine Emigrantin beginnt, ihrem Staatsoberhaupt verblüffend ähnlich zu sehen.
Ein Buch für alle, die England lieben, und für alle, die es seltsam finden. Tief in den britischen Alltag taucht die Reportage ein. Sie führt von London auf die Isle of Man, von Cornwall nach New York und zurück auf einen Hügel in Sussex. Im Zentrum aber steht eine deutsch-jüdische Familiengeschichte. Ein Leben lang kämpft Kathrine Talbot damit, ihre Erinnerungen in Literatur zu verwandeln. Als es ihr endlich gelingt, ist es fast schon zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Christoph Ribbat
Wie die Queen
Die deutsch-jüdische Geschichte einer sehr britischen Schriftstellerin
Mit zahlreichen Abbildungen
Insel Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Umschlagabbildung und alle Innenabbildungen mit Ausnahme der Abbildung in Kapitel 3 (Registrierungskarte): © Tom Barker, Clun (UK)
eISBN 978-3-458-77332-0
www.suhrkamp.de
Wie die Queen
Dies ist die Lebensgeschichte der Autorin Kathrine Talbot. Der Biograf stützt sich auf ihre Briefe, Tagebücher und autobiografischen Texte, auf Interviews mit Zeitzeugen und historische Dokumente. Für jeden Fehler trägt er die Verantwortung. Und ihm ist bewusst, dass diese Schriftstellerin von Biografien nicht viel hielt.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Dies ist die Lebensgeschichte der Autorin Kathrine Talbot.
Inhalt
1 Steine
2 Englisch
3 Wind
4 London
5 Cornwall
6 New York City
7 Holz
8 Sussex
9 Thomas
10 Die Tür
11 Die Reiseschreibmaschine
Über dieses Buch
Anmerkungen
Informationen zum Buch
1
Steine
Die Haushaltshilfe ist neunzehn Jahre alt. Sie träumt davon, Schriftstellerin zu werden. Sie wird an einem Montag deportiert. Gerade ist sie mit der Wäsche beschäftigt. Es ist ein besonders warmer Tag im Mai. Sie schaut aus dem Fenster und denkt: Draußen, in der Sonne, werden die Sachen schnell trocknen. Eine herausragende Haushaltshilfe ist sie sicher nicht. Aber das immerhin weiß sie.
Es geht in diesem Land ein Gerücht um. Man sagt, Dienstmädchen wie sie seien imstande, Piloten feindlicher Flugzeuge geheime Signale zu übermitteln. An Wäscheleinen in Gärten könnten sie Hosen, Hemden, Laken auf bestimmte Art und Weise aufhängen. Ein Grund, sie in Lager zu sperren.1
Der Polizist, der sie abführen soll, hat seine Frau mitgebracht. Diese sagt, sie müsse eigentlich selbst Wäsche waschen, bei sich zu Hause. Aber sie hilft beim Deportationsvorgang. Die Frau rät ihr, trotz des Wetters auch warme Sachen mitzunehmen. Nur für den Fall. Das klingt nicht gut.
In ihrem Zimmer sucht die Haushaltshilfe nach Kleidung für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ihre Eltern würden in diesem Moment von ihr erwarten, mutig zu sein und ruhig zu bleiben. Die Polizistengattin sieht ihr beim Packen zu. Die Haushaltshilfe faltet zusammen, stapelt, räumt ein, schaut von ihrem Koffer auf und bemerkt: Der Frau stehen Tränen in den Augen.
Zuerst wird die Haushaltshilfe in ein Gefängnis gebracht, in der nächstgrößeren Stadt. Hier kommt sie mit etwa fünfzig anderen Frauen zusammen. Sie alle wurden aus den Dörfern und Kleinstädten der Umgebung deportiert.
Sie selbst hat sich vor eineinhalb Jahren mit falschen Papieren in dieses Land geflüchtet. Eintausend Kilometer südlich von hier hat ein Herr hinter einem Schreibtisch ihr einen Tipp gegeben und ein anderer Herr hat für sie Unterlagen gefälscht. Er hat den Namen einer Schule eingetragen, die sie angeblich besuchen werde. Der Trick hat funktioniert. Auch ihre Eltern haben versucht zu fliehen, auf legalem Wege, und erst sah es gut für sie aus, aber jetzt nicht mehr. Sie hat eine Schwester, der sie noch nie in ihrem Leben begegnet ist. Eine Haarsträhne von ihr hat sie gesehen. Kennenlernen wird sie ihre Schwester nie.
Nach zwei Nächten in Haft geht es weiter zu einem Bahnhof. Mehr Deportierte kommen dazu, Hunderte Frauen jedes Alters, einige mit ihren kleinen Kindern. Sie steigen in einen Zug, der fährt, anhält, langsam weiterfährt, wieder anhält, stehen bleibt, stundenlang. Es ist heiß im Zug. Die Frauen und Kinder haben Durst, haben Hunger, haben Angst. Säuglinge schreien, schlafen und schreien wieder. Die Regierung hat Wissenschaftlerinnen deportieren lassen, Musikerinnen, Bildhauerinnen, Krankenschwestern, viele Dienstmädchen, einige Nonnen, viele Hausfrauen. Eine der Frauen in ihrem Waggon hat sechs Söhne. Alle sechs sind Soldaten und kämpfen für das Land, das jetzt ihre Mutter einsperrt.
Zwölf Jahre später wird die Haushaltshilfe in der Sprache, die sie gerade erst richtig lernt, ihren ersten Roman veröffentlichen. Drei Jahre danach wird der nächste Roman erscheinen und noch einmal vier Jahre nach dem zweiten Roman der dritte. Die internationale Presse wird ihre Werke preisen und nur einige Aspekte bemängeln. Als Schriftstellerin wird sie nicht in der ganzen Welt gelesen werden, aber zumindest auf beiden Seiten eines Ozeans. Als »geborene Romanautorin« wird eine einflussreiche Zeitung sie bezeichnen.
Der Zug setzt sich wieder in Bewegung. Dann kommen die Frauen im Bahnhof einer großen Stadt an. Man führt sie aus dem Gebäude heraus. Dort stehen Busse bereit. Sie steigen ein, die Türen schließen, die Busse fahren los, durch die Stadt. Die Haushaltshilfe schaut aus dem Fenster. Die Leute, die hier am Straßenrand stehen, haben anscheinend auf sie, die Deportierten, gewartet. Sie werfen Steine auf die Busse. Wer keine Steine gefunden hat, aber dennoch etwas werfen will, schleudert Erdklumpen. Die Leute werfen Erde und Steine, weil sie die Frauen, die in den Bussen sitzen, verabscheuen: Frauen wie sie.
Man führt sie in Lagerhäuser am Hafen. Die Gebäude stehen wohl schon länger leer, sind schmutzig und verstaubt. Sechs Toiletten gibt es, für Hunderte von Frauen. Die Klos sind schnell verstopft. Dass die Deportierten menstruieren könnten, hat niemand bedacht.
Niemand sagt ihnen, wie es weitergeht und wohin sie gebracht werden. Im Gefängnis gab es noch Strohmatratzen, hier nur den kahlen Holzboden. Nachts liegt die Haushaltshilfe wach und beobachtet, was in den Lagerhallen vor sich geht. Frauen stehen auf, ziehen durch die Dunkelheit. Sie hört Schreie und Gemurmel.
Sie schwört sich: Eines Tages wird sie über diese Erfahrungen schreiben. Aber es wird ihr schwerfallen, das in die Tat umzusetzen. Von dem, was sie jetzt erlebt, was sie vor der Flucht und auf der Flucht erlebt hat, von dem, was ihre Eltern, ihre Schwester, ihre ehemaligen Nachbarn erleiden werden, wird sie sehr lange Zeit nicht erzählen wollen oder nicht erzählen können. Als es irgendwann doch geht, wird es fast schon zu spät sein.
Damen einer Wohlfahrtsorganisation tauchen auf. Sie haben Teekannen dabei. Der Tee ist gesüßt. Zweimal am Tag gibt es Eintopf, ziemlich dünn, dazu pro Person zwei Scheiben Weißbrot und Margarine. Nach der dritten Nacht werden die Deportierten wieder zu Bussen geführt. Die ganze Welt wird diese Stadt eines Tages lieben, weil sie so fantastische Musiker hervorbringt. Originelle Frisuren werden diese jungen Männer haben. Alles, was du brauchst, ist Liebe, Liebe, werden sie singen. Liebe ist alles, was du brauchst. Die Haushaltshilfe wird der Stadt und ihren Steinewerfern nie verzeihen.
Diese Fahrt dauert nur zwei Minuten. Als der Bus hält, sind sie nach wie vor am Hafen. Die Türen öffnen sich. Mit all den anderen Frauen wird die Haushaltshilfe auf ein Schiff geführt. Hunger hat sie, fühlt sich schmutzig.
Das Schiff legt ab, lässt den Hafen hinter sich. Nach einer Weile klingelt eine Glocke. Was das bedeuten könnte, wissen die Frauen nicht. Also zeigen sie keine Reaktion. Irgendwann kommt einer der Seeleute und weist sie ins Innere. Auf langen Tischen stehen dort Papiertaschen, und jede Frau bekommt eine von ihnen in die Hand gedrückt. Sie öffnen die Tüten und schauen hinein. Als ihnen klar wird, was sich darin befindet, brechen viele der Frauen in Tränen aus.
2
Englisch
Im November 1938 steigt Ilse Eva Groß, siebzehn Jahre alt, in Zürich in ein Flugzeug. Ihr Ziel ist Croydon, Londons internationaler Flughafen. Die Maschine hebt ab und nimmt Kurs auf das Land, das sie achtzehn Monate später deportieren wird, als »enemy alien« der Kategorie »B«.
Aufgewachsen ist Ilse in der Gaustraße in Bingen. Die Nahe mündete in den Rhein, Burg Klopp stand auf dem Kloppberg und der Mäuseturm auf der Mäuseturminsel. Mit Mutter, Vater, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen hat sie ihre Binger Kindheit erlebt. Ohne ihre Schwester. Dennoch war es eine glückliche Zeit, bis zu Ilses Zusammenbruch.
Sie ist die Tochter eines Weinhändlers. Die Binger Firma W. Gross Söhne, gegründet 1835, führten Otto und Ernst Groß, ihre Onkel, und Karl Groß, ihr Vater. Der Name »Groß« wird mal »Groß« und mal »Gross« geschrieben. Sie, Ilse Groß, wird siebenundsechzig Jahre ihres Lebens in Ländern verbringen, die das »ß« nicht kennen.
Ihre Reise hat in Genf begonnen. Eigentlich hätte sie mit dem Zug durch Frankreich fahren sollen. Aber es gibt zu viele Flüchtlinge. Das meint auch die französische Regierung. Zu groß ist die Gefahr, dass sie einfach aus dem Zug aussteigen könnte. Also hat sie für eine Bahnfahrt keine Papiere erhalten. Ihre Eltern, vielleicht auch Freunde ihrer Eltern, haben das Geld aufgebracht, um ihr den Flug zu bezahlen. Sie fliegt zum ersten Mal in ihrem Leben.
Ilses Schwester, Vater und Mutter bleiben, das ist eine Katastrophe, in Deutschland. Die Eltern sind noch nicht emigriert, weil sie Ilses Schwester beschützen wollen. Berichte über die brennenden deutschen Synagogen hat Ilse kurz vor dem Abflug im Radio gehört.
Weil sie die letzten Jahre in Genf verbracht hat, ist Ilses Französisch hervorragend und ihre zweite Fremdsprache halb vergessenes Englisch. Sie hat die Internationale Schule Genf besucht. Einige amerikanische Mitschüler hatte sie und eigentlich hätte sie von ihnen Englisch lernen können. Aber vielleicht war sie zu beeindruckt von diesen Wesen: wie selbstbewusst sie waren und wie gut sie immer aussahen. So lässig, so offen, so hervorragend angezogen. Dieser eine Junge wusste alles über Politik und konnte zusätzlich noch, als wenn das nichts sei, unfassbar gut Klavier spielen. Chopin. Wie oft sie in Genf Chopin gehört hat. Aber sie hat diesen Jungen wie die anderen Amerikaner eher aus der Ferne bewundert.
Einen spezifischen Engländer fand sie ebenfalls eindrucksvoll. Mit der Schule hat sie Sitzungen des Völkerbunds besucht. Dort hat sie Anthony Eden mit eigenen Augen gesehen. Bei ihm handelte es sich um einen wirklich sehr eleganten Außenminister, in den sich gleich mehrere ihrer Mitschülerinnen, möglicherweise auch sie selbst, noch im Sitzungssaal verliebten.
Unter ihr liegt erst der Ärmelkanal, dann England. Und dann kann sie den Tower erkennen und das Terminal. Die Maschine fliegt eine Schleife über dem Süden von London und sie schaut aus dem Fenster und genau jetzt, in diesem Moment, gehen in Croydon die Lichter an.
Jemand hat ihr kurz vor der Abreise gesagt, in England gebe es ein Überangebot von Frauen. Ilse hält sich selbst für nicht sonderlich attraktiv. Also geht sie davon aus, dass sie in diesem Land wohl keinen Mann finden wird.
Aber das ist nicht das, was sie wirklich beschäftigt. Sie denkt an ihre Eltern, die zurückgeblieben sind. Sie ist nur die Vorhut der Familie. Auch die Eltern müssen sich retten und Deutschland verlassen. Vielleicht schaffen sie es nach England, vielleicht direkt in die USA.
Nach der Landung in Croydon geht die Fahrt in einen anderen Londoner Vorort. Ihr Cousin Willy wohnt in einem kleinen roten Haus in einer sehr langen Reihe anderer kleiner roter Häuser. Ilse tritt durch die Vordertür und steht gleich vor der Hintertür.
Willy ist eher ein Onkel als ein Vetter: Er ist gut dreißig Jahre älter als sie. In Heidelberg wohnte er mit Frau und Sohn in einer Villa. Hier in London versperren Heidelberger Möbel den Weg, schwere Eiche, eleganter Ahorn, um die herum es in der Villa sehr viel mehr Platz gab.
Im Radio läuft die BBC. »In Town Tonight«, eine Unterhaltungsshow. Am Ende sagt jemand: »Carry on, London!« Sie ist überrascht, dass auf dem Esstisch eine Wachstischdecke liegt und kein Stofftischtuch. Ihr Cousin und sie kommen beide aus einer Welt, in der stets nur Textilien die Tafel dekorierten. Ihr Großvater mütterlicherseits hat in Frankfurt am Main mit den innovativen kochechten, waschechten Lenco-Tischtüchern ein Unternehmen aufgebaut – florierend, bis vor kurzem. Jetzt schaut Ilse auf eine zwar durchaus moderne, wohl auch tendenziell geschmackvolle Decke, schwarz mit roten Punkten, aber ihr wird klar, dass sie noch nie in einem so bescheidenen Haushalt zu Gast war. Das heißt wohl, dass sich alles in ihrem Leben verändert hat.
Mit vierzehn war sie eines Tages aus dem Binger Lyzeum nach Hause gekommen, hatte sich ins Bett gelegt, geheult und nicht aufgehört zu heulen.
Drei Weinbaugebiete begegnen sich in Bingen: Rheinhessen, die Nahe, der Rheingau. Ilses Heimatstadt nannte sich in den Dreißigerjahren »die fröhliche Weinstadt am Rhein«. Wenn die Dampfer stromaufwärts Richtung Bingen fuhren und an der Lorelei vorbeikamen, dann sangen die Passagiere: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten«. Manche gedankenverlorenen Fahrgäste sangen das Lied auch dann noch, als jedem klar sein musste, dass Heinrich Heine, Verfasser dieser Zeilen, nun geächtet und das Lied daher unsingbar war. Am Binger Rheinufer aß man eine Brezel beim »Bretzelbub«. Am Kiosk kaufte man Ansichtskarten. Ein Motiv stand in besonders vielen Varianten auf den Kartenständern: der Diktator. Mit Hund, mit Kindern, im Braunhemd, im Trenchcoat, im Cut, im Stresemann. Man trank ein Glas Wein. Das wilde Urinieren betrunkener Touristen war ein Problem in Bingen. So sah es die Rhein- und Nahe-Zeitung. In einem Festzelt spielte sieben Tage in der Woche eine Tanzkapelle. »Annemarie« war einer ihrer Standards: »Und schießt mich eine Kugel tot / kann ich nicht heimwärts wandern / dann wein’ dir nicht die Augen rot / nimm halt einen andern.« Bingen-Besucher sangen gern »Annemarie«, wenn sie durch die Gassen wankten. Der Rhein sei der deutsche »Schicksalsstrom«, sagte ein Binger Werbeprospekt. »Stunden am Rhein« seien »Stunden tiefsten Erlebens«.2
Die Familie Groß wohnte einige Gehminuten vom Schicksalsstrom entfernt – kurz vor dem eleganten neuen Gebäude der Sektkellerei Scharlachberg. Die Eltern stellten der Tochter Fragen. Ilse hörte nicht auf zu weinen. Die Eltern riefen Sanitätsrat Dr. Mehler an. Der Mediziner stieg die Treppen zur Wohnung hoch, untersuchte Ilse, beriet die Eltern.
Ihre neue Mathematiklehrerin hatte Ilse und die fünf anderen jüdischen Schülerinnen in die letzte Reihe des Klassenraums gesetzt und ihnen verboten, je wieder etwas im Unterricht zu sagen. Dann hatte sie einen Vortrag über die Juden als niedere Lebensform gehalten. Sie hatte die nichtjüdischen Schülerinnen dazu angehalten, den sechs Mädchen das Leben von nun an so schwer wie möglich zu machen. Zwei Tage war Ilse danach noch zur Schule gegangen. Dann hatte sie nicht mehr gekonnt.
1934: Ilse Groß, dreizehn Jahre alt.
Der Sanitätsrat empfahl nichts Konkretes. Ilse blieb noch ein paar Wochen zu Hause. Dann verließ sie die fröhliche Weinstadt Richtung Schweiz: allein, vierzehn Jahre alt. Ihre erste Flucht aus Bingen.
Wenn sie in Genf hätte bleiben können, drei Jahre später, im Herbst 1938, hätte sie dort eine Fachschule für Bibliothekarinnen besucht. Sie hätte weiter tanzen gehen können – sie besaß silberne Tanzschuhe –, sich mit Freundinnen treffen, am See spazieren gehen. Aber den Eltern war es nicht mehr möglich, ihr Leben in Genf zu bezahlen. Ilses Aufenthaltserlaubnis lief ab.
In ihrem Genfer Zimmer hing, wie in vielen Jugendzimmern der Zeit, die »Unbekannte aus der Seine«. Es handelte sich um das Porträt einer attraktiven weiblichen Wasserleiche. Als völlig unklar war, was mit Ilse passieren würde, welches Land sie aufnehmen könnte, nach Deutschland konnte sie nicht zurück, in der Schweiz konnte sie nicht bleiben, stand sie am Ufer des Sees, schaute den Genfer Schwänen zu und stellte sich vor, im Wasser zu enden wie die populärste Ertrunkene ihrer Zeit. Irgendetwas daran fühlte sich auch romantisch an. Und dann ergab sich die Möglichkeit, nach England zu gehen. Die Rettung, zumindest für sie.
Zehntausende marschieren in den Dreißigerjahren durch englische Straßen. Ihre Hände schnellen hoch zum Gruß. Das Horst-Wessel-Lied singen sie in englischer Übersetzung. Sie gehören zur antisemitischen »British Union of Fascists«.3 Aber Gegendemonstranten stellen sich ihnen in den Weg. Und in Kirchen, Synagogen, Gewerkschaften formieren sich Initiativen, die eine großzügigere Flüchtlingspolitik für die verfolgten deutschen Juden fordern. Überall im Land spenden Briten für diese Organisationen, wie für das »Movement for the Care of Children from Germany«.4
Nach den deutschen Novemberpogromen beschließt das britische Parlament: Zehntausend jüdische Kinder und Jugendliche sollen – vorübergehend – ins Vereinigte Königreich eingelassen werden. Die Eltern der jungen Menschen sind ebenso in Gefahr. Für sie aber, so heißt es, finde sich auf den Britischen Inseln kein Platz. Grundsätzlich sollen die Grenzen dicht bleiben. Die Arbeitslosigkeit ist zu hoch. Also gibt es nur – oder immerhin – diesen Kindertransport.
In Deutschland, Polen, Österreich und der Tschechoslowakei begleiten Väter und Mütter ihre Kinder zu Bahnhöfen. Manche der Eltern umarmen die Kinder fest, küssen sie noch einmal und noch einmal. Es könnte schließlich ein Abschied für immer sein. Andere halten sich mit den Zärtlichkeiten zurück. Es soll ja wirken, als würde man sich bald wiedersehen. Der Vater eines Mädchens kniet sich vor das Kind auf den Bahnsteig und bittet es, in England alles dafür zu tun, ihre Eltern, Großeltern, ihre Tante und ihre Cousinen aus Österreich herauszuholen. Das Mädchen ist zehn Jahre alt.5 Die Eltern winken den Töchtern, den Söhnen hinterher.
Das Schicksal der allermeisten Zurückgebliebenen wird die Grenzen der Darstellbarkeit überschreiten. Die Züge fahren durch die Niederlande, die Kinder besteigen Fähren, und als diese in England anlegen, winken die Kinder, ihre Identitätsmarken um den Hals, für die Kameras der Pressevertreter. Die Fotografen lichten eher Mädchen als Jungen ab, weil Flüchtlingsjungen bei der Leserschaft nicht so beliebt sind. Die erste englische Mahlzeit der Kinder wird ebenfalls fotografiert: Eintopf. Abgeholt werden sie an der Liverpool Street Station in London, von Verwandten oder von Pflegeeltern. Andere finden Unterkunft in Heimen.
Manchen wird diese Rettungsaktion als Beleg für britische Großzügigkeit gelten. Es ist herzerwärmend, wie viele Menschen sich bereit erklären, die Schutzsuchenden aufzunehmen und zu behandeln, als seien sie ihr eigener Nachwuchs. Manche aber werden die Maßnahme als Element einer verfehlten Flüchtlingspolitik betrachten. Die Eltern der Geretteten werden in ihrer großen Mehrzahl dem mörderischen deutschen Antisemitismus zum Opfer fallen. Dass sie gefährdet sind, kann man im November 1938 schon absehen, auch wenn die Politik der Vernichtung noch nicht beschlossen ist. Keine Rettungsaktion Großbritanniens wird so umfangreich dokumentiert werden wie der Kindertransport und keine so kontrovers diskutiert.6
Ilses Schwester Bertha, fünfzehn Jahre älter als sie, hat schwere geistige und körperliche Behinderungen. Ihr Gehirn ist bei der Geburt geschädigt worden. Seit Ilse denken kann, hat Bertha in einem Heim in Rhens gelebt, fünfzig Kilometer rheinabwärts von Bingen.
Als Kind hat Ilse für Bertha Bilder gemalt und die Eltern haben die Bilder ins Heim mitgenommen. Ilse hat Gedichte über ihre Schwester geschrieben, eine Art romantische Obsession mit ihr gepflegt, am Klavier gesessen und improvisiert, Musikstücke gespielt über und für Bertha, die diese nie gehört hat. Ilse hat eine Haarsträhne Berthas bekommen: schönes, braunes Haar. Oft hat sie die Eltern gebeten, sie zu ihr mitzunehmen. Die Eltern sagten stets, dass sie Ilse das ersparen wollten. Es war kein Tabu in der Familie, sie redeten durchaus über Bertha, aber es stand fest, dass Ilse ihrer Schwester nicht begegnen sollte.
Zu Weihnachten packte die Mutter Päckchen für Bertha und für die Belegschaft des Heims. Sie schickte Nachthemden, Pantoffeln, Seife, Dosen mit selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen. Die Schwester lernte schreiben, als sie vierundzwanzig Jahre alt war. Ilse bekam eine Postkarte von ihr: ein paar Großbuchstaben, offensichtlich mit Mühe auf die Karte gebracht. Irgendwann klang Ilses romantische Neigung zur nie gesehenen Bertha ab und damit auch der Wunsch, sie zu besuchen.
Seit 1933 haben viele Menschen um die Eltern herum Bingen und Deutschland verlassen: jüdische Nachbarn, Freunde, Verwandte. Karl und Agnes Groß bleiben, wegen Bertha. Dass Behinderte im Nationalsozialismus besonders gefährdet sind, wird schon sehr früh klar. Ein Plakat von 1938 zeigt einen »erbkranken« Mann und verweist darauf, dass dieser die »Volksgemeinschaft« 60000 Reichsmark koste. Die praktischen Konsequenzen, die daraus zu ziehen seien, deutet der Aushang nur an. Im Geheimen bereiten deutsche Bürokraten und Mediziner sie vor.7
Doppelt so groß wie die Gruppe der durch den Kindertransport Geretteten ist die der nach Großbritannien geholten Haushaltshilfen. Wenn man sich verpflichtet, als Dienstbotin zu arbeiten, bekommt man ein britisches Visum. So können sich zwanzigtausend jüdische Frauen aus Deutschland, Österreich und Polen der Vernichtung entziehen. Sie kommen nicht als Gruppe, sondern einzeln, nach und nach. Auf sie warten keine Fotografen. Die Frauen verschwinden in den Haushalten, in denen sie kochen, bedienen, putzen. Die allermeisten von ihnen haben noch nie zuvor als Dienstmädchen gearbeitet. Einige von ihnen wissen nur, wie man Dienstmädchen beschäftigt.
Hinter dem Rettungsprogramm für »domestics« steht keine pure Menschenfreundlichkeit. In Großbritannien herrscht in den Dreißigerjahren eine Dienstbotenkrise. Geflüchtete sollen sie beheben. Junge britische Frauen aus der Arbeiterklasse wollen nicht mehr Hausangestellte werden. Es ist grauenhaft: Man bekommt einfach kein Personal mehr. Vielleicht liegt es daran, dass Dienstmädchen in vielen Familien keine Schrubber an Stielen ausgehändigt werden, obwohl in englischen Haushaltswarengeschäften durchaus Schrubber an Stielen erhältlich sind. Traditionell, die Symbolik will es so, soll das Dienstmädchen stets auf dem Boden knien, wenn es schrubbt. Möglicherweise ist der Beruf der Bediensteten auch deshalb unattraktiv, weil bei sexuellen Übergriffen durch die Herrschaft oder die Söhne der Herrschaft die schuldige Partei meist schnell gefunden ist: die Hausangestellte selbst. Oder es hat sich herumgesprochen, dass Dienstmädchen nicht die Badezimmer ihrer Arbeitgeber benutzen dürfen, sondern lediglich den für sie bestimmten Nachttopf in ihrem Zimmer, was peinlich ist und ständig daran erinnert, dass die Dienende konsequent ausgeschlossen wird von der Familie, mit der sie zusammenlebt und für die sie schuftet.8
In London sitzt Ilse jetzt oft neben einer Badewanne. Sie erzählt einem Kind Geschichten. Aus Cousin Willys Bungalow ist sie ausgezogen. Auch sie ist jetzt ein Dienstmädchen – wenn auch unbezahlt. Offiziell ist sie Schülerin. Das sagt ihr gefälschtes Visum. In der Wanne liegt ein siebenjähriges englisches Mädchen und korrigiert die sprachlichen Fehler, die ihre neue Betreuerin beim Erzählen macht.
Wenn Ilse genug zu essen bekommen würde, könnte man sagen: Sie hat Glück mit ihrem Arbeitsplatz. Sie muss nicht auf den Knien schrubben. Die Siebenjährige unterhält sich sehr gern mit ihr und liebt es, sie auf Fehler hinzuweisen. So lernt Ilse Englisch.
An jedem Abend liest Ilses Arbeitgeberin ihrer Tochter und ihrer Haushaltshilfe eine Stunde lang vor. Die Mutter hält ihr Kind für ein Genie. Von Ilses Fähigkeiten scheint sie weniger überzeugt. Sie liest Szenen aus Shakespeare-Stücken. Ilse sitzt auf einem Kissen, das Mädchen auf einem anderen Kissen, die Arbeitgeberin in einem Sessel, neben der Lampe, und für Ilse fühlt sich das Zuhören an, als würde sie auf einem Trapez turnen. Sie fliegt von einem englischen Wort, das sie schon versteht, zu dem nächsten Wort, das ihr bekannt vorkommt. Zwischen den Wörtern kann sich sehr viel Luft befinden.
Wenn die Mutter Shakespeare aus dem Programm nimmt, kommt die Zeit der Wouldbegoods: sechs dicke Freunde, englische Kinder, Oswald, Dora, Dicky, Alice, Noël und H.O. Warum H.O. so heißt, wie er heißt? Es wurde im Vorläuferband erklärt. Einen Sommer lang erleben die Wouldbegoods Abenteuer auf dem Land. Dort, so liest Ilses Chefin vor, seien die Leute freundlicher als in London, einfach weil es weniger Menschen gebe, also relativ gesehen mehr Freundlichkeit vorhanden sei. So, wie sich ein Pfund Butter sehr viel großzügiger auf einem Laib Brot verteilen lasse als auf einem Dutzend Broten.9
Ilse hat immer Hunger. Es gibt kein Brot im Haus. Zum Frühstück bekommt sie Porridge. Das ist die reichhaltigste Mahlzeit. Mittags, zumindest am Wochenanfang, sieht sie auf ihrem Teller ein Stückchen Überrest von dem Braten, den es am Wochenende gab. Donnerstags gibt es vielleicht ein kleines Würstchen. Was danach passiert: unsicher. Einen Keks bekommt sie am Nachmittag. Zum Abendessen lernt sie den entfernt zwiebackhaften englischen »water biscuit« kennen und die in diesem Königreich sehr populäre Rindfleischpaste Bovril. Aber auch das sind nur Kleinstportionen. Ihre Chefin ist spindeldürr. Sie scheint nie zu essen. Die kleine Tochter bekommt zusätzlich immer mal wieder ein Ei oder einen Apfel. Nicht Ilse.
Die Putzfrau bringt Ilse eine Scheibe Brot mit. Sie wischen zusammen Staub und reden. Die Putzfrau erzählt, dass ihr Mann sie schlägt und wie froh sie ist, wenn er nicht zu Hause ist. Sie findet Ilse und ihre eleganten Kleider offensichtlich interessant und irgendwie seltsam und sagt ihr, dass die Art, wie Ilse rede, sie an den walisischen Akzent erinnere. Wie solch ein Akzent klingt, ist Ilse komplett unbekannt, und was und wo Wales ist, auch. Aber sie ist dankbar für das Brot. Sie weiß, dass sich die Putzfrau dieses Geschenk eigentlich nicht erlauben kann.
Man sagt, dass man Englisch so sprechen soll, als hätte man eine Pflaume im Mund. Nachts liegt Ilse hungrig wach. Wenn in Bingen Gäste kamen, wurden die feinsten Tischdecken aufgelegt, aus Stoff, selbstverständlich. Das Tafelsilber wurde darauf arrangiert, zahlreiche Gläser eingedeckt. Zuerst gab es die Bouillon: Rinderbrühe, eine Farbe wie helles Gold, darin kleine Inseln von Markklößchen. Auf dem Tisch standen warme Brötchen parat, versteckt unter einer Stoffserviette in einem silbernen Korb. Dann ein Braten, Gemüse, Salat, zum Dessert hausgemachte Eiskrem, vielleicht eine Eisbombe, schließlich Obst und Käse.
Ilse steht auf, schaut aus dem Fenster. Von hier aus sieht sie auf ein luxuriöses Haus. Sie beobachtet die Dienstboten dort, die schon am Abend die Tabletts für das sicherlich opulente Frühstück vorbereiten. Sie legt sich wieder ins Bett und träumt von Schweizer Schokolade, gutbürgerlicher deutscher Küche, Restaurantbuffets. Sie stellt sich vor, dass die wohlhabenden Leute von gegenüber sie zu sich einladen und im nächsten Schritt adoptieren. Wie sie ihr erst Kuchen anbieten, wie sie dann in eines der Zimmer dieses Hauses einzieht und wie schließlich, nachdem ihre neuen Gastgeber alles Notwendige dafür in Bewegung gesetzt haben, ihre Eltern in Croydon landen und sie sich vor Freude weinend in die Arme fallen.
Einmal, vor dem Krieg, 1935, ist sie mit ihrer Mutter nach London gefahren: ein Besuch bei entfernten Verwandten. Mutter und Tochter erzählten ihren Gastgebern, dass die Badeanstalt am Rhein nun für Juden verboten war, dass in einem Ort nahebei das Schild hinge: »Die Straße nach Jerusalem führt nicht durch dieses Dorf«, dass ein Hitlerjunge einen Stein auf Ilse geworfen habe. Die Verwandten waren der Meinung, dass sich das alles sicher wieder normalisieren werde. So schlimm konnte es wirklich nicht sein. Das weiß man ja: Der Engländer an sich neigt dazu, Krisen nicht so aufzubauschen. Und Ilse wollte den Londonern gefallen. Also sagte sie, dass es nur ein kleiner Stein gewesen sei. Eher ein Kiesel. Er habe sie zwar am Kopf getroffen, sie aber kaum verletzt.
Erst später wurde ihr klar, dass es sich bei dieser Londonfahrt nicht um eine Vergnügungsreise gehandelt hatte. Ilse hatte Mitleid erregen sollen, so die Strategie der Eltern, damit diese Familie sie bei sich aufnehmen würde und eine der beiden Töchter schon einmal in Sicherheit sei. Der Plan war nicht aufgegangen. Kurze Zeit nach ihrer Rückkehr aus London kam ein weiterer Stein geflogen, nun kein Kiesel, durch die Fensterscheibe in den Salon der Familie Groß. Er traf den Sessel, in dem der Vater so gern saß, nur in diesem Moment gerade nicht.
Ilses Ungeschicklichkeit kann ihre Londoner Arbeitgeberin nicht ertragen. Diese hasst selbst den Haushalt und neigt zu cholerischen Anfällen. Sie ist Theosophin. Der Mensch trägt alles, was das Universum beinhaltet, latent in sich.10 An dieses theosophische Prinzip müsste sie eigentlich glauben. Aber was kann dieses Dienstmädchen überhaupt? Was ist in ihr latent?
Ilse Gross kennt sich sehr gut mit dem Œuvre des Dramatikers Jean Giraudoux aus. Sie liebt Dostojewskis Die Brüder Karamasow. Auch zu Strindbergs Theaterstücken, dem Traumspiel insbesondere, kann sie sich mit einiger Expertise äußern. 1937 hat sie den dritten Preis im Literaturwettbewerb der deutschsprachigen Schüler der Internationalen Schule von Genf erhalten, für »Momentaufnahmen aus unserem Alltagsleben«, ein Gedicht in komplexem Versmaß. Und sie hat Kurse in doppelter Buchführung belegt, im Verfassen französischsprachiger Geschäftskorrespondenz, im Schreibmaschineschreiben und in der Stenografie nach der modernen multilingualen Methode.
Ilse schiebt den für sie bereitstehenden Staubsauger durch die Wohnung. Solch ein Gerät bedienen zu dürfen: in England ein Haushaltshilfen-Luxus. Ihr Leben lang wird Ilse verheimlichen, dass sie im Sommer 1936 drei Monate lang eine Hauswirtschaftsschule besucht hat: unter der Leitung von Mme Dr. Rittmeyer, mit Blick auf den Genfer See. Vielleicht hat sie sich dort nicht allzu sehr bemüht. Mit dem Staubsauger saugt sie Socken des kleinen Mädchens auf, dann einen Strumpf ihrer Chefin. Das Gerät streikt. Die Theosophin verliert die Contenance.
Die Eltern versuchen von Bingen aus, ihr zu helfen. Die Situation muss sich ändern. Das Kind kann nicht dauernd hungrig sein. Ein Londoner Bekannter der Familie soll aufgesucht werden, ein früherer Kunde von W. Gross Söhne. Binger Weine werden auch in England geschätzt: Der Riesling, das weiß man, ist fantastisch. Ilse zieht sich etwas Vornehmes an und macht sich auf den Weg.
Der Herr wohnt direkt am Regent’s Park, in einer eleganten, geräumigen Wohnung, und sitzt hinter seinem Schreibtisch und hört sich Ilses Leidensgeschichte an und ihren Bericht von den Sorgen der Eltern, die immer noch in Deutschland seien und dringend herausmüssten. Er hat tatsächlich eine Idee, wie er helfen kann. Da er regelmäßig Karten für Theaterpremieren hier in London bekomme, werde er ihr, Ilse Gross, von nun an regelmäßig Tickets schicken. Gratis.
Hundekekse statt Menschengebäck serviert eine deutsch-jüdische Medizinstudentin, seit der Flucht englisches Dienstmädchen, einer Abendgesellschaft. Versehentlich. Sie wird sofort entlassen. Eine andere Hausangestellte, einundzwanzig Jahre alt, muss ihr Essen, das ist üblich, stets allein in der Küche einnehmen und nicht im Salon, wo die Familie speist. Sie ist todmüde von der Arbeit. In einem sechsköpfigen Haushalt ist sie die einzige Dienstbotin, kann sich aber als gerettet betrachten vor der immer aggressiveren Diskriminierung in Deutschland und muss daher Tag für Tag dankbar sein, weil das Leben da, wo sie herkommt, so viel schrecklicher wäre. Sie sitzt in der Küche, isst und weint. Der Hund der Familie sitzt neben ihr und leckt ihr die Tränen vom Gesicht.
Eine Haushaltshilfe namens Edith, geflohen aus Berlin, hat eine englische Chefin, die ebenfalls Edith heißt. Also nennt die eine Edith die sie bedienende Edith ab sofort Mary.11 Eine Österreicherin, ausgebildete Konzertpianistin, darf grundsätzlich das Instrument der von ihr bedienten Familie berühren. Aber sie wird von ihrer Chefin angemahnt, nur Klavier zu spielen, wenn wirklich niemand zu Hause ist.