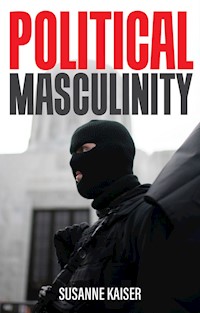14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Ein Roman für Opernliebhaber Als die junge Elia die weltberühmte Opernsängerin Mariana Lipovska zum ersten Mal singen hört, ist es, als habe sie ihre Zwillingsseele gefunden - und zugleich ihre Berufung. Je länger das süditalienische Mädchen ihr in der römischen Kirche Santa Maria in Aracoeli lauscht, desto mehr ist es von der göttlichen Stimme der Mezzosopranistin fasziniert. Auch die Operndiva spürt es, als Elia nach dem Konzert aufgeregt vor ihr steht: Die Automechanikertochter besitzt eine ungewöhnliche musikalische Begabung. Fortan widmet Mariana ihre ganze Freizeit der Stimmbildung des bezaubernden Mädchens. Doch im Gegensatz zu Marianas traumhafter Karriere muss die junge Frau Hohn und soziale Diskriminierung erleiden, bis sie wie ihr großes Vorbild den Durchbruch erlebt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 954
Ähnliche
Susanne Kaiser
Im Schatten der Tosca
Ein Opernroman
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2008© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40444-0 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-24696-5Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Mariana
Elia
Tosca
Diva
Die Autorin hinterließ ein umfangreiches Manuskript, an dem sie mehr als sieben Jahre gearbeitet hat. Im Einvernehmen mit ihr wurde es von Bettina Blumenberg gekürzt, bearbeitet und in die vorliegende Druckfassung gebracht.
Mariana
Mariana Pilovskajas Vater stammte aus Sankt Petersburg und hatte dort als junger Bursche bei seinem Onkel eine kaufmännische Lehre absolviert. Da die Firma gute Beziehungen zu Skandinavien unterhielt, wurde der tüchtige Nicolai nach seiner Volljährigkeit zu einem Geschäftspartner nach Stockholm geschickt. Dort sollte er sich erst einmal umsehen und Auslandserfahrung sammeln.
Das tat er recht hingebungsvoll. Zu Hause hatte die große Familie den jungen Mann umsorgt, das war zwar bequem gewesen, aber manchmal auch lästig. Die neue Freiheit gefiel ihm sehr. Als Erstes schrieb er sich an der Universität ein, Juristerei, Staatskunde, Geschichte, Philosophie. »Das alles kommt meinen kaufmännischen Bestrebungen zugute«, erklärte er in sehr vernünftig klingenden Briefen nach Hause.
Letzten Endes stimmte das sogar. Während er sich eine Zeitlang mit seinen Kommilitonen die Nächte um die Ohren schlug und sich gelegentlich mit brummendem Schädel in eine Vorlesung schleppte, um dort Verabredungen für weitere Abenteuer zu treffen, knüpfte er ganz arglos Freundschaften und Bekanntschaften mit den zukünftigen Rechtsanwälten, Professoren, Richtern, Ärzten, Abgeordneten, Ministern des Landes.
Nicolai hatte nie vorgehabt, sein Studium zu beenden, wozu auch, er hatte einen Beruf, der ihm gefiel. Aber wie die anderen wilden, bald wieder gezähmten jungen Männer fing auch er an, sich nach einer Ehefrau umzuschauen. Dabei ging er keineswegs berechnend vor, davor bewahrte ihn seine schwärmerische Seele. Er tat das für ihn genau Richtige: Er besann sich auf die hübsche Tochter des Geschäftsfreundes seines Onkels.
Die hatte sich ganz der Sangeskunst verschrieben und ihren beeindruckten Freundinnen feierlich gelobt, dass sie nie heiraten werde, sondern Sängerin werden wolle. Da die schwedischen Männer Birgit langweilten und sie eigentlich keinen Nicht-Schweden kannte außer Nicolai, der sich aber bei ihren Eltern kaum je blicken ließ, störte nichts ihren Seelenfrieden. Plötzlich aber kam Unruhe auf, denn der junge Russe erschien nun jeden Tag, mit einem Sträußlein, einem Gedicht, wundersamen Reden, und irgendwann erlag die besonnene Schwedin seinem Charme.
Also doch Ehefrau – statt Sängerin! Wie alle ihre Freundinnen, alle anderen Mädchen auch. Beides miteinander zu verbinden, es wenigstens zu versuchen, auf diese Idee kam kein Mensch. Auch Birgit nicht. Dafür konnte sie sich endlich eingestehen, dass ihr vor der unbürgerlichen, unseriösen Theaterwelt fast ein bisschen gegraust hatte – und vor allem, dass sie eigentlich unglücklich gewesen war über ihre »falsche Stimme«. Die war geschaffen für leichtfüßige Mädchen, leichtsinnige Soubretten, Kammerkätzchen oder für Koloraturen zwitschernde Damen, aber nicht für die schweren, tragischen Heldinnen, die ihrem eher herben Wesen entsprachen. Eine Fotografie aus der Verlobungszeit zeigte sie noch einmal als angehende Sängerin: ein ernstes, blondbezopftes Mädchen, den empfindlichen Hals durch einen Pelzkragen geschützt. Mit einer Notenrolle unter dem Arm.
Immerhin gab Birgit auch nach der Heirat das Singen nicht auf, und so wurde Mariana schon im Mutterleib freundlich umwogt und eingestimmt von weiblichem Gesang, nur gelegentlich aufgeschreckt durch allzu heftige pianistische Einlagen des Begleiters am Klavier.
So vertraut war sie mit dieser Stimme, dass sie ihr erstes Trinken erst aufzunehmen geruhte, als die Mutter der Neugeborenen ein Lied trällerte. Noch Jahre später half alles Zureden nichts, wenn Mariana etwas nicht essen wollte: Es musste gesungen werden, erst dann sperrte sie brav den Schnabel auf. Meist sang die Mutter mit ihrer hohen, biegsamen Stimme schwedische Kinderlieder, Kunstlieder, Arien, die Königin der Nacht, bei der Mariana vor Staunen das Schlucken vergaß. Manchmal erschien auch der Vater und sang mit seiner tiefen Stimme russische Lieder, das gefiel Mariana noch besser. »Dir frisst Mariana wirklich aus der Hand«, sagte die Mutter.
Singen, das war für die kleine Mariana die allernatürlichste menschliche Ausdrucksweise. Nur selbst singen mochte sie nicht. Sie liebte den Sopran der Mutter, sie vergötterte den tiefen Bass des Vaters. Aber ihre eigene Stimme hatte leider weder vom einen noch vom anderen etwas, sie kam nicht in die Höhe und nicht in die Tiefe, und in der Mitte piepste sie nur. »Eine Kinderstimme, wart’s ab«, meinte die Mutter. Aber Mariana wusste es besser. Stille sein – und allenfalls Klavierspielen lernen. Um eines Tages den Begleiter der Mutter zu verjagen, dessen allzu ausdrucksstarkes Geklimper ihr auch jetzt noch missfiel.
Mariana erwies sich als recht geschickt, sie hatte guten Grund, fleißig zu sein – sie war ganz einfach musikalisch. Als sie bei einem Hauskonzert zum ersten Mal die Mutter bei ein paar kleinen Liedern begleiten durfte, war Birgit vor Aufregung ganz heiser. Mariana jedoch funkelte mit gerunzelten Brauen zu dem in der ersten Reihe sitzenden Konkurrenten hinüber, dann griff sie mutig in die Tasten. Das Publikum war entzückt, am meisten der Pianist, der sich sogleich erbot, Mariana Klavierunterricht zu geben. »Hast du denn gar kein Lampenfieber gehabt?«, wurde sie gefragt. Sie begriff nicht so recht, was die Leute damit meinten. Ihr hatte der Auftritt gefallen, nur zu kurz war er gewesen.
Mariana konnte so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Das hatte sich bereits bei der Geburt eines kleinen Bruders gezeigt. Allerdings hatten ihr die Eltern schon vorher erklärt, dass bald ein Geschwisterchen käme, wie sehr sie sich darauf freuten, besonders für Mariana, sie sei dann nicht mehr so allein. »Natürlich musst du der Mama viel helfen, du bist ja schon ein großes Mädchen«, hatte der Vater noch gesagt. Das hatte ihr am meisten eingeleuchtet. Mit ihren fünf Jahren, so fand sie, gehörte sie schon fast zu den Erwachsenen. Der kleine Bruder hingegen erschien ihr doch eher überflüssig. Sie hatte sich schon nicht viel aus Puppen gemacht, mit diesem greinenden Wurm ließ sich noch weniger anfangen. Dennoch war sie bei der Betreuung des Kleinen eine durchaus zuverlässige, etwas gönnerhafte Hilfe.
Das ganz große Ereignis in Marianas Kinderleben war eine Reise nach Russland. Ein schneeweißes Schiff trug die Familie von Stockholm nach Sankt Petersburg. Die Eltern bewohnten eine luxuriöse Kabine mit Fenstern, Badezimmer und Doppelbett, daneben, durch eine Türe verbunden, lag die gemütliche Kabine der Kinder, mit einem Bullauge und Etagenbetten.
Wer wollte, ob groß oder klein, konnte ständig etwas unternehmen, in Spielsalons, Sporthallen, Tanzpavillons, wer lieber nichts tat, ließ sich auf Liegestühlen in feine Decken hüllen, um zu lesen, zu schlafen, in die Luft oder aufs Wasser zu schauen, umsorgt von beflissenen Kellnern in schicken Uniformen. Schon zum Frühstück gab es so viel zu essen, dass man den ganzen Tag satt war. Darum beschloss die Mutter schon am zweiten Tag, mit den Kindern das Mittagessen zu überspringen und dafür lieber am Nachmittag in Eisbechern und Sahnetörtchen zu schwelgen. Hierzu gesellte sich auch der Vater, beschwingt, mit vom Champagner geröteten Backen.
Eine Hauptbeschäftigung aller Passagiere, auch der Kinder, war das ständige Umkleiden. Zum Frühstück trug man etwas anderes als im Liegestuhl, unmöglich konnte man Bridge im gleichen Gewand spielen wie Shuffleboard. Mariana war sehr stolz auf ihre rüschenbesetzten Kleider, ihre feinen Lackschuhe, den breitkrempigen Organzahut, den Strohhut mit den Flatterbändern. Auch der kleine Bruder in seinen feschen Matrosenanzügen gefiel ihr. Als er für seine Matrosenmütze ein dunkelblaues Band mit dem Namenszug des Schiffes »S.M.Tsar Alexander« bekam, musste auch Marianas Strohhut mit einem solchen Band geschmückt werden.
Am Abend assistierten die Kinder staunend den Eltern beim großen Ankleidezeremoniell für das Dinner. Der riesige Schrankkoffer offenbarte seine Schätze, die er in Fächern und Schubladen verborgen hielt. Dann ging es um schwerwiegende Entscheidungen: zur großen Kette noch die Ohrringe? Lack- oder Lederschuhe? Diesen Gürtel oder jenen? »Sich schönmachen«, das war nichts, was sich hinschludern ließ. Es war Arbeit, eine ernsthafte, aber auch lustvolle Arbeit. Oder eben Kunst. Das prägte sich beiden Kindern fürs Leben ein.
Am vorletzten Tag der Reise las die Mutter in der Bordzeitung: »Five o’clock tea im Grünen Salon: Tamara Karamasova und das Tanzorchester Charly Kekoonen. Die Künstlerin singt Lieder aus ihrer kirgisischen Heimat. Und vieles mehr.« – »Nie gehört, klingt exotisch, da gehen wir hin«, sagte der Vater. Zunächst schrammelte das Orchester die üblichen Schlager. Dann jedoch spielte es einen Tusch, der Dirigent verbeugte sich, gleichzeitig ging die Türe auf, und eine üppige Dame betrat das Podium. Der gewaltige Busen war in ein violettes Mieder gezwängt wie in eine samtene Brünne, der blaugrün schillernde Taftrock endete in einer bauschigen Schleppe, an den Ohren der Künstlerin baumelten christbaumkugelgroße goldene Klunker, um ihren Hals wand sich eine Federboa. Aus dem porzellanweiß geschminkten Gesicht leuchtete grellrot ein kleingemalter Puppenmund.
Minutenlang, so wirkte es, starrte Frau Karamasova aus schwarz umrandeten Kohleaugen ins Publikum, schmerzlich versunken in die Klagelaute des Orchesters. Endlich, als habe sie einen schrecklichen Entschluss gefasst, ließ sie Luft einströmen in ihren mächtigen Brustkorb, was die stramme Brünne vollends zu sprengen drohte, das Mündchen öffnete sich zu einem breiten Froschmaul, und heraus strömte so etwas wie ein Orgelton. Tief, herzzerreißend, wunderschön. Daraus formte sich eine Melodie, die warme, volle Stimme glitt mühelos hinauf in höhere Lagen, sie sang eine traurige, alte Geschichte, jeder begriff sie, auch ohne zu verstehen. Das Publikum klatschte begeistert, als das Lied zu Ende war. »Donnerwetter«, rief der Vater, »Mhm«, murmelte die Mutter. Mariana tat keinen Pieps.
Sie saß da wie versteinert. Sie hatte gerade eine Offenbarung erlebt: Es gab auch tiefe Frauenstimmen. Das hohe Gezwitscher der Mutter war nicht die einzig mögliche, einzig richtige Ausdrucksform einer weiblichen Stimme. »Was ist los mit dir, ist dir nicht gut, gefällt es dir nicht, sollen wir gehen?«, fragte die Mutter. Mariana konnte nur mühsam den Kopf schütteln. Nicht einmal ein Erdbeben hätte sie von hier weggebracht, solange diese Wunderstimme in sie eindrang und ihr innerstes Wesen vor Glück erschauern ließ.
Die Liebe zum Singen hatte sie wahrhaftig mit der Muttermilch eingesaugt. Und die Mutter erklärte ihr immer wieder: »Singen können, das ist das Schönste auf der Welt.« Wenn sie sich gerade über ihren wirren Ehemann geärgert hatte, fügte sie noch hinzu: »Aber nicht nur als Liebhaberei. Nein, als Beruf. Wenn du Erfolg hast als Sängerin, dann kann dir der Rest der Welt den Buckel runterrutschen.«
Das glaubte auch die kleine Mariana. Aber etwas hatte sie eben gequält. Ihrer Meinung nach hatten alle Sängerinnen einen Sopran. Alles andere war nur Gekrächze. Ihre Kinderstimme gefiel ihr nicht. Und eine Ahnung sagte ihr, dass ihre Erwachsenenstimme anders klingen würde als die der Mutter. Das hatte sie so traurig gemacht, dass sie darüber nicht sprechen mochte, mit keinem Menschen. Doch nun hörte sie die tiefe Stimme der Russin. Mit einem Schlag waren aller Kummer, alle Mutlosigkeit verflogen. Jetzt konnte Mariana beruhigt und vergnügt abwarten. Ob hoch, ob tief, darauf kam es nicht an. Auch ihre kleine Kinderstimme und ihre eigene Sangeslust brauchte sie nicht mehr zu verstecken.
Noch in Petersburg war Mariana tief erfüllt von ihrem Erlebnis. »Ich werde Sängerin«, erzählte sie jedem der vielen russischen Verwandten, wobei der Vater dolmetschte.
»Ja, ja, bis ein frecher Russe daherkommt und dich heiratet. Schwupp, stehst du am Herd und hast sieben Kinder. Und aus ist’s mit der Sängerin. Wie bei deiner Mama. Was, kleines Schwedenmädel«, lachte einer der neuen Onkel und zwickte sie in die Backe.
Die Mama steht nie am Herd. Und hat auch keine sieben Kinder, dachte Mariana. Allerdings, Sängerin war sie auch nicht. Plötzlich, als ändere das alles, maulte sie: »Schwedenmädel. Ich bin eine halbe Russin.«
Wie leid es ihr tat, dass sie die Sprache nicht verstand. Der Tonfall, die Laute waren ihr nicht fremd, sie hatte all die russischen Lieder im Ohr. Wenn sie nur auf den Klang achtete, wunderte sie sich, dass sie den Inhalt nicht erfasste. Sie war so begierig, einen Sinn aus dem Gerede zu erhaschen, dass sie unentwegt nachfragte und nachplapperte. Und dann kam der Augenblick, in dem sie plötzlich einen Satz begriff: »Ach, mein Mäuschen, mein Schätzchen, mein Herzchen, du hast doch sicher noch Hunger«, hatte eine Tante gerufen und ihr das dritte Stück Kuchen auf den Teller gehäuft. Mariana hatte ganz entsetzt auf Russisch geantwortet: »Ach nein, danke, liebe Tante. Ich bin satt!« Zunächst hatte es niemand gemerkt, auch Mariana nicht. Aber plötzlich, im Nachhinein, erkannte man das Wunder, sie wurde in tausend Arme gerissen und geherzt, geküsst, bejubelt.
Von da an gab sie sich wirklich Mühe, und am Ende der Russlandferien konnte sie sich ganz nett unterhalten. Das machte ihr Spaß, nicht nur, weil sie plötzlich die Leute verstand, sondern mehr noch, weil sie ihre Art zu reden, zu gestikulieren annahm. Sie bewegte sich anders, ihre Stimme klang höher.
So stellte die Russlandreise sachte die Weichen in Marianas Leben. Und ein paar Dinge traten ans Licht: Mariana reiste leidenschaftlich gern, weil sie neugierig war, und Schiffsreisen waren besonders schön. Auf Reisen sah und erlebte man viel – fremde Landschaften, Pflanzen, Tiere. Und Menschen. Und noch etwas hatte sich durch die Reise ergeben: Plötzlich schwärmte Mariana für alles Russische, und in Tamara Karamasova sah sie ihr neues Ideal.
Doch zunächst einmal verlief alles ganz friedlich. In der Schule lernte Mariana Französisch und später auch Englisch. Die eine Lehrerin, eine ältliche Französin, ließ die Kinder parlieren, so viel sie wollten, die andere, eine junge, magenkranke Schwedin, quälte sie ausschließlich mit Grammatik, woraufhin die ganze Klasse Englisch hasste. Mit dem Vater sprach Mariana gern Russisch, worüber sich der kleine Bruder ärgerte, weil er nur wenig verstand.
Dann, nach der Konfirmation, erhielt sie endlich Gesangsunterricht, einmal in der Woche bei Professor Wettergren, dem alten Lehrer ihrer Mutter. Der hätte lieber noch eine Weile gewartet, aber weil er Marianas Eifer nicht verpuffen lassen wollte, ließ er sie Lieder und leichte Technikübungen singen.
»Sollen wir deine Gesangsstimme ruinieren, bevor du überhaupt eine hast?«, fragte er. »Noch wissen wir nicht einmal, ob du eine Nachtigall wirst oder ein Frosch, wobei gegen dessen Atemtechnik und stimmliche Durchschlagskraft wahrlich nichts einzuwenden ist.« Professor Wettergren achtete darauf, dass Mariana sich mit dem Inhalt der Lieder gründlich auseinandersetzte. »Auch bei Übersetzungen musst du haargenau wissen, Wort für Wort, was da gesagt wird. Glaub bloß nicht, dass der Text nicht wichtig ist, das tun nur dumme Sänger. Im Übrigen musst du bald Italienisch lernen, das ist die Grundlage des Gesangs. Und Deutsch. Denn, wie ich dich und deine Stimme einschätze, wirst du auch Wagner und Strauss singen.«
In der Opernliteratur kannte sich Mariana schon ganz gut aus. Auch das verdankte sie ihrem Lehrer, denn er hatte schon vor Jahren den Eltern geraten, die Tochter in die Oper mitzunehmen. Mittlerweile hatte sie eine ganze Reihe von Opern gesehen. Und vor allem: Sie hatte den Sängerinnen und Sängern gut zugehört, nicht nur mit den Ohren, auch mit dem Herzen, und ihnen dabei das Geheimnis abgelauscht, worauf es beim Singen wirklich ankam. Dieses heimliche Wissen, das ihr Verstand zunächst gar nicht wahrnahm, sollte bewirken, dass sie später nicht Schiffbruch erlitt, trotz widriger Winde.
Bevor es so weit kam, brach der erste Weltkrieg aus. Zuvor hatte die Familie wiederholt weitere Russlandreisen geplant, doch ständig war etwas dazwischengekommen. Jetzt war es damit sowieso zu Ende. Dafür tauchten immer mehr russische Verwandte und Freunde in Schweden auf. Schließlich tummelten sich überall russische Adlige, Gutsbesitzer, Bürger, Künstler, die gerade noch höchst angenehm gelebt und nie gearbeitet hatten. Nun besaßen viele von ihnen kaum mehr als ihr Leben und ein paar Habseligkeiten, Schmuckstücke, Teppiche, Bilder, was man auf der Flucht hatte mitnehmen können. Die wenigsten verloren darüber ihre gute Laune, geschweige denn ihre Haltung. Irgendwie schlug und schnorrte man sich durch. So gut wie niemand hatte einen Beruf erlernt. Aber man besaß gute Manieren, sprach Französisch, konnte Klavierspielen, Reiten, Sticken, Autofahren, Jagen, Tanzen, Singen. Also gab man Privatunterricht. Es galt nur noch, die reichen Schweden von der Notwendigkeit eines solchen zu überzeugen.
Das bescherte Mariana eine neue Gesangslehrerin.
»Sie ist eine Kusine meines Vetters dritten Grades. Sie stammt aus Kasachstan, soweit ich weiß, dort war sie eine erfolgreiche Gesangspädagogin, sie hat eine Reihe berühmter Schüler, dass ich die Namen nicht kenne, besagt wirklich nichts. Wir müssen ihr helfen. Und für Mariana ist es eine Chance. Sie ist fast sechzehn und sollte nicht länger ihre Zeit verplempern. Was hat sie denn bis jetzt bei Professor Wettergren gelernt?« So redete sich der Vater seiner Frau gegenüber in Schwung, bis die widerwillig und ohne Überzeugung nachgab.
Mariana hatte manchmal über den zögerlichen Unterricht gemurrt, aber jetzt hatte sie doch Sorge, ihren lieben alten Lehrer zu kränken. Dann aber erschien Madame Krasnicova.
»Die Gräfin lassen Sie weg, unnütze Titel, nichts für heimatloses Gesindel«, trompetete sie den Gastgebern entgegen.
Mariana schlug das Herz bis in den Hals: Diese bombastische Dame ähnelte der verehrten Tamara Karamasova wie eine Zwillingsschwester. Raumfüllend, hoheitsvoll, laut. Mariana war hingerissen. Diese Wunderfrau würde sie endlich einführen in die Weihen des hohen Gesangs, das spürte sie.
»Um Gottes willen, was hat man dir eigentlich bisher beigebracht?« Das war das Erste, was Mariana zu hören bekam. »Zwei Jahre, sagst du, das ist grauenhaft, eine Katastrophe. Alles falsch, alles. Wir werden lange brauchen, um auszubügeln, was dieser Professor angerichtet hat. Zum Glück bist du noch jung, aber ohne mich, ohne Leonie Krasnicova, wärst du verloren. Diese Piepsstimme, nichts ist da, womit schnaufst du eigentlich?«
Mariana war bestürzt, fast kamen ihr die Tränen. War alles zu Ende, noch ehe es angefangen hatte? Hätte sie nicht selbst etwas merken müssen? Dahin also führte blindes Vertrauen!
»Jetzt machst du nur noch, was ich dir sage. Und du sprichst mit keinem Menschen darüber. Meine Methode ist mein Geheimnis. Mein Kapital. Dafür würden viele wer weiß was geben. Geh ja nicht noch einmal zu deinem alten Lehrer, das verbiete ich dir. Ein ahnungsloser Zerstörer ist das. Wenn er merkt, dass du ihm auf die Schliche gekommen bist, wird er sich rechtfertigen wollen.«
Nach dieser Tirade nestelte Madame Krasnicova aus einem Brusttäschchen eine zierliche Taschenuhr an einer langen Kette hervor.
»Du liebe Güte«, rief sie aus, »die Stunde ist längst vorüber. Ich werde es nie lernen. Aber so bin ich eben, immer denke ich nur an die anderen, nie an mich!« Dann wechselte sie plötzlich den Ton und sagte vergnügt: »So, mein Kind, deine liebe Mutter hat uns sicher einen schönen Tee zubereitet. Hoffentlich gibt es süßes Gebäck. Ich habe einen Bärenhunger.«
»Jetzt wollen wir Atmen lernen«, verkündete Madame Krasnicova in der nächsten Stunde. »Zeig mir mal, wie du das bei deinem Professor gemacht hast.« Mariana ahnte, dass sicherlich alles falsch war, zaghaft holte sie Luft, ihre neue Lehrerin unterbrach sie auf der Stelle: »Ich sehe nichts, ich höre nichts, was ist los mit deinem Brustkorb, deinem Bauch, hast du keinen? Hier, fass mal bei mir an!«
Sie packte Marianas Hände und presste sie sich rechts und links an ihre Rippen. Dann schnaubte sie laut und pumpte in Bauch und Brustkorb Luft, Mariana spürte es deutlich durch das harte Fischbeinkorsett hindurch. Sie erinnerte sich an Tamara Karamasova. Hatte die nicht auch so Luft geholt? Also war es richtig.
Anschließend musste Mariana alles nachmachen, sie schnappte und schnaufte, schließlich wurde ihr schwarz vor den Augen.
»Mir ist schwindlig«, flüsterte sie und wäre fast umgefallen. »Ha, alte russische Schule, endlich hast du einmal richtig Luft geholt.« Nach ein paar weiteren Stunden taten Mariana die Rippen weh, sie hatte keine Ahnung, wohin sie die viele angestaute Luft lenken sollte. Aber Madame Krasnicova war zufrieden. »So, jetzt kümmern wir uns mal um deine Stimme.«
Das wenige, was ihr Professor Wettergren bisher eingeschärft hatte, war gewesen: Raus aus dem Hals. Nach vorne. Denk nach oben, zwischen die Augen.
»So ein Quatsch«, empörte sich Madame Krasnicova. »Hast du da vielleicht Stimmbänder? Na also. Die Stimme besitzt ein Organ, die Kehle. Hier, hör selbst.« Damit spitzte sie die Lippen und ließ ein dürftiges, hohes Tönchen entweichen. Darauf pumpte sie Luft in gewohnter Weise, und ein gutturales Röhren entströmte Brust und Kehle.
So viel Mühe sich Mariana in der folgenden Zeit auch gab, gelegentlich setzte sie den Ton eben doch noch vorne an, so wie es ihr Professor Wettergren geduldig beigebracht hatte. Und schon höhnte ihre Lehrerin: »Jetzt piepst sie wieder, piep, piep, piep. Nach hinten, zum Donnerwetter! So, und jetzt Druck. Nur so erzeugst du einen vollen Ton.« Weil Mariana offenbar immer noch nicht begriff, stürzte Madame Krasnicova auf sie los, griff nach ihrer Gurgel und drückte mit beiden Händen ihren Kehlkopf nach unten. Mariana konnte tagelang kaum schlucken.
Schließlich waren ihre Stimmbänder so überanstrengt, dass der Ton ganz von selbst in den hintersten Winkel der Kehle rutschte, manchmal sackte er einfach ab, sie konnte es nicht mehr kontrollieren. Oft sang sie schlichtweg zu tief, einen halben Ton, so schien ihr, eigentlich war es unüberhörbar. Aber Madame Krasnicova verlor kein Wort darüber. Dann war es wohl nicht wichtig, sagte sich Mariana. Sobald sie die Technik beherrschte, würde sich das automatisch einstellen.
Offenbar machte sie Fortschritte. »Heute wollen wir eine Rolle durchgehen«, eröffnete Madame Krasnicova eines Tages die Unterrichtsstunde. Mariana strahlte, jetzt war er da, der ersehnte Augenblick. Ihre Lehrerin klappte bedeutungsvoll eine zerfledderte Partitur auf. ›Boris Godunov‹. Mariana wunderte sich, was für eine Rolle mochte es da wohl für sie geben, vielleicht den Zarewitsch. Das war ein Mezzosopran, und ihre Stimme hatte sich inzwischen in dieser Stimmlage eingependelt.
Nein, es war die Amme. Eine echte Altpartie – und wahrlich keine Rolle, von der man als sangesbesessenes junges Mädchen träumte.
»Die Amme, ja aber . . .«, stammelte Mariana fassungslos.
»Ja, vielleicht ist die Partie zu groß für dich, dann nehmen wir die Schankwirtin durch«, schnitt ihr Madame Krasnicova streng das Wort ab. »Spielalt, kleine Rolle.«
An diesem Tag gab es an Marianas Gesang nichts zu bekritteln, die Enttäuschung schnürte ihr ganz von selbst die Kehle zu. Was für ein Einstand in die Karriere einer Sängerin! Erst sehr viel später erfuhr Mariana durch Zufall, dass sich Madame Krasnicova mit diesen beiden Rollen auf irgendwelchen Provinzbühnen jahrelang über Wasser gehalten hatte.
Jetzt aber würgte Mariana an den paar Tönen der Schankwirtin herum, und bald kam auch wieder der Schlachtruf: »Pressen, du musst pressen!«
Und Mariana presste und drückte, sie staute die Töne, die Luft, vor Anstrengung quollen ihr die Augen heraus. Sie war von Kopf bis Fuß verkrampft und verspannt. Ihre Stimme fing an zu tremolieren oder sank in den Keller.
Aber dass irgendetwas an der Unterrichtsmethode von Madame Krasnicova nicht richtig sein könnte, auf diese Idee kam sie nicht. Sie gab sich ganz allein die Schuld, dass sie mit dem Singen kaum Fortschritte machte – wenn man ehrlich sein wollte, waren es eher Rückschritte. Doch das lag wahrscheinlich nur an ihr, an ihrer Ungeschicklichkeit, ihrer Unbegabtheit, wer weiß. Lediglich das Lob, mit dem Madame Krasnicova genauso temperamentvoll um sich warf wie mit ihrem Tadel, hinderte Mariana daran, gänzlich zu verzagen. »Was für ein fleißiges Mäuslein! Mein Herzenstäubchen, bravo, die alte Leonie ist stolz auf dich!«, so konnte sie jauchzen und Mariana dabei an ihren gepanzerten Busen drücken und sie abschmatzen. Und dann schimpfte sie wieder nach Herzenslust – aus Fürsorge und Eifer, sicherlich. Sogar zusätzliche Unterrichtsstunden bot sie Mariana an. Wann setzte sich ein Lehrer so für seinen Schüler ein?
Schließlich, nach einem guten Jahr, trugen Marianas Bemühungen doch Früchte: Eines Tages hatte sie kaum mehr eine Stimme. Zuerst dachte Mariana noch an Erkältung, aber sie hatte keinen Husten, keinen Schnupfen, kein Fieber. Sie war einfach stockheiser.
»Was ist los mit deiner Stimme?«, fragte die Mutter besorgt.
»Ich weiß es nicht«, wollte Mariana sagen, aber sie brachte nur ein kümmerliches Krächzen heraus.
Birgit hatte sich schon längst Sorgen gemacht, auch Vorwürfe. Nach den Unterrichtsstunden wirkte Mariana oft angespannt und erschöpft zugleich, was weder zu ihr selbst noch zum Singen passte, normalerweise wurde man dadurch frisch und vergnügt. Fragen wich sie aus. Aber Birgit wusste aus eigener Erfahrung, wie merkwürdig eng Gesangsschüler meist mit ihren Lehrern verbunden waren – ja sein mussten. Anscheinend fand da ein bedingungsloses sich Ausliefern statt. Hier mit Ratschlägen aufzuwarten, hatte genauso wenig Sinn, wie einem verliebten Paar klarmachen zu wollen, es passe nicht zueinander. Zudem hatte ihr Mann sie ständig beschwichtigt: »Misch dich bloß nicht ein, du hast keine Ahnung, wie empfindlich Russinnen sind!«
Doch jetzt das schaurige Krächzen der Tochter! Zum ersten Mal im Leben geriet Birgit vollkommen aus der Fassung.
»Diese Schreckschraube, dieser aufgetakelte Zirkusgaul«, schrie und schluchzte sie, »hat das Glück meiner Tochter zerstört. Ich erwürge sie, wenn sie noch einmal über unsere Schwelle kommt. Schluss, aus, raus mit ihr, wenn du nicht den Mut hast und sie rausschmeißt, ich tu es mit Vergnügen!« Sie schnappte kurz nach Luft, dann setzte sie nach: »Ha, und das ist der Gipfel. Russinnen sind ja so empfindlich! Und die Schwedinnen? Die sind schwachsinnig: Die lassen sich die schönen Stimmen ihrer Töchter kaputtmachen – und zahlen noch dafür. Aber jetzt reicht es. Vielen Dank, habe die Ehre!«
So glühend, so schwungvoll, so hinreißend hatte Nicolai seine Frau noch nie erlebt.
»Was für ein Temperament«, rief er aus und sank vor ihr auf die Knie. »Ein Jammer, dass du mich alten Langweiler geheiratet hast. Du gehörst auf die Bühne!«
»Ja, mach dich nur lustig über mich«, empörte sich seine Frau.
Nicolai wurde pathetisch: »Ich meine es ernst. Und das verspreche ich dir: Madame Krasnicova ist aus unserem Leben bereits verschwunden!«
Am liebsten hätten sich Mutter und Tochter reumütig vor Professor Wettergren im Staub gewälzt und ihn um Hilfe angefleht. Aber das ging nicht, sie schämten sich zu sehr, hatten sie ihn doch schnöde verlassen, hintergangen, mit fadenscheinigen Ausreden, plumpen Lügen. Und der momentane Zustand von Marianas Stimme war wirklich gar zu blamabel. Mariana schämte und grämte sich darüber dermaßen, dass sie ein paar Wochen lang den Mund kaum mehr auftat. Was ihrer Stimme hervorragend bekam. Durch das erzwungene Schweigen erholte sie sich rasch, bald klang sie wieder rund und gesund.
Die falsche Technik ließ sich nicht so einfach beheben. Im Grunde hatte Mariana vom Singen nun keine Ahnung mehr, sie war vollkommen durcheinander. Alleine, ohne Anleitung, würde sie aus dieser verkorksten Situation nicht herausfinden. Auch die Mutter konnte ihr nicht helfen. Marianas Not ging ihr zu nahe. Zwar hatte sie selbst Gesang studiert, aber nie unterrichtet. Die Verantwortung erschien ihr zu groß.
Nun gab es unter den russischen Damen eine weitere Gesangslehrerin, das genaue Gegenteil von Madame Krasnicova, klein, zierlich, überaus vornehm. Und zudem tatsächlich eine ehemals erfolgreiche Künstlerin. Doch als Nicolai auf Frau Gregorija zu sprechen kam, stöhnte Birgit nur auf.
»Oh Gott, nicht schon wieder eine Russin!«
»Professorin am Petersburger Konservatorium«, gab Nicolai zu bedenken, »fragen wir sie doch wenigstens.«
Aber Frau Gregorija zierte sich zunächst: »Anfänger unterrichte ich grundsätzlich nicht.«
Darüber ereiferte sich die eben noch misstrauische Birgit: »Hören Sie sich meine Tochter doch erst einmal an.«
Schließlich einigte man sich auf eine Probezeit.
»Das ist ja fürchterlich, eine Katastrophe«, war auch hier das Erste, was Mariana zu hören bekam. »Wie heißt diese Person? Krasnicova, sagst du, nie gehört. Du lieber Himmel, alles falsch, alles. Ob ich das jemals ausbügeln kann, was diese Ignorantin angerichtet hat! Lange wird das brauchen, lange. Dieses Geknödel und Gequetsche, wo um Gottes willen glaubst du, dass ein Ton entsteht? Doch nicht hinten im Hals. Von der Maske des Sängers, der Maske, davon hast du wohl noch nie etwas gehört«, bemerkte Madame Gregorija mit spitzem Mündchen.
Als erste Maßnahme musste Mariana nun wochenlang nicht enden wollende Übungen auf die Vokale singen. Madame Gregorija jagte sie über Tonleitern, Triller, Quarten, Quinten, aaa, eee, iii, ooo, uuu, ao, ua, ei, hinauf und hinunter, dabei stach sie mit ihren dürren Fingern erstaunlich kraftvoll auf den Flügel ein, Mariana kam nur mit voller Lautstärke gegen das Getöse an. Dazwischen, selten genug, gab es halsbrecherische kleine Texte mit vielen M und N.All das diente der Stärkung der Kopfstimme.
Doch noch ein weiteres Spezialtraining stand an: Mariana, so befand Madame Gregorija, sei ein verkappter Sopran, »meine magischen Antennen täuschen sich nie«. Also versuchte sie, die Stimme mit forcierten Übungen um das hohe C hochzuschrauben. Selbst als Mariana der Hals kratzte und sie wieder heiser wurde, musste sie weitersingen, über Stock und Stein. Denn wenn sie sich auch nur ein einziges Mal vertat, fing Madame Gregorija an zu lamentieren: »Weißt du eigentlich, wen du vor dir hast?« Und dann folgte eine ausführliche Aufzählung aller Opernhäuser, Rollen, Dirigenten, in und unter denen sie gesungen hatte. »Verehrt, bewundert auf der ganzen Welt, und jetzt plage ich mich mit dir ab, glaubst du, ich habe das nötig?«, damit pflegten diese Ausführungen zu enden, zugleich meist auch die Unterrichtsstunde. Auf Tee, geschweige denn Kuchen, legte die Künstlerin keinen Wert, dafür kassierte sie das vierfache Honorar wie Madame Krasnicova, bar auf die Hand, sofort nach der Stunde.
Madame Krasnicova hatte es fertiggebracht, dass Mariana irgendwann keine Stimme mehr hatte. Nach ein paar Monaten Unterricht bei ihrer neuen Lehrerin besaß sie deren zwei, eine Kopfstimme und eine Bruststimme. Jede für sich funktionierte, miteinander zu tun hatten sie nichts. Einmal wagte Mariana zu fragen, ob diese beiden Stimmen nicht miteinander verbunden werden könnten, worauf Frau Gregorija schroff erklärte:
»Das ist der Registerbruch. Den haben alle Sänger. Stell bitte keine solchen blödsinnigen Fragen mehr, sei lieber froh, dass du jetzt zwei Register hast und nicht nur alles aus dem Hals herausquetschst.«
Über die mühsam wieder herbeigelockte Kopfstimme war Mariana tatsächlich überglücklich. Dennoch versuchte sie, wenn sie alleine war, die beiden Lagen übergangslos miteinander zu verbinden. Als Anfängerin hatte sie damit keine Mühe gehabt, jetzt gelang es ihr überhaupt nicht mehr. Wie immer sie es anzupacken versuchte, im besten Fall konnte sie sich von einer Lage in die andere hinübermogeln, aber der Übergang war immer zu hören, oft knarrend oder zittrig verwackelt und unangenehm. Oder sie schaltete einfach um, dann war es, als tönten zwei verschiedene Stimmen aus ihr. Und immer häufiger war sie auch wieder heiser. Vielleicht kam es von der übertriebenen Höhe, vielleicht vom ständigen Anschreien gegen die Begleitmusik.
Aber diesmal ließ sich Mariana nicht ins Bockshorn jagen. Plötzlich erinnerte sie sich daran, dass sie durch ihre vielen Opernbesuche im Herzen schon lange wusste, wie richtiges Singen klang. Ein müheloses Ineinandergleiten der Töne fand da überall statt, die Stimme war eine Einheit, getragen vom Atem.
Anders als bei Madame Krasnicova gab sie sich nicht länger unbesehen die Schuld an ihrem Unvermögen. Mariana hatte tatsächlich dazugelernt. Sie wurde misstrauisch: War Madame Gregorija gerade dabei, ihr einen Fehler anzudressieren, einen ganz schlimmen, womöglich gar nicht mehr gutzumachenden Fehler?
Der nächste Opernbesuch mit den Eltern bestätigte sie in ihrem Verdacht. Sie liebte den ›Troubadour‹, sie kannte ihn in- und auswendig, wenn die Azucena zu singen anfing, hielt es sie kaum mehr aus auf ihrem Sitz. Jetzt verfolgte sie mit neuer Spannung alle Sänger. Sie hatte es geahnt: Keiner von ihnen praktizierte dieses Unding »Registerbruch«. Da quoll es nicht einmal tief aus der Brust und das andere Mal hell aus der Maske. Wenn ein Bruch vorkam, dann als Stilmittel, weil jemand verzweifelt war, ratlos, außer sich.
»Ha, Registerbruch – den haben alle Sänger!«, fauchte sie im aufbrausenden Schlussapplaus die Eltern an. »Aus, vorbei, nicht eine Stunde mache ich da mehr mit.« In ihrer Aufregung war sie nicht mehr aufzuhalten. »Diese aufgeblasene Person! Wenn ihr’s nicht tut, ich sag ihr mit Vergnügen, was ich von ihr halte. Und von wegen Sopran: Die Azucena, das ist meine Rolle. Das habe ich schon immer gewusst.« Und so stand Mariana wieder ohne Lehrer da.
Zwei gefährliche Lehrerinnen hatte ihre offenbar kerngesunde Stimme verkraftet. Weitere Schauermethoden konnte sich Mariana nicht mehr leisten, das Singen war inzwischen für sie mehr als ein spannender Zeitvertreib geworden. Sie hatte nur noch ein Ziel: Sie wollte Sängerin werden. Der nächste Schritt musste der Richtige sein. Auch wenn sie sich vor Verlegenheit dabei wand, sie musste ihn tun.
Als Mariana bei Professor Wettergren erschien, ganz zusammengeschnurrt vor schlechtem Gewissen, einen riesigen Blumenstrauß in der Hand, unterdrückte er alle hämischen Kommentare. Schon auf ihren verworrenen Brief hatte er nur kurz geantwortet: »Na, dann komm halt mal.« Auch jetzt wollte er keine umständlichen Erklärungen, er ließ sie eine Weile reden, bot ihr Tee an, und als sie nicht mehr ganz so unselig auf ihrem Stuhl herumrutschte, fragte er sie:
»Magst du mir vorsingen? Ich begleite dich gerne. Anschließend wissen wir beide mehr.«
Zu Anfang würgte Mariana ein Kloß in der Kehle, aber Professor Wettergren tat so, als merkte er nichts. Nach über einer Stunde hörte er schließlich zu spielen auf, er schaute Mariana aufmerksam an, dann sagte er bewegt:
»Eine wunderschöne Stimme hast du. Natürlich wirst du Sängerin. Was denn sonst? Du gehörst jetzt auf die Musikhochschule, die Aufnahmeprüfung bestehst du mit Sicherheit. Dann ist Schluss mit dem Durcheinander.«
Mariana stürzte sich mit leidenschaftlichem Eifer in ihr Studium, endlich wusste sie, wohin mit ihrem Schwung, ihrer Kraft. Die wichtigsten neuen Lehrer hatte Professor Wettergren für sie ausgesucht.
»Zur Abwechslung mal biedere Schweden, aber glaub bloß nicht, dass die nicht auch kindisch eifersüchtig und missgünstig sind, wechseln könntest du kaum mehr.« Zum Glück kamen Lehrer und Schülerin gut miteinander zurecht.
Mindestens einmal in der Woche, noch jahrelang, pilgerte Mariana zu Professor Wettergren. Sie freuten sich beide auf diese Stunden. Angestachelt durch ihre Begeisterungsfähigkeit, breitete er seine Wissensschätze vor ihr aus, und sie sog alles in sich auf, was er ihr riet. Sie bildeten ein ideales Großvater-Enkelin-Gespann. Zwei glückliche Sangesbesessene. Irgendwann kramte er unter seinen Noten die heißgeliebten Lieder hervor, Schubert, Schumann, Hugo Wolf, Edvard Grieg.
»Gott allein weiß, warum sich an der Hochschule kein Aas um diese Schätze wirklich kümmert, vielleicht nennt man das Tradition«, mokierte er sich. Dort ging es neben dem Gesangsunterricht fast ausschließlich um Opernpartien.
Marianas Stimme war ein Mezzosopran, das bestritt inzwischen niemand mehr. Aber die Grenzen waren fließend, nach oben und nach unten, je nachdem hatte sie eine Tiefe fast wie ein Alt, und bis zu einer bestimmten Höhe blieb die Stimme biegsam und leicht – wer weiß, vielleicht war das Höhentraining von Madame Gregorija doch nicht ganz umsonst gewesen. Zumindest hatte es keinen bleibenden Schaden angerichtet, und Marianas Stimme war einfach von Natur aus so beschaffen. Jedenfalls stand ihr eine Vielfalt interessanter Rollen offen, ganz bestimmt auch die großen dramatischen Mezzopartien, die ihrem leidenschaftlichen Temperament entsprachen.
Daneben gab es noch einen riesigen Stundenplan, Deklamation, Sprechen, Klavierspielen gehörten dazu, Italienisch, Französisch, Deutsch, Theaterspielen, Kompositionslehre, sogar Fechten. Damit all dies Verwendung fände, beschloss Mariana, zusammen mit zwei anderen Mädchen, Erna Erichson und Astrid Berglund, eine Oper zu schreiben: ›Die Drei Musketierinnen‹. Über eine erste Szene mit viel Florettgefuchtel und Geschrei gedieh das Werk nicht hinaus. Doch als dieses Fragment am Ende des ersten Semesters zur Aufführung kam, brachte es seine Sänger-Autorinnen in den Ruf verwegener Ungebärdigkeit. »Trio Infernal« wurden sie von ihren weniger kühnen Kommilitoninnen genannt.
Zwischen Mariana, Erna und Astrid hatte am Tag der Aufnahmeprüfung eine lebenslange Freundschaft begonnen. Zunächst hatten auch sie wie die anderen Prüflinge stumm und in sich gekehrt dagehockt. Alle versuchten sich zu konzentrieren, zu sich zu kommen, bei sich zu bleiben. Mit zitternden Fingern wurde in Noten geblättert, unter leisem Gemurmel eine Arie memoriert, manche saßen wie festgenagelt auf ihrem Stuhl, andere irrten ruhelos umher. Niemand hatte das Bedürfnis, mit einem der Leidensgenossen zu sprechen: Die kostbare Stimme, man hätte sie am liebsten in Watte gepackt.
Mariana fühlte sich ganz wohl in ihrer Haut, aber auch ihr war nicht nach Reden zumute. Die meisten Eindrücke drangen gar nicht in ihr Bewusstsein, aber bei einem zierlichen rotblonden Mädchen hakte sich ein Stück ihrer Aufmerksamkeit fest.
»Du lieber Himmel, der geht’s aber nicht gut.«
Plötzlich sprang das Mädchen auf, käsebleich, und lief auf die Türe zu, im Gang hörte man ihre Absätze klappen, dann war es wieder still.
Das hatten alle gemerkt, doch niemand rührte sich. Nach einer Weile schaute Mariana auf, genau im gleichen Augenblick wie ein blondes Mädchen. Als hätten sie sich abgesprochen, starrten sie sich kurz an, schnellten hoch und rannten zusammen los, schnurgerade zur Toilette. Dort hing die unselige Gefährtin über der Kloschüssel und würgte sich den letzten Rest Galle aus dem Leib. Mariana und das blonde Mädchen knieten neben ihr nieder, tätschelten ihr den schweißnassen Rücken, streichelten die eiskalte Stirn.
»Was hast du, sollen wir einen Arzt holen?«, fragten sie.
Die andere schüttelte den Kopf, schließlich ächzte sie: »Seit vier Tagen warte ich drauf, aber nein, heute muss es kommen, ich hab Bauchweh, mir ist ganz schwindelig.«
Mariana und das blonde Mädchen waren geschickte Hilfsschwestern. Mit Massagen, munterem Gerede, Hin- und Hergeschleppe an der frischen Luft, Tee aus einer Thermoskanne bekamen sie die Geschwächte wieder auf die Beine. Zur endgültigen Stärkung zog Mariana ein Fläschchen aus ihrer Tasche.
»Wodka, den hat mir mein Vater mitgegeben! Übrigens, ich heiße Mariana.«
»Und ich Astrid«, sagte die Blonde.
»Ich Erna. Auf unsere Freundschaft.« Alle drei nahmen einen Schluck aus der Flasche.
Während des Semesters war es gar nicht so einfach, sich überhaupt kennenzulernen, jeder hatte viel zu tun, einige Fächer wurden einzeln unterrichtet, einheitliche Klassen gab es nicht. Zudem eilten außer den Sängern noch andere Studenten durch die langen, kahlen Gänge, Pianisten, Streicher, Bläser, Komponisten, Choristen, Kirchenmusiker. Mariana versuchte aus dem äußeren Erscheinungsbild das Fach zu erraten. Bei den Kirchenmusikern lag die Trefferquote am höchsten.
Am meisten Allüre zeigten die Sänger. Sie gingen offen auf andere zu, schauten ihr Gegenüber mit wachen Augen an, sie nuschelten nicht, jeder konnte weithin verstehen, was immer sie zu sagen hatten. Sie fühlten sich wohl in ihrem Körper – sie waren lebendig. Einem missachteten Leib konnte kein voller, strahlender Ton entströmen.
Das Gehabe mancher Sänger wirkte allerdings erst einmal aufgeblasen und dumm. Sie gefielen sich in irgendwelchen Posen: der affige Angeber, der tiefsinnige Kauz, die zickige Primadonna. Zum Glück gab es die Abschlussfeste. Da lernte man sich besser kennen, und bald stellte sich heraus: Wenn es ans Singen ging, schwanden die Albernheiten dahin, im Eifer des Gefechts wurden die Posen vergessen.
Auch die Studentenaufführungen hatten erfreuliche Auswirkungen. Als Publikum erschienen dazu Verwandte, Freunde, aber auch Fachleute, Chorleiter, Theatermenschen, Dirigenten. Mariana wurde schon bald gefragt, ob sie nicht bei Messen, Passionen, bei Kirchenkonzerten als Solistin mitwirken könne. Die Bezahlung war kläglich.
»Ach was«, sagte Professor Wettergren, »Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du fleißig bist, kannst du deine Mutter und mich mal zum Essen ausführen.« Er war begeistert. »Die Erfahrungen, die du da sammelst, sind unbezahlbar. Als Oratorien-Jule, wie so viele Mezzos, wirst du dein Leben nicht fristen müssen. Welch herrliche Musik lernst du dadurch kennen, allein schon die Altpartie aus dem Verdi-Requiem, gibt es was Schöneres?«
Es war fast unheimlich, wie glatt die Studienzeit verlief, aber Mariana war auch sehr, sehr fleißig. Und wirklich begabt, nicht nur beim Singen. Fremdsprachen machten ihr keine Mühe, am Klavier war sie beliebt als einfühlsame Begleiterin. Sie spielte tollkühn vom Blatt, mit Vorliebe Opern, denn auf diese Weise lernte sie nicht nur ihre eigene Partie kennen, sondern auch den ganzen musikalischen Zusammenhang. Einzig die Kompositionslehre betrieb sie mit mäßigem Eifer, sie war ihr zu theoretisch und sie spürte, dass sie über ein beflissenes Mittelmaß nie hinauskommen würde – so ziemlich das Trostloseste, was sie sich vorstellen konnte.
Die Erfolge beim Studium hatten sie auf gute Weise selbstbewusst gemacht. Sie war jetzt viel sicherer als noch vor zwei Jahren, sie wusste, was sie konnte und was nicht, ihr Anspruch war hoch, an sich selbst, aber auch an die anderen. Vor allem spürte sie inzwischen sehr deutlich, was ihr guttat, ihrer Stimme, ihrem Körper, ihrer Verfassung, und was nicht.
Im Nachhinein war sie geradezu froh über die beiden russischen Katastrophen. Seinerzeit hatte sie ihrer Mutter Vorwürfe gemacht: »Warum hast du mich nicht gewarnt, du hast doch gemerkt, wie miserabel es mir ging. Warum hast du diese Weiber nicht zum Teufel gejagt?« Damals hatte die Mutter geantwortet: »Was hätte ich dir sagen sollen? Du hättest mir doch nicht geglaubt. Ein paar Bemerkungen habe ich riskiert, aber du warst ganz blind und taub vor lauter Hingabe an diese Wunderwesen. Aber dein Retter stand ja schon bereit. Ich glaube, dir macht von jetzt an kein Mensch mehr weis, etwas sei nur so ›richtig‹ und nicht anders, solange dein eigenes Gefühl dagegen spricht.«
Zu Hause führte Mariana ein bequemes Leben. Man ließ sie in Ruhe, sie hatte keine Pflichten, wenn sie ausnahmsweise einmal einen Handgriff tun wollte, zum Beispiel einen heruntergerissenen Saum wieder hochnähen, kam die Mutter und sagte: »Ach lass doch, du bist fleißig genug.« Dass Marianas Mutter so viel Verständnis zeigte, lag sicher auch daran, dass sie selbst Sängerin hatte werden wollen und jetzt die Tochter, ihr so auffallend begabtes Kind, nach Kräften unterstützte.
Auch die russischen Großeltern sorgten für eine etwas lockerere Lebensart. Sie hatten auf dringendes Anraten ihres Sohnes noch rechtzeitig ihr Haus in Sankt Petersburg verkauft und waren in einen Vorort von Stockholm gezogen, in eine große Villa, die alsbald vollgepfropft war mit Elchgeweihen, Teppichen, Ahnenbildern und Ikonen, mit präparierten Auerhähnen, einem ausgestopften Bären, der in seinen Pranken ein Silbertablett hielt, mottenzerfressenen Wolfsfellen, Samowars, ausladenden Kandelabern mit tropfenden Wachskerzen.
Bald platzte das Haus vollends aus allen Nähten, denn im Laufe der kommenden Jahre trafen aus allen Ecken des riesigen Russland immer neue Verwandte ein, Tanten, Onkel, Vettern, Basen ersten, zweiten, dritten, vierten Grades. Einige von ihnen wanderten weiter nach Paris und Berlin. Sie waren aus ihrem behäbigen Nichtstun herausgeschleudert worden und tummelten sich nun in aufregenden, nicht immer ganz seriösen Branchen. Jeder Erfolg wurde nach Stockholm vermeldet, und alle waren stolz, auch Mariana.
Viele von ihnen blieben in Schweden hängen. Marianas Familie war bisher überschaubar klein gewesen. Wenn jetzt die Eltern mit den Kindern bei den russischen Großeltern vorbeischauten, schnatterte, zwitscherte und zeterte es bei denen wie in einer Voliere. Sie hielten ihr Haus offen für alle, ihr Leben lang. Das war mehr als großzügige Gastfreundschaft, das war herzliche Menschenfreundlichkeit.
Ihr Vater hatte diese geerbt, auch ihre Mutter besaß diese wunderbare Eigenschaft. Die Eltern hatten sofort Astrid und Erna, Marianas neue Freundinnen, unter ihre Fittiche genommen. Die waren von auswärts gekommen, mit wenig Geld und ohne einen Menschen zu kennen. Inzwischen gehörten sie zur Familie. Und die elterlichen Hauskonzerte waren sowieso stadtbekannt. In keinem anderen Haus wurde besser und anspruchsvoller musiziert – und anschließend üppiger geschlemmt und gefeiert. Allein an taufrischem Kaviar, den Herr Pilovski auch nach der Revolution aus dunklen Kanälen bezog, waren im Laufe der Jahre sicherlich mehrere Fässer verzehrt worden.
Nach drei Jahren hatte Mariana die Musikschule beendet. Ohne auch nur vorsingen zu müssen, wurde sie in die Opernschule übernommen. Und nach deren Abschluss boten ihr zwei Opernhäuser ein Engagement an: Stockholm und Göteborg. Mariana entschloss sich für Göteborg.
Vielleicht war es verrückt, ein Angebot der Stockholmer Oper auszuschlagen. Aber Mariana fühlte deutlich, dass sie erst einmal versuchen musste, auf eigenen Füßen zu stehen. Dazu musste sie von zu Hause weggehen, es half alles nichts. Gewiss, sie hätte eine eigene Wohnung nehmen können. Ja und dann? Dann würde sie ständig zu den Eltern laufen, und nichts hätte sich wirklich geändert. Auch die Eltern sahen es ein, Birgit brachte die Situation auf den Punkt: »Andere junge Leute fliehen aus der Familie, weil sie sich nicht mit ihr vertragen, du solltest gehen, weil wir uns zu gut verstehen.«
Aber auch aus Stockholm musste sie herauskommen. Außer Sankt Petersburg kannte Mariana bisher nur ihre Heimatstadt. Ein vorsichtiger erster Schritt vor die Stadttore empfahl sich also und war nicht überhastet. Sehr viel mehr war es nicht, wenn sie sich jetzt nach Göteborg aufmachte. Professor Wettergren lobte Marianas Entscheidung sehr:
»An einem kleinen Theater wirst du viel mehr zum Zug kommen. Etwas abseits vom Schuss geht es nicht gleich um Kopf und Kragen.« Auch mit dieser Prophezeiung behielt er recht.
In der ersten Zeit tat sich Mariana vor allem als Kammerzofe, Amme, Magd oder Dienerin hervor. Das kam ihr durchaus gelegen, sie musste sich erst einmal eingewöhnen, alles war aufregend und neu, die Theaterwelt, die Stadt, das Alleinsein – wirklich ihr ganzes Leben. Immerhin, so viel merkte sie rasch: Sie war ein richtiges Theatertier. Sobald sie die Bühne betrat, fühlte sie sich verwandelt. Ihre Nüstern blähten sich und schnupperten entzückt die leicht muffige Luft, wollüstig berührten ihre Füße den an einigen Stellen sachte knarrenden Holzboden, die Scheinwerfer oben im Schnürboden erschienen ihr geheimnisvoller und strahlender als jeder kristallene Lüster, nichts fühlte sich zärtlicher an als der samtene große Vorhang.
Nie langweilte sie sich auf den Proben, auch wenn sie lange Zeit nichts zu sagen und nichts zu tun hatte. Sie saß eben da und verfolgte aufmerksam jeden Gang, jeden Satz, jedwedes Geschehen. Sobald sie in ein Kostüm stieg, fühlte sie sich verzaubert, auch wenn es ihr nicht schmeichelte. In den grauen Lumpen einer alten Frau schrumpelte sie zusammen und zog humpelnd ein Bein nach.
Beim ersten Ton unten im Orchester fuhr es ihr in alle Glieder. Schon bei den Proben. Bei den Aufführungen vibrierte jede Faser in ihr, nicht vor Angst oder Aufregung, es war Begeisterung. Doch sobald sie den ersten Ton gesungen hatte, überkam sie konzentrierte Ruhe, nichts konnte sie aus dem Konzept bringen, einen Weltuntergang hätte sie sicher gar nicht gemerkt.
Ein schlaksiger junger Mann war genauso theaterbesessen wie Mariana. Er sauste durchs Haus, von der Bühne hinauf in die Direktion, hinüber zu den Werkstätten, hinunter in die Kantine, er holte Kaffee, schleppte Requisiten herbei, er klopfte die Sänger rechtzeitig für ihren Auftritt aus den Garderoben heraus. Kurzum, als »Mädchen für alles« hatte er sich um alles zu kümmern, jeder schrie nach ihm, der Regisseur, die Garderobiere, die Beleuchter, die Sänger. Er wurde dauernd herumgescheucht und angeschnauzt für Dinge, für die er gar nicht zuständig war, aber man hatte sich so an ihn gewöhnt: »Himmeldonnerwetter, warum ist der Stuhl nicht da? Wo stand er denn vorher?«
Da Mariana gut aufgepasst hatte, sagte sie es dem jungen Mann. Er hieß Björn Eksell, kam aus Göteborg und hatte gerade die Schule hinter sich gebracht.
»Ich kann nicht singen, nicht tanzen, ich will kein Schauspieler werden. Aber ich muss zum Theater. Das ist mein Leben. Ich weiß das«, erklärte er Mariana in einer kurzen Verschnaufpause.
Sie wurden schnell Freunde. Björn lud Mariana sogar zu sich nach Hause ein. Bald hatte Mariana das Gefühl, ihr Freund würde an der Oper zu schlecht behandelt. Er bekam nicht einmal ein Taschengeld. Weil er sich so eifrig um eine Stelle beworben hatte, nutzte man ihn jetzt aus. Er war beliebt, aber etwas ruppig sprangen doch einige mit ihm um, aus Nervosität oder einfach nur aus schlechter Laune, auch wenn sie ihm anschließend versöhnlich auf die Schulter klopften.
Ein hochgewachsener Schnösel erregte Marianas besonderes Missfallen. Ein blasierter Faulenzertyp. Er gehörte zum Regieteam, seine genaue Funktion ließ sich nicht ausmachen, allenfalls war er der Assistent des Assistenten, ein Hospitant oder ein geduldeter Zuschauer. Was er zu sehen bekam, schien ihn zu langweilen, wenn seine Miene überhaupt etwas ausdrückte, dann allenfalls: »Ich würde das alles anders machen.« Er hing, die Beine lässig übereinandergeschlagen, in einer Reihe hinter dem Regisseur – der ihn einfach nicht zur Kenntnis nahm. Wer immer an ihm vorbeiwollte, der stolperte über seine erstaunlich großen Füße, die in hässlichen gelblichen Schuhen steckten. Mit mürrischer Miene erwartete er eine Entschuldigung des Gestrauchelten.
Von der Bühne aus beobachtete Mariana sein unverschämtes Verhalten, sie hätte dem Kerl etwas gehustet. Die Art und Weise dagegen, wie er mit Björn umsprang, machte sie immer wütender. Denn ausgerechnet dieser Nichtsnutz kommandierte den Armen am meisten herum, schnippte nach ihm mit den Fingern, schickte ihn Kaffee holen und pfiff ihn an: »Ja wird’s bald?«
Mariana bekam es von der Bühnenrampe aus mit. Mit einem Sprung war sie im Parkett und fauchte: »Lüpfen Sie doch selbst Ihren Hintern und holen Sie Kaffee. Da wird Ihnen kein Zacken aus der Krone brechen.« Für ein vertrauliches »Du« war ihr der Kerl viel zu unsympathisch. »Sind Sie Russe?«
Der Regieassistent kicherte, der Regisseur drehte sich um und blickte den jungen Mann zum ersten Mal an, während er langsam sagte: »Nein, der Herr ist aus Göteborg. Der Sohn des Polizeipräfekten, ein gütiges Schicksal hat ihn uns zugeteilt.«
»So, so«, meinte Mariana laut in das nun folgende Schweigen hinein und drehte sich auf dem Absatz um.
Sie ging schnurstracks in den dritten Stock hinauf zur Direktion und bat die Sekretärin um ein Gespräch mit dem Verwaltungsdirektor.
»Fräulein Pilovskaja, was kann ich für Sie tun, Sie fühlen sich doch hoffentlich wohl bei uns?«, fragte der Direktor überrascht.
»Oh ja«, sagte Mariana, »ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie glücklich ich hier bin, es gefällt mir ausgezeichnet. Aber es geht um diesen jungen Mann, Björn Eksell. Der ist wirklich liebenswürdig. Und bienenfleißig, er reißt sich fast in Stücke, wenn wir den nicht hätten, würde vieles nicht so gut klappen. Nur, und da frage ich Sie, ist so jemand als Laufbursche nicht zu schade? Es ist unglaublich, wie der sich in Opern auskennt, wie er sie liebt und was er von Stimmen versteht. Davon könnte sich manch einer etwas abschneiden.« Mariana hielt inne, sie hatte spontan dahergeredet, aber nun fügte sie rasch hinzu: »Bitte verstehen Sie mich recht, der junge Mann hat sich nicht beschwert, ganz im Gegenteil, er ist eifrig wie am ersten Tag, und er hat keine Ahnung, dass ich mich einmische.«
Der Direktor hatte von dem fleißigen Jüngling noch nichts gehört, als Gratis-Hilfskraft hatte man ihn so nebenbei eingestellt. »Erstaunlich«, murmelte er und schaute sich Mariana interessiert an. Die lächelte, aber in ihren Augen glomm ein Fünkchen Aufmüpfigkeit. Das gefiel ihm. »Ich werde mir Ihren Schützling ansehen. Und kein Mensch erfährt von unserem Gespräch«, versicherte er Mariana.
Die Angelegenheit erledigte sich von selbst. Nach einer anstrengenden Probe, bei der nichts klappte, platzte dem Regisseur der Kragen. Er ertrug den nutzlosen Voyeur, der ihm dauernd im Nacken saß, nicht länger. Mit förmlicher Stimme sagte er im Hinausgehen:
»So, heute haben Sie gelernt, was alles nicht passieren darf. Jetzt haben Sie einen guten Überblick, wie es auf dem Theater zugeht. Mehr können wir Ihnen nicht bieten hier in der Provinz. Wir möchten Ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Sie haben sicher Großes vor, toi, toi, toi.«
Für einen Augenblick verrutschte dem Polizeipräfektensohn die Blasiertheitsmaske, hilflos stand er da – kümmerlich. Immerhin gelang ihm ein einigermaßen würdevoller Abgang.
Immer noch ärgerlich, packte der Regisseur Björn am Arm: »Komm, wir gehen zur Direktion.« Dort schimpfte er weiter: »Ihr lasst mich einfach sitzen mit diesem blasierten Idioten. Er hier, ohne ihn hätte ich heute das Handtuch geschmissen. Er ist ab heute mein zweiter Assistent. Gebt ihm einen Vertrag. Und Geld!«
»Da muss ich erst mit dem Intendanten reden. Wie heißt denn der Retter?«, fragte der Direktor.
»Björn«, sagte der Regisseur, »Björn Eksell.«
»Ach so«, entfuhr es dem Direktor. »Na, dann allemal. Machen wir gleich den Vertrag.«
Noch bei einem anderen Göteborger Opernjüngling sollte Mariana Schicksal spielen – wenngleich viele Jahre später und wahrhaftig entgegen ihrer Absicht. Das war Jens Arne Holsteen, ein blutjunger Geselle, der neben seinem Studium bereits die zweite Kapellmeisterstelle innehatte und seine Unsicherheit und geradezu krankhafte Schüchternheit hinter hochfahrender Arroganz zu verstecken suchte. Ebenfalls schüchterne, überempfindliche Wesen brachte er damit völlig durcheinander, stabilere Naturen mit mehr Selbstvertrauen wie etwa Mariana kamen ganz gut mit ihm zurecht. Bei ihnen verzichtete er von vornherein auf alles Imponiergehabe, da gab er sich beflissen, geradezu charmant. Mariana war zwar nicht immer seiner Meinung, doch seine Luchsohren, sein Wissen, sein Können als Musiker und sein fanatischer Eifer imponierten ihr.
Als einmal seine Eltern wie zwei düstere Raben in Göteborg auftauchten, bekam sie eine Ahnung davon, welchen Hintergrund dieser Jens Arne hatte. Der hochaufgerichtete Vater machte in seinem schwarzen Gehrock eigentlich eine gute Figur – wären da nicht die nach unten gezogenen, aufeinandergepressten Lippen und die stechenden Augen gewesen. Überhaupt umgab den ganzen Menschen ein Panzer aus Eiseskälte. Herr Holsteen war ein protestantischer Gottesmann, Inhaber eines höheren geistlichen Amtes, sowie Mitglied mehrerer kirchlicher Gremien und Verfasser moraltheologischer Schriften, in denen er die Sündhaftigkeit der Menschen, ihren Hang zum Bösen, ihre Verführbarkeit mit Bitterkeit umkreiste. »Das Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf«, davon war Herr Holsteen durchdrungen.
Auch Frau Holsteen erschien von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Eine Matrone, die stets erhobenen Hauptes hinter ihrem Gatten herwatschelte, wie schnell er auch eilte, und Wert darauf legte, mit Titel angeredet zu werden: »Frau Oberkirchenrat«. Dem hoheitsvollen Paar folgte ein junges Mädchen, ein munterer kleiner Trampel, Jens Arnes jüngere Schwester Amélie. »Ich sing auch schrecklich gern«, erzählte sie gleich Mariana. Aber eine Ausbildung, ach was, sie war ein Mädchen, da lohnte sich das nicht, das Studium des Bruders verschlang schon ein Vermögen. Den Bruder bewunderte sie über die Maßen: »Ein Genie. Ganz einfach.« Dieser Ansicht war auch die Mutter.
Jens Arne hatte sich beim Anblick der Eltern in sich selbst verkrochen.
»Strindberg und Co. lassen grüßen. Das größte Geheimnis ist: Wie kommen diese Fossilien zu der harmlosen, netten Tochter?«, zischelte Mariana Björn zu. »Unser lieber Jens Arne kann sich gratulieren. Ein Funken Genie steckt wohl wirklich in ihm.«
In Marianas zweiter Spielzeit startete die Oper ein ehrgeiziges Projekt: Den ›Ring des Nibelungen‹. Mariana vollführte schwimmend ihren Einzug in Wagners Opernwelt, als Floßhilde, eine der drei Rheintöchter. Auch ihre beiden Nixenschwestern waren Wagner-Neulinge. Der Regisseur hatte sich für die hübschen Mädchen allerhand turnerische Verrenkungen ausgedacht, an Seilen schwebend umgirrten sie den täppischen Alberich, aufreizende Schleiergewänder bedeckten nur knapp ihre Blößen. Darüber empörten sich die älteren Damen im Parkett, während die älteren und auch jüngeren Herrn sehr interessiert durch ihre Operngucker starrten. Die Presse lobte auch den glockenreinen Gesang.
Seit dieser Aufführung bekam Mariana von fremden Menschen Blumen hinter die Bühne geschickt, richtige Angebinde. Das beeindruckte ihre Familie, die zur Premiere erschienen war. Vor allem Alexej, Marianas Bruder, war zum ersten Mal stolz auf die Schwester:
»Siehst du, Kleider machen Leute. In deinen Lumpen, als altes Mütterchen, hast du mir nicht so gut gefallen.«
Als Nächstes trat sie in der ›Walküre‹ auf, als eine der Wotanstöchter durfte sie endlich eine Waffe schwingen, sie schickte gleich ein Foto an Erna und Astrid.
Im ›Siegfried‹ hatte sie nichts zu tun. In dieser Zeit bekam sie Urlaub für eine Gastrolle in Kopenhagen. Dort wurde ›Boris Godunow‹ in der Originalsprache gegeben, und weil man wusste, dass Mariana Russisch konnte, bot man ihr die Rolle des jungen Fjodor an. Zudem wollte man Kontakt aufnehmen mit der jungen Sängerin. Auch Oslo hatte schon Interesse gezeigt, aber aus Termingründen hatte Mariana bisher immer absagen müssen. Jetzt genoss sie den Abstecher in die Fremde, Kopenhagen gefiel ihr, dort kam es ihr weltläufiger vor als in Stockholm.
Dann aber musste sie eilig zurück nach Göteborg, denn in der ›Götterdämmerung‹ wurde sie gleich doppelt eingesetzt. Wiederum als Floßhilde und zusätzlich als eine der Nornen. Zwei Tage vor der Premiere erkrankte die Waltraute. Eine Zweitbesetzung gab es nicht, Mariana hatte an der Opernschule die Partie studiert, über Nacht frischte sie ihre Kenntnisse auf. Jetzt war sie wirklich enorm beschäftigt: In eine düstere Kutte gehüllt, musste sie mythische Webarbeit beraunen, leicht geschürzt den eigensinnigen Helden Siegfried umschmeicheln. Oder in voller Walkürenmontur die Schwester Brünnhilde, die für einen unseligen Augenblick lang glücklich Verliebte, warnen. Vergeblich, umso größer war ihr Erfolg beim Publikum. Auch die Presse war begeistert: Die »sehr erfolgversprechende junge Künstlerin« wurde nun plötzlich zur »großartigen Gestalterin«. So etwas nannte man einen Durchbruch.
Prompt bekam sie ein Angebot aus Stuttgart. Das war in der Opernwelt eine hervorragende Adresse, gerade für junge Sänger, für die sich das Haus besonders interessierte. Es ließ sie durch Späher überall ausfindig machen und bot ihnen gute, mehrjährige Verträge. Ein Engagement in Stuttgart galt als große Chance.
Auch Mariana empfand es so. Sie schaute in Björns Schulatlas nach, sie nahm sogar einen Zirkel: Dieses Stuttgart lag mitten im europäischen Festland, es schien so etwas wie ein Nabel Europas, nun ja, nicht Wien, nicht Paris, nicht Berlin. Aber das war gut so, dorthin hätte sich Mariana noch nicht getraut. Sie fühlte, wie das Fernweh nach ihr griff. Göteborg war der erste Schritt gewesen, gut, dass sie ihn getan hatte. Sie hatte viel gelernt, Erfahrung gesammelt, jetzt war sie keine Anfängerin mehr. Die nächste Etappe durfte ruhig größer sein.
Bevor sich Mariana nach vielen Abschieden auf die große Reise machte, kaufte sie zwei köstlich duftende, edle Lederkoffer. Sie kosteten sie eine Monatsgage, ein Spottpreis für zwei treue Reisegefährten rund um die Welt.
Stuttgart gefiel Mariana auf Anhieb. Die Stadt war von grünen Hügeln umgeben. Doch was da wuchs, waren nicht nur Bäume und Büsche, sondern auch Reben, die Weingärten reichten bis an die Häuser heran. Aus ihnen wurde ein süffiger, »räser« Wein gekeltert, den die Stuttgarter am liebsten selbst tranken, in ziemlichen Mengen, das nannten sie dann »ein Viertele schlotzen«. Und wer keinen Wein hatte, trank Most, Apfel- und Birnbäume wuchsen ja überall.
Die ganze Stadt schien opernnärrisch zu sein. Die Sänger wurden geliebt und verhätschelt, man grüßte sie selig auf der Straße, betrat einer von ihnen einen Laden, eilte der Besitzer herbei und bediente eigenhändig die hohe Kundschaft, und selbstverständlich murrte keiner der anderen Kunden, sie strahlten ihren bewunderten Liebling an und beschnatterten anschließend sein aufregendes Erscheinen.
An der Oper wurden fast ausschließlich hauseigene Sänger eingesetzt, selten Gäste, sie brachten nur Unruhe durch ihre Sonderwünsche und fügten sich meist nicht harmonisch ein in die sorgfältigen Inszenierungen. Neben den jungen Leuten gehörten auch altbewährte, zum Teil berühmte Kräfte zum Ensemble. Das spornte an, jeder wusste, wie gut die anderen waren. Und doch gab es kaum Neid und erstaunlich wenig Intrigen, nicht nur gemessen an anderen Häusern. Denn der Spielplan war so vielfältig gefächert, dass jeder zum Zug kam.
Marianas Einstandsrolle war die Nancy in ›Martha‹ von Flotow. Die Regie besorgte ein bekannter Theaterregisseur. Er und sein Bühnenbildner hatten sich für ihr Operndebüt die leichtfüßige ›Martha‹ ausgesucht und sich für die Partien der beiden jungen Damen und ihrer Verehrer junge, unverbrauchte Sänger erbeten.
Jetzt waren die beiden Herren von ihren vier Protagonisten entzückt. Liebevoll dachten sie sich für sie schnurrige Dinge aus, kleine Pannen, verstohlene Blicke, verräterische Gesten. Es ging very British zu, aber fernab der sonst üblichen Klamotte entstand die Komik durch winzige Abweichungen, Ungereimtheiten. Ganz sanft wurde die feine englische Art durch den Kakao gezogen.
Alle amüsierten sich köstlich auf den Proben. Das brauchte nicht unbedingt ein gutes Zeichen zu sein. Gerade wenn sich die Akteure vor Lachen auf die Schenkel schlugen und alles ganz wunderbar fanden, konnte es vorkommen, dass nachher die Premiere bleiern durchfiel. Doch diesmal blieb der fröhliche Schwung erhalten – und das bezaubernde Bühnenbild machte England-süchtig. Die Aufführung wurde ein absoluter Renner und immer wieder auf den Spielplan gesetzt, jahrelang.
Für Mariana war das ein Traumstart. Ein paar Wochen zuvor hatte kein Mensch in Stuttgart jemals von ihr gehört, durch ihre Nancy avancierte sie zu einem der gehätschelten Sängerlieblinge, konnte in mannigfachen Einzelheiten ihren wachsenden Bekanntheitsgrad wahrnehmen: Zum Beispiel bekam sie beim Metzger immer bessere Stücke. Seitdem Mariana eine eigene Küche hatte, brutzelte sie sich nämlich ab und zu ein Steak.
Diese erfreuliche Entwicklung beflügelte Mariana bei ihren zaghaften Kochversuchen. Nach acht Wochen das erste genießbare Steak, das ist doch was, lobte sie sich selbst. In der gleichen Zeit hatte sie ihr Schuldeutsch aufpoliert und fließend Deutsch zu sprechen gelernt. Bald verstand sie auch Schwäbisch.
Mariana wohnte im obersten Stock eines schönen dreigeschossigen Mietshauses in halber Höhe über der Stadt, mitten in einem reichen, gepflegten Viertel. Um das Haus herum lagen Gärten und Villen. Über eine merkwürdige Treppe mit Hunderten von ungewöhnlich breiten, niedrigen Stufen, die sich den Hügel hinunterschlängelten, erreichte Mariana in zwanzig Minuten die Oper. Heimwärts dauerte es sehr viel länger, aber da konnte sie die Straßenbahn nehmen. Wegen der schönen Aussicht, die man dann auf die Stadt hatte, war eine solche Fahrt wie ein Ausflug.
Unter ihr wohnte ein Kunsthistoriker mit seiner Frau. Er sah aus wie ein Ire oder Schotte aus uralter Familie, feingliedrig, rotblond, mit einem scharfgeschnittenen Vogelgesicht. Sie glich einer verführerischen Odaliske, lackschwarz der kurzgeschnittene Bubikopf, schneeweiß die samtweiche Haut. Ein interessantes, schönes Paar, das Vernissagen, Premieren, Konzerten, bei denen es auftauchte, großstädtischen Glanz verlieh.