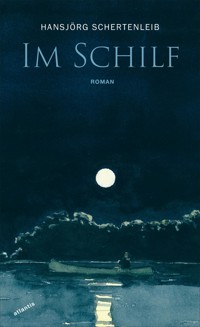
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Angelhütte am See hat Viktor von seinem Schwiegervater übernommen. Hier haben Max und er Tage und Nächte der Seligkeit verbracht, halb verwildert, am Lagerfeuer, im Glück über den guten Fang. Als Viktor eines Morgens das Ruderboot aufs Wasser hinauslenkt, erreicht ihn ein Anruf: Man teilt ihm mit, dass sein Vater gestorben ist, auf dem Amtsweg. Dieser Vater, der ihn ein Leben lang gegen eine Mauer der Ablehnung rennen ließ, löst nur wenig gute Erinnerungen aus, und eigentlich hat Viktor längst Max an seine Stelle gesetzt. So kommt ihm jetzt auch dieser andere Abschied in den Sinn, die Fahrt mit seiner Ex-Frau nach Irland, Max' leerer Blick. Dessen letzter Wunsch, die Asche an einem Lieblingsstrand zu verstreuen, bescherte ihnen dann eine weitere, absurde Reise - mitsamt Urne die Küste entlang. Doch auch der echte Vater, der wenig über sich sprach, ruft nach einer Geschichte. Viktor entschließt sich, ihm eine zu geben.Geschickt verbindet Hansjörg Schertenleib in seinem neuen, sehr persönlichen Buch Momente des Angelglücks am Sihlsee mit einem Roadtrip durch Irland und erhellt parallel dazu das Schicksal eines Verdingbubs, der sein ungeliebter Vater war. Ein packender Roman um Beschädigung, Scheitern und Selbstbehauptung - temporeich und stringent erzählt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hansjörg Schertenleib
Im Schilf
Roman
atlantis
Für Brigitte, love, life, wife.
Für Romana, die es mit ihm aushielt,
für Monika, die unter ihm litt,
und für Sonja, die er auf Händen trug,
bis er sie ebenfalls fallen ließ.
Ich suchte mir einen hohen Felsen,
wo ein warmer Nachtluftzug ging.
Dort schlief ich ein, während tief unten
die Fische zwischen spitzen Steinen zuckten.
Harry Martinson
Am See
Zischelnd gleitet Max’ Ruderboot durch den Teppich aus Seerosen ins offene Wasser und in die Morgensonne, die um die frühe Zeit noch kaum Kraft hat, da klingelt mein Handy: Mein Vater Arthur ist am 11. Januar, vor sechsundvierzig Tagen also, in einem Pflegeheim verstorben, zweiundvierzig Tage vor seinem 91. Geburtstag. Aus dem mit gelben Adern gesträhnten Himmel fällt ein fahler Lichtstrahl, trifft den See und blendet die Welt aus. Der Beamte des Amtsnotariats, der mich informiert, ist verständnisvoll und behutsam, in seiner Stellung wird er zerrüttete oder aus dem Lot geratene Familienverhältnisse gewohnt sein, jedenfalls vermittelt er mir nicht den Eindruck, er halte es für eigenartig oder falsch, dass er und nicht die Lebenspartnerin meines Vaters mich informiert. Ich falle in einen weißen Abgrund, fange mich aber gleich wieder; im Dickicht schimmern Spinnennetze, aufgespannt zwischen Ästen, die Taumäntel tragen. Die Weide, neben der Max und ich eine Stelle von Ranken und Unkraut befreit und zu einem versteckten Lagerplatz geebnet haben, ist niedergesunken und liegt im Wasser, der Schlag meiner Ruder versetzt ihren Stamm in träges Schaukeln. Ich empfinde Erleichterung, keine Trauer, bin vom Vorwurf erlöst, ein Leben lang der falsche Sohn gewesen zu sein. Mein Vater ist tot, und ich bin, mit vierundsechzig Jahren, befreit. Wir haben uns vor über sechs Jahren das letzte Mal gesehen und seither nicht ein Wort miteinander gewechselt. Mit vierzehn stellte ich mir zum ersten Mal vor, er sei tot, mit fünfzehn brachte ich ihn das erste Mal in Gedanken um, mit sechzehn zog ich von zu Hause aus. Etwas vom Schlimmsten, was man mir sagen kann, denn es ist eine Anschuldigung, eine falsche dazu, lautet: »Du bist wie er!« Dass ich ihm ähnlich sehe, und zwar mit jedem Altersjahr deutlicher, kann ich hingegen nicht bestreiten.
Knisternd tauen die Rispen des Rietgrases in der Morgensonne, Äste knacksen verschämt, Zweige lösen sich aus der Erstarrung, in die sie der Frost gezwungen hat, der über Nacht anschlug; die Kälte hatte mich gegen drei Uhr geweckt, ich schälte mich aus dem Schlafsack, nahm Max’ Wolldecke der Schweizer Armee aus dem Schrank, legte sie mir um die Schultern und trat auf die Veranda hinaus, um dem Glucksen des Wassers zu lauschen und auf erste Vogelstimmen zu warten. Im Morgengrauen nahm ich die Blechbüchse aus ihrem Versteck unter dem Bett, in dem Max früher schlief, und breitete die Schätze auf dem Bretterboden aus, die wir im Lauf der Jahre gesammelt haben und die außer uns nie jemand gesehen hat oder sehen wird.
Nachdem sich der Beamte verabschiedet hat, habe ich das Bedürfnis, meine jüngere Schwester Tanja anzurufen, da fällt mir mein letzter Besuch bei ihr ein, der bestimmt zehn Jahre zurückliegt; ihre Multiple Sklerose überfordert mich, doch das schlechte Gewissen, mich nicht genügend um sie zu kümmern, ist offenbar nicht groß genug, um sie häufiger zu sehen. Wir saßen auf dem Balkon ihres Heimzimmers, sie hatte zu viel Make-up aufgelegt, roch nach einem süßlichen Parfum, rauchte Kette und sah mich misstrauisch an, als werfe sie mir vor, dass es mir besser ging als ihr. Die Unsicherheit, ob ich mein Entsetzen über ihr Aussehen verbergen konnte, überspielte ich mit einer aufgesetzten Heiterkeit, die sie sicherlich durchschaute, das Unbehagen, das ihre unausgesprochenen Vorwürfe an mich auslösten, war so groß, dass ich bald nur noch über Ausreden nachdachte, um mich so schnell wie möglich verabschieden zu können. Das kalte, höhnische Lachen, das sie sich angewöhnt hatte, war mir so unangenehm wie der bittere Zug um ihren Mund und der Blick ins Leere, in den sie verfiel, sobald wir nicht über ihre Krankheit und ihr Leben im Heim redeten. Tanja hat schon immer gern im Mittelpunkt gestanden, aber seit sie krank ist, gibt es kein anderes Thema mehr, das sie interessiert; ich bin es leid, mir sagen lassen zu müssen, wie viel Glück ich habe, auch angesichts der Tatsache, dass unser Vater sie bevorzugte und ihr alles erlaubte, was uns Älteren, Veronika und mir, verboten war. Es gelang mir, die wilde Sehnsucht, die ich auf dem Heimbalkon plötzlich verspürt habe, die Sehnsucht, wieder jung zu sein und am Anfang meines Lebens zu stehen, nicht meiner Schwester vorzuwerfen, aber sie hat meinen Unwillen gespürt, in unserer Vergangenheit zu wühlen, um eine Nähe zwischen uns heraufzubeschwören, die vielleicht nie existiert hat. Über meine Lüge, sie bald wieder zu besuchen, ist sie kommentarlos hinweggegangen, kühl hat sie mich gemustert und dann spielerisch gegen den Oberarm geboxt, wie sie es als Teenager gern tat: »Hättest du mich wiedererkannt? Auf der Straße, mein ich? Ich dich auch nicht! Alt, wie du geworden bist, Bruderherz. Du hast mir gefehlt.« Mit dem »manchmal«, das sie nach einer kurzer Pause nachschob, hat sie mich vom Balkon in ihr Zimmer gedrängt.
Ein Dutzend kräftiger Ruderschläge genügt, um nicht in die Strömung zu geraten, die mich auf das Willerzeller Viadukt zutreiben würde, wie Max es mir gezeigt hat. Der verschilfte Uferbereich, in dem wir eines Nachts das Ruderboot nicht mehr fanden, nachdem wir auf der angrenzenden Wiese den gefangenen Hecht gebraten hatten, liegt keinen Steinwurf entfernt seeaufwärts. Der Holzverschlag, in dem wir damals die Nacht verbrachten, ist abgerissen worden, jetzt steht ein Carport dort. Früh am Morgen waren wir von einer Gans über die Wiese gejagt worden, die sich aufrichtete, triumphierend mit den Flügeln schlug und uns böse anfauchte.
Statt an meinen verstorbenen Vater denke ich an die Irlandreise, die ich vor vier Jahren mit Charlotte unternommen habe, obschon wir uns neun Monate davor endgültig getrennt und auf eine gütliche Scheidung geeinigt hatten. Charlottes verwitweter Vater Max hatte bei Ferien in Irland eine Frau in seinem Alter kennengelernt und war noch vor unserer Trennung kurz entschlossen zu ihr gezogen, um seinen Lebensabend mit ihr zu verbringen. Wir hatten zwar beide oft mit Max geskypt, aber besucht hatten wir ihn nie. Als Charlotte mich vor vier Jahren anrief, teilte sie mir aufgelöst mit, er liege im Sterben und wünsche sich, uns noch einmal gemeinsam zu sehen; wir hatten ihm nicht gebeichtet, dass wir kein Paar mehr waren. Die Nachricht hatte mir den Boden unter den Füßen weggeschlagen, und obwohl Charlotte sich die Unverschämtheit »Es wird dir leichtfallen, nur zu spielen, mit mir verheiratet zu sein« nicht verkneifen konnte, hatte ich zugesagt, sie als ihr Ehemann zu begleiten, um Max ein letztes Mal zu sehen.
Der leichte Dunst, der vom See aufsteigt, lichtet sich rasch, ich hebe die Riemen aus dem Wasser, kippe sie ins Boot, stelle sicher, dass die Dollen festsitzen, lege mich unter den Ruderbänken auf den Rücken und decke mich mit Max’ Wolldecke zu, um die Reise nach Irland in der Erinnerung noch einmal zu erleben und störenden Gedanken an meinen gestorbenen Vater aus dem Weg zu gehen.
Die Reise
Eins
Charlotte wartete an der Sicherheitskontrolle, sie hatte sich um Flugtickets und Boardingpässe gekümmert, am Flughafen Dublin einen Mietwagen reserviert und in einem Hotel in der Nähe von Ramelton zwei Zimmer gebucht, »weil in Letterkenny, wo mein Vater im Krankenhaus liegt, kein Mensch freiwillig über Nacht bleibt«. Im Zug zum Flughafen hatte ich es endlich geschafft, meinen Ehering auszuziehen; er glitt so mühelos vom Finger, als wollte er mich für all die vergeblichen Versuche der letzten Monate verhöhnen. Kann man ungeduldig stehen? Charlotte kann es, es hat mich von Anfang an gestört: Sie stand still vor dem Zugang, trotzdem war es, als springe sie quengelig auf und ab. Wie üblich war sie dezent geschminkt und bewies, wie wenig es braucht, wenn man alles hat. War ich etwa wieder bereit, zu sehen, was mir an ihr gefiel, statt all das, was mich an ihr störte? Ihre roten, schulterlangen Haare hatte sie mit einem hölzernen Kamm bewusst nachlässig hochgesteckt, sie trug Sachen, die ich nicht kannte. Wir umarmten uns auf jene unbeholfene und forciert zurückhaltende Art, die jedem Menschenkenner bestimmt sofort verrät, dass wir vor nicht allzu langer Zeit noch ein Paar waren und nach der richtigen Distanz suchten, die unserer neuen und noch ungewohnten Beziehung entsprach.
»Danke, machst du mit, Vik.«
»Wie geht es ihm?«
»Der Krebs hat gestreut. In der Niere, in der Lunge. Er wird blind.«
»Stirbt er?«
Vor dem Blick, mit dem sie mich ansah, habe ich mich im letzten Jahr unserer Ehe regelrecht gefürchtet. Der Blick sagt: Ich weiß, wer du in Wirklichkeit bist! Der Beamte, der uns durch die Sicherheitsschleuse winkte, reagierte auf Charlotte, wie es viele Männer tun: mit devoter Bewunderung. Wie wichtig es ihr ist, gemocht zu werden, war mir erst Monate nach unserer Hochzeit bewusst geworden.
Wir saßen in der siebten Reihe, Charlotte am Fenster, ich in der Mitte zwischen ihr und einem jüngeren, bulligen Mann, der stark schwitzte und während des ganzen Fluges vor sich hin murmelte. In den letzten Flugminuten, als das Festland Irlands zum Greifen nah vor uns lag und wir in rasch schwindender Höhe über aufgewühltes graues Meer glitten, geriet die Maschine in Turbulenzen, und mein Sitznachbar packte meinen Arm, ließ ihn aber sofort wieder los und entschuldigte sich.
Es dauerte beinahe eine Stunde, bis wir im Mietwagen saßen, einem weißen Opel Astra mit Automatikgetriebe, in dem es nach Putzmittel roch und auf dessen Armaturenbrett ein langes blondes Haar lag, das in die Höhe stieg und davonschwebte, als ich die Fahrertür zuzog. Die ersten Meilen fuhr ich unsicher, Charlotte fährt ungern, mir macht es nichts aus, erst auf der Höhe von Drogheda gewöhnte ich mich an das Steuer auf der rechten Seite. Ein Konvoi aus drei Lastwagen, der uns überholte, zog ein Luftloch hinter sich her, das unseren Wagen wie ein Faustschlag traf. Das tiefe Hornen, mit dem mich der vorderste Laster an den Rand der M1 scheuchte, wurde vom Wind verweht wie das Nebelhorn eines Dampfers. Bald darauf ließ der Regen nach, über der Irischen See war der Himmel von strahlendem Blau. Ein weiches Licht verlieh der Landschaft eine magische Aura, es war, als schwebte sie über sich selbst.
Wir fuhren schweigend, was wir in unserer Ehe höchst selten geschafft hatten, ohne dass unser Schweigen einen schalen, weil vorwurfsvollen Zug bekam. Gelegentlich machten wir uns auf etwas aufmerksam und kommentierten es. Die Landschaft fand ich enttäuschend; was ich sah, deckte sich nicht mit dem, was ich mir vorgestellt oder im Internet gesehen hatte. Reihenhaussiedlung reihte sich an Reihenhaussiedlung, Bungalow an Bungalow. Wir fuhren vorbei an Autogroßhändlern, Supermärkten, Holzlagern, kokelnden Reifenbergen und Tankstellen. Jetzt, da wir von der Küste ins Innere der Insel unterwegs waren, sah Irland endgültig aus wie das unrettbar überbaute und zersiedelte Mittelland der Schweiz. Immer wieder fiel Regen, der wenige Meilen später schlagartig aufhörte. Lange Zeit war es dunkel, als wäre der Tag bereits vorbei, später wurde es hell. Tropfen auf der Frontscheibe warfen blasse Schatten auf unsere Gesichter und Oberkörper, das Thermometer am Armaturenbrett zeigte sechs Grad an, es wehte ein böiger Wind. Ein längeres Stück fuhren wir durch Nordirland, der Straßenbelag war besser, die Mittellinie frisch und akkurat gemalt, die Grundstücke und Häuser wirkten gepflegter; die Landschaft war ebenfalls zerstört, aber auf zielgerichtetere und ordentlichere Weise.
Dachte Charlotte an ihren sterbenden Vater? An unsere gemeinsame Vergangenheit, unsere gescheiterte Ehe? Ihr Blick wirkte schläfrig, ihre Augen aber sprühten vor Lebenslust. Durfte ich sie fragen, ob sie mit einem Mann liiert war? Immerhin spielte ich für Max den Ehemann. Ich hielt den Mund, zeigte stattdessen auf eine Plastiktüte, die über der Fahrbahn einen Tanz vorführte.
Nach über zwei Stunden ermüdender Fahrt, mittlerweile befanden wir uns wieder in der Republik Irland, nun im County Donegal, wie ein Schild ankündigte, wurden die Zeichen der Zivilisation spärlicher; auf einer Wiese, die unnatürlich grün leuchtete, standen zwei Esel in der Sonne, vor einem Schuppen brannte ein Feuer. Charlotte zupfte etwas von ihrer Brust, vielleicht das Haar vom Armaturenbrett.
»Begrab mich bloß irgendwo, wo das Wetter besser ist als hier«, sagte sie und deutete durch die Frontscheibe.
Am Horizont stand eine dunkle Regenfront, die sich schnell auf uns zubewegte, das Außenthermometer zeigte vier Grad an.
»Max will kremiert werden«, sagte sie leise.
»Hab ich mir gedacht.«
»Er kann es nicht ausstehen, hilflos zu sein.«
»Wie heißt sie eigentlich?«
»Renate.«
»Eine Deutsche?«
»Renate Shenahan. Sie war mit einem Iren verheiratet. Aber sie stammt aus Emden, glaub ich.«
»Wo haben sie sich kennengelernt?«
»Im Titanic Museum in Belfast.«
»Wieso weiß Max nicht, dass wir nicht mehr zusammen sind?«
»Weil er dich mag.«
»Er mag mich nicht, Charlotte, er liebt mich. Und ich ihn auch.«
»Denkst du, das hab ich nicht mitbekommen? Der Sohn, den er nie hatte!«
»Eifersüchtig?«
»Auf einen, der seinen eigenen Vater hasst?«
Wie immer, wenn Charlotte hungrig war, rieb sie sich schläfrig die Nase; auf dem Flug war nur ein dürftiges Frühstück und lauwarmer Kaffee serviert worden, aber wir hatten beschlossen, erst nach dem Krankenhausbesuch im Hotel zu essen, statt unterwegs irgendwo anzuhalten. Am Rand von Letterkenny gerieten wir in einen Stau, der sich in zwei Spuren auf die graue Kleinstadt zubewegte, die sich eine Hügelflanke hochzog: Dort stand das General Hospital.
Zwei
Im Fahrstuhl, mit dem wir in den vierten Stock fuhren, roch es nach lauwarmem Essen, in der Ecke lag ein Stück Mullbinde. Der Mann, der mit uns in die Höhe glitt, trug schlammverkrustete Gummistiefel und hatte seine Mütze so tief ins Gesicht gezogen, dass ich die Freisprechanlage, die er trug, erst bemerkte, als er das Gesicht anhob und im Brustton der Überzeugung sagte:
»She’s tough as a nail.«
Wir stiegen aus, der Mann fuhr weiter; bevor sich die Lifttür zuschob, sahen wir uns an, er hatte Tränen in den Augen, doch er senkte nicht den Blick, als wollte er mich auf etwas vorbereiten. Stark wie ein Nagel! Wie immer, wenn Charlotte aufgeregt war, sagte sie nichts; ich hatte gelernt, in solchen Situationen den Mund zu halten und ihr nicht zu nahe zu kommen. Hinter mehreren Türen fiepten Maschinen, vor dem Bereitschaftszimmer der Krankenschwestern roch es nach Kaffee, der seit Stunden auf der Heizplatte stand. Zimmer 417 lag am Ende des Korridores, ein Fenster ging auf einen Parkplatz hinaus, hinter dem sich eine Siedlung identischer Reihenhäuser den Hang hinaufzog; viele der sicherlich fünfzig Häuser standen leer und befanden sich in unterschiedlichen Stadien des Zerfalls, kaum einer der Vorgärten machte einen gepflegten Eindruck.
»Der Mann, der mit ihm im Zimmer liegt, war früher Polizist.«
Charlotte lächelte verkrampft, klopfte leise an die Tür, drückte, ohne abzuwarten, die Klinke nach unten und betrat das Zimmer. Ich ließ einen Augenblick verstreichen, bis ich ihr nachging; auf den ersten Blick glaubte ich, der fremde Mann, der im Bett am Fenster lag, sei tot. Seine straff gespannte Gesichtshaut zeigte bereits die endgültigen Züge seines Totenschädels, wie eine Steinfigur lag er auf dem Rücken, die Hände vor dem Bauch gefaltet, und starrte an die Decke. Ich konnte nicht anders und hob auch den Blick: Über seinem Bett prangte ein Fleck aus Ringen in unterschiedlichen Brauntönen. Die Flüssigkeit der Infusion, die dem Mann gelegt war, glänzte wie Honig. Das zweite Bett war leer, eine Schwester war im Begriff, das Leintuch abzuziehen; Charlotte schnappte vor Schreck nach Luft, taumelte, griff geisterhaft langsam um sich und ließ sich von mir, bevor sie zu Boden sinken konnte, auffangen. Der Gesichtsausdruck der Schwester war streng, ihr Blick aber war gütig. Sie warf das Leintuch über einen Stuhl, nahm Charlotte bei der Hand, drückte sie aufs Bett und fragte, wen wir besuchen wollten. Wenn ich die Schwester richtig verstand, erklärte sie Charlotte, dass der Mann, der in diesem Bett gestorben war, nicht Max Hauert hieß und wir uns im falschen Zimmer befanden. Sie tätschelte ungerührt lächelnd Charlottes Wange und ging aus dem Zimmer; Charlotte atmete tief ein und schüttelte den Kopf, als wollte sie einen Gedanken vertreiben, den sie nicht aussprechen konnte.
»Er hat mir die falsche Zimmernummer genannt.«
Nach dem Tod meiner Mutter hatte mein Vater gar nicht erst versucht, allein zu leben. Am Tag nach der Kremation schaffte er ihre Sachen aus der Wohnung, als wollte oder müsste er ihre Spuren so schnell wie möglich verwischen. Ihre Kleider lagen auf dem Ehebett ausgebreitet, Blusen, Röcke, Jupes, Kleider, Mäntel, Jacken, Strickjacken, die vier Schubladen ihrer Kommoden standen offen, ihre Unterwäsche quoll heraus, auf dem Nachttischchen lagen Knäuel aus Strümpfen und Strumpfhosen, der Fußboden war mit ihren Schuhen bedeckt, als hätte er sie verzweifelt aus dem Schrank gefegt. Aber mein Vater ist nicht außer sich gewesen, weder vor Trauer noch vor Wut, und seine zielgerichtete Ruhe hat mich damals am meisten geärgert, seine kalte Entschlossenheit, die Sachen der Frau, die er geliebt hatte, wie er stur behauptete, und mit der er zweiundfünfzig Jahre verheiratet gewesen war, so schnell wie möglich wegzuschaffen. Meine Vorwürfe hatten ihn wütend gemacht, wir haben uns angeschrien, und ich bin mit dem festen Vorsatz aus der Wohnung gestürmt, ihn nie wiederzusehen. Die trotzige Ankündigung meines Vaters, er werde mit nichts als einem Lederrucksack reisen, darin nur das Allernötigste, Portugal, Spanien, Griechenland, Vietnam, Kambodscha, nahm ich, aus gutem Grund, wie sich zeigte, nicht ernst. Denn keine Woche später gab er eine Kontaktanzeige in einer Zeitschrift für Tierfreunde auf, in der der Rubrik für kontaktfreudige Senioren erstaunlich viel Platz eingeräumt wird. Seine Reisepläne brachte er nie mehr zur Sprache, stattdessen redete er bald davon, mit einer der sechs Frauen zusammenzuziehen, die er aufgrund seiner Anzeige getroffen hatte, er könne sich jedoch nicht entscheiden, mit welcher. Hätte er damals, nach dem Tod seiner Frau, die Stärke gezeigt, schwach zu sein, ich hätte ihn respektiert und wohl geliebt. Aber er unternahm nicht einmal den Versuch, es mit sich selbst auszuhalten, gab sich nicht die Chance, zu dem Mann zu werden, in den er sich unweigerlich verwandeln würde, wenn er allein lebte. Zudem machte ihn das Wissen, dass auch ihm die Lebenszeit knapp wurde, alles andere als nachsichtig oder neugierig, als tolerant oder großzügig. Er war immer noch abhängig von der Meinung anderer und verlangte, selbst um den Preis der Selbstverleugnung, Anerkennung, ja sogar Freundschaft von seinen früheren Vorgesetzten in der Bank, in der er bis zur Pensionierung als Sicherheitsbeamter gearbeitet hatte. Den Stolz, den ich für ihn empfand, als Verdingbub mit sieben Jahren Schulbildung eine fünfköpfige Familie als ungelernter Hilfsarbeiter durchzubringen, machte er zunichte, weil er die Unterschicht verachtete und sich über die Arbeiterbewegung und mein Engagement in der Gewerkschaft als Offsetdruckerlehrling lustig machte. Durch die naive Bewunderung seiner Vorgesetzten verleugnete er nicht nur seine Herkunft, sondern auch seinen Stand als Arbeiter, warf ich ihm vor. Wie für die meisten Jugendlichen gab es auch für mich nichts, was nicht absolut war, nur Weiß oder Schwarz, Richtig oder Falsch, Lob oder Tadel, gut oder schlecht. Ich war anmaßend, wozu sonst soll die Jugend taugen? Unentschieden gab es nicht, nur Siegen oder Verlieren. Aber obwohl ich mir wünschte, mein Vater wäre ein anderer gewesen, hätte ich ihn doch akzeptieren können.
Es dauerte keine zwei Minuten, bis die Schwester zurückkehrte und zu Charlotte sagte, ihr Vater liege einen Stock höher in Zimmer 517, und uns ein klärendes Gespräch mit Dr. Miah empfahl. Dabei knetete sie Charlottes Arm, resolute Anteilnahme im Gesicht, mit den Gedanken aber offensichtlich bereits in einem anderen Zimmer. Schließlich zog sie die Hand zurück, reichte sie mir zum Abschied und konnte sich für die Länge eines Herzschlags nicht gegen ein Lächeln wehren, weil ihr Daumen beim Händedruck wohl zufällig auf meinem Puls lag.
Das Scheppern, mit dem die Fahrstuhltür im fünften Stock hinter uns zuglitt, übertönte den Signalton meines Handys in der Hosentasche, aber das Vibrieren an meinem Oberschenkel verriet, dass eine Nachricht eingegangen war.
Charlotte konnte es nicht erwarten, ihren Vater zu sehen, mit großen Schritten eilte sie durch den langen, menschenleeren Korridor, ohne sich darum zu scheren, ob ich ihr folgte oder nicht. Um nachzusehen, wer geschrieben oder angerufen hatte, blieb ich vor der Toilettentür stehen, rief Charlotte hinterher, ich sei sofort so weit, und schloss mich in eine Kabine ein. Patricia schrieb, sie vermisse mich, fahre aber, um nicht ständig an mich denken zu müssen, übers Wochenende mit Ro in die Berge, um zu wandern. Wer war Ro? Rahel? Roberta? Rolf? Robert? Was bedeutete das verräterische aber? Meinem Spiegelbild wich ich aus, als ich mir die Hände wusch und beschloss, Patricia vorerst nicht zurückzuschreiben, um ihr meine unangenehmen Fragen zu ersparen. Charlotte wartete vor der Toilette auf mich, warf mir einen entnervten Blick zu und stürmte weiter. Auf den Gedanken, ihr von Patricia zu erzählen, kam ich nicht einmal: Sie war nie eifersüchtig gewesen. Vor der hintersten Tür blieb sie stehen, als sei sie vor eine Wand gerannt, drehte sich um und packte mich grob an der Schulter:
»Danke, machst du mit, das vergess ich dir nie.«
»Du willst Max also wirklich Theater vorspielen?«
»Er will, dass wir es gut haben, Vik!«
Ich ließ es bleiben, etwas dazu zu sagen; Max’ Wunsch, uns ein letztes Mal als glückliches Ehepaar zu sehen, wollte ich nicht im Weg stehen.





























