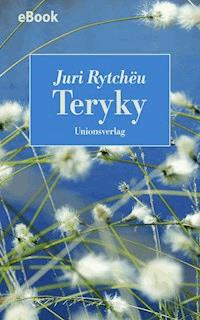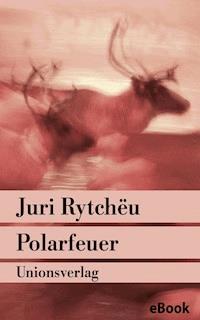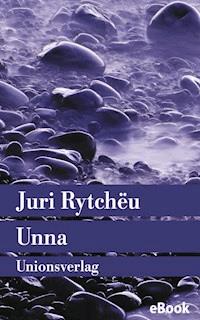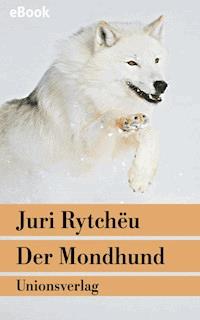8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
St. Petersburg Ende der Vierzigerjahre: Nach einer langen Reise quer durch den Kontinent klopft der junge Tschuktsche Gemo naiv am Portal der Universität an, weil er dort studieren will. Weit war die Reise von der Halbinsel Tschukotka, fremd ist die russische Kultur, mühsam der Lebensunterhalt, das Schreiben tschuktschischer Lehrbücher. Schriftsteller will er werden, obwohl er den Stempel des kulturellen Außenseiters trägt und die Zensurbehörden mit den Geschichten über seine Heimat provoziert, trotzdem: Gemo gelingt als erstem Schriftsteller seines Volkes der Sprung in den Literaturbetrieb. Seine Herkunft und seine Vergangenheit lassen ihn jedoch nicht los.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Nach einer langen Reise quer durch den Kontinent klopft der junge Tschuktsche Gemo naiv am Portal der Leningrader Universität an, weil er dort studieren will. Keiner ahnt, dass man diesen Jungen in einigen Jahren als ersten Schriftsteller seines Volkes feiern wird. Tastend geht er seinen Weg durch die sowjetische Nachkriegszeit.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Charlotte Kossuth (1925–2014) war Russisch-Lektorin in Halle/Saale und fast dreißig Jahre lang Verlagslektorin für russische und sowjetische Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Charlotte Kossuth.
Leonhard Kossuth (*1923) lehrte am Literaturinstitut in Leipzig und war dreißig Jahre lang Cheflektor für Sowjetliteratur in Berlin. Zudem ist er als Herausgeber, Übersetzer, Literaturkritiker und Publizist tätig.
Zur Webseite von Leonhard Kossuth.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Juri Rytchëu
Im Spiegel des Vergessens
Roman
Aus dem Russischen von Charlotte und Leonhard Kossuth
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Der russische Originaltitel lautet V zerkale zabvenija.
Gefördert vom Literarischen Colloquium Berlin mit Mitteln der Stiftung Pro Helvetia.
Originaltitel: V zerkale zabvenija
© by Juri Rytchëu 1997
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Jurek Zaba, Wasser I, 1998, Öl auf Leinwand, 45x38 cm.
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30455-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 00:37h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
IM SPIEGEL DES VERGESSENS
1 – Man sagt, der Mensch durchlebt unmittelbar vor dem …2 – Die Umgebung des Moskauer Bahnhofs verblüffte Nesnamow …3 – Die Siebzehnte Linie der Wassili-Insel endet in einer …4 – Als Nesnamow sein Zimmer betrat, fand er auf …5 – Sie mussten kurzfristig aus dem Zimmer auf der …6 – Die Einsamkeit des Lebens im Hotel bedrückte Nesnamow …7 – Dieser Winter schien nie zu enden. Schneestürme tobten …8 – Boris Saikin hatte großes Glück gehabt, denn in …9 – Als Gemo die Belegexemplare seines ersten Buches erhalten …10 – Das Zimmer war ziemlich groß und hatte einen …11 – Gemo bemerkte die Veränderung der Einrichtung sofort …12 – Der Magadaner Flugplatz lag beim dreizehnten Kilometer der …13 – Nesnamow erinnerte sich ungern an das Leben im …14 – Der beste Ort zum Lesen, sein Lesesaal der …15 – Gemo erhielt eine Vierzimmerwohnung am Gribojedow-Kanal, im so …16 – Die eintönigste Jahreszeit in Leningrad ist der lange …17 – Der ältere Sohn, Sergej, war in ein eigenes …18 – Von langem Läuten aufgeweckt, stieß Valentina ihren Mann …19 – Gemos letztes Buch war 1991 erschienen, die letzte …20 – Schon beim Aussteigen aus dem Hubschrauber erblickte Stanislaw …Anmerkungen der ÜbersetzerMehr über dieses Buch
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Charlotte Kossuth
Über Leonhard Kossuth
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Juri Rytchëu
Zum Thema Russland
Zum Thema Arktis
Für Galja,die treue Gefährtin meines langen Lebens.
Mir bleibt nur eine Sorge –
die einzige und goldne:
Das Joch der Zeit –
was tu ich, dass ich dies Joch zerschlag?
Ossip Mandelstam
Deutsch von Paul Celan
1
Man sagt, der Mensch durchlebt unmittelbar vor dem Tod sein ganzes Leben noch einmal, bis ins Letzte, und erinnert sich dabei sogar an Dinge, die er gern für immer vergessen hätte. In seinem Bewusstsein sieht er mit rasender Geschwindigkeit Bilder der fernen Kindheit vorbeifliegen, Bilder der Jugend, des Eintritts in die Welt der Erwachsenen, und in diesem bunten Kaleidoskop gibt es keine kleinen oder bedeutungslosen Ereignisse: Alles ist wichtig, das scheinbar geringste Detail, eine unwillkürliche Geste, ein Versprecher haben im weiteren Leben doch diese oder jene Rolle gespielt, spätere Handlungen, Schicksalswendungen beeinflusst.
Doch solche Erinnerungen überkommen uns nicht nur vor dem Tod.
Georgi Sergejewitsch Nesnamow, der jetzt im Vorortzug Kolossowo–Leningrad sitzt und noch vor wenigen Tagen Literaturredakteur einer Kreiszeitung war, ist in Rente gegangen, hat sich endgültig und unwiderruflich von seiner Arbeit verabschiedet, die er fast fünfzig Jahre zuverlässig wahrgenommen hat. Er weiß, dass er nie mehr in sein winziges Arbeitszimmer mit dem altersschwachen Schreibtisch zurückkehren würde, der nicht nur mit untilgbaren Flecken von Tinte und Leim bedeckt war, sondern – so schien es ihm – auch mit eingetrocknetem Blut, obwohl in diesem Raum – soweit sich Nesnamow erinnern kann – weder jemand geschlagen noch gar erschlagen worden war. Nie mehr würde er durch das in viele kleine Felder unterteilte Fenster hinausblicken, vor dem sich seit einem halben Jahrhundert nichts verändert hatte: eine krumme Straße mit einem Zaun, der überraschend am Gebäude des Dorfladens endete, das in den ersten Nachkriegsjahren im Stil der vorrevolutionären Gutshäuser erbaut worden war – mit Ziergiebel und Ziersäulen.
Im Herbst neunundvierzig hatte man Nesnamow die Immatrikulation an der Leningrader Universität verweigert, weil er unter der deutschen Okkupation gelebt hatte und überdies ingermanländischer Herkunft war. Damals begegnete man Leuten wie ihm mit großem Misstrauen, überprüfte jeden sorgfältig, sogar wenn er zur fraglichen Zeit als Minderjähriger im abgelegenen Dorf Treskowizy gelebt hatte, einige Kilometer waldeinwärts von der Eisenbahnstation Wruda. Man gab ihm zu verstehen, dass er sich mit solch einer Biografie nicht vordrängen, sich lieber still verhalten und seine Träume von Hochschulbildung, von einer Karriere als Schriftsteller für immer begraben sollte; dabei hatte er, voll scheuer Ehrfurcht vor dem gedruckten Wort, von jung auf eben davon heimlich geträumt.
Georgi Nesnamow kehrte also in den Kreis zurück, und auf dem Weg in sein Heimatdorf suchte er die soeben gegründete Kreiszeitung auf. Im Arbeitszimmer des Redakteurs saß ein glatzköpfiger Mann in Militäruniform, mit den Schulterstücken eines Hauptmanns. Der schaute den jungen Mann an und fragte: »Du willst wohl bei der Zeitung arbeiten?«
Nesnamow nickte schweigend.
In jenen Jahren gab es kaum jemanden, der in der Kreiszeitung arbeiten konnte: Die meisten jungen Männer mit entsprechender Schulbildung waren im Krieg gefallen, und die Überlebenden suchten ihre Ausbildung an Instituten und Universitäten zu vervollkommnen und wurden bereitwillig, fast ohne Examen aufgenommen.
»Es gibt eine interessante Aufgabe«, sagte mit Kommandeursstimme der Redakteur Steppan Steppanowitsch Filippow, der wegen seiner Trunksucht bald den Spitznamen Schnaps Schnapsowitsch erhalten und für immer behalten sollte. »In unserem Kreis, konkret im Dorf Treskowizy, ist eine Gruppe Studenten der Leningrader Universität zum Ernteeinsatz gekommen. Darunter sind ein paar Burschen von Tschukotka! Stell dir vor, die sind durchs ganze Land gefahren, aus einer Gegend, wo wegen der Kälte außer Rentiermoos nichts wächst, um hier Getreide einzubringen! Die haben doch so was noch nie gesehen! Wenn du darüber ordentlich schreibst, stelle ich dich ein! Zieh los!«
Schnell war Georgi wieder draußen und rannte mitten auf die Straße, um per Anhalter ans Ziel zu kommen.
Doch in Treskowizy erwartete ihn eine schreckliche Nachricht: Ausgerechnet die drei tschuktschischen Jungen waren am Morgen weggefahren. Er hatte sie um wenige Stunden verfehlt. Der Leiter der Erntehelfer-Brigade sagte: »Diese Jungs hatten keine Ahnung von Landwirtschaft. Hatten Angst, sich Pferden und Kühen zu nähern, rannten vor ihnen davon. Lachten, sooft sie Hähne krähen hörten. Für sie war alles neu – sogar ein grüner Baum. Einer von ihnen, Juri Gemo aus Uëlen, gab sogar zu, in der Kindheit habe er geglaubt, auf den russischen Getreidefeldern würden fertige Brote und Brötchen reifen. Sie selbst wollten nicht wegfahren, ich hätte aber nicht die Verantwortung tragen mögen, wenn ihnen was zustößt. Hinterher hätte ich meinen Kopf dafür hinhalten müssen!«
Enttäuscht und ratlos durchquerte Georgi sein Heimatdorf, erwiderte zerstreut die Grüße seiner Landsleute. Als er am Ende der einzigen Straße am Elternhaus stehen blieb, durchzuckte ihn plötzlich eine Idee.
Er suchte die Studenten auf, fragte sie stundenlang nach den Weggefahrenen aus, wie sie sich verhalten hätten, hielt deren Namen fest und erfuhr sogar, unter ihnen sei auch ein Eskimo gewesen.
Unter Berufung auf eine wichtige redaktionelle Aufgabe ließ er sich vom Kolchosvorsitzenden den Schlüssel zum Leitungszimmer geben und saß dort die ganze Nacht über seiner Skizze. Er stellte sich vor, wie Juri Gemo das erste Mal im Leben ein Pferd, eine Kuh aus der Nähe sieht, einen Hahn krähen hört, wie er durchs Getreidefeld geht, die Ähren streift und erkennt, dass dieses neue, für ihn noch unverständliche Leben voller bedrohlicher Überraschungen ist. Immer wieder kehrt er in Gedanken in sein vertrautes Uëlen zurück, ins Halbdunkel der Jaranga, ans Ufer des Polarmeers … Georgi versetzte sich so intensiv, ja mit geradezu erschreckender Hingabe in einen tschuktschischen Jungen, dass er Mühe hatte, in die Wirklichkeit, zu sich selbst zurückzufinden.
Gegen Morgen, erschöpft von der großen Anspannung, schlief er schließlich über den voll geschriebenen Blättern ein.
Im Schlaf sah er sich selbst in Uëlen, am Ozean, und rosa Möwen flogen mit durchdringenden Schreien über ihm.
Filippow überflog die sauber abgeschriebene Skizze, las sie dann, etwas langsamer, nochmals durch und erklärte mit kaum verhohlener Verwunderung: »Das hast du gut geschrieben. Wir kürzen ein wenig und setzen das in die nächste Nummer. Dich aber behalte ich als Mitarbeiter für Literatur.«
So hatte das neue Leben von Georgi Sergejewitsch Nesnamow begonnen, der dann fast fünf Jahrzehnte in ebenjenem winzigen Arbeitszimmer mit der immer gleichen Aussicht verbringen sollte. Erstaunlich aber ist, dass er nie wieder solch eine unerklärliche schöpferische Begeisterung erlebte wie in jener Nacht, als er seine Skizze über die Jungen aus dem Norden schrieb. Zwar versuchte er einige Male, etwas Ähnliches zuwege zu bringen, aber das wirkte immer gequält, unecht.
Nachdem Nesnamow fast zehn Jahre im Studentenheim der landwirtschaftlichen Fachschule am Ort gewohnt hatte, erhielt er, da er nun verheiratet war und einen Sohn hatte, eine Zweizimmerwohnung. Die Versuche, zum Studium zugelassen zu werden, stellte er schließlich ein, hörte auch auf, seine Aufnahme in die Partei zu beantragen, und fand sich damit ab, dass er den Rest des Lebens als Mitarbeiter für Literatur bei einer Kreiszeitung verbringen würde.
Genaugenommen hätte Nesnamow die Zeitung allein herausgeben können. Er wusste sehr gut, wie man einen Umbruch macht, wie man das Material auf Spalten verteilt, welche Worte in einem Leitartikel vorkommen mussten. Zehn Chefredakteure hatte er überlebt, und mindestens für die Hälfte von ihnen hatte er politische Artikel geschrieben. Diese Artikel waren freilich eher schablonenhaft, doch allein der Prozess der Niederschrift äußerlich gewichtiger und bedeutender Worte bereitete ihm großes Vergnügen und tiefe innere Befriedigung. Zeitungsnummern mit eigenen Artikeln heftete er sorgfältig ab und brachte sie in sein häusliches Archiv ein, die vergilbten Seiten mit seiner ersten Skizze aber nahm er immer wieder mit Erregung und zugleich mit bitterem Gefühl in die Hand.
Sein Leben änderte sich, als seine Frau unerwartet starb, und zwar als Opfer einer – wie man damals sagte – verbrecherischen Abtreibung, die eine alte Bekannte und Leiterin einer Kinderkrippe, Nina Breslawaskaja, vorgenommen hatte. Die kräftige Frau mit aus den Nähten platzenden Formen und riesigen, schaufelartigen Händen zeigte dem betroffenen Georgi einen blutig-braunen Klumpen und sagte dazu: »Ein Mädchen.« Seine Frau starb zwei Tage darauf an Blutvergiftung, Nina aber kam mit dem Schrecken davon. Unbekannte, weitreichende Kräfte der Kreisobrigkeit bewahrten sie vor juristischen Folgen. Nesnamow versetzte das Erlebnis in einen Zustand der Erstarrung. Er lehnte es kategorisch ab, seinen Sohn Stanislaw, der bereits acht Jahre alt war, Verwandten zu übergeben, ging weiterhin seiner Arbeit nach und verrichtete sie erstaunlich gewissenhaft, ersetzte oft sogar den Korrektor, ganz zu schweigen davon, dass er sämtliche Artikel sorgfältig verbesserte, redigierte und oft einfach umschrieb.
Der Sohn war stets gut gepflegt, sauber gekleidet und lernte vorzüglich. Äußerlich hatte sich Nesnamow in keiner Weise verändert, vielleicht war er noch verschlossener geworden, aber schon vorher war er nicht besonders mitteilsam und zugänglich gewesen.
Als er das Grab seiner Frau zum dritten Mal besucht hatte, erfuhr er nachts im Traum eine große Erschütterung: Mit erschreckender Deutlichkeit empfand er sich plötzlich als ein völlig anderer Mensch – fern von dem Dorf Treskowizy auf der kalten Halbinsel Tschukotka geboren und in Leningrad als Schriftsteller lebend, als Verfasser von Büchern, die nicht nur tschuktschisch, sondern auch russisch erschienen. Zunächst war das amüsant, sogar interessant, doch allmählich kam ihm der Gedanke, in seinem Kopf gehe etwas Sonderbares vor sich; vielleicht litt er gar an einer Geisteskrankheit? Der Kreispsychiater untersuchte ihn aufmerksam, klopfte ihm mit einer Art Spielzeughammer auf die Knie und sagte mit einem Seufzer: »Ihre Nerven möchte ich haben, Georgi Sergejewitsch!«
Doch jenes andere Leben begleitete ihn von nun an ständig, und allmählich gewöhnte sich Nesnamow sogar daran, sprach auch mit niemandem mehr darüber. Im Gegenteil, ihm schien es in seiner Situation das vernünftigste, alles für sich zu behalten und sein Geheimnis nicht einmal seinem nächsten Menschen, dem Sohn Stanislaw Georgijewitsch, mitzuteilen.
Nachdem sein Sohn die Schule beendet hatte, wurde er ohne Weiteres am Leningrader Institut für Finanzen und Ökonomie aufgenommen, er absolvierte es mit Auszeichnung und wurde als Leiter der Kolossower Kreisfinanzverwaltung eingesetzt.
Sie bewohnten eine alte Zweizimmerwohnung, ohne sich zu stören. Der Vater erledigte nach wie vor alle Hausarbeit, kochte das Essen, wusch die Wäsche, räumte auf. Als Stanislaw ihm seine Hilfe anbot, versicherte er dem Sohn, dass ihn diese Tätigkeit überhaupt nicht belaste, sondern ihm sogar Freude und Erholung von der Routinearbeit bei der Zeitung bringe.
Nach wie vor hielt er seine heimlichen Fantasien über eine andere Existenz, über sein zweites Leben, das er in Leningrad führte, vor dem Sohn verborgen. Er fürchtete sich aber, dorthin zu fahren, und verbrachte den Sommerurlaub gewöhnlich in Treskowizy, in dem alten Haus, das er nach der Rehabilitierung des Vaters zurückerhalten hatte.
An schwülen Sommerabenden, in der abendlichen Einsamkeit, suchten ihn jeweils Gedanken an die Geheimnisse des Lebens, an die Reinkarnationslehren indischer Weiser heim. All diesen Theorien gegenüber verhielt sich Nesnamow skeptisch, traurig dachte er, in seinem Fall handle es sich – jenseits aller Fantastereien, aller qualvollen und gewundenen Gedankengänge – nicht um Seelenwanderung, sondern um ein wahrhaftig anderes, zweites, parallel verlaufendes Leben eines Menschen. Unklar war lediglich, ob solches nur ihm widerfuhr oder ob jeder einen Doppelgänger in einer parallelen Welt hatte, nur dass nicht jedem das Los zuteil wird, dies zu erfahren. In seinen Überlegungen ging Nesnamow sogar noch weiter – er nahm an, dass es nicht nur eine, sondern mehrere parallele Welten gibt, vielleicht sogar unendlich viele. Und die Transformation eines Menschen führt nicht zu seiner Verkörperung in irgendwelchen Lebewesen, Käfern, Raubtieren, wie die indischen Weisen behaupten, sondern in anderen Menschen, also könnten Georgi Nesnamows in endloser Zahl und vielerlei Gestalt existieren. Es war einfach nicht jedem gegeben, das zu wissen, und dass es ihm bewusst geworden war, war eine Anomalie, eine unvorgesehene Abweichung von der bestehenden Ordnung. Nesnamow war klar, dass er nur jemandem seine Entdeckung einzugestehen brauchte, und er würde bestenfalls ausgelacht, schlimmstenfalls aber für immer und ewig in eine Irrenanstalt gesperrt. Darum war es in seiner Lage das beste und sicherste, alles im Herzen zu bewahren. Überdies hegte Nesnamow den Verdacht, dass zahlreiche Menschen mit Geheimnissen leben, die sie unter keiner Folter preisgeben würden. Dennoch rief bei ihm jede gedankliche Versetzung in jenes andere Leben heftige Erregung hervor, zerstörte den inneren Rhythmus des gewohnten Lebens, und danach fühlte er sich einige Tage krank, niedergeschlagen.
Der Sohn ging eine Vernunftehe ein, als er sich endgültig etabliert hatte, und kaufte sich sogar eine genossenschaftliche Einzimmerwohnung. Sie vollzogen einen so genannten familiären Tausch: Georgi Sergejewitsch zog in die neue Wohnung um, das junge Paar aber richtete sich in der alten Zweizimmerwohnung ein, wo sie mehr Platz hatten.
Das Leben ging seinen Gang, man erbaute den Kommunismus, beerdigte die überalterten Generalsekretäre, und es sah aus, als würde es mit dem großen Land ewige Zeiten so weitergehen, bis es schließlich sein erhabenes Ziel erreicht hätte.
Unerwartet brach die Glasnost herein, was für Georgi Sergejewitsch eine überraschende Folge hatte: Die Leitartikel wurden überflüssig. Überall brodelten politische Leidenschaften, Republiken trennten sich von der Union, Russland wurde für unabhängig erklärt, es kam zu Putschen, zu Konfrontationen, die in Schießereien mündeten, Panzer rückten in Moskau ein, und Tschetschenien wurde zum Kriegsschauplatz.
Der Sohn, Stanislaw Georgijewitsch, versorgte die größer gewordene Familie – schon waren drei Enkel zur Welt gekommen, zwei Jungen und ein Mädchen –, er fuhr zu Baubrigaden, und als privatrechtliche Genossenschaften erlaubt wurden, engagierte er sich flugs in der Sägereibranche. Zielstrebig erweiterte er sein Unternehmen, bis er schließlich Chef einer der ersten privaten Kreisbanken wurde. Nun fuhr er ein prächtiges Auto, einen Jeep »Grand Cherokee«, verfügte über Leibwächter, ein eigenes Kontor, das er Office nannte und mit prächtigen Ledermöbeln aus Finnland eingerichtet war.
Nesnamow fühlte sich mitunter richtig fremd unter den neuen Umständen. In solch bedrückenden Augenblicken wandte er sich immer öfter jenem anderen Leben zu, flüchtete vor der beängstigenden Gegenwart dorthin. Obwohl alle auf die neue Ordnung schimpften, wuchs der Reichtum des Sohnes unentwegt, er kaufte Häuser, ganze Betriebe, wurde zu einem Kapitalisten, wie sie der Vater in unzähligen, im Lauf der Jahre geschriebenen politischen Leitartikeln gebrandmarkt hatte, wobei er zu Beginn Lenin und Stalin, dann Chrustschow und Bulganin, dann Breshnew, Andropow, Tschernenko zitiert hatte … Nun war auch mit Gorbatschow-Zitaten Schluss, und offenbar brauchte man niemanden mehr damit zu beunruhigen, was und auf welche Weise der jeweilige Staatslenker aus diesem oder jenem Anlass gesagt hatte.
Nesnamow wusste, dass er der Zwiespältigkeit, in die er geraten war, nur als Rentner entkommen konnte. Man hatte seinem Antrag ziemlich schnell entsprochen, und obwohl man ihm aufgrund unverständlicher Berechnungen angeblich die höchstmögliche Rente zubilligte, reichte das Geld gerade, um nicht verhungern zu müssen. Doch alle Mitarbeiter versicherten einmütig, mit der Zeit, wenn sich die Finanzen stabilisierten, würde die Summe ausreichen, um in Würde existieren und einmal im Jahr sogar in den Urlaub reisen zu können. Die neuen Leute in der Redaktion fühlten sich durch seine Gegenwart beengt, beeilten sich, ihn hinauszudrängen, und er wusste, dass sie heimlich über ihn lächelten, über ihn und seine altmodische Art, über sein Festhalten am altbewährten Zeitungsstil.
Der Sohn erschien in seinem stromlinienförmigen und blitzenden Wagen. So selbstbewusst, wie er auftrat, wirkte er sogar bedeutender als der Kreissekretär der bereits entmachteten Partei.
»Hallo, Rentner«, begrüßte er laut den Vater und küsste ihn herzhaft. »Ich bin, ehrlich gesagt, froh, dass du dich endlich von diesem Zeitungsjoch befreit hast.«
»Weißt du, mein Sohn, ich habe diese Arbeit geliebt. Habe mich mein Leben lang bemüht, sie gewissenhaft und ehrlich zu machen. Jemand musste sie doch machen, und das Los fiel mir zu.«
»Entschuldige, Papa«, antwortete Stanislaw. »Ich wollte dich nicht kränken. Aber du musst zugeben, wir leben jetzt in einer anderen Zeit, und ein Zurück gibt es nicht.«
»Da hast du recht«, sagte Nesnamow spöttisch. »Ein Zurück gibt es nicht.«
Der Sohn hatte eine Flasche »Finnland«-Wodka mitgebracht. Leicht berauscht bot er an: »Wünsch dir, was du willst. Ich verfüge über genug Mittel, um dir ein glückliches Alter zu bereiten. Wenn du willst, bauen wir das Haus in Treskowizy um, installieren heißes und kaltes Wasser, einen Telefonanschluss. Du wirst wie ein Gutsbesitzer leben, an der frischen Luft. Ich kaufe dir auch ein Auto …«
»Ich kann nicht Auto fahren«, erwiderte Nesnamow lächelnd. »Und all das brauche ich auch nicht. Ich bin nicht mehr jung, alles Mögliche kann passieren. Hier ist mein Testament. Darin steht nichts Besonderes, nur ein Wunsch. Und ich möchte, dass du mir fest versprichst, ihn zu erfüllen … Nein, nein, das kannst du bestimmt. Vielleicht kostet es dich einige Tage, das ist alles … Versprichst du es mir?«
»Mehr noch, ich schwöre es dir!« Stanislaw blickte dem Vater forschend in die Augen. »Aber warum redest du plötzlich vom Testament? Du musst jetzt das Leben genießen, dich freuen, Reisen unternehmen!«
»Du hast es erraten, mir schwebt eine kleine Reise vor. Nicht weit. Ich möchte nach Leningrad, entschuldige, nach Petersburg.«
»Ich bestelle dir ein Hotelzimmer. Das wird schon bezahlt sein, du wirst dich um nichts sorgen müssen.«
»Aber kein Luxusappartement. Etwas Bescheidenes, im Zentrum der Stadt. Die Hauptsache ist dennoch, versprich mir, zu erfüllen, was im Testament steht.«
»Aber natürlich. Soll ich es dir auf die Bibel schwören?«
»Ich brauche keine Schwüre«, winkte Nesnamow ab. »Ich kenne dich doch. Mir genügt, wenn du mir versprichst, den Wunsch zu erfüllen, den ich da aufgeschrieben habe.«
»Ich verspreche es«, sagte Stanislaw mit ernster Stimme und nahm vom Vater behutsam einen gewöhnlichen Briefumschlag entgegen.
Der Vorortzug hielt am Bahnsteig des Baltischen Bahnhofs. Der Rentner Nesnamow nahm sein Köfferchen, stieg in die Metro um und fuhr weiter zum Hotel »Oktjabrskaja«.
2
Die Umgebung des Moskauer Bahnhofs verblüffte Nesnamow. Vor allem sprang der Überfluss an Esswaren in die Augen, die in allen Kiosken, an Ladentischen, mitunter sogar von Hand zu Hand verkauft wurden – Brot, Wurst, Butter, verschiedene Spirituosen. Am Newski-Prospekt gab es zwar keinen so schwunghaften Handel, dafür überraschten die Aufdringlichkeit ausländischer Reklame und die blitzenden Schaufenster, die vielen Bistros und Restaurants. Da gab es sogar einen englischen Pub, ein Bierlokal, das von einfacheren Leuten offenbar kaum besucht wurde. Ein endloser Strom glänzender Autos erfüllte die breite Straße, erinnerte unwillkürlich an Berichte der wenigen sowjetischen Reisenden, die Gelegenheit gehabt hatten, mit eigenen Augen den Westen zu sehen. Es hatte gar nicht lange gedauert, und die Dichte des Autoverkehrs im ehemaligen Leningrad, dem jetzigen Petersburg, hatte das westliche Niveau erreicht und vielleicht sogar übertroffen. Ganz bestimmt aber der Gestank der Abgase.
Dennoch, wenn man den Blick hob und nach vorn sah – der Newski war nach wie vor die pfeilgerade Straße, die zum freien Wasser führte – zur Newa.
»Wie kommen wir dahin?« fragte Korawje, der jedes Mal zusammenzuckte und sich erschrocken umsah, wenn vom Stromabnehmer der Straßenbahn knisternd die Funken sprühten. Guchuge war darauf bedacht, möglichst am Rand des Bürgersteigs zu gehen, da er befürchtete, ihm könne von einem oberen Stockwerk etwas Schweres auf den Kopf fallen.
Nur Gemo blieb zumindest äußerlich ruhig. Er erinnerte sich noch gut an die Hinweise erfahrener Leute, wie man sich in der Stadt orientieren müsse, mit welcher Straßenbahn oder welchem Trolleybus sie zu der auf einer Insel gelegenen Universität kämen. Die erste Orientierungshilfe war schnell gefunden – der pfeilgerade Newski mit seinen funkelnden Lichtern und den dröhnenden Straßenbahnen, auf dessen nassem, feuchtem Asphalt sich ein Regenbogen spiegelte – es regnete!
»Sollten wir nicht lieber zu Fuß zur Universität gehen?« schlug Korawje bedachtsam vor. »Das ist irgendwie gewohnter und sicherer.«
»In der Straßenbahn könnte uns sogar ein Stromschlag treffen – wie das blitzt!« Gemo zeigte auf einen Funken sprühenden und dröhnenden Wagen, der soeben vorbeibrauste.
Er erinnerte sich an den Stromschlag, der ihn damals in der Schule durchzuckte, als er die Hand in eine leere Lampenfassung steckte: Die Elektrizität bezogen sie von einem Windmotor, aber die Glühbirnen reichten nicht, einige schwarze Fassungen hatten leer dagehangen und Neugierige verführt.
Da war es nun, Leningrad, sein langjähriger Traum noch aus Schulzeiten, da der Lehrer für Literatur und russische Sprache, Lew Wassiljewitsch Belikow, ihnen von dieser wunderschönen Stadt erzählt hatte – voll herrlicher Paläste, mit Flüssen, deren Ufer in Granit gefasst sind, und mit den in den Himmel ragenden goldenen Spitzen der Admiralität und der Peter-und-Pauls-Festung. Jetzt verbargen sich die Spitzen hinter den Wolken eines tief hängenden, regnerischen Himmels. Die Stadt machte einen zwiespältigen Eindruck: Zu lange hatte Gemo von einer Begegnung mit ihr geträumt, hatte er die wenigen Bilder in Büchern betrachtet, sich ihr Aussehen aufgrund der Erzählungen seiner Lehrer in der Fantasie ausgemalt. In Wirklichkeit war Leningrad ganz anders, fremd, feucht und kalt. Viele Häuser, deren Putz abgebröckelt war, machten einen jämmerlichen Eindruck. Ganze Stadtviertel waren von schmutzigen Bretter- und Sperrholzzäunen eingefasst, aus den Torbögen stank es nach saurem Essen und feuchten Fußlappen. Die von der langjährigen Belagerung, von Artilleriebeschuss und Bomben stammenden Kriegswunden waren nur notdürftig übertüncht worden – mit Farbe, die schon wieder abblätterte.
Als die Jungen die verräucherten Arkaden des Kaufhofs »Gostiny dwor« hinter sich gelassen hatten, schnupperte Korawje plötzlich und sagte: »Ich rieche ein großes Wasser.«
Doch vor ihrer Begegnung mit der Newa tauchte rechter Hand der in vielen Büchern über die Revolution abgebildete Bogen des Generalstabsgebäudes auf. Er war nicht zu verkennen. Durch ebendiese steinerne Enge hatten die Matrosen- und Rotgardistenscharen zum Sturm auf das Winterpalais, den Stammsitz der Monarchen, angesetzt. Das Palais selbst wirkte durch den Regenschleier erstaunlich niedrig, nicht so beeindruckend, wie sie erwartet hatten.
Alle hielten unwillkürlich inne, da aber rief Gemo: »Schaut nur, die große Brücke vorn!«
Die Newa verblüffte sie durch ihre gewaltigen Wassermassen und ihre Majestät. Allenfalls der große tschuktschische Fluss Anadyr hielt einem Vergleich mit ihr stand. Die Brücke wirkte unendlich lang, sie dröhnte und bebte unter der Last einer darüber fahrenden Straßenbahn. Darunter brodelte schwarzes Wasser, das den Geruch von feuchter Frische verbreitete. Gemo glaubte sogar einen Fischgeruch wahrzunehmen, wie er für das braune Wasser des Anadyrer Limans charakteristisch ist. Vielleicht schwammen auch hier, tief im dunklen Wasser, Schwärme unbekannter russischer Fische, die es zu den Wassern des Baltischen Meeres zog.
Jenseits der Brücke bogen sie nach links ab, und vom Flussufer kamen sie zu Häusern, die so eng aneinander gedrängt standen, als hätte beim Bauen der Platz nicht gereicht. Mächtige Steintreppen führten hinauf zu einer unermesslich großen Tür, die für gigantische Tiere oder Riesen bestimmt zu sein schien.
Vor dem gläsernen Haupteingang zur Universität, einem, wie sich herausstellte, niedrigen, in fernes feuchtes Dunkel führenden, zweistöckigen Gebäude, brannte eine Laterne.
»Wir sind da!« rief Gemo müde und zufrieden und nahm den tüchtig ramponierten Sperrholzkoffer von der Schulter, den er in der Tischlerei der Anadyrer Pädagogischen Lehranstalt eigenhändig gezimmert hatte.
Doch ungeachtet der Erleichterung, dass sie nun am Ziel waren, spürte er plötzlich Unruhe. Alles war ganz anders, als er es sich vorgestellt und erträumt hatte.
Hinter dunklem Glas war die Gestalt eines Menschen zu erkennen. Guchuge, der besonders gute Augen hatte, schaute hin und sagte: »Er sieht aus wie der Kapitän vom Eisbrecher ›Jossif Stalin‹.«
Und wirklich, die Gestalt hinter der Tür trug eine Kapitänsmütze mit funkelndem vergoldetem Rand, und die Ärmel des Uniformmantels waren von breiten gelben Streifen gesäumt.
Guchuge klopfte zaghaft. Die Tür öffnete sich schwer und langsam, aber ohne zu knarren, und durch einen Schnurrbart ertönte eine volle, tiefe Stimme: »Wer seid denn ihr? Abiturienten?«
Abiturienten … Das Wort kannten die Jungen noch nicht. War es vielleicht die Bezeichnung für irgendein Volk?
»Wir … wir sind Tschuktschen«, antwortete Guchuge.
Der Wachmann zögerte erst und sagte dann gedehnt: »Ach, Tschuktschen!« Die Tür ging langsam wieder zu.
Schweigend blieben die müden Weggefährten einige Minuten vor der geschlossenen Tür stehen.
»Na, hör mal!« tadelte Korawje seinen Kameraden. »Du hättest sagen sollen, wir sind zum Studium hergekommen. Und dann – was bist du schon für ein Tschuktsche? Du bist doch ein Eskimo, ein Inuit!«
»Das ist doch egal!« Guchuge spuckte enttäuscht aus. »Da hast du deine viel gepriesene russische Gastfreundschaft! Was machen wir jetzt? Ob wir noch mal klopfen?«
»Nein«, entschied Gemo. »Klopfen werden wir nicht mehr. Wir verbringen irgendwo die Nacht. Dieser Mann ist ein Schweizer, ein Wachmann.«
»Offenbar holte man die ersten dieser Wachleute aus der Schweiz«, vermutete Korawje, der Geschichte studieren wollte.
Die ganze Luft war von Feuchtigkeit durchtränkt, die ihnen von überall her zusetzte. Richtige Regentropfen, wie sie es gewohnt waren, gab es aber nicht. Nachdem sie eine Weile auf der Uferstraße herumgeschlendert waren, immer darauf bedacht, nicht in die Steinschluchten der Straßen einzutauchen, ließen sich die Jungen unter den ägyptischen Sphinxen gegenüber der Akademie der Künste nieder.
Gemo fand fast keinen Schlaf. Er dachte darüber nach, wie für ihn im Morgengrauen, das mühsam durch den feuchten Schleier drang, nicht nur ein neuer Tag beginnen würde, sondern auch ein völlig neues Leben, dem früheren im alten Uëlen gar nicht mehr ähnlich.
In der Fakultät für die Völker des Nordens entfiel für deren Zugehörige der Ausscheidungskampf, das Aufnahmeexamen war eher eine Formalität als eine strenge Prüfung. Nach der Immatrikulation wurden die drei wie alle ersten Semester zum Ernteeinsatz beordert.
Im Dorf kamen sie nachts an, und gegen Morgen vernahm Gemo durch die dünnen Wände des Heuschuppens plötzlich einen gellenden Schrei, als wäre es ein Hilferuf. Er trat hinaus in die Morgendämmerung und erblickte auf einem schiefen Zaun einen bunten, seltsam gefärbten Vogel. Mit weit geöffnetem Schnabel schrie er immer wieder, und Gemo erriet sogleich, dass es der in der russischen Literatur so schön beschriebene Hahn sein müsse und sein Schrei das berühmte Krähen … Er lachte laut auf, der Hahn schielte beleidigt zu ihm hin, schüttelte seinen roten Kamm und krähte lauter als zuvor. Die jungen Burschen arbeiteten nur zwei Tage auf dem Dorf.
Der zum Kutscher bestimmte Korawje fürchtete sich, den Pferden nahe zu kommen, und Guchuge versteckte sich, um einer Begegnung mit den Kühen zu entgehen, im Schuppen. Gemo schaffte es nicht, Garben zu binden. Obwohl er sich große Mühe gab, fielen sie unter seinen Händen auseinander. Der Leiter der Universitätsgruppe ordnete an, die Studenten nach Leningrad zurückzuschicken.
Einen halben Tag warteten sie in der Kreisstadt Kolossowo auf den Zug. Während sie durch die Straßen der unscheinbaren Siedlung schlenderten, stieß Gemo auf das kleine Redaktionshaus der Kreiszeitung »Kolossower Prawda«, blieb lange davor stehen und erinnerte sich an das Redaktionshäuschen in der Lawrenti-Bucht, das er gekalkt hatte, um Geld für die nächste Etappe seiner langen Reise zur Leningrader Universität zu verdienen.
Im Hof der Universität stand das Wohnheim, wo man Gemo ein Bett zugewiesen hatte. Die Studenten aus dem Norden waren auf verschiedene Räume verteilt und mit Studenten anderer Fakultäten gemischt worden. Das war im Großen und Ganzen richtig: So gewöhnten sie sich viel schneller an die neuen Bräuche in der großen Stadt. In Gemos Zimmer wohnten vorwiegend Philologen, doch es gab auch einen Ökonomen, den blinden Aspiranten Samzow, der jedes Mal, wenn er das Zimmer betrat, mit dem tastenden Stock an Gemos Bett geriet und auf dessen Deckenbezug dunkle Schmutzflecken hinterließ. Ihm das vorzuwerfen, brachte Gemo nicht übers Herz, er deckte sein Lager einfach mit alten Zeitungen zu. Der Blinde kannte das »Kapital« von Marx auswendig und konnte bei einem Wortgefecht fehlerlos ganze Textstellen zitieren.
Zu Gemos Nachbarn gehörte ein weiterer bemerkenswerter Mensch, Pawel Bulgakow, Student von der Fakultät für Ostsprachen, der selbstständig Hebräisch gelernt hatte und auf dem Klavier im Freizeitraum Préludes und Mazurken von Chopin spielte. Pascha verblüffte durch unwahrscheinliche Magerkeit und durch derart abgerissene Kleidung, dass er mit seiner provozierenden Schlampigkeit sogar von den allgemein ärmlichen Sachen der jungen Burschen abstach. Statt Unterwäsche trug Bulgakow Reste von Unterhosen und Hemden, die seine Blöße kaum bedeckten.
Neben dem großen Raum mit dem Klavier, wo sie abends hin und wieder gerade in Mode kommende Tänze einübten, wohnte in einem Winkel der Philologiestudent Dutow mit seiner Frau und einer kleinen Tochter. Mit seinen Medaillons klappernd, bewegte er sich geschickt auf Beinprothesen fort, und alle Bewohner des Wohnheims nannten ihn ehrerbietig »unseren Maressjew« – nach dem berühmten Flieger, der beide Beine verloren hatte, aber an die Front zurückkehrte und später Held des bekannten Buches »Ein wahrer Mensch« von Boris Polewoi wurde.
Zwei Ausländer, der Ungar Laszló und der Tscheche Jiří, mit Spitznamen »Partisan«, vervollständigten die Liste der Zimmergefährten. Der Tscheche Jiří hatte in den Kriegsjahren als Partisan in Jugoslawien gekämpft und einen prächtigen Ledermantel mitgebracht, den er einem deutschen Offizier abgenommen hatte. Dieser Mantel half den Bewohnern des Zimmers Nr.4 oft aus einer Verlegenheit. Jiří lieh ihn bereitwillig jedem Studenten, der in eine schwierige Situation geraten war, und der trug ihn dann in die Pfandleihe auf der Achten Linie der Wassili-Insel.
Die Vorlesungen fanden im Gebäude der Philologischen Fakultät statt, so dass sie nicht weit gehen mussten.
Die meisten Lehrkräfte für die Sprachen des Nordens hatten noch vor Kurzem, als die Sowjetmacht in den Randgebieten des Landes eben erst errichtet wurde, an den ersten Eingeborenen- und Taiga-Schulen unterrichtet, die dortigen Sprachen erlernt, für sie Schriften geschaffen und diese bei den Völkern von Nomaden und Jägern verbreitet.
Pjotr Jakowlewitsch Skorik hatte in den zwanziger Jahren in Uëlen gearbeitet, an ihn erinnerte man sich noch gut in Gemos Heimatdorf. Neben seiner wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit hatte Skorik Lehrbücher für tschuktschische Schulen geschrieben. Er hatte alsbald Gemo zur Arbeit herangezogen und ihn zum Mitverfasser eines neuen Lesebuchs in tschuktschischer Sprache gemacht.
Eine Fremdsprache konnte man an der Universität nach Wunsch lernen, und Gemo entschied sich für Englisch. Einstmals hatte das die Mutter des Uëlener Schuldirektors, Praskowja Kusminitschna, unterrichtet. Die alten Tschuktschen, die auf amerikanischen Walfangschiffen gefahren waren, unterhielten sich gern mit ihr, erinnerten sich daran, wie sie große amerikanische Städte besucht hatten, wo sie sich am meisten über die zahlreichen Polizisten und Schwarzen wunderten.
Der Englischunterricht war, wie es schien, Frauen vorbehalten. Englischlehrerin war Sofja Petrowna White, die verblüffend an die Engländerin aus Tschechows »Tochter Albions« erinnerte. Gemo erkühnte sich sogar, sie zu fragen, ob sie nicht aus Britannien stamme, worauf die ältere Dame mit der stark gepuderten Nase entgegnete: »Meine Vorfahren sind bereits zu Zeiten Peters des Großen aus England gekommen, um in der russischen Flotte zu dienen!«
Dunkle, fast nicht mehr erkennbare Porträts ihrer Vorfahren hingen in Sofja Petrownas Zimmer in der Herzen-Straße, wohin Gemo gern ging, um sich über seine Lektüre prüfen zu lassen. Die Lehrerin setzte dem Studenten starken Tee mit Milch vor, »auf englische Art« zubereitet.
Die Geschichte der Erforschung der sowjetischen Arktis las Professor Wiese, der im Nordpolarmeer neue Gebiete entdeckt hatte und nach dem ein Flecken von ewigem Eis bedeckten Landes benannt war. Der Professor war schon alt, er konnte kaum noch die Beine bewegen. In die Fakultät kam er mit einem Privatauto, was noch eine Seltenheit war, und der Chauffeur half ihm die Stufen hinauf. Nachdem Wiese hinter dem Katheder Platz genommen hatte, las er aus seinem eigenen Buch »Die Meere der sowjetischen Arktis« vor, ließ sich aber hin und wieder zu belebenden Erinnerungen an die Zeiten seiner Jugend hinreißen. Sein beliebtester Ausdruck für die Beschreibung der Eismeerküsten war das Wort »trostlos«.
Professor Plotkin hielt Vorlesungen über Sowjetliteratur. Vor allem lobte er den Roman »Fern von Moskau« von Wassili Ashajew, der vor Kurzem den Stalinpreis erhalten hatte. »Früher«, verkündete Plotkin, »war der Held eines literarischen Werkes eine einzelne Persönlichkeit. Aber erst die Literatur des sozialistischen Realismus entdeckt einen neuen Helden, den Menschen der Arbeit. Die epochale Neuerung der Sowjetliteratur besteht obendrein darin, dass nun nicht mehr der einzelne Mensch zum Helden wird, sondern das Kollektiv, das Arbeitskollektiv. Doch Wassili Ashajew ist noch weiter gegangen! Er hat bewiesen, dass zum literarischen Haupthelden nicht nur der Mensch der Arbeit werden kann, nicht nur das Kollektiv, sondern der Gegenstand der Arbeit selbst! Daher können wir mit Fug und Recht sagen, der Hauptheld des Romans ›Fern von Moskau‹ ist«, der Professor machte eine kurze Pause und schloss feierlich: »die Erdölleitung!«
Im Frühling legte Gemo das Literaturexamen bei einem jungen Assistenten des Professors ab, Fjodor Abramow. Als er sagte, der Hauptheld von Ashajews Roman sei die Erdölleitung, runzelte der einstige Frontsoldat die Stirn und sagte verächtlich: »Unsinn!« Diese Bemerkung säte in Gemos Kopf Zweifel. Dann war also nicht alles, was die Gelehrten vom Katheder verkündeten, endgültige Wahrheit.
Allmählich gewöhnte sich Gemo an das Stadtleben, und es bildete sich sogar eine mehr oder minder feste Tagesordnung heraus. Nach seiner tschuktschischen Gewohnheit, die er sein ganzes Leben lang beibehalten sollte, stand er früh auf, im Morgengrauen, machte aber, um die anderen Bewohner nicht zu wecken, kein Licht, zog sich im Dunkeln an und ging in den Waschraum. Dort traf er, nachdem er das Licht angezündet hatte, meistens seinen blinden Bettnachbarn, den Politökonomen Samzow, an, der sich in tiefer Finsternis rasierte. Samzow erkannte und grüßte ihn, während er sich vor dem Spiegel weiter mit dem elektrischen Rasierapparat übers Gesicht fuhr. Zuerst wunderte sich Gemo: Wenn er sich selbst nicht sah und sich im Dunkeln rasieren konnte, wozu brauchte er den Spiegel? Dann aber kam er darauf: Samzows Rasierzeug lag auf dem Wandbrett vor dem Spiegel.
In einer kleinen Küche neben dem Freizeitraum lieferte ein großer Boiler immer kochendes Wasser. Hastig trank Gemo Tee und setzte sich mit seinen Büchern an einen Tisch. In diesen zwei, drei Stunden schaffte er es, einige Texte für das Lehrbuch zu übersetzen, das er gemeinsam mit Skorik zusammenstellte, und auch sonst fast alle erforderlichen Arbeiten zu erledigen, so dass er den Tag freihatte. Er konnte nach den Vorlesungen mit der Straßenbahn spazieren fahren, durch die Stadt schlendern und, falls er Geld besaß, sich ein Bier genehmigen; auch Bibliotheken besuchte er – die Fakultätsbibliothek, die Zentralbibliothek und sogar den Zeitungssaal der Öffentlichen Bibliothek.
Während Gemo an dem Lehrbuch in seiner Muttersprache arbeitete, kehrte er gewissermaßen in die Heimat zurück. Das Buch war für die außerschulische Lektüre bestimmt und enthielt alles Mögliche: Erzählungen von Klassikern der russischen Literatur, Werke sowjetischer Schriftsteller, Gedichte und Skizzen über Naturerscheinungen.
Als Pjotr Jakowlewitsch Skorik die ersten Proben seines Studenten gelesen hatte, sagte er zufrieden: »Du bist zweifellos sehr befähigt!«
3
Die Siebzehnte Linie der Wassili-Insel endet in einer Richtung am Newa-Ufer, das hier aber nicht so prächtig und feierlich aussieht wie dort, wo die Akademie der Künste liegt und wo den Kai zwei aus dem alten Theben stammende Sphinxe zieren. Schiffe verschiedener Größe lagen da, eng aneinander gedrängt, und auch das Publikum, das am staubigen Ufer spazieren ging, unterschied sich von jenem, das auf dem Newski-Prospekt defilierte.
Nesnamow blieb am Krusenstern-Denkmal stehen.
Gemo war überrascht von der einsamen Figur, die aussah, als wäre sie von einem am Granitufer liegenden Schiff an Land gekommen. Trotz des ziemlich hohen Sockels schien der Seefahrer auf der Erde zu stehen, er hatte den Kopf leicht geneigt, als wolle er scheu die Spaziergänger grüßen, die an der rostigen Bordwand des riesigen, zu einem Wohnheim umfunktionierten deutschen Beuteschiffs vorüberkamen. Von da erklang Musik. Jemand spielte Akkordeon, und unmittelbar neben der Bordwand drehten sich etliche Paare im Tanz, Staubwolken wirbelten auf. Gemo hielt seinen Erstling, der von Tag zu Tag schwerer wurde, im Arm und beobachtete neugierig, was da vor sich ging. Er übersetzte jetzt viel in seine tschuktschische Muttersprache und verdiente genug, um ein Zimmer einer Wohnung zu mieten, die im Hof des ufernächsten Hauses der Siebzehnten Linie gelegen war. Ihm gefiel diese eher einfache Gegend ohne die Paläste und Villen, die durch ihre Pracht einschüchterten. Vor allem aber zogen ihn die am Ufer vertäuten Schiffe an, darunter die vertrauten, mit Motor und Segeln ausgestatteten hydrografischen, die im Frühling als erste nach Uëlen zu kommen pflegten. Ihm hatte immer geschienen, als führen die schönsten Schiffe vorüber, mit Kurs auf Nordwest, der Küste des Nördlichen Eismeers entlang, das die große Sowjetunion umspülte. Die aber, die sich der Uëlener Küste näherten, brachten neue Menschen, neue Waren für das unmittelbar vor dem Krieg gebaute Kaufhaus.
Die Leningrader Uferstraße wurde für Gemo ein Ort des Erinnerns, der gedanklichen Rückkehr in heimatliche Gefilde, an die heimische Küste und das hohe Kap hinter dem Leuchtturm. Sergej lag ruhig in seinem Arm, schniefte friedlich und nuckelte verschlafen an seinem Gummischnuller, den sie mit großer Mühe in einer Apotheke ergattert hatten. Wenn er die Universität beendete, würde Sergej schon fünf Jahre alt sein und in Uëlen bereits zur Schule gehen, die sein Vater sieben Jahre besucht hatte, von 1939 bis 1945. So würde es sein, wenn …
Vor einigen Tagen hatte Gemo beim Schulbuchverlag, der sich im markanten Haus Nr.28 auf dem Newski-Prospekt befand, Alteingesessenen als Singer-Haus bekannt, ein neues Manuskript für das Lesebuch abgegeben. Er hatte dafür einen Vorschuss bekommen, eine hohe Summe. Den Termin zu halten hatte ihn freilich Mühe gekostet. Die Arbeit am Manuskript war für eine Weile ins Stocken geraten. Es fehlten Gedichte, die den tschuktschischen Jahreszeiten gewidmet waren, bis Gemo Skorik kühn vorschlug: »Und wenn ich nun diese Verse schreibe?«
»Kannst du denn das auf tschuktschisch?« fragte Skorik skeptisch.
»Ich versuch’s halt.«
Skorik hatte vor Kurzem seine Dissertation eingereicht und den Grad eines Kandidaten der Philologie erworben. Akademische Grade verliehen einem eine neue Qualität, schufen einen unsichtbaren Glorienschein ums Haupt. Wie bei Innokenti Suslow, der über die Geschichte der geografischen Entdeckungen in der sowjetischen Arktis las und, äußerlich ein unscheinbares Männlein, in gestopften Hosen und geflickten Schuhen herumlief. Doch er war Professor, das war unverkennbar, wenn er den Universitätskorridor entlangging. Gemo kannte sogar einen sehr bedeutenden Akademiker, den Lehrer von Pjotr Jakowlewitsch Skorik, Iwan Iwanowitsch Mestschaninow, der vor allem als Direktor des Marr-Instituts für Sprache und Denken tätig war. Das zarte, in Wuchs und Körperbau eher einem Jüngling ähnelnde Akademiemitglied mit sorgfältig gestutztem grauem Schnurrbart fuhr an dem von ihm geleiteten Institut in einem prächtigen SIL 110 vor, der Chauffeur sprang eilfertig heraus und öffnete dem Wissenschaftler die Wagentür.
Die Stadtsonne, irgendwie staubig, vor allem gegen Ende des Tages, als hätte sie den Schmutz der Straßen aufgenommen, versank langsam hinter den am anderen Ufer der Smolenka gelegenen Häusern, hinter dem schattigen Smolensker Friedhof. Doch immer mehr Volk strömte auf die Uferstraße, und die Musik wurde lauter. Betrunkene kamen aus den Bierstuben in den nahe gelegenen Kellern getorkelt, wo herrliche Würstchen verkauft wurden und man einen Krug Shiguljower Bier »mit Anhänger« bestellen konnte, das heißt mit hundert oder hundertfünfzig Gramm Wodka. Gemo hatte das Getränk probiert, und es hatte ihm gefallen, denn es stärkte Geist und Kühnheit, half ihm, einem beliebigen Gedanken Ausdruck zu verleihen, für den er vorher, als er noch nüchtern war, die passenden Worte nicht gefunden hatte. Das karge Stipendium verjubelten sie gewöhnlich in so einem Bierkeller, an den übrigen Tagen aber tranken sie vorwiegend ungesüßten Tee und aßen dazu ein Brötchen nebst billigen, zuckerbestreuten Bonbons. Heute musste Gemo in keine Bierstube gehen: Zu Hause warteten ein reich gedeckter Tisch und Gäste – die unvermeidlichen Nachbarn und zwei studierende Landsleute, der Eskimo Guchuge und der Tschuktsche Korawje.
Von den Gästen war als Erster der Nachbar Iwan Dodin gekommen, ein Chauffeur. Er bewohnte mit seiner Frau und einer Stieftochter, Schülerin der zehnten Klasse und ein überreifes, schönes Mädchen, das größte Zimmer der Wohnung.
»Du hast ein gutes Quartier gefunden«, bemerkte Korawje, der ein Studium an der Abteilung Geschichte der Fakultät für die Völker des Nordens aufgenommen hatte. Er zeichnete sich durch seine Ordentlichkeit aus und unterschied sich rein äußerlich vorteilhaft von seinem Freund, dem aus Unasik gebürtigen Eskimo Guchuge, an dem alles zerknautscht und zerknittert aussah – sogar das Gesicht wirkte irgendwie schief im Unterschied zu dem glatten, ansprechenden Gesicht seines Landsmanns. Manchmal kam Gemo der Gedanke, dass Korawje – wenn sich der orthodoxe Glaube weiter in Russland verbreitet hätte – ein sehr guter Pope geworden wäre mit seiner Gründlichkeit und seinem imponierenden Gehabe.
»Du hast hier ein Schwitzbad, eine Bierstube und die Miliz!«
»Weit gehen musst du jedenfalls nicht!« setzte Guchuge hinzu, ohne freilich zu präzisieren, was er meinte.
Diese drei städtischen Einrichtungen befanden sich alle im Hof des Hauses, und aus der Küche konnte man abends durch das zur Hälfte überstrichene Fenster des Schwitzbades die Frauenabteilung sehen, wo sich im durchsichtigen Dunst verführerische nackte Gestalten bewegten. Guchuge bemerkte, es wäre nicht schlecht, im Haus ein Fernglas zu haben.
Gemos Frau Valentina stellte einen großen Topf mit gekochten Kartoffeln und Salat auf den Tisch. Die Gäste setzten sich manierlich. Iwan Dodin, einstweilen noch nüchtern, führte eine ernsthafte und höfliche Unterhaltung und erörterte die amerikanische Aggression in Südkorea.
»Den Kapitalisten lässt der siegreiche Vormarsch des Sozialismus keine Ruhe«, sagte er tiefsinnig.
»Sie wollen die Märkte erweitern«, pflichtete ihm Korawje bei.
»Die Koreaner sind übrigens uns, den Tschuktschen und Eskimos, ähnlich«, bemerkte Guchuge.
»Vielleicht sind sie entfernte Verwandte von euch?« mutmaßte Dodin.
»Gut möglich«, sagte Korawje. »Wissenschaftler sind der Meinung, es gebe eine pazifische Zivilisationsgemeinschaft. Dazu gehört die Kultur des Fischfangs und der Jagd auf großes Seegetier. Anders als die Europäer, die den Boden pflügen, landwirtschaftliche Kulturen anbauen und Vieh halten, leben diese Völker von den Gaben des Meeres.«
»Und die Rentierzüchter?« mischte sich Guchuge ein, der gierig den Tisch betrachtete und es auf den fetten Schinken abgesehen hatte.
»Die Rentierzucht ist bei den Tschuktschen erst vor relativ kurzer Zeit aufgekommen«, erklärte Korawje.
»Schenkt euch ein, greift zu!« forderte die Hausfrau ihre Gäste auf.
Gemo war fast glücklich: Er besaß ein nahezu eigenes Zuhause, zumindest für etliche Monate, war verheiratet, hatte einen Sohn und konnte freigebig Gäste bewirten.
Wer hätte gedacht, dass eine zufällige Begegnung auf einer Linie der Wassili-Insel sein weiteres Leben bestimmen würde?
Valentina war auf dem Mittleren Prospekt der Wassili-Insel zur Baltischen Werft unterwegs gewesen. Vor dem Krieg hatte ihr Vater in dem Werk gearbeitet, und auch später, während der Blockade, war er dageblieben. Jeden Tag war er zu Fuß ins Werk gelaufen, trotz Beschuss und Bomben, unterm Heulen der Luftschutzsirenen und dem Pfeifen von Geschossen, so lange, bis er sich eines Morgens nicht mehr von seinem Lager erheben konnte. Valentina hoffte, Arbeit im Konstruktionsbüro zu bekommen, denn sie hatte im Institut für Städtebau den Beruf einer technischen Zeichnerin erlernt.
Ein sonderbarer junger Mann war ihr von der Uferstraße her gefolgt, und an der einsamsten Stelle, als weit und breit keine Passanten zu sehen waren, blickte er sich zum Entsetzen des Mädchens um und trat dicht auf sie zu. Er stellte sich als Student der Universität vor, der für den Sommer Arbeit suche. Doch aus irgendeinem Grund kam er nicht mit in die Kaderabteilung, wo Valentina wieder einmal kein Glück hatte, weil sie keine ständige Aufenthaltserlaubnis besaß. Obwohl ihre Dokumente belegten, dass sie aus dem belagerten Leningrad evakuiert worden war, konnte sie diese Bescheinigung in ihrer Heimatstadt nicht bekommen. Ihre Wohnung hatten andere, ihr unbekannte Leute belegt, daher verweigerten sie ihr in der Hausverwaltung das erforderliche Papier, und das Mädchen musste bei nahen und entfernten Verwandten um Unterschlupf betteln. Gemo erwartete sie bei der Pförtnerloge, und nachdem er das Mädchen angehört hatte, versprach er ihr, für sie Arbeit mit dem Abschreiben seiner Manuskripte in tschuktschischer Sprache zu besorgen. Also verabredeten sie ein Treffen. Aus dem Abschreiben der Manuskripte wurde nichts. Es stellte sich heraus, dass der Verlag sie maschinengeschrieben brauchte. Doch sie trafen sich auch fernerhin, bis zum Spätherbst, als Valentina beschloss, sich zur Holzaufbereitung in Karelien anwerben zu lassen. Da war Gemo klar, dass er sie für immer verlieren würde, und er machte ihr einen Heiratsantrag – er, ein Mann, der nichts besaß außer einem Bett im Wohnheim und Essenmarken für die Universitätsmensa. Aber Valentina willigte ein. Sie ließen die Ehe im Standesamt auf der Achten Linie der Wassili-Insel registrieren.
Zwei Jahre waren vergangen, und zur Verwunderung vieler war diese übereilte Ehe nicht zerbrochen; nun waren sie sogar zu dritt.
»Autofahren ist doch etwas anderes als ein Hundegespann lenken!« verkündete Dodin laut und wandte sich an den neben ihm sitzenden Guchuge. »Weißt du, was Lenkradspiel ist?«
Guchuge aber war mit seiner schönen Nachbarin, Dodins Stieftochter Margarita, beschäftigt. Geschmeichelt von seiner Aufmerksamkeit, gestattete das Mädchen beglückt, dass er ihr Wodka ins Bier goss.
»Als ich mit meinem Anderthalbtonner in Prag einfuhr«, erging sich Dodin in Kriegserinnerungen, »haben mir die Mädchen Blumen auf die Motorhaube geworfen! Ganze Sträuße!«
Gemo war zufrieden. Allmählich kam Fröhlichkeit auf, die Gäste aßen und tranken, Valentina und Dodins Frau schafften es kaum, immer wieder Töpfe mit gekochten Kartoffeln hereinzubringen.
Korawje, der den Wodka nur in kleinen Schlucken trank, erzählte von seinen historischen Forschungen.
»Wir Tschuktschen haben schon etwas, worauf wir stolz sein können! Ich habe mir in der Bibliothek einen Geschenkband bestellt, der zum dreihundertsten Jahrestag der Romanow-Dynastie herausgegeben wurde. Im Verzeichnis der Völker, die unter der zaristischen Selbstherrschaft lebten, stehen auch wir. Aber mit der Bemerkung: ein nicht völlig unterworfenes Volk … Versteht ihr, alle möglichen Tataren, Baschkiren, Kleinrussen, Weißrussen und Georgier, von den Kalmücken will ich gar nicht erst reden, alle haben sich unterworfen, wir aber nicht!«
Gemo hatte das nicht gewusst. Korawjes Mitteilung ließ sein Herz höher schlagen.
»Du hast doch Verse für das Lehrbuch geschrieben«, fuhr Korawje fort. »In der Literatur ist es gewöhnlich so: Bevor ein Schriftsteller ins Lesebuch kommt, muss er als beispielhaft anerkannt sein, meist geschieht das erst nach seinem Tod. Du aber gerätst im Nu ins Lesebuch! Das will doch was heißen!«