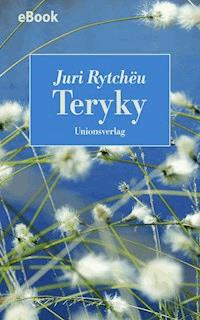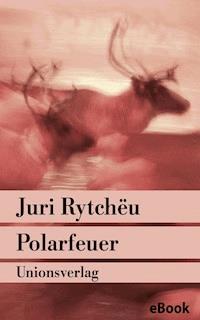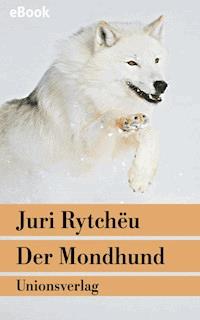11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Juri Rytchëus Familiengeschichte ist zugleich die Saga des tschuktschischen Volkes. Denn von Generation zu Generation wurden seit Anbeginn der Zeiten die Taten, Verdienste und Schicksalsschläge weitergegeben. Wir hören von Göttern, Geistern, Händlern und Zaren, vom Segen der Nähnadel, vom Fluch des Alkohols. Eine fremde, barbarische Zivilisation voll technischer Wunder bricht über die kleine Siedlung an der Küste herein. Die hohe Kunst, im Einklang mit den rauen Naturkräften der Arktis zu leben, droht in Vergessenheit zu geraten. Da beschließt der letzte Schamane Mletkin auf eine große Reise zu gehen. Als er schließlich an sein heimisches Ufer am arktischen Meer zurückkehrt, versucht der er, das alte und das neue Wissen zu vereinen, um seinem Volk eine Zukunft zu sichern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Die hohe Kunst, im Einklang mit den rauen Naturkräften der Arktis zu leben, droht in Vergessenheit zu geraten. Da beschließt der letzte Schamane der Tschuktschen, auf eine große Reise zu gehen, um die fremde, barbarische Zivilisation zu verstehen. Das alte und das neue Wissen in sich vereint, versucht er, seinem Volk eine Zukunft zu sichern.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Antje Leetz (*1947) war Lektorin für neue russische Literatur im Verlag Volk und Welt Berlin und Redakteurin in einem Verlag in Moskau. Sie als Herausgeberin, Übersetzerin und als Autorin von Radiofeatures zum Thema Russland tätig.
Zur Webseite von Antje Leetz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Juri Rytchëu
Der letzte Schamane
Die Tschuktschen-Saga
Roman
Aus dem Russischen von Antje Leetz
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Aus dem russischen Manuskript »Biblija po-čukotski, ili poslednij šaman Uėlena«.
Originaltitel: Biblija po tschukotski, ili posledui schaman Uelena
© by Juri Rytchëu 2000
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30447-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 02:58h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER LETZTE SCHAMANE
VorwortErster TeilDie Erschaffung der Erde, des Himmels, der Wasser und des MenschenDer erste Mensch unseres GeschlechtsLeben und Prüfungen MlemekymsDas Erscheinen der RentiermenschenDie Prüfung der SchamanenDie Bewahrung des NamensDie ersten HaarmünderKrieg mit den TangitanDer Jahrmarkt am Fluss AnjuiDer Angriff der TangitanWale und TangitanZweiter TeilDie Geburt des GroßvatersDie Schule der SchamanenReise durch die TundraDas Meer und der MenschWale und MenschenBei den HaarmündernDie VölkerschauIn San FranciscoZurück in UëlenMletkins neue FamilieZeiten und MenschenDie neuen RussenÜbersichtskarteWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Antje Leetz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Juri Rytchëu
Zum Thema Russland
Zum Thema Arktis
Zum Thema Schamanismus
Zum Thema USA
»Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes …«
Das erste Buch Mose, Genesis 1. Kapitel
»Die Menschen schaffen die Götter nach ihrem Bild und Ebenbild …«
Mletkin, der letzte Schamane von Uëlen
Vorwort
Nach altem Brauch wird die Abstammung eines Menschen als Baum mit vielen verzweigten Ästen dargestellt.
Wo ich geboren wurde, da wachsen kein Wald und keine hohen Bäume. Aber das heißt nicht, dass es dort überhaupt keine Pflanzen gibt. Es gibt sogar Birken, Zedern, Weiden, Erlen. Allerdings ragt die Krone des größten dieser »Bäume« nur wenige Zentimeter aus dem Erdboden.
Meine Ahnentafel gleicht dem Tundragewächs Junëu – der Goldenen Wurzel, die fest in der Muttererde verankert ist. Sie sitzt nicht tief, denn der ewige Frost macht den Boden hart. Aber kein Sturm kann sie ausreißen, keine Kälte ihre Wurzeln abtöten.
Genauso stelle ich mir meine Wurzeln vor, die ich in diesem Buch bis zu den frühsten Ursprüngen zu ergründen suche.
Viele Berichte über meine Vorfahren, insbesondere über die fernen, sind nicht dokumentarisch belegt, weder auf Papier noch in einer anderen Form, über die die moderne Zivilisation verfügt, wie sonst üblich bei historischen Personen. Aber sie leben im Gedächtnis der Menschen, wie auch unsere Vergangenheit in der Erinnerung weiterlebt, sie wird von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. Die zeitlich jüngeren Ereignisse treten natürlich deutlicher hervor. Je weiter das Leben meiner Vorfahren in die Vergangenheit zurückreicht, desto nebelhafter erscheint es. Um es wieder zu erwecken, muss ich nicht nur mein Gedächtnis anstrengen, sondern auch meine Vorstellungskraft, gleich einem Künder vergangener Zeiten.
Möglich, dass meine Berichte über die vergangene Zeit von den so genannten wissenschaftlichen Forschungen abweichen. Hier bin ich bereit, mit den Männern der Wissenschaft zu streiten. Erstens, woher nehmen sie die Gewissheit, dass ihre eigenen Berichte wahr sind, wenn sie kein einziges Mal am Abend den langen Geschichten der berühmten Legendenerzähler zugehört haben, wie zum Beispiel dem Walrosselfenbeinschnitzer Nonno und meiner Großmutter Giwewnëu? Warum sollte den Erzählungen eines russischen Kosaken mehr zu trauen sein, der einen Tschuktschen oder Eskimo nicht von einem Tundratier unterscheiden kann, als den Berichten, die die Ureinwohner der Tschuktschenhalbinsel über Jahrhunderte überliefert haben?
Der Nebel, der die alten Mythen einhüllt, die uns den Geist des alten Lebens überbringen, soll sich ein wenig auflösen, hell und deutlich sollen die lebendigen Gesichter meiner Vorfahren werden, auf die ich nicht weniger stolz bin als die Vertreter angesehener europäischer Familien auf ihre ehrwürdige Herkunft.
In den Überlieferungen wird als erster Name unser Vorfahre Ermen erwähnt, der einen Sohn, Akmol, hatte. Der wiederum nahm sich in der benachbarten Eskimosiedlung Nuwuken die Eskimofrau Ulessik. Beide sollen einen Sohn, Mlemekym, gehabt haben und der wiederum einen jüngeren Bruder, Goigoi, den eine Eisscholle wegtrug und der sich in ein Teryky, einen Tiermenschen, verwandelte. Der Nachkomme von Mlemekym, Mlerynnyn, stahl den Ewenen eine Rentierherde und begründete auf der Tschuktschenhalbinsel die Rentierzucht, wofür er den Beinamen Mlakoran erhielt. Mlakoran nahm sich als zweite Frau die Ewenin Tulma, die die Tochter Koranau gebar. Durch die Hand dieser Tochter starb Mlakoran, denn nach Aussagen der beiden Schamanen Këu und Kelëu konnte nur dieses Opfer die Bewohner von Uëlen vor dem Massensterben retten. Der älteste Sohn Mlakorans, Tynemlen, wird in den Überlieferungen neben Kunlelju genannt, der berühmt war wegen seiner Siege über die russischen Kosaken. Zum Gedenken an die Vorfahren gaben die Schamanen dem nächsten Nachkommen unseres Stammes den Namen Mlemekym.
Die Namen wiederholen sich von Zeit zu Zeit. Mehrmals taucht der Name Tynemlen auf, der die Tochter des Rentiermenschen Tynawana zur Frau nahm. Ihr ältester Sohn, Mlatangin, heiratete Korginau, die Tochter des Schamanen Kaljantagrau, der die Verbindung der Ureinwohner von Uëlen mit dem Schamanengeschlecht begründete. Aus dieser Ehe ging mein Großvater Mletkin hervor, der die Tochter des Rentiermenschen Rentyrgin, Giwewnëu, heiratete, er war der letzte Schamane von Uëlen. Schamane heißt auf Tschuktschisch Enenylyn – jemand, der die Gabe des Enen hat, des Heilers. Übrigens besitzt das Wort Enen – Gott – in unserer Sprache die gleiche Wurzel wie das Wort Ener – Stern.
Dieses Buch soll jedoch nicht nur vom Stammbaum meines Geschlechts berichten, es ist nicht nur die Geschichte unseres Clans, es erzählt auch von der Quelle meiner Bücher. Einige tschuktschische Mythen kennen manche Leser vielleicht bereits aus Wenn die Wale fortziehen und Teryky. Mein Großvater Mletkin tauchte bereits als Kagot im Roman Die Suche nach der letzten Zahl und als Rinto in Die Reise der Anna Odinzowa auf. Der aufmerksame Leser wird Züge meiner Vorfahren in vielen Helden meiner Werke wiederfinden.
Und dennoch ist dieses Buch die Geschichte des letzten Schamanen von Uëlen.
Sankt Petersburg, 1998–2000
Erster Teil
Die Erschaffung der Erde, des Himmels, der Wasser und des Menschen
Einst flog ein Rabe über die Erde. Von Zeit zu Zeit verlangsamte er seinen Flug und entleerte sich. Dort, wo das Feste hinfiel, entstand das Festland, wo das Flüssige hinfiel, bildeten sich Flüsse und Seen und ganz zum Schluss winzige Teiche und Bäche. Manchmal geschah es, dass sich die Ausscheidungen des Erstvogels vermischten, dort entstanden die Tundrasümpfe. Die härtesten Teile des Rabenkots dienten als Material für Geröll, Berge und Felsen.
Aber die aus dem Inhalt von Darm und Blase des Erstvogels erschaffene Welt lag in undurchdringlicher Finsternis.
Da rief der Rabe die Vögel zu Hilfe und schickte sie nach Osten, damit sie in das feste, dunkle Himmelsgewölbe eine Öffnung für die Sonnenstrahlen hackten. Als Erster flog der Adler los. Der schwere Schlag seiner Flügel war lange in der Dunkelheit zu hören. Kraftlos und flügellahm kehrte er zurück, mit einem verbogenen Schnabel, aber ohne Erfolg. Als Nächsten schickte der Rabe den Hornlund. Er ist zwar klein, aber sein Schnabel kräftig und scharf. Auch der Hornlund kehrte erfolglos zurück. Desgleichen die Möwe, die Scharbe, die Schnepfe, die Lumme, die Ente und die langsame Eidergans.
Da meldete sich die kleine Schneeammer. Der Rabe zweifelte, aber es gab keinen Ausweg, kein anderer wollte mehr in das feste Himmelsgewölbe ein Loch hacken.
Die Schneeammer flog fort, und lange kam keine Nachricht von ihr.
Der Rabe dachte schon, der kleine Vogel wäre ebenfalls gescheitert. Aber eines Tages entdeckte er im Osten einen kleinen purpurroten Fleck. Der Fleck wurde immer größer, als ob sich Blut über das dunkle Himmelsgewölbe ergösse.
Gleich darauf tauchte alles in purpurrotes Licht – die vom Raben erschaffene Tundra, die Seen, Flüsse, Bäche, Hügel, Berge und steinernen Felsen. Und in diesem blutroten Streifen funkelte plötzlich ein Sonnenstrahl auf, der die Erde erhellte.
Auf der Spitze des Sonnenstrahls kehrte die Schneeammer zurück, die Vögel erkannten sie anfangs nicht: Die Brust des kleinen Vogels war mit purpurroten, blutigen Federn bedeckt und der Schnabel fast bis zum Stumpf abgewetzt.
So holte die kleine Schneeammer der Erde die Sonne, ihr ganzes übriges Leben aber musste sie mit einem winzigen, abgewetzten Schnabel und roten Federn auf der Brust herumfliegen.
Die anderen Tiere wurden teils aus unbeseelten Gegenständen erschaffen, teils aus größeren Tieren. Aber die allerersten Vertreter der Tierwelt entstanden immer paarweise, damit sie in Zukunft eigenständig leben und Nachkommen zeugen konnten.
Die erste Frau hieß Nau. Sie erkannte sich noch nicht als ein Wesen, das sich von den Tieren, von den niedrigen Tundrablumen, die zum Licht drängten, von den Keimen der Goldenen Wurzel Junëu, von den Wolken, die über den Himmel zum Meer zogen, unterschied. Ihre nackten Füße wurden vom Moos und vom weichen Gras gestreichelt und gekitzelt, und sie lachte leise. Ihr Lachen vermischte sich mit dem leisen Rauschen der Meeresbrandung, mit dem Raunen des Windes, mit dem Pfeifen der Zieselmäuse aus der Tundra.
Etwas Unüberwindliches zog sie zum Meeresufer, zur Brandung, zu den farbigen Steinchen, die im Wasser murmelten. Jedes Mal, wenn sie sich dem Ufer näherte, kamen die Meerestiere angeschwommen – die Ringelrobben, die Walrosse, die Seehunde, die Mähnenrobben.
Doch die stärkste Erregung und Freude empfand Nau, wenn der Wal angeschwommen kam und laut blasend eine Fontäne ausstieß – R-r-re-u! Sie antwortete mit einem Lachen und nannte den Wal – Rëu.
Einmal kam der Wal Rëu angeschwommen, als die Sommersonne schon tief über dem Horizont stand und ein heller Pfad von dem grellen Ball zum steinigen Ufer führte. Kaum hatte Rëu das nasse Ufergeröll berührt, verwandelte er sich in einen wunderschönen Jüngling, nahm Nau bei der Hand und führte sie in die Tundra auf einen grünen Moosteppich. Dort liebte er sie und streichelte sie, doch jedes Mal, wenn die Sonne zur Hälfte im Meer versank, eilte er zurück zum Ufer, ging ins Wasser, verwandelte sich mit dem letzten verlöschenden Strahl wieder in einen Wal und schwamm davon, wobei er eine Fontäne hoch in den Himmel stieß – R-r-r-rëu!
Und Nau rief ihm vom Ufer zu: R-r-r-rëu!
So ging es den ganzen Sommer, und es schien, als nähme das Glück kein Ende. Aber die Tage wurden kürzer, und immer häufiger glänzte Nachttau auf dem Hochzeitsbett aus Tundramoos und Gras. Die Sonnenstrahlen wurden spärlicher. In der Luft tanzten die ersten Schneeflocken. Wenig Zeit war geblieben bis zu dem Augenblick, wo das Eis das weite Meer erstarren ließ und tiefer Schnee die Erde zudeckte. Bald sollte Rëu mit seinen Verwandten in warme Gegenden ziehen, wo der Ozean immer frei ist von Eis. An jenem Abend konnte sich Rëu lange nicht entschließen, zurück ins Wasser zu gehen, obwohl die Wellen seine Beine umschmeichelten und die Brandung ihn leise rief: R-r-r-rëu … Nau stand wie immer in einiger Entfernung vom Ufer und beobachtete ihn.
Plötzlich wandte sich Rëu um und sagte: »Nein, ich kann dich nicht verlassen. Ich bleibe bei dir.«
Im Frühjahr, als die Flüsse aufbrachen und die Eisschicht in der Lagune taute, gebar Nau. Sie gebar kleine Wale und setzte sie gleich ins Wasser. Rëu betrachtete sie und lachte glücklich. Um die Kinder zu säugen, stieg Nau in die Lagune und ließ ihre von Milch prallen Brüste auf dem Wasser schwimmen. Die Waljungen kamen angeschwommen und saugten schmatzend. Sie wuchsen schnell, und im Herbst musste Nau sie ins offene Meer lassen, denn die Lagune wurde ihnen zu klein und zu flach. Im freien Meer schlossen sie sich ihren Walbrüdern an, die aus den warmen Gewässern kamen, wo das Meer niemals gefror. Nau und Rëu standen am Ufer und schauten auf ihre ausgelassenen Kinder, die sie kaum von den anderen Waljungen unterscheiden konnten.
Vor Einzug des Winters, als am Horizont die Eiskante auftauchte, zog die Walherde weg und mit ihr die Kinder von Nau und Rëu.
Im nächsten Frühjahr gebar Nau neue Kinder, die bereits ein menschliches Aussehen hatten. Danach gebar sie nur noch Menschen, die allmählich die Küstengegend besiedelten.
Die Seele von Rëu ging durch die Wolken, der Leib aber wurde nach seinem Wunsch in einem Meeresstrudel versenkt.
Nau jedoch blieb noch lange am Leben, und alle glaubten, es gäbe sie ewig. Sie wurde sogar die Ewig Lebende genannt.
Die Menschen wussten um ihre Herkunft, denn Nau erzählte oft davon. Im Sommer wimmelte das Meer von Tieren, die die Walbrüder herantrieben. Die Menschen jagten Walrosse, Seehunde und Ringelrobben, aber die Wale rührten sie im Angedenken an ihre Verwandten nicht an. Sicher hätte das ewig so fortgedauert, hätte sich nicht ein Mensch gefunden, der an der Verwandtschaft der Menschen mit den Walen zweifelte.
Er sagte: »Sie sind uns überhaupt nicht ähnlich. Sie sind sehr groß, stumm, nur ein Berg von Fett und Fleisch.«
Er legte eine Harpune auf einen Wal an. Nau ermahnte ihn, wollte ihn abhalten, aber der Mann blieb hart. Und er tötete den Wal. Im selben Augenblick, als die Harpune in das Herz des Meeresriesen drang, hörte das Herz der ewig Lebenden Nau auf zu schlagen.
Eine der Naturkatastrophen, die die Menschen als Bestrafung für ihre Sünden und für die Abkehr von jahrhundertealten Geboten zu erleiden hatten, war die verheerende Überschwemmung, die die Landverbindung zwischen den Inseln Imaklik und Inalit zerstörte und die Strecke zwischen dem Kap Konetschny und Kygmin – das ist Alaska – mit Wasser überflutete.
Die zweite Version der Herkunft des Uëlener Menschen besagt, dass die Uëlener nicht nur vom Wal Rëu abstammen, sondern auch vom Eisbären. Und die Uëlener Frauen seien Töchter der Sonne.
Im Pantheon der tschuktschischen Mythologie kann man sich leicht verirren. Aber nur auf den ersten Blick. Alle Widersprüche, unlogischen Beschreibungen der Helden in den alten Berichten, die Ungereimtheiten in ihren Handlungen ordnen sich dem Willen des Enantomgyn unter, des Schöpfers, der manchmal auch »Höhere Kräfte« genannt wird. Er oder sie tragen für alles die Verantwortung. Enantomgyn ist niemandem untertan, über ihm gibt es kein Wesen. Deshalb hängen sogar die Dämonen des Bösen – die Kelen – von seinem Willen ab und sind seiner unverständlichen Logik und seinen Absichten untergeordnet.
Der erste Mensch unseres Geschlechts
Ermen stieg langsam auf das hohe Kap, das über die schaumige Meeresbrandung ragte. Die aufgeregten Möwen und Lummen ließen ihren stinkenden Kot auf ihn fallen, der schmatzend auf den Umhang aus Walrossdärmen klatschte. Ermen drehte sich um und schaute auf die dunklen Punkte der Jarangas, die im weißen Schnee standen, der die lange, steinige Landzunge bedeckte. Dieser Ort gefiel ihm immer besser. Die Landzunge wurde im Süden von einer weiten Lagune umspült, vom Norden her rückte die Eiskante des zugefrorenen Ozeans heran. Der wasserreiche Bach, eingezwängt in ein schmales Tal und bis zum Grund zugefroren, schlief noch, aber bald würden die heißen Sonnenstrahlen des Frühlings Schnee und Eis schmelzen lassen, der helle, reine Strom würde über die Steine murmeln.
Die fernen Jarangas erinnerten Ermen an auf Schnee verteilten Kot. An fetten, schwarzen Kot, den der Wind noch nicht getrocknet hatte. »Uw-elen – Schwarzer Kot«, dachte Ermen und lächelte vor sich hin.
So erhielt die Siedlung der Luorawetlan, wie sich die Tschuktschen selbst nannten und was wörtlich »Mensch in der wahren Bedeutung« heißt, ihren Namen.
Der Ort erwies sich tatsächlich als außergewöhnlich. Wenn der Schnee taute und das Eis wegzog, lag die Landzunge, vom Wintermantel befreit, zwischen zwei Wassern. Es gab genug Meerestiere zum Jagen, und im Herbst lagerte unter dem Felsen eine riesige Walrossherde.
Mit geschärften Speeren machten sich die Uëlener in aller Frühe auf die Walrossjagd. Die Beute zerlegten sie gleich an Ort und Stelle und verstauten sie in Löchern, die sie in die gefrorene Erde gruben. Über das blutbefleckte Ufer kreisten Möwen, haschten nach den Eingeweiden und flogen damit aufs offene Meer.
Ermen suchte sich aus den von Blut und Fett glitschigen Kieselsteinen einen passenden Stein aus und machte sich daran, das stumpf gewordene Messer zu wetzen. Er hob den Blick und entdeckte auf dem Kamm des Felsens über dem Lagerplatz der Tiere menschliche Figuren, die die Uëlener schweigend beobachteten. Sogar auf große Entfernung konnte man erkennen, dass es sich um Aiwanalinen, Eskimos, handelte, die aus der benachbarten Siedlung Nuwuken auf dem Kap Deshnjow kamen und mit langen Speeren und Pfeil und Bogen bewaffnet waren. Ermen beobachtete die Aiwanalinen unverwandt, aber sie schossen keinen einzigen Pfeil ab.
Die Uëlener hatten sich die Lagerstätte der Walrosse angeeignet, die die Nachbarn als ihr althergebrachtes Eigentum betrachteten. Ermen wollte keinen Kampf mit ihnen, aber es gab keinen anderen Weg. Eine Verständigung war zwecklos, denn diese Menschen sprachen eine andere Sprache, und auch in ihrem Aussehen unterschieden sie sich von den Luorawetlan.
Die zahlreichen Zusammenstöße mit feindlichen Stämmen hatten Ermen auf dem langen Weg nach Uëlen eine einfache Regel gelehrt: Es siegt immer der, der als Erster angreift, der den Feind überrascht.
Mehrere Tage und Nächte wurden in Uëlen die Speere geschärft, die Frauen nähten dicke Walrosshäute für Panzer, die Alten schliffen beim Licht steinerner Tranlämpchen, in denen brennendes Moos schwamm, aus Walrosshauern scharfe Spitzen für die Pfeile.
Im Schutz der nächtlichen Dunkelheit stiegen die bewaffneten Männer in die Kajaks aus Leder, stießen lautlos ab und fuhren ganz dicht am Ufer entlang, wo die Felsen über dem Meer hingen, nach Nuwuken.
Im Hauptboot saß im Bug Ermens Sohn, Akmol. Der Junge wurde zusehends erwachsen, ein richtiger Mann, ein furchtloser Krieger. Wäre der nächtliche Angriff erfolgreich, könnte Akmol sich in Nuwuken eine Frau holen. Der Krieg hatte eine gute Seite: Die einsamen Männer des Stammes erhielten die Möglichkeit, sich eine Lebenskameradin zu beschaffen. Akmols ältere Brüder hatten bereits Familie, nun war die Reihe am Jüngsten. Wenn alles gelang, konnte man auf eine Erneuerung des Blutes hoffen. Die Ehen zwischen Luorawetlan und Fremden wurden für sehr fruchtbar gehalten, es wurden kräftige und gesunde Kinder geboren.
Akmol kannte seine Aufgabe, doch er war so aufgeregt, dass seine Hand, die den Speer hielt, taub wurde, in ihm erkaltete alles und das Herz schlug bis zum Hals.
Die Paddel hoben und senkten sich lautlos, nur das schwache Schimmern der Wassertropfen zeugte vom Vorhandensein der Angreifer. Jeglicher Laut wurde vom ewigen Tosen der Brandung verschluckt, die gegen das Meeresufer schlug, solange das Eis sie nicht bändigte.
Kaum hatten die Lederboote das Ufer erreicht, stürzten die Luorawetlan vorwärts. Sie kletterten leichtfüßig und lautlos den steilen Felsen hoch und drangen wie ein Sturmwind in die zur Hälfte unterirdischen Behausungen der Aiwanalinen ein. Schreie ertönten, Stöhnen, Aufrufe zum Widerstand.
Akmol riss die schwere Walrosshaut weg, die als Wohnungstür diente. In einer kleinen steinernen Lampenschale zitterte ein winziges Flämmchen. Aber sein Licht reichte aus, um die Menschen zu erkennen, die sich, zu Tode erschrocken, in einer Ecke zusammendrängten. Den Jüngling blickten die brennenden, kohlschwarzen Augen eines jungen Mädchens an. Akmol ging zu ihr, griff sie und zog sie mit sich. Er spürte nicht einmal, wie sich ihre Zähne, spitz wie bei einem jungen Hund, in seine Hand bohrten. Das Wehklagen von Frauen erscholl in der Dunkelheit neben den Behausungen aus Gestein, Stöhnen, Flüche in beiden Sprachen und laute, drohende Schamanenlieder, begleitet von donnergleichen Schlägen der Schellentrommeln. Hier und da leuchteten Feuer auf, die sich, als wären sie lebendig, von Hütte zu Hütte bewegten. An manchen Stellen brannte das Feuer heller, und im Schein der lodernden Flammen blinkten Speerspitzen auf und blitzten die Augen der Krieger.
Akmol schleppte das Mädchen zum Boot. Die Uëlener Krieger hatten sich hier bereits mit ihrer Beute, jungen Mädchen, versammelt. Die Aiwanalinen aus Nuwuken verfolgten die Lederkajaks nicht. Die Uëlener hissten die Segel und fuhren bereits beim Licht des anbrechenden Tages zu ihrer Landzunge zurück.
Akmols Beute lag gebunden auf dem Boden des Kajaks. Erst als der allein stehende Felsen Senlun deutlich hervortrat, gab Ermen seinem Sohn ein Zeichen, er solle das Mädchen losbinden. Die Aiwanalinin wandte ihr Gesicht ab, und einmal traf ihre Spucke sogar Akmols Auge. Er wollte die Gefangene schlagen, aber der Vater hielt ihn streng zurück: »Wage nicht, die zukünftige Mutter deiner Kinder anzurühren!«
Akmol musste Ulessik, so hieß das Eskimomädchen, wie ein wildes Tier zähmen. Es vergingen mehrere Monate, bis sie ihn an sich heranließ.
Indes machten die Aiwanalinen den Versuch, sich an den Uëlenern zu rächen, wurden aber am Zugang zur Landzunge im Tal von Ekwen, einer verlassenen Siedlung zwischen Uëlen und Nuwuken, geschlagen und zogen sich mit großen Verlusten in ihre Steinbehausungen zurück.
Als die meisten jungen Frauen, die beim ersten Kriegszug geraubt worden waren, schwanger wurden, beschloss Ermen, mit den Nuwukenern Frieden zu schließen. Diesmal fuhren sie an einem hellen Sonnentag los, ohne sich im Schatten der dunklen Felsen zu verstecken.
Von weitem sah Nuwuken wunderlich aus. Wie eine Anhäufung von Steinen, die vom Felsen gefallen sind. Als Ulessik ihre Heimatsiedlung entdeckte, rief sie fröhlich etwas in einer krächzenden, kehligen Sprache. Sie hatte ihre Heimatgegend erkannt und war so ungeduldig, dass sie nach vorn sprang und fast aus dem Boot gefallen wäre.
Ulessiks Leute standen dicht zusammengedrängt am Ufer. Über ihren Häuptern blitzten scharfe Speerspitzen aus harten Walrosshauern. Hinter den bewaffneten Männern standen Schamanen mit riesigen Schellentrommeln. Ihr Unheil verkündendes Gedröhn war weithin zu hören.
Die Uëlener waren unbewaffnet. Sogar die Harpunen für die Walrossjagd hatten sie zu Hause gelassen.
Als die Boote sich dem Ufer näherten, pfiffen hoch über den Köpfen der Uëlener Pfeile: Die Aiwanalinen gaben den Fremden zu verstehen, dass sie umkehren sollten.
Plötzlich vernahmen alle den lauten Schrei einer Frau. Das war Ulessiks Stimme. Sie flehte die Verwandten an, nicht zu schießen, sie schrie, sie seien mit guter Absicht gekommen, ohne Waffen. Sie war so erregt, dass sie mehrmals schluchzte und nicht weiterreden konnte. Der Pfeilbeschuss hörte auf, aber Ulessiks Schrei verstummte nicht, er verwandelte sich in einen Schrei von Schmerz und Leid. Akmol glaubte, seine Frau wäre von einem Pfeil getroffen worden, aber die anderen Frauen und die älteren Männer im Boot ahnten, was los war: Die Wehen hatten eingesetzt. Unter dem Stöhnen der Gebärenden stieß das Lederboot der Luorawetlan ans Ufer. Die älteren Frauen holten das Kind, trennten die Nabelschnur mit einem einfachen Jagdmesser an Stelle der üblichen Steinklinge durch, wickelten das Kind in das flauschige Fell eines jungen Rens und reichten es der glücklichen Mutter.
Akmol und Ulessik betraten gemeinsam mit ihrem Kind als Erste das Ufer von Nuwuken. Der Älteste der Aiwanalinen trat zu ihnen, und als er sich überzeugt hatte, dass das Neugeborene ein Junge war, zerbrach er über ihm einen Pfeil als Zeichen des ewigen Friedens.
Das Neugeborene erhielt den Namen Mlemekym, was bedeutet: Zerbrochener Pfeil.
Leben und Prüfungen Mlemekyms
Mlemekym hatte mehrere Brüder und Schwestern, die als einträchtige Familie neben dem Felsen der Uëlener Landzunge lebten und deshalb den Beinamen Enmyralinen erhielten, was bedeutet: die bei den Felsen wohnen.
Im Sommer jagten die Brüder Walrosse, Wale und Seevögel und im Winter Nerze, Seehunde und den Umka, wie die Tschuktschen den Eisbär nennen. Die Frauen nähten aus dem Fell der Bären Winterpologs, in denen es sogar bei der härtesten Kälte warm und gemütlich war.
Von den vier Brüdern heiratete der jüngste mit Namen Goigoi als Letzter. Er nahm sich eine Frau aus der Nachbarsiedlung der Aiwanalinen, so war es bei den Uëlenern Brauch geworden. Die junge Frau hieß Tintin, Süßwassereis.
Jeden Morgen, wenn sie ihren Mann auf den langen und schweren Weg ins vereiste Meer begleitet hatte, setzte sie sich in den kalten Teil der Jaranga und summte ihr Lied.
Eines Abends kehrte Goigoi nicht mehr vom Meer zurück.
Tintin heftete ihren Blick auf das Packeis, bis die Augen schmerzten und tränten, und tastete jede Falte des vereisten Ufers ab. Als er auch am nächsten Tag nicht kam, ging Tintin zum Schamanen Këu.
Gemeinsam mit Tintin vollführte der Schamane den unvermeidlichen Ritus und sagte, Goigoi sei entweder umgekommen oder habe sich in ein schreckliches, wildes, behaartes Wesen verwandelt, in einen Teryky.
Innerhalb von drei Frosttagen war das Eis, das mit dem Ufer zusammengewachsen war, fest geworden. Der Druck hatte das Packeis aufgetürmt, aber zwischen Eisbergen und Ufer lag eine gleichmäßige, glatte Schneefläche.
Tintin beschloss, ein Süßwassereisstück vom kleinen Wasserfall unter den Felsen zu holen. Sie spannte sich selbst vor einen leichten Hundeschlitten und lief im Schutz der blauen, tiefen Schatten der Felsblöcke, die über dem Meer hingen. Hier herrschte Stille. Aber etwas ließ sie aufhorchen. Tintin schaute sich um und beruhigte sich gleich wieder: Der Schnee war zu gering, als dass sie vor einer Lawine hätte Angst haben müssen, und bis zur Ankunft der Eisbären war noch viel Zeit.
Da hörte Tintin ein schwaches Stöhnen. Sie zuckte zusammen.
Goigoi lag zwischen zwei aufgetürmten Eisschollen, so als wollte er zwischen ihnen Schutz suchen. Wegen des Fells auf Gesicht und Körper war er kaum wiederzuerkennen. Seine Kleidung war zerfetzt.
Ein Mensch, der sich in einen Teryky verwandelt, kann sich nicht selbst töten. In einer alten Legende heißt es, dass der Teryky verdammt ist, den Tod von Menschenhand entgegenzunehmen.
»Goigoi!«, schrie Tintin. »Ich wusste, dass du zu mir zurückkehrst, ich war immer sicher, dass du lebst!«
Tintin fand eine Höhle, versteckte ihren Mann darin und befahl ihm, sich nicht in der Siedlung zu zeigen. Sie besuchte ihn heimlich und brachte ihm Essen.
Goigoi konnte nicht lange in der Höhle bleiben. Die Steinwände beengten ihn, der Gedanke an die Zukunft rief ihn ins Freie, und seine Augen suchten die vertrauten Umrisse der benachbarten Berge. In den Nächten kroch er aus der Höhle. Von der Anhöhe aus sah er den Widerschein der Feuer vor den offenen Türen der Jarangas. Eines Tages hielt er es nicht mehr aus, rutschte den Hügel hinunter, vergaß alle Vorsicht und kroch zu seiner Jaranga, die sich in der heraufziehenden Nacht dunkel vom Himmel abhob.
Plötzlich fingen die Hunde laut und wütend zu bellen an. Sie witterten ihn. Mlemekym kam mit einem Speer aus der Jaranga gerannt. Er sah, wie jemand wegrannte und in der Dunkelheit verschwand. Vielleicht war es nur eine Sinnestäuschung? Aber vielleicht war es der Teryky! Das Tier, in das sich der unglückliche Goigoi verwandelt hatte.
Këu trat zu ihm. »Mir ist sehr bang ums Herz, es war, als ob jemand hinter dem Hügel verschwunden ist.«
»Weder unser Vater«, sagte Mlemekym, »noch unsere Vorfahren, die wir noch kennen gelernt haben, haben berichtet, dass sie mit eigenen Augen einen Teryky gesehen haben. Sie haben nur davon erzählt. Sollte es uns etwa zuteil werden, eins zu sehen?«
»Und es zu töten«, sagte Këu.
»Und wenn es Goigoi ist?«
»Goigoi existiert nicht mehr … Nur der Teryky.«
»Was sollen wir tun?«
»Wir befragen die Götter.«
Aber der Teryky Goigoi kam von selbst zu den Menschen. Es stieg langsam den Hügel hinab und ging zu den Jarangas. Mlemekym versuchte das Gesicht des Tieres zu erkennen, doch die aufgehende Sonne blendete ihn, und dem Teryky ging sein mächtiger Schatten voran.
Mlemekym kehrte in die Jaranga zurück und holte Pfeil und Bogen. Auch Këu trat bewaffnet aus seiner Jaranga.
Die Brüder gingen langsam dem Teryky entgegen. Als sie so nah waren, dass sie seinen schweren Atem hörten, schien es Mlemekym, als ob jemand spräche.
Goigoi war in Hörweite seiner Brüder, die die Bögen gespannt hatten. Er schrie, sie sollten ihn gleich töten und nicht lange quälen.
»Als ob er spricht«, sagte Mlemekym.
»Ein Teryky kann nicht sprechen«, entgegnete Këu fest.
Plötzlich vernahmen alle Tintins Schrei. Sie rannte mit wehenden Haaren zu ihnen. Wie der Schatten einer Wolke, die der Wind wegträgt, raste sie an den Brüdern vorbei und rief: »Tötet ihn nicht! Er ist euer Bruder! Tötet ihn nicht!«
Goigoi ergriff Tintin. Seine Augen waren voller Tränen. Er sah sie das letzte Mal, das letzte Mal die Welt, die Wolken, das letzte Mal spürte er den kalten Wind, sah er die Brüder, die auf ihn zielten.
Goigoi nahm alle Kraft zusammen, stieß Tintin weg und schritt auf die Brüder zu. Im selben Augenblick fühlte er, wie sich mit einem dumpfen Geräusch zwei Pfeile in seine Brust bohrten. Er spürte keinen Schmerz. Er sah ein unglaublich helles Licht, in dem er schwamm, und er hörte, wie die Stimmen der Menschen sich immer weiter entfernten.
Tintin rannte zu Goigoi, aber auf seinen weit geöffneten Augen schmolzen die Schneeflocken nicht mehr.
Unter dem Schnee verschwand das Fell vom Gesicht des Teryky, und Goigoi erschien Tintin und den verwunderten Brüdern so, wie er an jenem Frühlingsmorgen von ihnen gegangen war …
Der dritte Pfeil, den Këu abgeschossen hatte, durchbohrte Tintins Kherker, und sie fiel vornüber, mit dem Gesicht auf Goigoi.
Mlemekym wird bereits im Zyklus »Über die Rekken« erwähnt, der zu den »Alten Legenden« gehört, wo wundersame Verwandlungen vor sich gehen, wo die Steine, Berge, Meereswellen, Wolken, das Gras eine Seele haben, wo die einen Tiere sich in andere verwandeln, der Mensch in verschiedenen Gestalten existieren und von einem Zustand in den anderen übergehen kann.
Mlemekyms ältester Sohn, der unser Geschlecht fortsetzte, wurde als ungewöhnlich großes und kräftiges Kind geboren. In seinem Mund war schon ein Vorderzahn zu sehen, und seine Mutter Ulessik hatte anfangs Angst, ihn zu stillen.
Mlemekym gab ihm lange Zeit keinen Namen, aus Furcht fehlzugehen. Bis sich das Kind eines Tages mit dem Kopf am Holzbalken des Bettes stieß und der einzige Zahn abbrach.
Da riefen alle wie aus einem Munde: »Er heißt Mlerynnyn! Gebrochener Zahn!«
Später änderte Mlerynnyn seinen Namen in Mlakoran um, was bedeutet »Der das Ren gebrochen hat«.
Aber das ist bereits eine andere Legende.
Das Erscheinen der Rentiermenschen
In der Mitte des Winters, wenn das Wetter umschlägt und sich die rote Frostsonne am Horizont zeigt, beginnt die Zeit der Entbehrung. Die Herbstvorräte an Kopalchen und gesäuerten Kräutern gehen zu Ende. Doch was noch wichtiger ist: Immer öfter kehrten die Jäger ohne Beute heim. Die Fröste, die in dieser Zeit sehr streng sind, überziehen das zwischen den Eisschollen bereits aufgetaute Wasser wieder mit einer Eishaut, und die Seehunde ziehen nach Süden.
In den kalten Jarangas wurde mit der einzigen Licht- und Wärmequelle, dem Seehundtran, sehr sparsam umgegangen, und um die langen, kalten und dunklen Winterabende zu verkürzen und zu verschönern, berichteten die Erzähler von vergangenen Zeiten, von zauberhaften Verwandlungen und von der Herkunft alles Lebens auf der Erde.
Aber die größte Anziehungskraft besaßen die Erzählungen über die Völker im Süden von Tschukotka, die hinter den felsigen Gebirgsketten lebten. Diese Menschen hatten ein ungewöhnliches Tier gezähmt, ein Ren mit weichem Fell, aus dem Winterkleidung hergestellt wurde, durch die kein eisiger Wind dringen konnte. Auf dem Kopf dieses wundersamen Tieres wuchs ein beinerner Strauch. Das Fleisch des Tieres hatte einen ungewöhnlich guten Geschmack. Die Herde weidete friedlich vor den Jarangas. »Das Essen weidet auf vier Beinen direkt vor der Jaranga«, berichteten die Erzähler und schluckten den kalten Speichel hinunter.
Mlerynnyn hatte bereits das Ufer, das von der steinigen Landzunge bis zu den Eisschollen mit einer dicken Schneeschicht bedeckt war, hinter sich gelassen, konnte aber nirgendwo auch nur das geringste Anzeichen von offenem Wasser entdecken. Einige Male kletterte er auf einen hohen Eishügel und schaute sich um, doch seine Augen tränten, und die heiß ersehnte dunkle Wolke über der Wasseroberfläche oder hellen Dampf konnte er nicht entdecken.
Die Nerze tauten mit ihrem Atem für gewöhnlich kleine Löcher in das dünne Eis, das sich gerade gebildet hatte. Aber überall war die Eisoberfläche gleichmäßig glatt und leicht mit Schnee bedeckt. Das Morgenrot verwandelte sich in einen verwaschenen, blassroten Streifen am Horizont, die Sonne tauchte nur für einen kurzen Augenblick auf, um gleich wieder im Meer zu verschwinden, so als wollte sie sich vor der schrecklichen Kälte verstecken.
Der Pelzbesatz rund um das Gesicht des Jägers war längst mit Reif bedeckt, und Mlerynnyn musste ihn mehrmals abklopfen, um besser sehen zu können. Es war Zeit zurückzukehren.
Er stieg auf einen kleinen Eisberg und musste plötzlich lächeln: In der Nähe der Insel in der Meerenge lag auf einer flachen jungen Eisscholle ausgestreckt ein riesiger Umka – ein Eisbär – und beobachtete eine Ringelrobbe. Er lag so still und unbeweglich, dass er aussah wie tot. Mlerynnyn kannte diese trügerische Erscheinung gut. Er wusste, dass der Bär in diesem Zustand besonders hellhörig und vorsichtig war, ganz Aufmerksamkeit.
Der Jäger schlich sich von der windabgewandten Seite an und bemühte sich so leise aufzutreten, dass der Schnee unter seinen Füßen nicht knirschte. Manchmal schien ihm, dass der Bär ihn spürte, dann hielt der Jäger inne und hörte für eine Weile sogar auf zu atmen. Wenn der Eisbär den Kopf hebt und sich scheinbar verschlafen umschaut, ist es besonders gefährlich, sich zu bewegen. In solchen Augenblicken glaubte Mlerynnyn, sein Herz bliebe stehen. Natürlich hätte er sich mit dem Speer auf den Bären werfen können, um zu versuchen, das Tier sofort zu töten. Aber mit einem derart geschmeidigen Bären, der nur scheinbar schwerfällig dalag, war das kaum möglich. Um das Herz zu durchbohren, hätte Mlerynnyn mit der Speerspitze genau unter die linke Schulter treffen müssen. Der beste Augenblick des Angriffs war, wenn der Bär ganz mit der Ringelrobbe beschäftigt war. Allerdings brauchte man dazu viel Zeit. Und unbeweglich in der Kälte auf dem Eis zu liegen, war kein Vergnügen. Man konnte zu Tode erstarren.
Während Mlerynnyn nachdachte und bemüht war, sich durch keine einzige Bewegung zu verraten, fasste der Bär plötzlich mit einer blitzschnellen, geschickten Bewegung den glatten Kopf einer zum Atmen an die Oberfläche gekommenen Ringelrobbe und zog sie aufs Eis. Blut färbte den frischen Schnee und das riesige Tier knurrte vor Vergnügen. Verzaubert beobachtete Mlerynnyn die Bewegungen des Riesen und stürzte sich mit Geschrei auf den triumphierenden Bären.
Der Bär erstarrte vor Verwunderung. Diesen Augenblick nutzte Mlerynnyn, um den Speer mehrmals in den Körper zu stoßen. Das Tier fiel zuerst auf die Knie und sackte dann röchelnd, mit blutigem Schaum vor dem Maul, die Ringelrobbe unter sich begrabend, auf die Scholle.
Bei solcher Kälte musste sich Mlerynnyn beeilen: Der Frost machte das Fleisch hart, noch während er es schnell zerlegte und die schweren Knochen zur Seite warf. Das abgezogene Fell füllte er mit dem Fleisch, steckte noch die Robbe dazu und schleppte die Beute zum Ufer. In der Aufregung hatte er ganz die Zeit vergessen, den Rest des Weges musste er beim Schein des Polarlichts zurücklegen.
Nach altem Brauch bekam jeder aus der Siedlung ein Stück von der Beute ab – vom zahnlosen Alten bis zum Säugling. Das Festessen fand in Mlerynnyns Jaranga statt und dauerte vom Morgen bis zum Abend. Als die Menschen satt waren und eine gesetzte und gemütliche Unterhaltung begann, kam wieder der alte Traum vom »Essen, das auf vier Beinen direkt vor der Jaranga weidet« hoch.
Wieder und wieder erzählte man sich, dass die Luorawetlan, die in der südlichen Tundra siedelten, von diesen wunderbaren Tieren so viele besaßen, dass sie sie nicht zählen konnten. Diese Rene hatten sie von benachbarten Völkern, die eine andere Sprache sprachen. Die Inbesitznahme der Rentiere war allerdings durchaus keine friedliche Angelegenheit gewesen, zeitweise war es sehr blutig zugegangen. Doch das hatte die Luorawetlan nicht aufgehalten: Das Überleben auf dieser Erde, die arm war an Nahrung, war die Hauptsache.
Im Frühjahr, als die Schneekruste noch fest genug war, um die schwer beladenen Schlitten zu tragen, machte sich Mlerynnyn mit einigen gut ausgerüsteten Kameraden auf den weiten Weg, um sich Rentiere zu holen.
Anfangs fuhren sie am Meeresufer entlang, überwanden unbekannte Gebirgsketten, Täler und die von den fernen, blauen Bergen umrahmten endlosen Weiten der Tundra.
Mlerynnyn ließ sich von den wenigen Kenntnissen leiten, die er über die Kaaramkyner, eine ewenische Sippe, besaß. Ihre Lebensart weckte Bewunderung! Sie waren weder groß gewachsen noch stattlich. Aber sie ritten auf den gehörnten Tieren, statt sich den Strapazen eines langen Fußwegs auszusetzen.
Das Land, durch das Mlerynnyns kleine Truppe zog, war karg und menschenleer. Das Gesicht der Erde wechselte allerdings: In einigen windgeschützten Tälern wuchsen hier und da hohe Sträucher und sogar richtige Birken, deren Holz für die leichten Kufen der Winterschlitten verwendet werden konnte.
Die geschwächten Hunde schafften es kaum, die mit Walbarten schwer beladenen Schlitten durch die feuchte Tundra zu ziehen. Unterwegs jagten die Männer Wild und fingen Fische. Der Winter war längst zu Ende, der Schnee schmolz, und die Erde bedeckte sich mit Gras und Blumen. Aber von den Kaaramkynern keine Spur. An einem hellen Tag jedoch nahm Mlerynnyn in dem Duft der Tundrapflanzen einen kaum spürbaren Rauchgeruch wahr. Er war so fein wie eine Spinnwebe im Herbst, er verschwand, um kurz darauf wieder aufzutauchen, und es verging einige Zeit, bevor sich Mlerynnyn sicher war, dass der Geruch aus südöstlicher Richtung kam.
Es war der Geruch von Feuer, die Vorahnung eines Lebens, in dem das Aroma von gekochtem Rentierfleisch zu spüren war.
Als die Männer einen Hügel überwunden hatten, erblickten sie das Lager der Kaaramkyner – die nach oben spitz zugehenden Jarangas, über denen eine feine, zartblaue Rauchsäule stand. Kinder spielten, Frauen liefen hin und her und riefen sich mit unbekannten Kehllauten etwas zu. Doch Rentiere waren nicht zu sehen. Kein »Essen, das auf vier Beinen direkt vor der Jaranga weidet«.
Dann entdeckten sie die Tiere.
Zuerst dachte Mlerynnyn, das sei ein breiter Busch. Doch dieser Busch bewegte sich, und aus dieser sich bewegenden, lebendigen Masse drang ein Laut, der entfernt an das Grunzen von Walrossen erinnerte. Dieses Grunzen vermischte sich mit dem dumpfen Klang aneinander stoßender Geweihe, und dieser Laut weckte in Mlerynnyns erregtem Herzen die Erwartung eines reichen Festmahls, und dieses Gefühl war jenem ähnlich, das er empfand, wenn er ein großes Meerestier jagte. Schließlich entdeckten sie auch die Kaaramkyner selbst, die Rentierhirten. Sie rannten auf ihren krummen Beinen hin und her und trieben die Herde zusammen.
Mlerynnyn teilte seine Truppe auf: Den größeren Teil schickte er los, damit dieser die Hirten zusammen mit den Rentieren ergriff, und er selbst überfiel mit zwei Kriegern das Lager und drang in die verräucherten, dämmrigen Behausungen ein.
Hier roch es ganz anders als in den Jarangas der Meeresjäger, zu denen Mlerynnyn gehörte. Es überwog der Geruch harzigen Holzes, vermischt mit dem süßlichen Aroma gekochten Rentierfleischs, sauren Bluts und roher Häute.
Die Frauen drängten sich erschrocken in der hintersten Ecke der Jaranga. Mlerynnyn erblickte ein ängstliches junges Mädchen, und es überkam ihn heftiges Verlangen. Er zerrte sie an der Hand nach draußen, hinter die Winterschlitten, und nahm sie auf einem weichen, grasbewachsenen Hügel. Ihn verwunderte die ungewöhnliche Blässe und Zartheit der Mädchenhaut und das fast völlige Fehlen eines Haarpelzes auf dem Schoß, die begehrte weibliche Stelle erschien ihm wie ein weiches Kinderknie.
Das Mädchen weinte nicht und wehrte sich auch nicht sehr. Sie gab nach und bog sich sanft unter der Last des Mannes, und Mlerynnyn, versunken in süßer Wollust, war für einen Moment sogar dem grausamen Alltag entrückt.
Von nun an mussten die Überfallenen Sklaven sein, denn die Luorawetlan selbst, die von einem »Essen auf vier Beinen direkt vor der Jaranga« träumten, wussten nicht, wie mit den Rentieren umzugehen war, und fürchteten die Gehörnten sogar in der ersten Zeit.
Mlerynnyn musste sich beeilen: Sie mussten so schnell wie möglich das fremde Land verlassen, denn andere Kaaramkyner konnten angreifen und ihre Stammesgenossen befreien. Am dritten Tag versuchte der älteste der Kaaramkyner auf dem Rücken eines Rens zu fliehen, kam aber nicht weit. Mlerynnyn holte ihn ein, zog sein langes Jagdmesser heraus und stieß es dem Alten ins Herz. Wäre Mlerynnyn Gefangener gewesen, hätten sie mit ihm das Gleiche gemacht. Er erfüllte seine Pflicht. Der Mensch eines fremden Stammes war in den Augen der Luorawetlan kein Mensch. Er war ein Fremder, ein Feind, der den augenblicklichen Tod verdiente.
Die junge Gefangene schaute mit weit geöffneten Augen auf die Hinrichtung ihres Vaters, aber kein Muskel zuckte auf ihrem ebenmäßigen Gesicht, so als wäre sie versteinert. Die anderen, überzeugt von der Entschlossenheit des Führers der Luorawetlan, machten keine weiteren Fluchtversuche mehr.
In das heimatliche Uëlen kehrten sie auf bekannten Pfaden zurück, unter der warmen Sommersonne, die in der Tundra die Luft zeitweilig so erhitzte, dass sie, wären keine Mücken gewesen, mit nacktem Oberkörper hätten gehen können. Den Kaaramkynern machten die Bisse der blutrünstigen Insekten scheinbar nichts aus, sie verjagten sie träge von ihrem Gesicht und schritten völlig ruhig neben den Rentieren einher.
Mlerynnyn schlief in der Jaranga der Rentiermenschen, und jede Nacht nahm er viele Male die gefügige und süße Gefangene, die ihm mit jedem Tag lieber wurde. Mit Mühe gelang es ihm, ihren Namen zu erfahren – Dilma, Tilma oder Tulma. Er konnte ihn nie richtig aussprechen, und die junge Frau lächelte verschämt. Ihr flaches Gesicht, das an das aus Holz geschnitzte Gesicht eines guten Geistes erinnerte, drückte Nachdenklichkeit und Verständnis aus, und Mlerynnins Herz schmolz vor heißem, süßem Gefühl.
Sich aus einem fremden Stamm eine Frau zu nehmen, war ein alter Brauch, der noch aus den Zeiten stammte, da die Luorawetlan keine mit eigenen Händen gebauten Behausungen besaßen und gleich wilden Tieren in steinernen Höhlen lebten. So wurden Nachkommen mit erneuertem, frischem Blut gezeugt. Diesem Brauch war es zu verdanken, dass die Uëlener stark und gesund waren und Geisteskraft besaßen.
Mlerynnins Verhalten rief bei keinem seiner Gefolgsmänner Missbilligung hervor. Bedauerlich war nur, dass sich in der Siedlung nur ein einziges junges Mädchen fand, alle übrigen schienen uralte Weiber zu sein, die nur dazu taugten, das Haus ordentlich zu halten, Essen zu kochen und die schadhafte Kleidung zu flicken.
Manchmal erklärten die Kaaramkyner, dass eine Rast notwendig sei, damit die gehörnten Tiere ausruhen und auf dem Rentiermoos grasen konnten. Dann verließ Mlerynnyn seine Geliebte und begab sich zur Rentierherde. Er hielt respektvollen Abstand zu den Tieren, die ihn mit großen, vorwurfsvollen Augen ansahen und ihre spitzen, verzweigten Geweihe schüttelten. Sein Herz war voll von dem Gefühl erfüllter Pflicht: Von nun an würden seine Leute im Winter nicht mehr Hungers sterben, denn jetzt weidete tatsächlich direkt vor den Jarangas das »Essen auf vier Beinen«. Allerdings zeigte sich, dass das zarte, süße Rentierfleisch weniger sättigend war als das der Robben und Walrosse. Dafür waren es viele Tiere, nicht zu zählen!
Mlerynnyn wies seine Leute an, die Tätigkeit der Kaaramkyner aufmerksam zu beobachten, den Umgang mit den Renen zu lernen, um in Zukunft allein mit den Tieren fertig zu werden. Am schwersten erwies sich das Reiten. Die Kaaramkyner saßen auf dem Rücken des gehörnten Tieres, als wären sie festgewachsen. Allerdings waren sie kleiner und folglich auch leichter als die Luorawetlan, ein gutes Reittier konnte das Gewicht eines erwachsenen Kaaramkyners mit Leichtigkeit tragen.
Die Kaaramkyner lachten über die erfolglosen Versuche der Luorawetlan, auf das Rentier zu steigen. Es schien, als ob sie die Unfreiheit nicht im Geringsten bedrückte. Sie lebten so wie immer. Nur dass sie nicht mehr nach ihrem Willen nomadisieren konnten, denn Mlerynnyn zeigte ihnen jeden Morgen die Richtung an.
Sie bewegten sich langsam vorwärts, denn sie warteten auf den Winter, hofften, dass die Flüsse zufroren. Mlerynnyns kleine Truppe konnte die Wasserhindernisse mit dem Kajak überwinden, aber für eine riesige Rentierherde brauchte man einen zuverlässigen Übergang, obwohl die Tiere über kleine Flüsse ohne große Schwierigkeiten schwimmen konnten.
Mlerynnyn wurde klar, dass die Rene noch verhältnismäßig wilde Tiere waren, die den Menschen nicht an sich heranließen. Sogar die Reittiere musste man mit Bedacht aus einer großen Zahl völlig gleich aussehender Tiere auswählen. Das Geschick der Kaaramkyner rief bei Mlerynnyn Entzücken hervor. Sie konnten ein rennendes Rentier mit einem Lasso einfangen, mit einem Schlag zu Boden werfen und im selben Augenblick töten. Zum Zerlegen des Körpers brauchten sie nur einen kurzen Moment. Dabei verloren sie nicht einen Tropfen des kostbaren Blutes, das sie in den ersten Kammern des Magens auffingen und in einer warmen Ecke ihrer Jaranga aufhängten. Nach einigen Tagen war der dicke Brei aus halb verdautem Hautschlauch und gegorenem Blut gar. Das war ein sättigendes und nahrhaftes Essen, aber man musste sich erst daran gewöhnen. Das Rentier wurde voll und ganz genutzt, von den schwarzen Nüsschen des Kots zum Gerben der Haut bis zur letzten Sehne. Von den Rentierläufen zum Beispiel wurde die Haut abgezogen und Schuhe und Winterfäustlinge daraus hergestellt. Die übrige Haut wurde mit dem Messer abgekratzt und gegessen. Der größte Leckerbissen war das Mark aus den Knochen der Läufe, rosa, süß und fett, es hinterließ auf den Lippen noch lange Zeit eine dünne Fettschicht, die man nicht abwaschen konnte. Kaum ein Teil des Rens, der sich nicht als schmackhaft erwies. Sogar die Hufe wurden, wenn sie für eine bestimmte Zeit auf heißer Kohle gelegen hatten, weich und zart, und es war ein Genuss, sie abzunagen. Hatten sie einem getöteten Ren die Haut abgezogen, kamen gleich die Kinder angerannt und warteten ungeduldig darauf, dass sie ihnen gereicht wurde. Unter der Haut nisteten nämlich die großen weißen Larven der Bremsen – ein beliebter Leckerbissen.
Das »Essen, das auf vier Beinen direkt vor der Jaranga weidet« erforderte allerdings, wie sich herausstellte, unermüdlich Zuwendung. Vor allem durften die Rene nicht allein gelassen werden: Ständig versuchten sie, in die weite Tundra zu laufen, und dann würde es Tage dauern, die abtrünnigen Tiere wiederzufinden und zur Herde zurückzubringen. Deshalb waren immer mindestens zwei Hirten bei der Herde. Die Tiere mussten sich an Orten aufhalten, an denen es genügend Rentiermoos gab – unansehnliche, bläuliche Flechten, die Hauptnahrung der Tiere. Auch Wasser musste nahe sein, und es war wünschenswert, dass ein leichter Wind über die Herde wehte, der die Mücken und Bremsen vertrieb. Außer den Insekten machten auch die Tundrawölfe, kräftige und blutrünstige Tiere, auf Rene Jagd. Sie wurden mit Pfeilen abgeschossen, mit Fallen gefangen oder mit speziell darauf trainierten Hunden verjagt.
In der zweiten Sommerhälfte, als die Kälber herangewachsen waren, erklärten die Kaaramkyner, die Zeit der Schlachtung sei gekommen. Gerade jetzt sei das Rentierfell noch weich und eigne sich gut zum Nähen von Winterkleidung.
Die Kaaramkyner baten die Luorawetlan, sich bei der feierlichen Opferung für den Großen Geist des Rens nicht einzumischen und Abstand zu halten. Mlerynnyn versprach es. Er hatte Scheu vor den unsichtbaren Kräften, die auf das Menschenleben Einfluss ausübten. Auf alle mögliche Weise konnten sie auf die Menschen einwirken. Dass sie unsichtbar waren und namenlos, jagte ihm Angst ein, und er wollte sie lieber nicht verärgern.
Die Kaaramkyner fassten sich bei den Händen und stampften im Kreis um ein getötetes Rentier, wobei sie herzzerreißende Kehllaute ausstießen, die offenbar Gesang sein sollten. Sie bewegten sich in einem bestimmten Rhythmus, blieben auf einmal unverhofft stehen, ließen die gefassten Hände los und stießen aus weit geöffneter Kehle einsilbige Rufe aus. An diesem Tanz nahmen auch die festlich gekleideten Kinder teil. Tulma sah Mlerynnyn kokett an und machte eine einladende Geste, sich am Jubel zu beteiligen. Aber Mlerynnyn zögerte. Alles erschien ihm merkwürdig wild, unverständlich, Furcht einflößend.
In den folgenden Tagen waren die Frauen mit der Bearbeitung der frischen Haut beschäftigt. Außerdem waren die Tundrabeeren reif, im blauen Moos leuchteten die Hüte der Pilze, auf die die Rentiere besonders wild waren. Die gesammelten Beeren lagen fest zusammengepresst in Körben aus Baumrinde und wurden in die dunklen Ecken der Nomadenjaranga gestellt.
Gefangene und Sieger begannen sich allmählich zu verstehen. Die Kaaramkyner hatten sich offenbar mit ihrem Schicksal abgefunden. Sie wussten, dass die Unbekannten ihre Rene und ihre Kenntnisse brauchten. Sie sahen jetzt sogar fröhlicher aus, immer häufiger erklang in ihren Jarangas Lachen. Wenn sie ihre herzzerreißenden Lieder sangen, tanzten und die Arme in die Höhe warfen, dachte Mlerynnyn, dass sie eigentlich gar keine schlechten Leute seien. Aber um sie als Gleichgestellte zu betrachten, fehlte, dass sie die menschliche Rede kannten, außerdem stießen sie merkwürdige Laute aus, die sie wohl für Gesang hielten, auch waren sie klein, hatten flache Gesichter und ihre Augen waren unglaublich schmal. Wenn sie die Schlitze in der hellen Sonne auch noch zusammenkniffen, verstand Mlerynnyn gar nicht, wie sie überhaupt sehen konnten.
Erstaunlicherweise regten diese Mängel, die die Kaaramkyner von den Luorawetlan trennten, Mlerynnyns Manneskraft an, wenn er dabei an Tulma dachte. Gerade diese Unähnlichkeit mit den eigenen Frauen übte auf ihn große Anziehungskraft aus. Die junge Frau trug in ihrem Schoß schon die Frucht, und Mlerynnyn achtete darauf, dass sie von schwerer Arbeit verschont blieb, vor allem beim Aufbau des Nomadenlagers an einem neuen Ort, wenn die Frauen lange, mit fettigem Rauch getränkte Stangen schleppen und über das Gerippe der Jaranga eine riesige Flickendecke aus zusammengenähten Rentierfellen ziehen mussten.
Als die ersten Schneeflocken zu tanzen begannen und die Rentiere morgens knirschend die zugefrorenen Pfützen zertraten, brachte Tulma ein Mädchen zur Welt.
Die Kleine quäkte laut in der verräucherten Jaranga und öffnete lange ihre Augen nicht, als wollte sie diese Welt nicht sehen.
Mlerynnyns Herz füllte sich mit einer Zärtlichkeit, die er bis zu diesem Augenblick nicht gekannt hatte. Er hatte bereits Kinder von seiner ersten Frau, die er sich nach altem Brauch in der Nachbarsiedlung Nuwuken genommen hatte. Er liebte die Kinder und sorgte sich um sie, und wenn die Hungertage anbrachen, litt er vor allem unter seinem Unvermögen, sie satt zu machen. Aber dieses kleine Wesen mit den ungewöhnlich schmalen Augen erzeugte in ihm ein Meer von unerwartet warmen Gefühlen. Jedes Mal, wenn er das kleine Mädchen betrachtete und sah, wie es gierig an der blau geäderten Brust der Mutter saugte, glaubte er zu spüren, wie heißes Blut seine Adern füllte. Manchmal öffnete es seine verschleierten Augen und sah seinen Vater durchdringend an.
Das heimatliche Uëlen erreichten sie, als die Lagune schon mit festem Eis bedeckt war.
Die Uëlener betrachteten verwundert und skeptisch die riesige Rentierherde, die sich auf der weißen Eisdecke der Lagune verteilt hatte. Sogar die Hunde wagten nur aus der Ferne, die gehörnten Tiere anzubellen.
Këu trat zu Mlerynnyn und sagte: »Von nun an heißt du Mlakoran, denn du hast für unser Volk ein unschätzbares Geschenk geholt, das Essen, das auf vier Beinen direkt vor der Jaranga weidet.«
Mlakoran stieg zu seiner Jaranga hoch, auf dem Arm das in Fell gewickelte Mädchen. Einige Schritte hinter ihm ging Tulma, gekleidet in ein reich geschmücktes Frauengewand. Sie hatte die Augen gesenkt, aber Mlakoran sagte laut und deutlich, damit es alle hörten:
»Das hier ist meine neue Frau und mein neues Kind – Koranau!«
Die Prüfung der Schamanen
Nun teilte Mlakoran seine Zeit zwischen Uëlen und dem Nomadenlager, zwischen der Familie am Meeresufer und der in der Tundra. Er wurde zu einem guten Rentierhirten und fuhr nur noch selten zum Jagen aufs Meer. Er lernte sogar, sich mit den Kaaramkynern zu verständigen, und die kleine Koranau plapperte in zwei Sprachen gleichzeitig, womit sie bei den Erwachsenen ein wohlwollendes Lächeln hervorrief.
Mlakoran wählte zwei Uëlener Familien aus, wies sie an, ein eigenes Tundralager zu errichten, und teilte ihnen je eine Herde zu. Sie mussten alle Weisheiten des Umgangs mit den gehörnten Tieren lernen, um in Zukunft die Kaaramkyner ersetzen zu können.
Allerdings erwies sich der erste Versuch als erfolglos. Gleich im ersten Winter aßen die Rentierzüchter von Uëlen den fruchtbaren Teil der Herde auf und brachten das Vieh damit um die Möglichkeit, sich zu vermehren. Mlakoran war drauf und dran, seine Stammesgenossen deshalb zu schlagen, aber er wollte das nicht vor den Augen der gefangenen Kaaramkyner tun, die, obwohl sie sich frei in der Tundra bewegen konnten, niemals vergessen sollten, dass sie im Grunde Sklaven waren. Nicht genug, dass die neuen Herden um ihren Nachwuchs gekommen waren, die Rentiere flüchteten dazu noch in die Tundra, und die Gefangenen brauchten mehrere Tage, um wenigstens einen Teil der Herde zurückzubringen.
Die Rentierzucht war also gar nicht so leicht wie angenommen. Das »Essen, das auf vier Beinen direkt vor der Jaranga weidet« erforderte ständige Aufmerksamkeit. Die Gehörnten warteten nur darauf, dass der Hirte sich abwandte und mit einer anderen Sache befasst war.
Die Rentierzüchter murrten und verfluchten den Tag und die Stunde, als sie, verführt von der Aussicht auf ein leichtes Leben mit ständiger Nahrung, sich einverstanden erklärt hatten, in die Tundra zu ziehen. Aber sie verloren kein Wort darüber. Mlakoran war sehr schroff in der Bestrafung Unwilliger, egal, ob Gefangener oder eigener Stammesgenosse. Aus diesem Grund kam es oft zum Streit zwischen ihm und dem Hauptschamanen von Uëlen – Këu, einem kräftigen, betagten Mann, der für immer in seinem Alter eingetrocknet zu sein schien. Er allein konnte die Stimme gegen Mlakoran erheben. Er warf ihm vor, dass das Haupt des Stammes sich nicht mehr um sein Volk kümmerte und sich sogar mit einer Fremdstämmigen verbunden hatte, obwohl Këu selbst mit einer Aiwanalinin aus Nuwuken verheiratet war.
Tulma wurde in Uëlen nicht angenommen. Wenn Mlakoran die Heimatsiedlung und seine Jaranga besuchte, wurde für die Tundrafamilie ein abgeschiedener Polog vorbereitet, als seien sie ausgestoßen oder mit einer ansteckenden Krankheit behaftet. Obwohl Tulma die Sprache gelernt hatte, redete kaum einer mit ihr, meist ging sie mit der Tochter ans Meer und beobachtete stundenlang das endlose Wasser, Wellen und Meeresvögel, die zahlreich waren in der Sommerzeit. Manchmal stimmte sie ein sehnsüchtiges Lied an, das aus der Tiefe ihrer Kehle zu kommen schien, und Këu, der den unbekannten Lauten lauschte, schüttelte vorwurfsvoll den Kopf und sagte offen heraus, diese Frau hätte Mlakoran behext.
Këu sagte in einer riesigen Jaranga ununterbrochen Beschwörungsformeln auf. Er wollte seinen Stammesgenossen vom Zauber der fremden Frau befreien. Er rief alle helfenden Geister zu sich und beschenkte sie freigebig mit heiligen Opfergaben, doch umsonst: Mlakoran hatte das Leben am Meer schnell über und kehrte mit unverhohlener Freude in die Tundra zurück.
Das »Essen, das auf vier Beinen direkt vor der Jaranga weidet« bewahrte die Uëlener im Winter nicht vor Hunger. Gerade dann nämlich, wenn die schwerste Zeit nahte, der Höhepunkt des Winters mit spärlichem Licht und langen Frösten, die die freie Wasserfläche zwischen den Eisschollen mit einer dicken Eisschicht bedeckte, gerade in dieser Zeit zog die Rentierherde weit weg vom Meeresufer auf die Winterweiden. Um dorthin zu gelangen, musste eine mehrtägige Reise mit vom Hunger geschwächten Schlittenhunden unternommen werden.
Das ärgerte Këu, der genauso wie die anderen Uëlener darbte. Er glaubte, Mlakoran hätte sich absichtlich von der hungrigen und lästigen Verwandtschaft entfernt, nur um nichts vom Rentierfleisch abgeben zu müssen. Wenn Këu sah, wie die Uëlener Meeresjäger mit leeren Händen zurückkehrten, nachdem sie den ganzen Tag im Eiswind verbracht hatten, inmitten des Treibeises, dann erinnerte er sich, wie erfolgreich Mlakoran bei der Jagd gewesen war, bevor er zu den Rentieren zog. Und noch etwas konnte Këu beobachten: Ein echter Rentierzüchter überlegt lange, ob er das Ren tötet oder ob er diese Handlung umgehen kann.
Këu kam oft in die Jaranga der von Mlakoran verlassenen Frau, hörte ihr Wehklagen und seufzte mitleidig. Nach und nach brachte er die Rede auf die Hexerei, die ihren armen Mann verwandelt hatte.
»Wir haben doch bis jetzt ohne diese Rentiere gelebt und es war gut so«, sagte der Schamane. »Was für einen Nutzen bringen diese gehörnten Tiere, die man sowieso immer nur suchen muss? Versuch mal, in der Schneewüste so ein winziges Nomadenlager zu finden.«
Er fühlte, wie sein Hass auf Mlakoran wuchs. Dieser Hass drückte sein Herz ab und ließ ihn nicht frei atmen.
Këu hatte einen Sohn, dem er sein Schamanenwissen beibrachte. Der junge Mann lernte vom Vater die Kunst, wie man die Leiden Kranker milderte, er konnte kranke Hunde heilen, verjagte Hexenkräfte, vollführte den Ritus beim Abschied von einem Toten.
Kelëu, ein Jüngling von ungewöhnlicher Kraft, mit ungewöhnlich großen, durchdringenden Augen, rasierte sich nicht den Schädel, sondern ließ seine Haare wild wachsen. Sein langer, spärlicher Bart wehte, wenn er schnell lief, und langsam ging Kelëu nie. Der junge Schamane hatte eine volltönende, melodische Stimme, und beim Tanz und beim Dichten neuer Lieder konnte es keiner mit ihm aufnehmen. Er war der erste Luorawetlan, der in seinem künstlerischen Schaffen den Gesang der benachbarten Aiwanalinen aufnahm, er entlehnte von ihnen den großen, klangvollen Jarat, die Schellentrommel. Sie wurde aus besonders behandeltem Walrossmagen hergestellt, den man über einen Reifen aus schwarzen Walbarten spannte. Ihr Laut drang weit, man konnte ihn sogar vom anderen Ufer der Uëlener Lagune aus hören. Kelëu fertigte gern allerlei kleine Figuren aus den Hauern von Walrossen, dem Walrosselfenbein, an und verzierte gewöhnliche Knöpfe aus Bein mit Ornamenten. Auf der polierten Oberfläche eines Walrosshauers stellte er als Erster in kleinen Bildern die Erschaffung der Erde, des Himmels und des Menschen dar.
Zu allem Überfluss war Kelëu auch noch ein erfolgreicher Jäger, er konnte, ohne müde zu werden, den Eisbären verfolgen, bei der Walfischjagd nahm er sofort den Platz am Bug des Lederkajaks ein, den Platz des ersten Harpuniers.
Und gutmütig war er, seine Leute sahen ihn nie zornig oder mürrisch. Man konnte ihn mitten in der Nacht wecken, er kam sofort, um einem Kranken zu helfen.
Mlakoran gab sich Mühe, Kelëu an sich zu binden, er brachte ihm viel Aufmerksamkeit entgegen, doch Kelëu war nach wie vor zu allen gleichermaßen gerecht und nahm weder für die eine noch die andere Seite Partei.
Këus Clan wurde in Uëlen immer bedeutender und einflussreicher. In Streitfällen hatte das letzte Wort der alte Schamane, und da Mlakoran meist abwesend war, wurden die allgemeinen Angelegenheiten von Këus wachsender Familie gelenkt.
Warum kommen die Rekken immer dann, wenn der Winter bereits über seinen Höhepunkt hinaus ist und die Sonne schon wieder hinter dem Horizont aufsteigt? Ausgerechnet an den stillen Sonnentagen wurde ganz Uëlen von einer Krankheit heimgesucht. Die Menschen starben innerhalb kurzer Zeit an einem ungewöhnlich hohen Fieber und an ununterbrochenem Husten. Man schaffte es kaum, die Toten zu begraben.
Selbst Këu wurde krank.