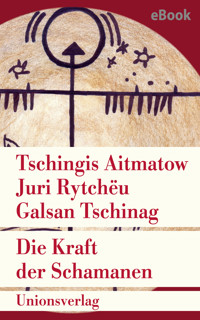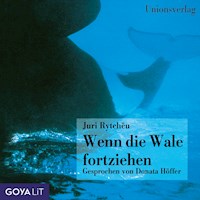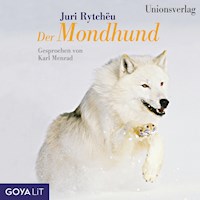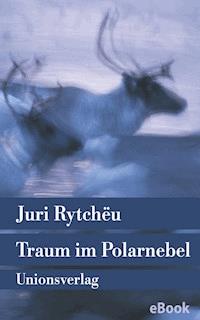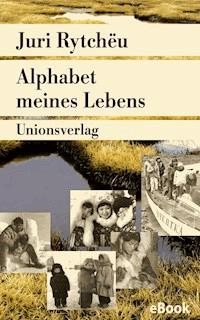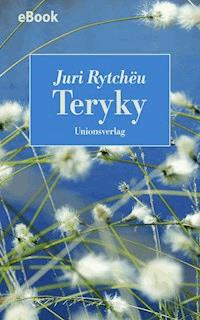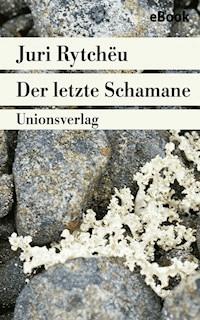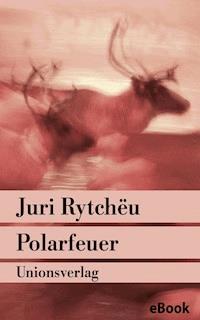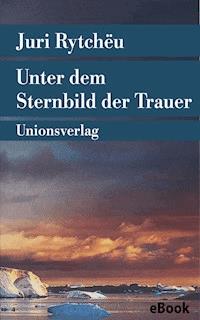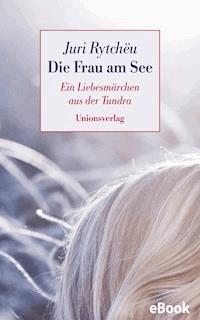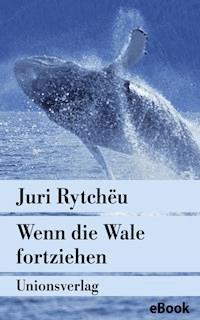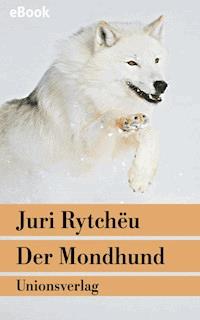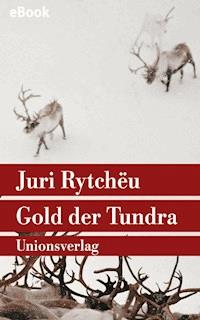
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unerklärliche Faszination verbindet Robert und Susan Carpenter seit ihrer Kindheit mit dem so nahen, aber unzugänglichen Land der Tschuktschen am anderen Ufer der Bering-Straße. Dort hatte ihr Großvater als Händler gelebt, bis die Revolution kam. Ihre tschuktschische Großmutter, die ebenfalls nach Alaska emigriert war, erzählte ihnen tausend Geschichten vom Leben in der Jaranga und in der Tundra. Und was hat es mit der rätselhaften Zeichnung auf sich, die der Großvater hinterließ? Als die Perestroika beginnt, machen sie sich auf die Reise, um das Land ihrer Ahnen kennen zu lernen, aber auch um einen alten Schatz zu finden. Sie geraten mitten in die Wirren eines verlorenen, vergessenen Landes, in dem nichts mehr ist, wie es früher war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Zwei Amerikaner brechen auf, die verlorene Welt ihres Großvaters zu suchen, der aus dem unzugänglichen Land am anderen Ufer der Bering-Straße nach Alaska emigriert war. Aber die Tschukotka hat sich dramatisch verändert. Die beiden geraten mitten in die Wirren eines verlorenen, vergessenen Landes, in dem nichts mehr ist, wie es früher war.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Kristiane Lichtenfeld (*1944) war Lektorin für polnische und multinationale sowjetische Literatur. Seit 1980 ist sie freie Übersetzerin aus dem Polnischen, Russischen und Georgischen und arbeitet auch für den Rundfunk.
Zur Webseite von Kristiane Lichtenfeld.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Juri Rytchëu
Gold der Tundra
Roman
Aus dem Russischen von Kristiane Lichtenfeld
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Der russische Originaltitel lautet Čukotskij Anekdot.
Die deutsche Ausgabe wurde in Absprache mit dem Autor leicht bearbeitet.
Die Übersetzung wurde gefördert vom Literarischen Colloquium Berlin mit Mitteln der Stiftung Pro Helvetia.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e.V. für die Unterstützung.
Originaltitel: Čukotskij Anekdot (St. Petersburg, 2002)
© by Juri Rytchëu 2002
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Natalie Fobes/Getty Images
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30454-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 00:21h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
GOLD DER TUNDRA
1 – Aus den Panoramafenstern von Anchorages feinstem Fischrestaurant ›Garfunkel …2 – In Ulak rüstete man sich zum Empfang der …3 – Mischa Melenski hatte die geräumige Wohnung erhalten …4 – Oberst Dudykin hielt die Reise der örtlichen Bewohner …5 – Wassili Jamron behandelte Antonina wie eine leibliche Tochter …6 – Der Vollmond beleuchtete die Buchten und Meerbusen des …7 – Wenn vor den Augen eines Menschen etwas Unerwartetes …8 – Jeden Morgen, sofern es das Wetter erlaubte …9 – »Früher hieß das einfach Wahlen. Kein Mensch bezeichnete …10 – Das Flugzeug aus Nome war auf dem internationalen …11 – Die Wahlen für das Haupt der Kreisadministration standen …12 – Susan Canishero wollte Arkadi Pesterow zu ihrer Vertrauensperson …13 – Die Geschwister saßen wieder einmal in ihrem Lieblingslokal …14 – Nach dem, was in Anadyr vorgefallen war …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Kristiane Lichtenfeld
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Juri Rytchëu
Zum Thema Russland
Zum Thema Alaska
1
Aus den Panoramafenstern von Anchorages feinstem Fischrestaurant ›Garfunkel and Seaports‹ eröffnete sich ein prachtvoller Blick auf die Bucht, den Hafen, die Schiffe, die ihre Ladung löschten oder auf Reede lagen. Besondere Aufmerksamkeit erregte der weiß funkelnde Touristenkreuzer McKinley, der Fahrten zu den Fjorden von Alaska und in die hohen Breiten unternahm. Mit ihm beabsichtigte der Meeresbiologe Robert Carpenter, Abteilungsleiter für Fisch und Wild im Landwirtschaftsministerium der USA, auf seine erste Reise nach Tschukotka zu gehen.
Angeregt unterhielt er sich mit seiner eigens zur Verabschiedung angereisten Schwester. Susan war ungefähr im gleichen Alter wie der Bruder, und man sah ihnen deutlich an, dass sie Geschwister waren.
Susan machte eine kleine Pause, um einen Schluck kalifornischen Weißwein zu trinken und einen Bissen vom gekochten Steinbutt zu zerkauen, dann sprach sie weiter: »Du weißt, dass der Großvater uns kein großes Erbe hinterlassen hat … Er war schließlich nur ein Handelsvertreter von Olaf Svensson, diesem nun weiß Gott wohlhabenden Mann, der noch bis in die Mitte der Dreißigerjahre den gesamten Einzelhandel entlang der Küste der Tschuktschen-Halbinsel unter seiner Kontrolle hatte. Ich habe alles eingehend studiert, was Großvaters Boss Svensson und der große Roald Amundsen, dem Großvater auf seiner Expedition sogar Geld geborgt hat, über unseren Vorfahren geschrieben haben. Großvater war kein schlechter Mensch, und er genoss nicht nur die Achtung der Tschuktschen, sondern sogar die einiger hoher sowjetischer Beamter. Hör genau zu, was er mir vor seinem Tod gesagt hat. Damals lebte in Ulak der Tschuktsche Mletkyn, mit Spitznamen Frank genannt. Er galt als großer Schamane und nach damaligen Maßstäben als gebildet. Er konnte Russisch und Englisch lesen und schreiben, besaß medizinische Kenntnisse, nahm mitunter sogar einfache chirurgische Eingriffe vor.«
Susan zog aus ihrer Handtasche eine sorgsam zusammengelegte Zeichnung, entfaltete sie, strich glättend darüber und legte sie dem Bruder hin.
»Was ist das?«, fragte Robert.
»Ein Tschuktschenzelt, eine Jaranga«, erläuterte Susan. »Dies ist Mletkyns Jaranga, und die Zeichnung hat unser Großvater angefertigt. Schau, das Dach ist mit Walrosshäuten bedeckt, und hier das Geflecht – das sind dicke Lederriemen, die sozusagen die gesamte Dachkuppel der Jaranga umschließen. Die Riemenenden hängen rundum über die Wände herunter und sind mit großen Steinen beschwert. Diese Steine und das Riemengeflecht über der Zeltkuppel halten das Dach selbst beim stärksten Orkan.«
Robert betrachtete aufmerksam die Zeichnung, ohne zu begreifen, was die Schwester veranlasste, ihn mit der Bauweise der alten Jaranga eines Ulaker Schamanen vertraut zu machen.
»Hier, diese beiden Steine sind markiert.« Susan setzte ihren Zeigefinger erst auf einen, dann auf einen zweiten der Steine.
Die Jaranga war sehr präzise dargestellt, mit kleinsten Details: Die Tür stammte eindeutig von einem gestrandeten Walfangschoner. Und die beiden Steine, auf welche die Schwester zeigte, trugen klar erkennbare kleine Kreuze.
»Diese Steine sind der Schatz unseres Großvaters«, sagte Susan leise. »Und kein geringer.«
Robert sah die Schwester verblüfft an.
»Zu Zeiten des berühmten Goldfiebers in Alaska kam vielen Leuten die Vermutung, das kostbare Metall könne auch am anderen Ufer der Beringstraße vorhanden sein. Und obwohl die damalige Zarenregierung den amerikanischen Goldsuchern mit größtem Misstrauen begegnete, glückte es doch dem einen oder anderen, nach Tschukotka vorzudringen. Diese Leute wuschen das Gold in den Flusstälern, auf den Geröllbänken der zahlreichen Bäche. Und obgleich sie keine Riesenfunde machten, konnten sie manchmal ganz hübsche Mengen herauswaschen. Unser Großvater kaufte das Gold auf, wenngleich dies einen groben Verstoß gegen die russischen Gesetze bedeutete. Nach der Revolution, als die Bolschewiken die amerikanischen Händler nach und nach vertrieben, gelang es unserem Großvater, den Goldsand und die Goldklumpen in solchen Steinen zu verstecken.« Susans Finger piekte auf die Zeichnung. »Außen beklebte er sie mit Flusskies. Wie Großvater sagte, verwendete er dabei einen besonders festen Klebstoff, den er von Mletkyn kannte. Der bestand aus Sekreten der Geschlechtsdrüsen des Grönlandwals und einer besonders zubereiteten Walrosslymphe. Äußerlich, so versicherte Großvater, unterschieden sich die Steine in nichts von den anderen, mit denen die Jaranga des Ulaker Schamanen behängt war.«
Der Bruder schüttelte belustigt den Kopf. »Seither ist ein Dreivierteljahrhundert vergangen. Sicher ist in der Zwischenzeit jemand auf die Idee gekommen, an diesen ungewöhnlich schweren Steinen ein bisschen zu kratzen.«
»Ich habe in der Kongressbibliothek eine Unmenge tschuktschischer Zeitschriften durchstöbert und bin nirgends auf einen derartigen Hinweis gestoßen. Anfang der Fünfzigerjahre hat man Tschuktschen und Eskimos aus den Jarangas in Holzhäuser umgesiedelt. Die alten Jarangas wurden zerlegt oder einfach niedergebrannt. Die großen Steine holten sich die Leute vor die Holzhäuser, sie waren eine beliebte Sitzgelegenheit.«
»Nein, ich glaube nicht daran, dass das Gold unentdeckt geblieben ist«, sagte Robert. »Bestimmt hat man es längst gefunden. Ich vermute sogar, dass es nicht Ortsansässige waren, die die Steine ausgeweidet haben, sondern Zugereiste, Russen.«
Susan faltete das morsche Blatt Papier mit der Darstellung der Jaranga des Schamanen Mletkyn sorgsam wieder zusammen, rief den Kellner und bat um die Rechnung.
Seit jungen Jahren fühlte sich Susan fast unerklärlich zu jenem Landstrich hinter der Beringstraße hingezogen. Obgleich sie in Nome geboren war, betrachtete sie insgeheim die kleine, an der Beringstraße gelegene Siedlung Nuwukan als ihre Heimat, wo sich ihr Großvater und die Großmutter Elisabeth zum ersten Mal begegnet waren. Die Großmutter hatte ihren eigenen, yupikischen Namen besessen – Kagat. Der aber geriet nach der Heirat nahezu in Vergessenheit, als ihr Mann ihr den Namen Elisabeth gab. Sie überlebte ihn um eineinhalb Jahrzehnte und sprach am Ende ihres Lebens oft von der Heimat. Diese Erzählungen vom heimatlichen Nuwukan hatten Susans Neugier geweckt. Sie hatte eifrig Russisch gelernt, las begierig sowjetische Bücher und Zeitschriften und hatte mit ihrem Interesse zuletzt auch den Bruder angesteckt.
Während der kurzen Liegezeit der McKinley in Nome kamen neue Passagiere an Bord: Michael Kronhouse, Professor an der Universität in Fairbanks und Fachmann für die Sprachen und die Ethnografie der Ureinwohner Alaskas, und eine Gruppe amerikanischer Eskimos, hauptsächlich Bewohner der Sankt-Lorenz-Insel.
Diese blieben eher für sich. Sie scheuten sich sogar, in der Bar zu erscheinen, obgleich sie, so schien es, den Spirituosen nicht abgeneigt waren.
Aus der Gruppe der Eskimos ragte der hoch gewachsene, hagere Dwight Mylygrok heraus, ein bekannter Walrossbeinschnitzer von der Kleinen Diomedes-Insel. Später erfuhr Robert Carpenter, dass Mylygrok ein Stiefbruder Atyks, des berühmten Ulaker Sängers und Darstellers alter Tänze vom Beringmeer, war. Der Überlieferung nach hatten Mylygroks und Atyks Väter in jungen Jahren, einem überkommenen Brauch gemäß, für einige Zeit die Frauen getauscht, und das Ergebnis solcher Einhaltung eines alten Gesetzes war das Erscheinen zweier begabter Menschen gewesen. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Atyk und Mylygrok einander regelmäßig bei den großartigen Festivals begegnet, die man zur Sommerzeit an beiden Ufern der Beringstraße veranstaltete. Gewöhnlich wurde dafür der Zeitpunkt gewählt, da man den ersten Grönlandwal fing, daher nannten die Ethnografen, von denen es bei diesen Gelegenheiten in den Nomadenlagern und den meernahen Siedlungen wimmelte, diese Feste Walfeste.
Mitte der Vierzigerjahre wurden diese Kontakte einseitig unterbunden, als Churchill in Fulton mit seiner berühmten Rede gegen die Sowjetunion auftrat. Bei eben diesem Datum setzen die Historiker den Beginn des Kalten Krieges an. Die gegenseitigen Besuchsreisen der Nachbarn an der Beringstraße hörten auf, und wenn es vorkam, dass sich die Jäger beim Frühlings-Walrossfang begegneten, war man bemüht, nicht viel Worte darüber zu verlieren. Sobald nämlich die sowjetischen Grenzer von derlei Begebenheiten erfuhren, gingen Berichte darüber an den KGB. Man schleppte die Menschen zu Verhören, ängstigte sie und drohte, sie im Wiederholungsfall ins Gefängnis zu sperren.
Dennoch kam es zu Begegnungen.
Mitte der Sechzigerjahre landeten in Inalik, einer winzigen Eskimosiedlung auf der Kleinen Diomedes-Insel, drei sowjetische Eskimos, die sich angeblich im Schneesturm verirrt hatten. Einer von ihnen wünschte, nicht in die Heimat zurückzukehren, und blieb in Alaska. Carpenter hatte ihn des Öfteren in Nome getroffen, er war ein gewöhnlicher Eskimo-Bursche. Er begann zu studieren und wurde Mitarbeiter des von Michael Kronhouse geleiteten Sprachinstituts. In der Gruppe der Eskimos, die sich jetzt in die Sowjetunion aufmachten, befand er sich aber nicht.
Ende der Siebzigerjahre besuchte ferner ein tschuktschischer Journalist aus Ulak für einige Zeit Nome, die Kleine Diomedes-Insel und die Sankt-Lorenz-Insel. Man empfing ihn betont freundschaftlich, und sogar die Lokalzeitungen nannten ihn »die erste Schwalbe eines neuen Frühlings zwischen Alaska und der Tschuktschen-Halbinsel«, dennoch hielt sich ihm gegenüber ein gewisser Verdacht: Die offiziellen sowjetischen Behörden gestatteten kaum einem Mitbürger eine solche Freiheit des Reisens und des Umgangs mit Ausländern. Nach seiner Abreise und dem Abdruck seines Beitrags über das Leben kleiner Nordvölker in der angesehenen amerikanischen Zeitschrift National Geography kam es zwischen den beiden Großmächten zu keiner spürbaren Erwärmung.
»Mein Großvater war Händler in Keniskun, an der Pazifikküste der Tschuktschen-Halbinsel, und meine Großmutter stammte aus der Eskimosiedlung Nuwukan am Kap Deschnjow, ihr Mädchenname war Kagat«, sagte Robert Carpenter und stellte sich dem Professor vor.
»Ich weiß davon.« Michael Kronhouse nickte. »So mancher berühmte Reisende vom Ende des vorigen und vom Beginn diesen Jahrhunderts, darunter Amundsen und Stefansson, hinterließ in seinen Reisetagebüchern zahlreiche wohlmeinende Äußerungen über ihn, was man von sowjetischen Schriftstellern nicht sagen kann. Wissen Sie etwas über das Leben Ihres Großvaters auf Tschukotka?«
Robert Carpenter zögerte mit der Antwort. »Ich selbst bin in Nome geboren«, sagte er dann, ein wenig weiter ausholend. »Seit der Kindheit aber habe ich von meiner Großmutter Kagat-Elisabeth viel von dem kleinen, nur aus vier Jarangas bestehenden Keniskun gehört, wo sich der Laden unseres Großvaters befand. Das hat sich mir so tief in die Seele gesenkt, dass mir vorkommt, meine wahre Heimat wären Keniskun und Nuwukan.«
»Keniskun und Nuwukan gibt es schon lange nicht mehr«, versetzte Michael Kronhouse. »Ende der Fünfzigerjahre wurden alle Eskimos ausgesiedelt, zuerst in die tschuktschische Siedlung Nunakmun in einem Fjord der Lawrentija-Bucht, danach in das Kreiszentrum Kytryn. Die offizielle Begründung dafür lautete, dass man auf dem Steilhang, auf dem die Behausungen – Nynlju genannt – standen, unmöglich Holzhäuser errichten konnte. Obgleich dort zuvor schon eine Schule, ein Leuchtturm und eine Polarstation gebaut worden waren. Aber das war ein Vorwand. Der Hauptgrund bestand in der engen Verwandtschaft der Nuwukaner mit den Bewohnern der Kleinen Diomedes-Insel. In Inalik lebten ihre Brüder, Schwestern, Großväter und Großmütter. Die russischen Grenzer vermuteten nicht ohne Grund, dass sich die Nuwukaner während der Walrossjagd in der Beringstraße heimlich mit ihren Verwandten trafen. Die Nuwukaner Eskimos, die es gewohnt waren, in enger Sippengemeinschaft zu leben, wurden bei den Tschuktschen nicht heimisch. Sie konnten gute Nachbarn sein, nicht aber mit ihnen den Friedhof teilen, Heiligtümer, die Meeresküste … Das hatten die sowjetischen Bürokraten nicht berücksichtigt. Sie konnten nicht verstehen, wieso Menschen unglücklich sind, denen man kostenlos nagelneue Holzhäuser überließ, Mobiliar und Darlehen für die Ausstattung … Die Bolschewiken begriffen auch nicht, dass sie eine einzigartige ethnische Gruppe vernichteten, die letzte lebende Brücke, die die Urbewohner der östlichen und der westlichen Halbkugel miteinander verband. Ein Teil der Nuwukaner siedelte später nach Ulak um, immerhin mehr in die Nähe der verlassenen Heimat, ein anderer Teil ging in das Kreiszentrum Kytryn, wo die stolzen Meeresjäger, Walfänger, öffentliche Toiletten säuberten, allerlei Hilfsarbeiten verrichteten und allmählich dem Trunk verfielen. Das Einzige, worin die Gemeinschaft der Nuwukaner noch bestand, war die sorgsame Pflege von Liedern und Tänzen. Haben Sie außer den nostalgischen noch andere Interessen, was Tschukotka angeht?«
»Meine Idee ist es, ein Monitoring einzurichten, um die Wanderungen der großen Meeressäuger in der Beringstraße zu beobachten, und für diese Arbeit ortsansässige Jäger der Tschuktschen-Halbinsel heranzuziehen. Der Vorschlag hat erstaunlich viel Unterstützung in mehreren Ministerien gefunden.« Robert Carpenter spürte, dass seine Antwort allzu offiziell geklungen hatte, und verlegen fügte er hinzu: »Ich würde auch gern jemanden von meinen entfernten Verwandten finden.«
Die Gruppe der Eskimos hatte sich am Bug versammelt und sprach lebhaft über die sich vor ihnen auftuende Beringstraße. Etliche unter ihnen kannten diese Gegend gut, die Älteren waren hier früher sogar an Land gegangen, an dieser Küste, die sich jetzt aus einem unebenen blauen Streifen am Horizont allmählich in ein Festland mit graubraunen Felsen, grünen Tälern und steilen, steinigen Kaps verwandelte. Zahllose Schwärme von Seevögeln breiteten sich flach über das Wasser. Dann und wann stiegen Walfontänen in die Luft empor, und durch den Lärm des Schiffsmotors hindurch drang das Grunzen von Walrossen.
In diesen Breiten herrscht Ende Juni der Polartag. Zwar versinkt die Sonne in den Abgründen des Ozeans, aber sie steigt sogleich wieder herauf und beleuchtet die endlosen Wasserweiten. Leicht steuerbords, gleichsam in die Meeresfläche eingefasst, erhoben sich die Diomedes-Inseln. Getrennt nur durch eine zwei Meilen schmale Meerenge, verschmolzen sie selbst aus geringer Entfernung in eins.
Diese Landschaft hat mein Großvater gesehen, und nicht nur einmal, dachte Robert Carpenter. Warum war er aus dem fernen Australien hierher gekommen? War es nur der Wunsch gewesen, schnell reich zu werden, oder hatte es noch andere Gründe gegeben? Schließlich war Australien lange Jahre nach seiner Entdeckung und dem Anschluss an die Besitzungen der britischen Krone hauptsächlich von Verbrechern besiedelt gewesen, von Mördern, die man zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt hatte, von allem möglichen menschlichen Auswurf. Ob der Großvater vielleicht ein direkter Nachkomme solch eines Ausgestoßenen gewesen war, von denen sich die wohlanständige englische Gesellschaft losgesagt hatte?
Gewöhnlich gingen weiße Männer, nachdem sie eine Zeit lang in Dörfern der Tschuktschen oder Eskimos gelebt, sich dort eine Frau genommen und Kinder gemacht hatten, wieder auf und davon, ließen die hiesigen Frauen mit dem Nachwuchs sitzen und vergaßen sie vollends. Robert Carpenter senior jedoch hatte Frau und Kinder mit sich genommen. Anfangs hatte er sich in Nome niedergelassen, zum Ende seines Lebens aber war er in die Nähe von San Francisco gezogen. Ob er vorgehabt hatte, nach Tschukotka zurückzukehren und seine Schätze zu holen? Vermutlich, denn in den ersten Jahren der Revolution glaubte niemand im Westen, dass sich diese in der Staatsführung eines so riesigen Landes wenig erfahrenen Revolutionäre mit dem halbgebildeten Advokaten Wladimir Lenin an der Spitze lange würden halten können.
Er begab sich auf die Kapitänsbrücke und bat um ein Fernglas. Die McKinley passierte backbords die Ruinen des alten Nuwukan, aus der Entfernung kaum auszumachende, in die Erde eingewachsene Behausungen. Etwas weiter rechts sah man das halb zerstörte Gebäude der Polarstation sowie den Leuchtturm mit der Bronzebüste des russischen Kosaken Semjon Deschnjow, der als erster Europäer diese Meerenge, die die Alte von der Neuen Welt trennt, durchfahren hatte.
Dabei hätte man hier von Rechts wegen nicht ihm, sondern dem Großen Inuk ein Denkmal setzen müssen, diesem »wahren Menschen«, der bewiesen hat, dass es möglich ist, unter extremen Bedingungen, am äußersten Rand des menschlichen Lebenskreises, in Würde zu leben.
2
In Ulak rüstete man sich zum Empfang der amerikanischen Touristen. Der Dorfsowjet belegte im Parterre eines gewöhnlichen Wohnhauses eine Dreizimmerwohnung, und über dem Aufgang wehte eine verblichene Fahne von unbestimmter Farbe.
In dem engen Raum hatte sich zusammengefunden, was in Ulak Rang und Namen hatte: das Haupt der Lokalbehörde Michail Amos, der Direktor des Ateliers für Walrossbeinschnitzarbeit Anatoli Jetuwgi, die Schuldirektorin Awgusta Tantro, der Chef des Bezirks-KGB Dmitri Dudykin, der Kommandeur der Grenzwache Tschikin, der Stellvertretende Vorsitzende des Kreissowjets Dschafar Taligur sowie Margarita Borotojewa, Vertreterin der Moskauer Touristikfirma »Polarlicht«.
Dmitri Dudykin hielt eine Rede. Ungeachtet seines Oberstenranges war er in Zivil und unterschied sich äußerlich durch nichts von seiner Umgebung. Nur in seinem Gesicht ließ sich eine gewisse Raubgier beobachten, wie bei einem hungrigen Hecht. Die Ähnlichkeit mit einem Fisch verstärkten sein lang gestrecktes Gesicht und die weißlichen, ausdruckslosen Augen.
»Ich habe Mitteilungen darüber, dass unter den amerikanischen Touristen auch solche sein werden, die sich für unsere Militärgeheimnisse interessieren. Seid auf der Hut. Vor allem, was die militärischen Objekte betrifft …«
»Und was sollen wir als militärisches Objekt ansehen?«, erkundigte sich Michail Amos. »Die Ruinen der Radarstation, den erloschenen Leuchtturm?«
Natürlich hatte auch Dudykin selbst keinen Schimmer, was in diesem Nest als Geheimobjekt gelten konnte. Den Standort der Siedlung hatten Militärsatelliten längst registriert, und sogar die frei erhältlichen Touristenkarten waren viel präziser und detaillierter als die Landkarten, die, hinter Vorhängen verborgen, in seinem Arbeitszimmer in Anadyr und bei der Grenzwache hingen. Die Vorschriften für das Fotografieren waren veraltet. Bereits vor der Perestroika hatte ein japanisches Fernsehteam Tschukotka besucht. Die hatten Landkarten bei sich gehabt, wie sie die sowjetischen Militärs im ganzen Leben noch nicht besessen hatten! Die Warnung vor Kontakten mit dem Ausland war ja auch nicht mehr gültig. Im Gegenteil, es gab die Empfehlung, gemäß der Politik des neuen Denkens, solche Kontakte auf jegliche Weise zu fördern. Bald war es so weit, dass die offiziellen Organe bei einem so hochwichtigen, ja historischen Ereignis wie der Ankunft der ersten amerikanischen Touristen in Ulak nichts zu tun hatten!
»Dennoch, Wachsamkeit ist geboten!«, sprach Dudykin mit Strenge. »Unter den Touristen befinden sich möglicherweise Agenten des CIA! Ich habe eine Liste …« Der KGB-Mann entnahm seinem schwarzen Diplomatenköfferchen ein Blatt Papier. »Hier, Michael Kronhouse, Leiter des Sprachenzentrums der Urvölker an der Alaska-Universität in Fairbanks. Der wird ganz bestimmt Verbindungen zur örtlichen Intelligenz knüpfen wollen, vor allem zu Lehrern der heimischen Sprachen und zu Nuwukaner Eskimos. Gibt es solche bei uns?«
»An Nuwukanern wären da Jascha Tagjok, Leiter des örtlichen Folkloreensembles, die Tschuktschisch-Lehrerin Tanja Putschetegina … Die übrigen Nuwukaner haben ihre Muttersprache vergessen«, erklärte Michail Amos. »Und auch Sie selbst leben ja schon fast ein Vierteljahrhundert auf Tschukotka, ohne die hiesigen Sprachen zu kennen.«
Natürlich, noch vor sehr Kurzem hätte sich Michail Amos um keinen Preis eine solche Bemerkung erlaubt, inzwischen aber verfügte Oberst Dudykin nicht mehr über seine einstige Macht. Amos ärgerte diese sich hinziehende Konferenz. Sein Kopf schmerzte nach dem gestrigen Abend zum Zerspringen, im Safe aber wusste er eine Flasche mit frischem Selbstgebrannten, den der Revierpolizist Katejew, ständiger Zechgenosse des Hauptes der Dorfadministration, vom Dorfarzt Miljugin besorgt hatte. Einigen Spaß bereitete es Amos lediglich, sowohl Dudykin als auch Taligur und alle anderen Vertreter der Macht verunsichert, ja sogar erschreckt zu sehen.
Einzig Margarita Borotojewa, die Repräsentantin der Touristikfirma »Polarlicht«, hielt beherzt die Fahne hoch. »Alles, was Sie sagen« – sie nickte zu Dudykin hin – »ist wichtig. Aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist: den Touristen auf höchstem Niveau aufzuwarten, ihnen das Allerbeste zu zeigen, alles, worauf Ulak und ganz Tschukotka heute stolz sein können.«
»Ich wüsste zu gern, worauf wir stolz sein können«, murmelte Amos vor sich hin.
»Genau!« Dudykin, eben noch verdüstert, belebte sich. »Wir müssen es so einrichten, dass wir alles Negative vor der Aufmerksamkeit der amerikanischen Touristen abschotten.«
»Der Verkauf von Spirituosen im Laden wird untersagt! Überhaupt sollte man den Laden für diese Zeit schließen. Die Regale sind sowieso leer, wir blamieren uns nur. Es wird Inventur gemacht!«, steuerte Taligur seine Ideen bei.
»Bei uns kauft kaum jemand Schnaps im Laden, der ist zu teuer«, bemerkte Amos, dessen Gedanken abermals um jene im Safe verborgene Flasche kreisten.
»Sondern wo?«, fragte Taligur.
»Bei den Russen … Etliche von denen brennen selber. Lehrer, Bauleute, Heizer in den kommunalen Wohnungen …« Den wichtigsten Schnapsbrenner in Ulak, den Doktor, verschwieg Amos jedoch.
»Die Miliz muss Weisung erhalten – keine Betrunkenen auf die Straße lassen!«, erklärte Dudykin entschieden.
»Sollen wir sie anketten? Wie Hunde?«
»Da ist noch so ein verdächtiges Element auf der Liste der Touristen«, fuhr Dudykin fort. »Ein Mister Robert Carpenter, angeblich Wissenschaftler, Spezialist für Walrosse und Wale.«
»Ein bekannter Name«, bemerkte Amos nachdenklich. »Vor der Revolution hat es da, glaube ich, so einen Händler in Keniskun gegeben. Sollte der noch am Leben sein?«
»Der Heizer Andrej Sipkaljuk hat sich gelegentlich damit gebrüstet, dass dieser Carpenter sein Großvater sei. Sipkaljuks Großmutter soll bei Carpenter in Keniskun Dienstmädchen gewesen sein und Kinder von ihm gehabt haben«, ließ sich der Kommandeur der Grenzwache Tschikin vernehmen.
»Wie alt wäre er dann, doch mindestens hundert Jahre!«, rechnete Amos verwundert.
»Bei den Amerikanern gibt es viele Langlebige«, gab die Borotojewa zu bedenken. »Im Westen bilden die Älteren das Hauptaufkommen an Touristen. Ein Leben lang sparen sie, gönnen sich nichts, um dann ein glückliches Alter zu genießen.«
»Darin liegt der grundlegende Unterschied zwischen Sozialismus und Kapitalismus«, bemerkte Amos.
»Worin?«, fragte Dudykin aufhorchend.
»Bei uns haben wir eine glückliche Kindheit, und bei denen gibt es ein glückliches Alter.«
Dudykin vertiefte sich erneut in die Liste und präzisierte: »Nein, nein, dieser Carpenter muss jünger sein, Jahrgang zweiundfünfzig. Entweder ein Namensvetter oder ein entfernter Verwandter.«
Man rief Tagjok herbei, den Leiter des Dorfensembles und ehemaligen Solisten der berühmten Truppe »Ergyron«. Äußerlich machte er einen angenehmen Eindruck, er war korrekt gekleidet und sauber rasiert. Mit »Ergyron« hatte er ganz Europa bereist, er war mehrmals in Alaska gewesen und sogar bis Grönland gekommen.
»Bei mir ist alles bereit«, meldete Tagjok. »Die Vorführung wird zwei Stunden dauern.«
»Ist das nicht ein bisschen viel?«, fragte Amos.
»Bestens so, in Ordnung!« Dudykin nickte billigend. »Es ist die beste Art und Weise, um die Gäste zu unterhalten und sie von ungenehmigter Kontaktaufnahme abzuhalten. Und wie steht es mit dem Repertoire? Ich meine hinsichtlich Ideologie und Tendenz …«
»Unsere Lieder und Tänze sind in der Tendenz stets richtig«, erwiderte Tagjok würdevoll und sah dem Oberst gerade in die Augen.
Awgusta Tantro gab Bescheid, dass in der Schule sauber gemacht worden sei, dass die Kinder im Internat frische Bettwäsche erhalten hätten und dass es für sie eine gute Mahlzeit geben werde, ein Festessen, präzisierte sie.
Am Eingang zum Dorfsowjet tummelte sich allerlei angereistes Volk: Fernsehleute aus Anadyr, Magadan und Moskau, Journalisten, Fotoreporter.
Nur Iwan Kutegin saß allein hoch oben auf dem Felsen Eppyn, von wo sich ein weiter Blick auf den nördlichen Ausgang der Beringstraße eröffnete, und beobachtete mit einem gewaltigen Fernglas den Meereshorizont. Er hatte es sich auf einem von zwei gänzlich gleichartigen großen Steinen bequem gemacht. Die Steine waren von einer bemoosten rauen Kruste bedeckt, die die Spuren von Tierkrallen trug, so als habe jemand versucht, die Oberfläche zu zerkratzen. Aus Erzählungen der alten Leute wusste Kutegin, dass an eben dieser Stelle der berühmte Ulaker Schamane Mletkyn bestattet worden war, aber fast schon am Tag nach dem Begräbnis war er spurlos verschwunden, so erzählte man.
Kutegin gehörte zu denen, die sich am meisten vom Besuch der amerikanischen Touristen versprachen. Er hielt vorsorglich eine größere Kollektion von Souvenirs für den Verkauf bereit und hoffte auf einen Erlös von mehreren Hundert Dollar. Natürlich würde es schwierig sein, das Geschäft heimlich vor der Obrigkeit zu tun. Was das Haupt der Dorfadministration und den Direktor des Ateliers für Walrossbeinschnitzerei anging, in dem der Meister formal eingeschrieben war, so bereitete ihm das keine Sorgen. Vor allem fürchtete er Dudykin und Taligur.
Kutegin stieg zur Straße hinunter, ging auf die Menschenansammlung vor dem Dorfsowjet zu und verkündete lauthals: »Der Dampfer kommt!«
Früher hatte eine solche Ankündigung den Ulakern viel bedeutet. Alles Neue kam von See hierher, zuerst auf Segelschiffen, später auf Dampfern. Wer als Erster die Kunde vom Herannahen eines Schiffes herbeibrachte, den erfüllte das mit Stolz. Auf der hohen Plattform des Beobachtungsturms der Grenzwache trat der Posten, mit einer Wattejacke in Tarnfarben bekleidet, unruhig auf der Stelle. Beim besten Willen hätte er das sich nähernde Schiff nicht sehen können, denn der Turm stand so, dass sein Hauptbeobachtungsfeld die Siedlung war, nicht aber die hinter dem schroffen Felsen verborgene Staatsgrenze. In der Tat beaufsichtigten die Ulaker Grenzer im Wesentlichen die örtliche Bevölkerung, für die im Schoße der sowjetischen Bürokratie alle Arten von Verboten gediehen, nur um die vor lauter Nichtstun verschmachtenden Wachen zu beschäftigen. In einem Dreivierteljahrhundert hatte es einen einzigen Überläufer gegeben, aber auch das war kein Amerikaner gewesen, sondern ein Abenteuer suchender Mexikaner, ein, wie sich bald zeigte, geistig verwirrter Mensch. Und Anfang der Siebzigerjahre waren zwei Heizer aus dem Kesselhaus des Kreiszentrums Kytryn in betrunkenem Zustand mit einem Gummiboot in einen Sturm geraten und zum Kap Prince of Wales getrieben worden. Dafür hielten sich die Ulaker öfter mal nicht an die im Grenzgebiet geltenden Vorschriften. Bald waren die Passierscheine fehlerhaft ausgestellt, bald hatten sie dieselben nicht rechtzeitig erhalten und fuhren ohne die nötigen Papiere zur Jagd auf die Meerestiere hinaus.
Besonderen Eifer legten die Bewacher der Staatsgrenze bei der Kontrolle der Pässe an den Tag. Sie mochten einen Menschen vom Sehen kennen, mit ihm schon getrunken haben, aber unbedingt kontrollierten sie seinen Pass. Ein Ulaker Jäger konnte sich ohne Patronen aufs Meer oder in die Tundra begeben, keinesfalls aber ohne Pass. Eine Abfahrt oder Ankunft ohne Dokument galt als Grenzverletzung und wurde bestraft.
Die Soldaten trugen heute Paradeuniform, die Stiefel blitzten. Auf Befehl des Grenzwachenleiters hatten die Menschen, die zur Begrüßung gekommen waren, auf einer Kiesbank Aufstellung genommen, die günstigsten Plätze waren von den Fernsehleuten und ihrem Gerät besetzt.
Die Borotojewa hielt eine amerikanische Flagge in der Hand, neben ihr stand Michail Amos, der inzwischen den ersehnten Schluck aus der Flasche genommen hatte und somit selbstgewiss war und heiter gelaunt.
Der Liner näherte sich langsam der Küste, gleichsam tastend, um nicht auf eine Untiefe zu stoßen. Iwan Kutegin sah durch das Fernglas längsseits die zusammengedrängten Passagiere in ihren grellfarbenen Jacken, behängt mit Fotoapparaten und Videokameras.
Neben Kutegin hatte Arkadi Pesterow Stellung bezogen. Pesterow, ausgebildeter Lehrer und Absolvent der Parteischule in Chabarowsk, war einst Direktor des Ateliers für Walrossbeinschnitzarbeit gewesen, dann aber wegen »mangelnder ideologischer Wachsamkeit« aus der Partei ausgeschlossen worden. Man hatte ihn beschuldigt, allzu enthusiastisch den Musiker Rostropowitsch empfangen zu haben, der, wie sich herausstellte, damals, Anfang der Siebzigerjahre, vom KGB »beschattet« wurde. Rostropowitsch sei ja nach Ulak gekommen, um, wie die »zuständigen Organe« zu verstehen gaben, über die Beringstraße nach Amerika zu flüchten. Pesterow wurde daraufhin seiner Ämter enthoben und zum Ingenieur für Meeresjagd und Fischfang im Sowchos degradiert, widmete sich aber vor allem der Trinkerei. Inzwischen hatte er viele Jahre im Dauerrausch verbracht. Kutegin verachtete ihn deshalb ein wenig. Iwan Kutegin hatte aus eigener Kraft mit dem Trinken aufgehört, ohne sich einer Behandlung nach der Doktor-Schitschko-Methode zu unterziehen. Wie verderblich diese üble Trinkerei war, zeigte ein Blick auf Pesterows blasses, ausgemergeltes, unrasiertes Gesicht, ja auf die Mehrheit der großzügig mit der Produktion des Dorfarztes getränkten Ulaker. Bei alledem wurde Pesterow in Ulak mehr respektiert als Michail Amos, das Haupt der Dorfadministration. Der ehemalige Direktor des Ateliers für Walrossbeinschnitzerei kannte sich in den Gesetzen aus, vor allem aber befand er sich wegen seiner verderblichen Angewohnheit in ständiger Opposition zu den Behörden und ging demonstrativ zu keinerlei Wahlen – dies sei alles Schwindel und Volksbetrug. Die Obrigkeit verachtete Pesterow demonstrativ, fürchtete ihn aber auch ein wenig. Dudykin sah von Weitem zu ihm hin und dachte argwöhnisch, der solle ja nichts anstellen, dieser reinblütige Tschuktsche. Pesterow hatte seinerzeit an Stelle seines angestammten Namens Tynawukwutagin den russischen Namen seiner ersten Frau angenommen.
Jetzt, beinahe nüchtern, riet er seinem Landsmann, mit der Valuta vorsichtig zu sein: »Das Valutagesetz gilt unverändert, auch wenn es schon lange nicht mehr beachtet wird. Im Fall des Falles können sie dir einen Strick draus drehen.«
»Du solltest mir lieber helfen«, bat Kutegin. »Ich gebe dir einen Anteil.«
Pesterow hatte in der Schule, in der pädagogischen Lehranstalt und später an der Parteischule Englisch gelernt. Dank seines ausgezeichneten Gedächtnisses hatte er sogar in seinem vom Alkohol vernebelten Kopf einige Kenntnisse bewahrt und konnte sich durchaus verständlich machen.
Unterdessen war der Koloss der McKinley zum Stehen gekommen, und die zur Begrüßung Versammelten konnten sehen, wie beide Anker nach unten gingen. Sogleich wurden sechs geräumige Beiboote zu Wasser gelassen. Mit Passagieren gefüllt, fuhren sie auf das Ufer zu. Als der Bug des ersten Bootes den Ulaker Kies berührte, erscholl aus dem Obergeschoss der Schule die amerikanische Hymne, gespielt von dem hiesigen Ziehharmonikaspieler Terkië. Terkië war gelähmt, Schüler der höheren Klassen hatten ihn auf ihren Armen in den ersten Stock des Schulgebäudes getragen und ihn vor das geöffnete Fenster gesetzt. Bald verstummten die letzten Akkorde der feierlichen Musik, und die Grenzer machten sich an die Kontrolle der Pässe. Dudykin wandte sich zur Borotojewa um und fragte streng: »Wo bleibt unsere Hymne?«
»Welche? Unsere alte enthält noch den Text vom weisen Stalin, und die neue hat man uns nicht geschickt.«
Die Touristen, deren Papiere kontrolliert waren, gingen hinüber zur amerikanischen Flagge, die die Borotojewa immer noch hoch erhoben hielt. Sie sprach laut und forsch Englisch mit ihnen, zu Dudykins Neid und Ärger, der kein Wort verstand. Die Überprüfung der Dokumente zog sich in ermüdender Weise hin. Es kam zur Verzögerung bei den amerikanischen Eskimos. Deren nagelneue Pässe weckten bei der Grenzwacht besonderes Misstrauen. Robert Carpenter beobachtete die schleppende Prozedur und sagte vernehmlich in recht sauberem Russisch: »Eigentlich haben die Inuit nach den jüngsten Vereinbarungen zwischen unseren Staaten das Recht auf eine visafreie Einreise nach Tschukotka.«
»Über diese Regelung sind wir nicht informiert«, antwortete Tschikin höflich. »Wir bräuchten dafür besondere Instruktionen.«
Carpenter zuckte die Achseln und wollte soeben auf die Kiesbank hinaufsteigen, auf der sich die Einheimischen drängten, als der Anschrei der Borotojewa ihn aufhielt: »Nicht von der Gruppe entfernen!«
Unterdessen ging ein anderer Amerikaner, ein dunkelhaariger mit Schnurrbart, der bei den amerikanischen Inuit gestanden hatte, auf die Borotojewa zu und sagte: »Wir, die Vertreter der örtlichen Bevölkerung Alaskas, benötigen kein übliches touristisches Programm.«
Die Borotojewa musterte ihn aufmerksam. Der Mann sah so gar nicht wie ein Inuk aus.
»Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle – Professor Michael Kronhouse.« Der Professor streckte ihr die Hand hin. »Leiter des Zentrums für die Sprachen der Ureinwohner an der Alaska-Universität.«
»Ich habe von Ihnen gehört!« Mit diesen Worten drängte sich Jascha Tagjok nach vorn.
Zum Erstaunen aller sprachen der Nachkomme der Nuwukaner Eskimos und der amerikanische Professor lebhaft miteinander. Dudykin hätte beinahe geschrien: »Sprechen Sie Russisch!« Jedoch in dieser Weise konnte er wohl einen Ureinwohner Tschukotkas, der sich beim Telefonieren mit Verwandten in einer entfernten Ortschaft vergaß, zum Schweigen bringen – dies aber waren immerhin Ausländer, mochte der Teufel sie holen! Daran gewöhnt, zu befehlen und zu kommandieren, fühlte sich Dudykin jetzt ratlos, ja sogar in gewissem Grade gedemütigt. Er, der wichtige Mann, der in die Staatsgeheimnisse eingeweiht war, stand unversehens im Abseits, weggedrängt von der den Gästen entgegenflutenden Menge. Die Borotojewa las den Touristen bereits mit lauter Stimme das Programm vor und gebot ihnen, ihr zu folgen. Als Punkt eins war das Kennenlernen der alten Siedlung Ulak vorgesehen.
»Der Name Ulak, wie die Ethnografen behaupten«, berichtete die Borotojewa, forsch eine Broschüre des Historikers Wladilen Leontjew über die Ortsnamen Tschukotkas wiedergebend, die das Heimatkundemuseum von Anadyr publiziert hatte, »kommt von dem Eskimo-Wort ›ulak‹, und das bedeutet übersetzt ›Frauenmesser‹ …«
Die Touristen schrieben eifrig in ihre Notizblöcke, hielten ihre Tonbandgeräte dichter heran, ließen die Videokameras laufen und die Fotoapparate klicken.
Michael Kronhouse zog aus einem großen Umschlag eine Fotografie, sah immer wieder darauf und schaute umher. Pesterow, der sich in der Nähe befand, warf über seine Schulter hinweg einen Blick auf die Aufnahme.
Es handelte sich dabei um eine Panoramaansicht des alten Ulak. Natürlich hatte er dieses frühere Ulak nie gesehen, aber die alten, längst dahingegangenen Schnitzmeister – Chuchutan, Wukwutagin und Tukkaj – hatten zu gern eben diese Ansicht auf einem langen Walrossstoßzahn dargestellt. Das heimatliche Dorf eignete sich bestens dafür, auf einen Walrossstoßzahn übertragen zu werden, denn es erstreckte sich über die ganze Länge der aus Kies und Geröll bestehenden Landzunge. Auf der einen Seite wurde die Nehrung von der Lagune umspült, auf der anderen vom Eismeer.
»Der Fotograf hat das Bild von der Stelle aufgenommen, an der die Jaranga des berühmten tschuktschischen Schamanen Mletkyn stand«, sagte Pesterow. »Weiter hinten, in Richtung Lagune, war die Jaranga meines Großvaters.«
»Die Aufnahme wurde neunzehnhundertsechsundzwanzig gemacht«, sagte Kronhouse.
»Ja, richtig! Darum gibt es außer der Schule nicht ein einziges Holzhaus darauf, nur Jarangas«, bemerkte Pesterow nachdenklich. »Und wir haben hier gar keine alten Leute mehr, die sich an diese Zeiten erinnern.«
»Ist Ihnen der Name Robert Carpenter bekannt?«
»Gehört habe ich ihn mal, aber ich erinnere mich nicht …«
»Vor der Revolution lebte bei Ihnen in Keniskun ein Händler Robert Carpenter«, half Kronhouse nach.
»Ja, ja! Ich habe darüber gelesen!« Pesterow schlug sich mit der Hand an die Stirn. »In dem Roman Brand in der Polarnacht von Tichon Sjomuschkin.«
Kronhouse dachte betrübt, dass offenbar dieser Roman des sowjetischen Schriftstellers die einzige historische Quelle jener Zeiten für die heutige Generation von Tschukotkas Ureinwohnern darstellte.
»In unserer Gruppe befindet sich sein Enkel, er heißt ebenfalls Robert Carpenter«, sagte Michael Kronhouse.
»Das bin ich.« Carpenter reichte Pesterow die Hand.
»Arkadi«, nannte Pesterow seinen Vornamen und sah sich um. Sein langes Gespräch mit den Amerikanern zog sichtlich die Aufmerksamkeit Oberst Dudykins auf sich.
»Kommen Sie, ich mache Sie auch mit meinem Freund bekannt, dem berühmten Ulaker Walrossbeinschnitzer Iwan Kutegin«, schlug Pesterow hastig vor. »Er ist hier bei uns Mitglied des Künstlerverbandes, Träger des Staatspreises … Sie können sich bei ihm zu Hause seine Arbeiten ansehen.«
Kutegin, der sich schon bereithielt, streckte den Gästen schüchtern die Hand hin. »Dort drüben stand unsere Jaranga.« Kutegin machte eine ausholende Handbewegung in Richtung Lagune. »Und hier« – er tappte mit dem Fuß auf – »haben Kmol, sein Bruder Giwëu und dessen ganze Familie gewohnt. Die Nachkommen des berühmten Schamanen Mletkyn.«
»Und wo sind die Jarangas hingekommen?«, fragte Carpenter.
»Das weiß ich nicht mehr«, antwortete Kutegin, während er langsam die Richtung zu seinem Haus einschlug. »Etliche davon hat man verbrannt.«
»Aber die Steine, es hingen doch viele Steine an den Jarangas«, wandte Carpenter ein und verblüffte mit seiner erstaunlichen Detailkenntnis. »Die Steine hat man ja wohl nicht verbrannt …«
»Das stimmt.« Pesterow, ein wenig mutiger geworden, schaltete sich wieder in das Gespräch ein. Sie hatten die übrige Menge bereits ein gutes Stück hinter sich gelassen. »Man hat sie zum Heiligen Stein gebracht.«
»Und wo ist dieser Heilige Stein?«
»Man hat ihn als Fundament für die Bäckerei genommen«, antwortete Pesterow düster.
Die Erinnerungen stiegen in ihm auf. Ein dunkler Herbsttag, der Sturm brauste, die weißen Schaumkämme der schwarzen Wellen glitten bis an die äußersten, dem Meer zunächst stehenden Jarangas heran … Der Großvater hatte den Jungen, der damals noch den bei der Geburt gegebenen tschuktschischen Namen Tynawukwutagin trug, hierher geführt. Unterm Schoß des Mantels aus Walrossdärmen, der vor dem nassen Wind schützte, trug der Großvater das Opfergericht, etwas Schwarzes und Glitschiges, über das Bröckchen weißen Rentalgs gestreut waren. Der Großvater erklomm den glatten, schlüpfrigen Stein, der dem Rücken eines aus dem Meer getauchten Grönlandwals wundersam ähnelte, und begann zu singen, sang mit weit aufgesperrtem Mund gegen den eisigen Wind. Gesang und Worte trug der Wind sogleich davon, sodass der Junge nichts davon mitbekam. Wahrscheinlich betraf dieser Akt ihn, der am folgenden Tag die erste Klasse der Ulaker Schule besuchen sollte.
Später vermutete der Physiklehrer, der Heilige Stein sei nichts anderes als ein Meteorit mit Einsprengseln magnetischen Eisens. Er stellte ein Federmesser gegen die steile Flanke des steinernen Riesen, und das Messer hielt daran wie festgeklebt.
An heiteren Sommertagen, in der kurzen Ruhezeit zwischen der Jagd auf die Frühlingswalrosse und der Ankunft der ersten Walrudel, wurden am Heiligen Stein Feste mit Gesang und Tanz gefeiert, dann trat jedes Mal Atyk in den Kreis, ein noch rüstiger Alter. Er sang mit lauter, heiserer Stimme, und als Pesterow später einen berühmten schwarzen Sänger hörte und danach den russischen Sänger Wladimir Wyssozki, gewahrte er zu seinem Erstaunen, dass Atyk ihnen in dieser Art des Gesangs um viele Jahre voraus gewesen war.
Nach den Sechzigerjahren, als die neue Bäckerei gebaut wurde, ließ der Bauleiter Gawrila Popow den Heiligen Stein ausroden und mit zwei mächtigen Bulldozern an Stahltrossen in die nicht sonderlich tief ausgehobene Baugrube schleppen. Darüber wälzte man von den Jarangas übergebliebene Steine. Nur ein paar Greise beweinten stumm und tränenlos dieses lästerliche Tun, die übrigen Bewohner von Ulak indessen, wie stets halb im Rausch, begleiteten mit zustimmendem Geschrei die letzte Reise des Heiligen Steins. Es geschah dies zu eben jener Zeit, da Nikita Chruschtschow, der nächste Führer des Sowjetvolkes, eine neue Offensive gegen die Kirche unternahm.
An der Bäckerei machte Robert Carpenter kurz Halt und betrachtete aufmerksam das Fundament des Gebäudes. Der Zementputz war längst gebröckelt und abgefallen, und so ragten die Jaranga-Steine in ihrer ursprünglichen Gestalt, bewachsen mit schwammigem, rauflächigem Moos, aus der Erde.
»Sowieso muss die Bäckerei abgerissen werden«, bemerkte Pesterow bekümmert.
»Warum?«, fragte Carpenter.
»Pilzbefall«, erklärte Pesterow. »Vom Festland haben sie befallene Baustoffe hergebracht. Es wurde nichts kontrolliert.«
In Kutegins Atelier hielten sich die Gäste nicht lange auf. Pesterow stand Schmiere und verdiente sich Prozente bei dem Geschäft – er sollte den Meister warnen, falls sich jemand näherte. Carpenter und Kronhouse aber kauften nicht viel, offenbar waren sie nicht die betuchtesten unter den Gästen.
Unterdessen trieb die Borotojewa die Gäste mit lauten Rufen zum Kulturhaus, während sie sie zugleich vom Kleinhandel loszureißen suchte.
Am Eingang wurde Robert Carpenter von einem jungen Burschen angehalten, der mit einer speckigen Jacke bekleidet war und dessen alte Jeans in kurzen Gummistiefeln steckten. Sein lange nicht mehr gekämmtes dichtes Schwarzhaar bauschte sich auf dem Kopf. Der Bursche lächelte schief mit zahnlosem Mund, er verbreitete um sich den Geruch von billigem, im Magen gestautem Alkohol.
»Du also bist Robert Carpenter?«, fragte er, auf unsicheren Beinen schwankend.
»Der bin ich.«
»Der Enkel des Händlers Robert Carpenter?«
»Jawohl.«
»Und warum hat man dich genauso genannt?«
»Das müsste man meine Eltern fragen«, antwortete Robert höflich. Der Umgang mit dem betrunkenen Typ war ihm unangenehm, aber er ließ sich nichts anmerken. Die Dreistigkeit des Burschen, sein Grinsen vermischten sich sonderbar mit Anbiederei und kläglichem, nur scheinbarem Stolz.
»Und ich bin Andrej Sipkaljuk«, sagte der Bursche. »Wie es heißt, sind wir verwandt … Dein Großvater war der Vater meiner Mutter. Weißt du davon?«
»Nein.« Robert zuckte die Achseln. Obwohl es durchaus so sein konnte, denn nach dem Brauch jener Zeit galt der Weiße als Mensch hoher Rasse, er erschien als Quelle frischen Blutes.
»Alle sagen es«, wiederholte der Bursche nachdenklich.
Die Menschenmenge war längst durch die breite Eingangstür in das Kulturhaus vorgedrungen, nur noch Robert und Andrej standen draußen. Andrejs Gesicht kam plötzlich Robert ganz nahe, und er flüsterte laut: »Gib mir sechzig Rubel!«
»Warum sechzig?«, fragte Robert automatisch zurück.
»Das ist genau der Preis einer Flasche!«
»Ich habe kein russisches Geld. Nur amerikanische Dollars.«
»Dann gib Dollars!«
Robert wühlte in seiner Brieftasche und holte eine Fünfzigdollarnote hervor. Andrej schnappte den Geldschein und sagte im Davonlaufen: »Wie gut ist es doch, einen reichen amerikanischen Verwandten zu haben!«
Im großen Saal des Kulturhauses ertönten bereits die Schellentrommeln, und die Männer, in Weiß gekleidet, sowie die Frauen in farbiger, baumwollener Kamlejka saßen in einer Reihe auf der Bühne. Als Erste traten wie üblich die Kinder auf. Sie bewegten noch linkisch, ungeschickt die Arme, nicht im Takt, hingegen zeigten die nach ihnen kommenden älteren Kinder bereits ein Gefühl für die alte Musik der Beringstraße.
Die in der ersten Reihe sitzenden Gäste – die amerikanischen Inuit – gaben beifällige Aufschreie von sich, und manch einer vermochte nicht an sich zu halten, sprang auf die Bühne und reihte sich in den allgemeinen Tanz der Freude ein, welcher der Melodie und der ungezwungenen Tanzweise nach so ganz dem ähnelte, was Robert Carpenter von klein auf in Nome gehört und gesehen hatte. Die gleichen Gesichter, die gleiche Sprache, die gleiche Kleidung, wie sie bei den alten Tänzen getragen wurde.
Der Blick einer der Tänzerinnen traf sich einige Male mit dem seinen, und Robert verspürte eine leise Erregung im Herzen.
»Antonina Tamirak«, nannte Pesterow ihren Namen. »Sie ist extra aus Kytryn hergekommen. Sie ist die beste Tänzerin hier im Kreis.«
Nachdem sie untereinander beratschlagt hatten, gingen die amerikanischen Inuit auf die Bühne. Sie nahmen die Schellentrommeln der Ulaker und begannen zu singen. Jascha Tagjok zuckte zusammen: Dieses selbe Lied hatte er den berühmten Nutetëin singen hören. In der Jugend, als man sie aus Nuwukan aussiedelte und an das fremde Ufer des Kytryner Meerbusens brachte, in die tschuktschische Siedlung Nunakmun, hatten viele Menschen geweint und zurückgewollt. Die strengen Grenzer aber setzten sie beinahe gewaltsam an der Küste aus, wo sie eine schweigsame Menge empfing, von der kalte Feindseligkeit ausging. Viele Jahre später, als die von Stalin befohlenen Massenaussiedlungen ganzer Völker aus ihren angestammten Gebieten bekannt wurden, begriff Jascha Tagjok, dass sich das Los seiner Stammesgenossen, der Nuwukaner, in nichts von dem Schicksal der unglücklichen Tschetschenen, Inguschen, Kalmücken unterschied …