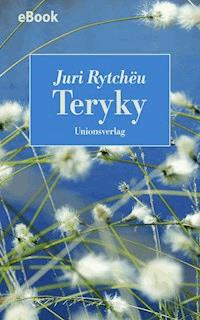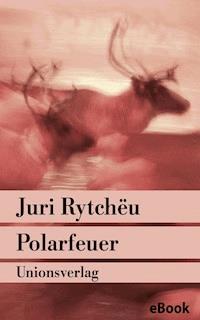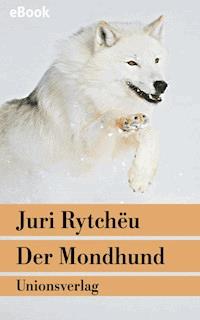12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Enmyn, der Tschuktschensiedlung an der Nordostküste Sibiriens, bis zur nächsten Krankenstation sind es dreißig Tage Fußmarsch durch die Polarkälte der Tundra. Dem schwerverletzten und halb ohnmächtigen Kanadier John MacLennan bleibt nichts anderes übrig, als sich drei »wilden und ungewaschenen« Tschuktschen anzuvertrauen, die ihn auf einem Hundeschlitten zum rettenden Arzt bringen wollen. Unterwegs befällt ihn der Wundbrand. In letzter Not kann ihm die Schamanin Kelena die Finger beider Hände amputieren und rettet ihm so das Leben. Als er zur Küste zurückkehrt, ist sein Schiff, das dort auf ihn warten sollte, längst in See gestochen. Widerwillig und der Verzweiflung nahe, richtet er sich auf einen Winter im eisigsten Winkel Asiens ein. Aus einem Winter wird ein ganzes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Nach einem Unfall wird der Kanadier MacLennan auf einem Hundeschlitten durch die eisige Tundra, im äußersten sibirischen Norden, zu einer rettenden Schamanin gebracht. Bei der Rückkehr zur Küste ist sein Schiff längst in See gestochen. Er muss als einziger Weißer unter dem Volk der Tschuktschen überwintern. Aus einem Winter wird ein ganzes Leben.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Arno Specht hat in den Sechziger- und Siebzigerjahren Werke russischer Autoren, darunter Konstantin Michailowitsch Simonow und Juri Rytchëu, ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Arno Specht.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Juri Rytchëu
Traum im Polarnebel
Roman
Aus dem Russischen von Arno Specht
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die russische Originalausgabe erschien 1968 unter dem Titel Son v nacale tumăna.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1973 im Verlag Volk und Welt, Berlin.
Originaltitel: Son v nacale tumana (1968)
© by Juri Rytchëu 1968
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30457-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 02:21h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TRAUM IM POLARNEBEL
1 – Am Morgen des 4. September hörten die Einwohner …2 – Wenn John auch keinen Augenblick das Bewusstsein verlor …3 – An der Bordwand der »Belinda« hielten drei Gespanne …4 – In der einbrechenden Dunkelheit, die alle Geräusche dämpfte …5 – Bedächtig stopfte Orwo den winzig kleinen Kopf seiner …6 – Den Ärmel ihres Kerkers zurückschlagend, entblößte Kelena einen …7 – Gegen Mitternacht legte sich der Sturm. Beim Erwachen …8 – John MacLennan hatte sich in Tokos Jaranga einquartiert …9 – In seiner Kammer hatte er sich so eingerichtet …10 – Es kam eine Zeit, in der für John …11 – Wir brauchen Walrosshaut«, mahnte Pylmau die Männer immer …12 – Als fern zwischen den Schollen des Packeises ein …13 – Bis auf einen schmalen Streifen gegenüber der Siedlung …14 – Die Sonnennächte in der Beringstraße waren für die …15 – Im Vorherbst herrscht allein die Sonne am wolkenlosen …16 – Nach dem ersten Schneefall übte sich John im …17 – Der Winter war in diesem Jahr härter als …18 – Im Winter war ein Tag wie der andere …19 – Fast ein Monat war vergangen, seitdem Orwo …20 – Gegen Morgen hatte der Eisbrei die Küste von …21 – Im Rücken den Wind, der ihre Kamleikas wie …22 – Auf ihrem Schlitten hatten die beiden Reisenden zwei …23 – Jenseits von Kap Dalny hatten die Walrosse auf …24 – Ehe John aber zur ersten Patrouillenfahrt auslaufen konnte …25 – Längst schon waren die Jagdspieße so scharf geschliffen …26 – Die Rentierherde ließ sich an der gegenüberliegenden Seite …27 – Die Sonne war verschwunden. Zum letzten Mal hatte …28 – »Das Jahr 1917 ist angebrochen«, schrieb John MacLennan …29 – Im leuchtenden Schneegestöber kam er morgens in Johns …30 – In den schlaflosen Nächten auf dem Meer …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Arno Specht
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Juri Rytchëu
Zum Thema Russland
Zum Thema Arktis
Zum Thema Schamanismus
Zum Thema Abenteuer
1
Am Morgen des 4. September hörten die Einwohner der Siedlung Enmyn an der Eismeerküste ein Krachen, das anders klang als das Krachen von berstendem Eis, rollenden Schneelawinen oder herabstürzendem Gestein am Felsenkap von Enmyn.
Im Tschottagin streifte Toko gerade die weiße Kamleika über. Als er behutsam in die weiten Ärmel fuhr, mahnte ihn der scharfe, fremdartige Geruch des Gewebes, den Kittel erst einmal gründlich im kalten Wind auszulüften, ehe er ihn zur Fuchsjagd anzog.
Nach dem ohrenbetäubenden Krachen fuhr er schnell mit dem Kopf durch den Ausschnitt und sprang mit einem Satz ins Freie. Dort, wo das Schiff der Weißen lag, verzog sich langsam eine Wolke. Eissplitter knackten unter Tokos Sohlen.
Aus allen zwanzig Jarangas strömten die Menschen. Schweigend, den Blick auf das Schiff gerichtet, standen sie da und grübelten über die Ursache des seltsamen Krachens nach.
»Sie wollten wohl das Eis an der Bordwand sprengen«, meinte Armol.
»Das denke ich auch«, stimmte ihm Toko zu, und beide Jäger liefen schnell zu dem im Eise festgefrorenen Schiff.
Die Wolke über dem Schiff hatte sich verzogen. In der Morgendämmerung sah man unter dem Bugspriet ein kleines Loch im Eis. Immer öfter stieß man gegen Eisbrocken, die dicht um das Schiff verstreut waren.
Vom Deck vernahm man erregte Stimmen; längliche Schatten huschten hinter den gelblich erleuchteten Bullaugen hin und her.
Toko und Armol verlangsamten den Schritt. Bald hatten die anderen sie eingeholt.
»Blut!«, rief Toko, über die Spuren gebeugt, die zum Eisloch an der Bordwand führten.
»Blut!«, riefen auch die anderen und betrachteten die dunklen Flecken auf dem Eis und dem Decksaufbau.
Lang gezogen wie das Heulen eines angeschossenen Wolfes drang ein Schrei aus dem vereisten hölzernen Schiffsrumpf.
»Ein Unglück auf dem Schiff!«, sagte Toko und war mit einem Satz an Deck.
Er öffnete leise die Kajütentür und sah in der Mitte des Raumes dicht gedrängt die weißen Seeleute stehen. Der Dunst ihres Atems hing unter der niedrigen Decke. Blecherne, mit Seehundtran gefüllte Funzeln gaben nur schwaches Licht.
Als mit Toko Frostluft in die Kajüte drang, schrie ein langer Seemann mit einem bunten Schal um den Hals zornig auf ihn ein. Wenn auch Toko die Sprache der Weißen nicht kannte, begriff er doch, dass man ihn hier nicht haben wollte. Er spürte hinter seinem Rücken die erhobene Faust und schlüpfte aus der Kajüte.
Auf die fragenden Blicke der Enmyner, die schweigend an der Bordwand standen, konnte Toko nur mit dem Kopf schütteln, dann schloss er sich der Menge an.
Vor zehn Tagen hatte das Schiff Enmyn angelaufen. Es war wohl zu weit nach Norden, hinter die Straße zwischen der Wrangelinsel und dem Kontinent, vorgestoßen und hatte dann versucht, vor den Eisfeldern auszureißen, die sich um ihren Winterplatz langsam zusammenzogen. Aber das Eis hatte das Schiff in die Enge getrieben und an die felsige Küste von Enmyn gedrückt.
Die Weißen waren von Bord gegangen, niedergeschlagen und erschöpft. Im Unterschied zu ihren Vorgängern hatten sie in keiner der zwanzig Jarangas, die sie nacheinander aufsuchten, nach Fellen, Fischbein oder Walrosszähnen gefragt, sondern nur nach warmer Kleidung und Rentierfleisch. Da kein Rentierfleisch vorhanden war, nahmen sie auch mit Walrossleber vorlieb.
Zwar zahlten sie für die Bekleidung nur wenig, doch waren ihre Tauschgegenstände, Nähnadeln, Äxte, Sägen und Kochkessel, von guter Qualität und sehr begehrt.
Der Kapitän, einen Backenbart im knochigen rauen Gesicht, sprach mit Orwo, der früher auf einem Walfischschoner gefahren war und einige Zeit in Amerika gelebt hatte. Er erkundigte sich nach dem Weg zur Irwytgyrstraße und blickte dabei sorgenvoll auf das dichte Eis, das bis an den Horizont reichte.
Orwo, dem der Kapitän leidtat, versuchte, ihm klarzumachen, dass schon wiederholt starker Südwind das Eis von der Küste zurückgetrieben habe, und zwar nicht nur zu Beginn des Winters, sondern auch in den dunklen Tagen, in denen die Sonne jenseits des Horizonts umherwanderte und sich nicht getraute, ihr Antlitz dem Frost auszusetzen.
An der leeren Pfeife saugend, seufzte der Kapitän.
Seit zwei Tagen wehte der Wind von Süden und trug von den Gipfeln Schnee an den Rand des Ufereises. Nicht weit vom Schiff zog sich zur offenen See eine breite offene Fahrrinne hin.
Ermutigt blieben die Seeleute an Bord, um den günstigsten Augenblick der Ausfahrt nicht zu verpassen.
Solch ein Wind trieb das Eis jenseits des Kaps Enmyn leicht auseinander, sodass man vom Rand des Ufereises Robben schlagen konnte, um seinen Vorrat für den Sommer aufzufüllen.
Schon in der Morgendämmerung hatten sich die Jäger auf den Weg gemacht, um den Anbruch des kurzen Tages nicht zu versäumen. Heimgekehrt mit reicher Beute, saß man jetzt in den Tschottaginen am hellen Feuer und stimmte gesättigt Lieder an. Bis zu dem vom Eis gefesselten Schiff hallten die dumpfen Schläge der Jarjars.
Der Winter versprach ruhig zu werden. Bis oben hin waren die Fleischgruben gefüllt mit den umsichtig in Fell zusammengerollten Kymgyts und den erlegten Robben, denen man nur das Fell abgezogen und die Flossen abgehackt hatte.
In diesem Sommer war die Jagd der Einwohner von Enmyn ertragreich und der Tauschhandel rege gewesen.
Tabak und Tee waren so reichlich vorhanden, dass sogar Orwo, der den wirklichen Preis der Erzeugnisse der Weißen kannte, dem verarmten Kapitän mitunter großzügig eine Prise Tabak anbot.
Mit dem Kopf auf das Schiff weisend, trat Orwo zu Toko und sagte leise: »Sie hätten noch warten sollen. Wir bekommen Südwind.«
»Es stöhnte jemand. Ich bin hingegangen, aber sie haben mich weggejagt.«
»Vielleicht nicht mal weggejagt?«, mutmaßte Orwo. »Der weiße Mann sagt Freundliches oft so, als schimpfe er.«
»Wollen wir noch einmal an Bord gehen?«, fragte Toko.
»Warte«, hielt ihn Orwo zurück. »Man wird uns rufen, wenn man unsere Hilfe braucht, wir wollen sie nicht aufdrängen. Die Weißen pflegen eine Art Versammlung oder Gericht abzuhalten. In Schwarz gekleidet, sitzen sie beisammen, küssen ein aufgeschlagenes Buch und halten Rat, wer mit dem Strick erwürgt und wer in ein finsteres Haus gesperrt werden soll. Ich habe es in Nome gesehen.«
»So strenge Strafen haben sie!«, entsetzte sich Armol.
»Ebenso groß ist auch ihre Schuld«, erwiderte Orwo seufzend.
Lautes Stöhnen schreckte die Versammelten auf. In der erleuchteten Türöffnung erschien der Kapitän, musterte die graue Menschenmenge und rief nach Orwo.
»Yes! It’s me!«, antwortete Orwo bereitwillig und stelzte über die breite Bohle, die als Fallreep diente.
Er betrat die Messe und sah sich um. Auf einer niedrigen Pritsche entdeckte er einen jungen Mann mit verbundenen Händen, die auf einer blutigen Decke lagen. Es war John, dessen Name sich in der Sprache der Bewohner von Enmyn wie »Son« anhörte.
Er lag mit geschlossenen Augen da und stöhnte. Schweißnass klebte das blonde Haar an seiner Stirn. Die zarten Nasenflügel vibrierten, als nähmen sie Wohlgerüche wahr. Tiefe Schatten verdunkelten die Augenpartie wie eine Schneeblende.
»John paff!«, sagte der Kapitän, auf den Verletzten und dessen Hände deutend.
Auch ohne Erklärungen des Kapitäns konnte sich Orwo denken, was vorgefallen war. Die ungeduldigen Seeleute hatten die Eisbarriere, die das Schiff vom offenen Fahrwasser trennte, sprengen wollen. Orwo kannte das aus seiner Fahrenszeit: Man bohrte Löcher in das Eis, steckte Patronen mit Papphülsen hinein und entzündete eine dünne Schnur, an der ein schnelles Feuer entlanglief. Das Eis barst, sodass die Splitter in den Himmel flogen. Manchmal glückte es, doch heute hatte es vergeblich gekracht: In der Eisdecke zeigte sich nicht der kleinste Riss.
»Man hätte warten sollen«, bemerkte Orwo. »Vielleicht treibt der Wind das Eis vom Ufer fort.«
Der Kapitän nickte und bedeutete denen, die dicht um den Verletzten herumstanden, auseinanderzugehen. Orwo trat an den Liegenden heran. Die Arme, oder besser gesagt, die Hände hatten etwas abbekommen.
»Orwo!«, rief der Kapitän.
Als sich der Alte umwandte, sah er auf dem Tisch eine kleine Flasche aus Metall.
»Ich besitze noch siebzig Dollar. Hier …«, sagte der Kapitän und legte eine Handvoll zerknüllter Geldscheine auf den Tisch. Wenn Orwo auch wusste, dass Scheine den gleichen Wert hatten wie Metallgeld, so schätzte er sie doch nicht sehr.
»John muss in ein Krankenhaus gebracht werden, sonst stirbt er.«
»Das Krankenhaus ist weit«, seufzte Orwo. »Kann sein, dass es John bis Anadyr nicht schafft.«
»Das ist aber die einzige Möglichkeit. Man muss dem Jungen helfen.« Der Kapitän zuckte die Achseln.
»Helfen muss man«, stimmte Orwo zu. »Ich werde mit meinen Kameraden reden.« Immer noch drängte sich die Menge an der Bordwand. Im Osten, hinter den spitzen Zacken ferner Eisbänke, glühte das Morgenrot, ohne das Licht der Sternbilder auszulöschen, die mit gleicher Helligkeit wie in der Nacht am Himmel standen. Langsam ging Orwo die vereiste Bohle hinab.
»Was ist geschehen?«, fragte Toko als Erster.
»Sons beide Hände sind verletzt«, gab Orwo Auskunft. »Es geht ihm schlecht. Man muss ihn nach Anadyr bringen.«
»Wohin?«, fragte Armol, als habe er nicht recht gehört.
»Nach Anadyr«, wiederholte Orwo. »Da gibt es beim Kreisvorstand einen russischen Doktor.«
»Wer soll ihn so weit bringen?«, zweifelte Toko. »Und wenn er unterwegs stirbt?«
»Sterben kann er auch hier«, meinte Orwo. »Sie haben nichts, womit sie uns bezahlen können, außer dieser Flasche voll bösen Wassers, das einen fröhlich und närrisch macht, und der Handvoll Papiergeld«, fügte er nach kurzem Schweigen hinzu.
Wortlos blickten die Männer auf die Spitzen ihrer Stiefel aus Rentierfell. Durch die dünne Holzwand der Kajüte konnte man das Stöhnen des Verletzten hören.
»Was geht er uns an?«, brach Armol das Schweigen. »Ein Fremder, ein Weißer! Sollen sie doch sehen, wie sie fertig werden. Wir haben ihn nicht verletzt und haben nichts damit zu tun.«
»Was Armol sagt, stimmt«, bestätigte Toko. »Was haben wir schon von ihnen? Nicht einmal Tabak besitzen sie. Bis wir die Hunde nach Anadyr und zurück gehetzt haben, vergeht fast ein voller Mond. Und wie viel Futter dabei draufgeht! Wir können nicht auf die Jagd gehen; und wer soll die Zuhausegebliebenen ernähren?«
»Du hast recht, Toko«, sagte Orwo.
Die Beine gespreizt, stand er in Gedanken versunken da. Die Männer hatten recht: Warum sollten sie einem weißen Mann helfen, der seine eigenen Schamanen und sein eigenes Land hatte?
Wer hatte ihm, Orwo, geholfen, als ihn in Alaska der Husten krümmte? Und wer, als er Müllgruben durchstöbern musste und sich mit den Hunden um Speisereste raufte? Auf dem Schiff war es ihm nicht besser ergangen. Niemals durfte er mit den anderen zusammensitzen. Nachdem sie Mittag gegessen hatten, brachten sie ihm einen Eimer, gefüllt mit einem Gemisch aus Knochen, Fleisch, Süßem, Bitterem und Saurem. Dann sahen sie ihm beim Essen zu und lachten über ihn. Als die Matrosen einen Eisbären auf treibender Scholle abschossen und das Junge an Bord nahmen, kümmerten sie sich mehr um das Tier als um den Menschen Orwo, der Robben geschlagen, Wale gefangen und ebenso große weiße Bären gejagt hatte.
Das Stöhnen wurde lauter. Im wachsenden Tageslicht zeichnete sich das im Eise festsitzende Schiff mit seinem verschneiten Deck, den Eiszapfen in der Takelage und den eisblumenbedeckten gelblich schimmernden Bullaugen deutlicher ab.
»Lasst uns nach Hause gehen«, sagte Orwo, wandte sich vom Schiff ab und schlug als Erster den Weg zu den Jarangas ein. Die anderen folgten. Das Knirschen des Schnees unter ihren Sohlen aus Walrosshaut übertönte das Stöhnen des Verletzten.
Doch die Männer hatten kaum das Ufer erreicht, als sie den Kapitän nach Orwo rufen hörten.
In der frostigen Dämmerung tauchte er neben ihnen auf und bat sie zu warten. Er wollte mit ihnen reden. Als er den Alten am Ärmel fasste und mit sich ziehen wollte, schüttelte ihn Orwo ab und sagte würdevoll: »Wir gehen zu dritt … Toko, Armol und ich.«
»Gut, gut«, nickte der Kapitän und trottete mit ihnen zum Schiff zurück.
Offenbar hatte man den Verletzten woanders untergebracht; er befand sich nicht mehr in der Messe. An seinem Platz erblickte Orwo drei Winchesterbüchsen, einen Zinkbehälter mit Patronen und eine große stählerne Schrotsäge.
»Diese Winchesterbüchsen gehören euch, wenn ihr ihn nach Anadyr fahrt und ein Papier von dort mitbringt, dass ihr ihn heil und unversehrt abgeliefert habt«, erklärte der Kapitän.
Toko, der noch nie im Leben so gute Waffen gesehen hatte und selbst nur eine schlechte Flinte besaß, stürzte zu den Büchsen. Das war ein unerhört hoher Preis: drei Winchesterbüchsen für eine Fahrt von einem Monat.
»Gibt er uns die Gewehre sofort?«, fragte er.
»Ich werde es gleich erfahren«, antwortete Orwo.
Darauf entspann sich ein langer Wortwechsel zwischen ihm und dem Kapitän.
»Jetzt will er uns nur eine Winchester geben, die anderen beiden nach unserer Rückkehr«, übersetzte Orwo.
»Und wenn er uns betrügt?«, warf Toko ein.
»Dann sind wir die Dummen«, sagte Armol und spuckte aus.
Missbilligend blickte der Kapitän zuerst auf ihn und dann auf das Klümpchen Spucke in der Ecke.
Toko stieß den Kameraden in die Seite. »In einer Holzjaranga spuckt man nicht«, flüsterte er.
Der Kapitän nahm eine der Büchsen und drückte sie Orwo mit sanfter Gewalt in die Hand, die beiden anderen übergab er Armol und Toko, nachdem er die Magazine entfernt hatte.
Dann wandte er sich bedeutungsvoll mit ein paar Worten an Orwo, der sofort übersetzte.
»Der Kapitän bürgt mit seinem Kopf dafür, dass die Winchesterbüchsen und das Schiff auf uns warten, bis wir zurück sind. Als Pfand lässt er uns die Nester für die Patronen.«
»Wir sind einverstanden«, sagte Toko, nachdem er sich durch einen Blick mit Armol verständigt hatte.
Die drei verließen die Kajüte und stiegen über das Fallreep aufs Eis hinunter. In Erwartung weiterer Nachrichten kam die Menge näher an die Bordwand und blieb dann schweigend in der Kälte stehen.
Als Orwo, Armol und Toko aber wortlos an ihnen vorbei zu ihren Jarangas gingen, folgten sie ihnen schweigend und entfernten sich immer weiter von dem eisbedeckten Schiff.
»Wir hätten ihn noch um ein kleines Holzboot bitten können«, bedauerte Armol.
»Beklage dich nicht. Man hat uns einen guten Preis gezahlt«, meinte Orwo verständig. »Etwas anderes wäre es, eine kleine Jaranga aus Stoff von ihnen zu erbitten. Der Verletzte ist nicht gewohnt, in der Tundra zu übernachten. Außerdem ist ein Stoffzelt eine gute Sache. Vielleicht dürfen wir es nachher behalten, wir könnten dann Kamleikas daraus machen.«
Als Toko den Tschottagin betrat, nahm seine Frau, die schon alles wusste, aus einem Ledersack gerade die Bekleidungsstücke für weite Reisen heraus: das weite Oberkleid aus Rentierfell mit Kapuze, die doppelten Hosen, drei Paar Stiefel aus Rentierfell, Fausthandschuhe, die ockergefärbte hirschlederne Kamleika, die mit dichtem, Reif abweisendem Marderfell besetzte Pelzmütze und als Unterlage ein Bärenfell.
Toko holte den Winterrentierschlitten mit Kufen aus Birkenholz vom Dach, legte den langen Zugriemen aus Walrosshaut zurecht und ging, die in der Siedlung umherstreunenden Schlittenhunde einzufangen.
2
Wenn John auch keinen Augenblick das Bewusstsein verlor, so ließ ihn der furchtbare Schmerz in den Händen doch die Welt wie durch einen dichten, wehenden Schleier des Leidens sehen.
Jede Bewegung erinnerte ihn an das Feuerwerk, das vor wenigen Stunden vor ihm aufgeflammt war.
Nachdem er aber einen Krug Kaffee mit Kondensmilch geleert hatte, fühlte er sich merklich wohler und stellte überrascht fest, dass er mehr denn je vom glücklichen Ausgang seiner ersten Arktisreise überzeugt war.
Er trat aus der engen, verräucherten Messe ins Freie und atmete tief die Frostluft ein. Fast liebevoll blickte er auf die öde Felsenküste, auf der sich als dunkle Punkte die Hütten der Tschuktschen abzeichneten, beglückt und froh darüber, dass er, John MacLennan, weit weg von dieser entsetzlichen Gegend geboren war. Mitleid mit den Unglücklichen regte sich in ihm beim flüchtigen Blick auf die dicht gedrängt stehenden Behausungen und die kaum erkennbaren kleinen Rauchsäulen über ihnen.
John MacLennan war der Sohn eines Bibliothekars aus der Hafenstadt Port Hope am Ontariosee. Sein Vaterhaus stand an einer Straße, die zum Hafen führte, wo seine kleine Jacht »Good Luck« in den Wellen schaukelte. Doch nicht das Boot, sondern Bücher riefen MacLennan, den Jüngeren, zur See: Kiplings Gedichte und befahrener Seeleute vage Schilderungen über ferne Länder, über nächtliche Stürme und Küsten, die noch kein zivilisierter Mensch betreten hatte.
Allen elterlichen Ermahnungen und flehenden Blicken seiner Braut Jeannie, der reizenden kleinen Lehrerin, zum Trotz ging John auf große Fahrt. Per Eisenbahn durchquerte er den Kontinent und wechselte von Vancouver nach Nome hinüber, dessen geräumigen Hafen Walfischfänger, Handelsschiffe der Hudson’s Bay Company, notdürftig für arktische Gewässer hergerichtete unförmige Pötte und schneeweiße Jachten aus den Vereinigten Staaten füllten.
In einer Hafenkneipe lernte John MacLennan bald seinen künftigen Chef, Hugh Grover, aus Winnipeg, also fast einen Landsmann, kennen, der Eigner eines Handelsschoners war. Schon in frühester Jugend hatte ihn die See in ihren Bann geschlagen. Dazu beigetragen hatten viele Geschichten seines Onkels, der als Seemann die Hudson Bay befahren hatte. Als dieser beim Rasenmähen vom Schlag getroffen starb, stellte sich heraus, dass er Hugh Grover zum Alleinerben eingesetzt hatte.
Von den wenigsten Mitgliedern der bunt gemischten Schiffsbesatzung wusste man, woher sie kamen. John nahm sofort eine privilegierte Stellung unter ihnen ein. Obwohl dem Kapitän offiziell kein Gehilfe zustand, ernannte man ihn dazu, und er wurde Hugh Grovers bester Freund. Alles verlief nach Wunsch. Auf ihrer Fahrt an der Eismeerküste entlang, an der sie des Öfteren kurz Station machten, um mit den Eingeborenen zu handeln, träumten Hugh und John davon, als Erste bis zur Mündung des fernen sibirischen Stromes Kolyma vorzustoßen. Das wäre eine Sensation in der Seefahrt der russischen Arktis gewesen, und die Namen John MacLennans und Hugh Grovers würden wie die Franklins, Frobishers, Hudsons und anderer Weißer, die die lautlose schneebedeckte Weite besiegt hatten, auf der Landkarte verewigt werden.
In ihrem Streben nach Entdeckerruhm überhörten Hugh und John das Murren der Besatzung und vergaßen den Kalender, der unerbittlich die Tage des kurzen Polarsommers zählte.
Jenseits der Longstraße, nahe der Kolymamündung, deren Strömung ihnen immer wieder von der Brandung zerfaserte Taigastämme entgegentrieb, tauchte am Horizont ein scheinbar harmloser, im Eismeergebiet jedoch sehr gefährlicher, schmaler weißer Streifen auf.
Angesichts der drohenden Gefahr legte Grover hart das Ruder um und machte kehrt.
Gegen Abend, als der weiße Streifen zu einem deutlich auszumachenden Eisfeld wurde, befahl der Kapitän, die Segel zu setzen, und rief John unten im Maschinenraum zu, das Äußerste aus dem alten Motor herauszuholen.
Drei Tage lang mühten sie sich ohne Rast und Ruh, dem unaufhaltsam näher rückenden Eisfeld zu entkommen.
In der Abenddämmerung, wenn die Eisschollen den Blicken der Seeleute entschwunden waren, fassten sie die Hoffnung, dass sie dem Weißen Tod an ihren Fersen entronnen seien. Doch in der ersten blassen Morgendämmerung leuchtete das Eis schon heller als der Himmel. Bedrückt horchten die Seeleute auf das ferne Krachen und Rascheln der sich reibenden Eisschollen.
Wenig später hatte das Eis die »Belinda« eingeholt. Ohne landen oder den Kurs ändern zu können, trieb das Schiff jetzt mit dem Eisfeld. Weder Motor noch Segel bestimmten die Geschwindigkeit, mit der sich die »Belinda« fortbewegte, sondern einzig und allein der Nordostwind, der das Eisgemengsel zur Beringstraße trieb. Zwar krachte der Schiffsrumpf, widerstand jedoch noch immer dem Druck der Schollen.
Die einzige, von Tag zu Tag wachsende Hoffnung blieb, dass das Eis die »Belinda« durch die Beringstraße in das offene Fahrwasser der Beringsee schob. Als aber nur noch vierundzwanzig Stunden flotter Fahrt das Schiff vom ersehnten Ziel trennten, setzte sich das Eis in Sichtweite des Kap Enmyn fest und drückte die »Belinda« an den Rand des Ufereises.
»Hier müssen wir überwintern«, sagte der Kapitän düster. »Sicher nicht als Erste und auch nicht als Letzte. Gut, dass die Küste bewohnt ist.«
Doch die Verhandlungen mit den Eingeborenen kamen nur mühsam in Gang. Die Wilden konnten nicht begreifen, dass es auf dem Schiff keine Tauschobjekte mehr geben sollte, dass alles für Polarfüchse und Walrosszähne, die den Stauraum füllten, draufgegangen war.
Unter ihnen fand sich ein Mann, der etwas Englisch sprach: eine Art Ältester oder Führer, dem die Hüttenbewohner aber deswegen keine sichtbare Ehrerbietung entgegenbrachten. Anscheinend beruhte sein Ansehen auf anderen Tugenden. Sein Name war Orwo, im Unterschied zu den anderen Namen leicht auszusprechen, nicht wie der von Orwos Tochter, Tynarachtyna, an dem sich John die Zunge zerbrach.
Orwo war es auch, der die Vermutung ausgesprochen hatte, der Südwind werde das Eis von der Küste abdrängen und damit den Weg zur Beringstraße öffnen.
Schon vor zwei Tagen hatten sich erste Anzeichen für einen Wetterumschlag eingestellt: Das Eis geriet in Bewegung, und in der ersehnten Richtung bildete sich eine lange, fast an die »Belinda« heranreichende breite Fahrrinne.
Nach kurzer Beratung entschloss man sich, den verbleibenden Damm durch Sprengung zu beseitigen.
Nach dem Frühstück ging John MacLennan zu den Sprenglöchern, die die Matrosen in das Eis geschlagen hatten. Nachdem er einige Zeit an der Bordwand die aufgehende Sonne bewundert hatte, begab er sich mit Sprengstoff und Zündschnur bedächtig zu den Sprenglöchern, in die er die dicken Patronen legte. Als er sie zugescharrt und sicherheitshalber festgestampft hatte, setzte er an der ausgezogenen Zündschnur den Hauptstrang in Brand. Zischend lief ein bläuliches Flämmchen auf die Sprengladung zu.
John ging zum Schiff zurück, setzte sich auf einen Eisbrocken und zählte die Sekunden. Die erste Detonation krachte. Entgegen seiner Erwartung klang sie dumpf und schwach. Dennoch spürte John ein kraftloses Beben in dem scheinbar für ewig an die Felsenküste geschmiedeten Eisfeld. Nach den drei folgenden stärkeren Detonationen regneten Eispuder und Eissplitter auf John herab.
Gespannt wartete er auf die fünfte Detonation. Zu gern hätte er gewusst, ob die Rinne nun breiter geworden war. Doch vor der fünften Detonation war nicht viel zu erwarten.
Die vorgeschriebenen Sekunden und weitere verstrichen, ohne dass es krachte.
Vorsichtig hob John den Kopf aus der Deckung. Kein Rauch, kein Flämmchen zeigte sich. Nach einer Weile ging er langsam auf den Spalt zu, in der Annahme, die vorausgegangenen Detonationen hätten die Zündschnur verschüttet und gelöscht. Die Rinne war so schmal wie vorher. Anscheinend hatte der Sprengstoff nicht gewirkt. Nach den vier Ladungen zeigte sich nur eine kleine Vertiefung im Eis, das nirgends bis auf den Grund durchschlagen war.
Eisbrocken und Schnee bedeckten die fünfte Patrone. Nur das leicht qualmende Ende der angebrannten Zündschnur ragte heraus. Unbedacht ließ sich John auf die Knie nieder, um den Schnee über der Patrone wegzuscharren, die im selben Augenblick detonierte.
Ein Feuerschein, grell wie das Polarlicht, blendete John. Der Luftdruck presste sein Trommelfell nach innen. Er fiel hin und blieb liegen, bis ein heftiger Schmerz in Gesicht und Händen ihn bis ins Mark durchdrang. Er schrie auf, schrie, ohne seine Stimme zu hören, die Arme mit den blutigen Handschuhfetzen, den zerrissenen Fingern und bläulich weißen Sehnen, von denen in dicken Tropfen das warme Blut in den Schnee fiel, von sich gestreckt.
Die Matrosen, die an Deck Zeuge des Unfalls geworden waren, stürzten zu dem Verunglückten. In weit ausholenden Sprüngen überholte sie der Kapitän.
»Was hast du angerichtet, Junge!«, rief er, während er John behutsam aufzurichten versuchte. »So helft mir doch und stützt ihn!«, schrie er die Matrosen an.
Unschlüssig kamen die Seeleute näher. Ängstlich blickten sie auf die Reste der Zündschnur und die Fetzen der Dynamitpatrone.
»Keine Angst!«, röchelte John. »Sämtliche Ladungen sind detoniert.«
Als man ihn zum Schiff trug, spürte er, wie mit dem strömenden Blut das Leben aus ihm wich. Ein seltsames, erschreckendes Gefühl.
»Stillt mein Blut!«, bat er, als man ihn auf den kleinen Diwan in der Messe bettete.
Einer der Matrosen kam darauf, ihm mit einem Stück Tauwerk die Arme abzubinden. Die Blutung kam zum Stillstand. John fühlte, wie es seinen Körper feurig durchrieselte. Ein heißer Strom pulste in Handgelenken und Zehen; sein Mund füllte sich mit Speichel, der nach Eisen schmeckte und Übelkeit erregte.
»Muss ich sterben?«, fragte der Verletzte den Kapitän, der am Kopfende des Lagers nervös an seinem Backenbart zupfte.
»Nicht doch, John«, erwiderte er. »Ich werde alles tun, um dich zu retten. Man wird dich ins Krankenhaus nach Anadyr bringen. Da gibt es einen Arzt.«
»Und sie werden auf mich warten?«, fragte John flehend.
»Wie kannst du einem Freund solch eine Frage stellen?«, empörte sich Hugh. »Im Übrigen kleben wir an dieser Küste, dass wir, selbst wenn wir wollten, keinen Zoll von ihr wegkämen. Wenn wir offenes Fahrwasser bis Nome hätten«, fügte er bekümmert hinzu, »lägst du schon in drei Tagen im Hospital. Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass wir auf dich warten.«
»Ich danke dir, Hugh«, seufzte John erleichtert. »Du warst mir immer ein echter Freund.«
In dem männlichen Antlitz des Kapitäns las er so viel freundschaftliche Anteilnahme und Sorge, dass er die Schmerzen und das Fieber in seinem Körper leichter ertrug.
»Die Tschuktschen bringen dich mit dem Hundeschlitten nach Anadyr. Ich sorge dafür, dass sie dich gut behandeln.«
»Werden sie mir auch nichts tun?«, erkundigte sich John.
»Wer?«, fragte Hugh, der die Frage nicht verstanden hatte.
»Na, diese Wilden, die Tschuktschen«, antwortete John. »Ich finde sie wenig vertrauenerweckend. Ein unsympathisches Völkchen. Dreckig und unwissend.«
»Sie sind zuverlässig«, beruhigte Hugh den Freund, »besonders wenn man sie gut bezahlt.«
»Spare nicht an ihnen, Hugh«, sagte John flehend. »Gib ihnen alles, worum sie bitten … In Port Hope rechnen wir miteinander ab.«
»Was soll das!«, schalt Hugh. »Was gibt es unter Freunden für Abrechnungen!«
Als Toko eintrat, scheuchte ihn der Kapitän mit einem Anschnauzer auf Deck zurück.
»Du solltest nicht so barsch mit ihnen verfahren, Hugh. Sei freundlicher zu ihnen«, meinte John.
Der Kapitän gab ihm recht, und verlegen befahl er, Orwo zu rufen.
Von dem, was der Kapitän mit Orwo besprach, konnte John kaum etwas verstehen, denn der Tschuktsche sprach ein fast unverständliches Englisch.
Als John die Augen schloss, überkam ihn Brechreiz, den er jedoch zurückdrängte, bis Orwo gegangen war, um sich vor ihm keine Blöße zu geben.
Auf Befehl des Kapitäns, John in eine andere Kajüte zu verlegen und die Messe aufzuräumen, trugen die Matrosen den Verletzten fort und schleppten Kleidung für die weite Reise heran.
Behutsam streiften sie ihm die alten Sachen ab und zogen ihm zuerst ein neues Wollhemd an, warme Tuchhosen, doppelt gestrickte Socken und darüber die Winterpelzbekleidung, die John erst vor Kurzem von den Tschuktschen erstanden hatte. Hugh brachte Johns Seemannskiste und einen großen Sack mit Verpflegung.
»Hier sind Kaffee, Zwieback, Zucker, Konserven, Kondensmilch und eine Feldflasche mit Whisky«, zählte Hugh sachlich auf. »In der Kiste liegen Wäsche zum Wechseln, deine Papiere, Briefe und Fotos deiner Angehörigen.«
»Ich danke dir, Hugh«, sagte der Verletzte, gequält lächelnd. »Die Kiste hätte ich nicht gebraucht, weil ich doch nicht lange in Anadyr bleiben werde.«
»Du wirst Geld und Papiere brauchen«, erklärte Hugh entschieden, »denn die Russen sind ungeheuer pedantisch. Außerdem sind sie scharf auf Dollars. Du wirst für die Behandlung bezahlen müssen.«
»Du hast recht, Hugh«, erwiderte John. »Ich werde nie vergessen, wie du mir in dieser schweren Stunde gütig zur Seite gestanden hast. Du bist mir teurer geworden als Bruder, Vater und Mutter.«
Kapitän Grover, der im Allgemeinen keineswegs empfindsam war, zog sein Taschentuch und wischte sich die Augen. Er war aufrichtig bewegt, denn er mochte den Jungen, auf den er in Nome aufmerksam geworden war. Schon in der Hafenkneipe hatte er erkannt, dass ihm John auf der weiten Fahrt in die Arktis das einsame Dasein unter den Grobianen und ausgemachten Strolchen seiner Besatzung als guter Kamerad erträglich machen konnte.
In langen Reden hatte er John klargemacht, wie naiv dessen Ansichten über diese grausame Welt wären, in der jeder einen warmen Platz und möglichst fetten Anteil an der Beute zu ergattern suchte. Als die Besatzung einmal mit List ein paar Frauen an Bord gelockt hatte, redete er dem empörten John freundschaftlich zu, Verständnis für die Elenden zu haben, die kein anderes Vergnügen kannten, als sich am Ende der Reise für ihren Beuteanteil zu betrinken oder sich auf langer, anstrengender Fahrt durch »Liebe« zu zerstreuen.
Reisefertig lag John auf dem Rücken und dachte, wie viel Güte und Mitgefühl doch in diesem Manne steckten, den er zunächst für einen Zyniker und skrupellosen Geschäftsmann gehalten hatte. Hugh hatte zweifellos in manchem, wenn nicht sogar in vielem recht. Aber er war zu offen und zu gerade. Er, der so verächtlich über die Tschuktschen gesprochen hatte, war jetzt auf ihre Hilfe angewiesen. Zwar würde er sie gut bezahlen, aber wie viel leichteren Herzens würde er, John, sich auf den weiten, unbekannten Weg in die fremde russische Stadt machen, wenn es nur ein Quäntchen Vertrauen zwischen den Wilden und den Männern der »Belinda« gegeben hätte.
3
An der Bordwand der »Belinda« hielten drei Gespanne. Ihre Lenker trieben die eisenbeschlagenen Bremsstöcke in das Eis und begaben sich auf Einladung des Kapitäns an Deck.
In der aufgeräumten Messe führte der Kapitän die drei Tschuktschen höflich zum Tisch, auf dem drei große rumgefüllte Silberbecher standen.
Halb aufgerichtet lag John auf dem Diwan. Im Overall mit einer Kapuze aus Rentierfell, den Pelzhosen, den rentierledernen Stiefeln und der iltisfellbesetzten Mütze mit Ohrenklappen unterschied er sich wenig von den Lenkern.
Grover reichte jedem einen Becher, gab das Zeichen, ihn auf einen Zug zu leeren, und wandte sich dann mit folgenden Worten an die drei Tschuktschen: »Man vertraut euch das Leben eines weißen Mannes an. Ihr habt John MacLennan heil und unversehrt in der russischen Stadt Anadyr abzuliefern, zu warten, bis er geheilt ist, und ihn dann an diesen Ort zurückzubringen. Ihr wisst, wie wertvoll uns das Leben unseres Freundes ist«, fuhr der Kapitän mit einer Kopfbewegung auf John fort, »und ihr haftet mit eurem Kopf dafür, dass ihm nichts zustößt.« In freundlicherem Ton schloss er: »Aber wenn alles klargeht, werdet ihr reich belohnt. Sie haben mich verstanden, Orwo, jetzt übersetzen Sie Ihren Kameraden meine Worte.«
Während Orwo übersetzte, musterte Toko den Verletzten. Ihm missfielen seine kalten Augen, die durch einen hindurchzusehen schienen, als stände niemand vor ihnen.
Durchbohrt von Johns Blick, fühlte Toko eine seltsame Kälte im Magen, die selbst der feurige Rum nicht vertrieb.
Mit folgenden Worten übersetzte Orwo Kapitän Grovers Ansprache: »Verflucht sei die Stunde, in der ich mich darauf eingelassen habe! Eingewickelt hat er mich, der Fuchs! Die Winchestergewehre haben mich geblendet. Was sollen wir jetzt tun? Wir werden ihn hinfahren müssen. Wie eine hungrige Laus ist er. Wenn ihm etwas geschieht, geht es uns schlecht … Was meint ihr, sollen wir fahren?«, fragte Orwo, an Armol gewandt.
Armol, der der Übersetzung nur mit halbem Ohr gefolgt war und nur die letzte Frage verstanden hatte, nickte schweigend.
»Ich habe noch nie eine richtige Winchesterbüchse besessen«, sagte Toko nach einigem Zögern.
Behutsam trugen sie den Verletzten aus der Kajüte und betteten ihn auf einen der Hundeschlitten, auf dem sie eine kleine Überdachung aus Rentierfell errichtet hatten. Die beiden anderen beluden sie mit Proviant, Hundefutter, Johns Seemannskiste und Reservekleidung.
Toko band außerdem eine Stoffjaranga auf seinen Schlitten, für den Fall, dass man in der Tundra übernachten musste.
Ihr Aufbruch verzögerte sich, weil sich jeder einzelne Matrose verpflichtet fühlte, einige Abschiedsworte zu murmeln. Kapitän Grovers Abschied aber zog sich so lange hin, bis dem Scheidenden Tränen die Wangen herunterliefen. Seltsam sah ein weinender Mann aus!
Während Toko auf die kalten Augen starrte, die in Tränen schwammen, regte sich Mitleid, gemischt mit Triumph, in seiner Seele. John, der den Blick auffing, wandte sich zornig ab und streifte mit den riesigen Handschuhen aus Rentierfell die Tränen von den Wimpern. Dabei verzog er schmerzhaft das Gesicht.
Orwo schrie die Hunde an, und langsam setzten sich die Schlitten in Bewegung. Die weißen Männer liefen, laute Abschiedsworte rufend, hinterher. John wurde das Herz schwer; immer tiefer ließ er den Kopf hängen, bis der flauschige Besatz seiner warmen Mütze aus Rentierfell vollends sein Gesicht verdeckte.
Schiff und Eis hinter sich lassend, fuhren die Schlitten landeinwärts. Auf der Höhe der Jarangas bremste Toko sein Gespann leicht und blickte auf seine Frau, die vor dem Eingang stand und den Gespannen nachsah. Abschied nehmend, begegneten sich ihre Blicke. Toko erinnerte sich an den Abschied der weißen Seeleute und dachte bekümmert, dass es nicht übel wäre, sich Wange an Wange von seiner Frau zu verabschieden, ihren vertrauten Geruch wahrzunehmen, um während der langen Reise zum unbekannten Anadyr an ihn denken zu können.
Sie überquerten jetzt die Lagune. Da es nur wenig geschneit hatte, erstreckte sich blankes Eis von dem einen Ufer der Lagune zum anderen. Um nicht auszugleiten, suchten die Hunde Schneewehen auf, die Gespannführer aber lenkten sie auf das Eis zurück, auf dem die Schlitten, wie von selber gleitend, an die eingespannten Hunde heranfuhren.
Toko blickte zurück auf die im frühen Dunkel der verschneiten Weite sich auflösenden Jarangas und den vertrauten Felsen am Horizont. Unablässig behielt er seine Jaranga im Auge, die er selbst errichtet und zu deren Bau er Treibholz unter den Felsen gesammelt hatte. Dann hatte er warten müssen, bis er bei der Teilung der Beute seinen Teil Walrosshaut zur Dachbedeckung erhielt. Angesammelten Seehundstran in Säcken aus Robbenfell und Riemen aus Walrosshaut hatte er seinen Freunden, den Rentierzüchtern, als Gegengabe für die Felle im Schlafraum der Jaranga geliefert. Nicht nur, dass seine Jaranga denen der anderen in keiner Weise nachstand, erschien sie Toko und Pylmau sogar noch schöner und wohnlicher, weil es ihre eigene Behausung war. Erst seit drei Jahren verheiratet, war es ihnen, als seien sie schon ein Leben lang beisammen, so leicht errieten sie gegenseitig ihre Wünsche, auch ohne Worte und Erklärungen.
Jetzt verschwand die heimatliche Jaranga am leeren Horizont. Keine Spur mehr in der eintönigen Weite, die auf Lebewesen und Behausungen hingedeutet hätte.
Tokos Schlitten bildete den Schluss. An der Spitze des Zuges bahnte Armol den Weg für Orwos Schlitten, der den Kranken beförderte. Um den Verletzten vor dem von den Hundepfoten aufgewirbelten Schnee zu schützen und zu verhüten, dass der Wind sich unter den Rand seiner Pelzmütze setzte, hatten sie die kleine Fellüberdachung vorne geschlossen, sodass John nur nach hinten einen Ausblick hatte.
Schmerz und Müdigkeit trübten die blauen Augen des weißen Mannes, die auf die Hunde des folgenden Gespanns gerichtet waren. Vielleicht war es auch der Kummer darüber, dass er von den Kameraden getrennt, allein auf die weite Reise gehen musste. Wer wusste, was in diesem Kopf mit dem hellen Haarschopf – scheinbar schon früh ergraut – vorging. Wie kam es nur, dass seine Augen so kalt blickten!
John spürte den unverwandten Blick des Eingeborenen. Wie seltsam schmal seine Augen waren. Wie konnte man die Welt erkennen durch so enge Schlitze, ähnlich dem in Großmutters Sparbüchse? Blickte man aber tiefer in sie hinein, glaubte man, in einen bodenlosen Abgrund zu schauen, ewig finster und rätselhaft. Was für Gedanken mochten diesen jungen Tschuktschen im Augenblick bewegen?
Auf der glatten Eisfläche der Lagune rumpelte der Schlitten nicht mehr, und der Schmerz in den Händen ließ nach. Lange noch sah John die Masten der »Belinda«, zwei dunkle Striche am verblassenden Himmel, die ihn mit einer vertrauten Welt verbanden. Dort aber, wohin die Hundegespanne liefen, lagen Ungewissheit und die Hoffnung auf Überleben.
Als die Masten verschwanden, fühlte John so eine Leere im Kopf, als sei ihm das Hirn beim Schaukeln der Narten über die aufeinandergetürmten Eisschollen zwischen Schiff und Küste abhandengekommen. In seinem Unterbewusstsein aber lauerte die Angst, Angst vor der ungeheuren Weite, vor der Kälte, die ihm bereits unter den Pelzoverall kroch, und vor den Schlittenlenkern mit den unergründlich dunklen Augen. Unter ihren ständigen Blicken hatte er das Gefühl, als bewege er sich in einem geschlossenen Kreis, um den ein Abgrund gähnte.
Was mochte von seinen Händen und Fingern noch übrig sein? Von Zeit zu Zeit versuchte er, sie zu bewegen. Dabei schienen sie ihm unversehrt zu sein. Seltsamerweise aber spürte er Schmerzen bis an die Ellenbogen und Oberarme, obwohl sie nicht einen Kratzer abbekommen hatten. Er versuchte, sich von seinen Schmerzen abzulenken und an alles Mögliche zu denken, um das Selbstgefühl nicht zu verlieren. Unheimlich, wie dieser Raum den Menschen verschlang, ihn körperlich und geistig in nichts auflöste.
Um den endlosen Raum wenigstens nicht sehen zu müssen, schloss John die Augen und lehnte sich gegen die gefalteten Rentierfelle in seinem Rücken. Im Schlaf versuchte er, der drückenden Umwelt, den düsteren Gedanken und den Schmerzen in beiden Händen zu entfliehen.
Armol bremste seinen Schlitten und hielt. Das hieß, dass jetzt die Reihe an Toko war, die Spitze zu übernehmen.
Toko schrie auf die Hunde ein und überholte die anderen Schlitten. Im Pulverschnee, den erst Mitte des Winters orkanartige eisige Stürme feststampfen und mit rauer Hand glätten würden, hatten es die Hunde schwer, die bisweilen mit eisverkrustetem Fell bis an den Bauch in den lockeren Schneewehen versanken.
An Steigungen und tiefen Schneewehen, an denen Toko absprang und, sich ans Schlittenhorn klammernd, nebenherlief, wurde ihm so warm, dass er den Pelzoverall samt Kapuze abwarf, sodass Reif sein Haar überzog.
Dann wieder ließ er sich mit solcher Wucht auf den Schlitten fallen, dass die Walrossriemen, die die aus Holz geschnitzten Teile zusammenhielten, knarrten und der Leithund vorwurfsvoll den Kopf umwandte.
Dick eingemummt, sodass man keine inneren Regungen hätte feststellen können, weil nichts mehr von seinem Gesicht zu sehen war, dachte Orwo angestrengt über seine Handlungsweise in den letzten Stunden nach. Dabei gelangte er zu der Erkenntnis, aus verwerflicher Gier falsch gehandelt zu haben.
Zweifellos waren die Winchesterbüchsen, die ihnen Kapitän Grover versprochen hatte, schön, aber waren sie nicht auch ohne sie ausgekommen, wie Orwos Vorfahren ohne Tabak, Tee, ohne das böse, närrisch machende Wasser und die Nadeln aus Stahl? Sie hatten sich damit begnügt, mit Pfeil und Bogen zu jagen.
All die neuen Dinge, die die weißen Männer an die Küste der Tschuktschen brachten, machten das Leben nur schwieriger.
Bitterkeit war in ihrem süßen Zucker. Was aber konnte man dagegen tun? Zwar hatte er in den ungeheuer großen Siedlungen der weißen Männer gelebt, doch eine Antwort auf die Frage hatte er nicht finden können, er, der nur schmutzige Hafenkneipen und Abfallgruben kennengelernt hatte.
Ihm war jene Welt zuwider, aber wer konnte sich dafür verbürgen, dass den Weißen die Lebensweise der Tschuktschen gefiel? Jeder lebte auf seine Weise, und es hatte keinen Sinn, den anderen ummodeln und seine Sitten und Gebräuche ändern zu wollen. Wenn man die Nase nicht in anderer Leute Lebensweise steckte, sondern nur zum gegenseitigen Vorteil handelte, gäbe es keinen Zwist. Ein Unglück, wenn sich der weiße Mann in das Leben der Eismeerküstenbewohner mischte … Solche Gedanken nahmen ihm die Ruhe. Weshalb nur hatte er sich bereit erklärt, diesen Krüppel zu fahren? Er war aschfahl und hatte einen bösen Blick.
Im Osten wurde es heller, nur noch die hellsten Sterne leuchteten. Vor dem Hintergrund kahler gezackter Gipfel am blauen Himmel zeichnete sich ein Gebirgsrücken ab, hinter dem das nach Anadyr führende große Tal lag. Drohend glänzten seine zerklüfteten Gipfel in den Strahlen der jenseits des Horizonts unsichtbar dahinschleichenden Sonne.
Orwo reckte den Kopf aus dem Pelz und rief: »Lass uns halten, Toko, und die Kufen mit Eis überziehen.«
Als Toko den Schlitten bremste, blieben der Leithund und danach auch die anderen Zugtiere stehen.
John öffnete die Augen, das rhythmische Wiegen des Schlittens auf der ebenen Eisfläche hatte aufgehört.
Wieder begegnete sein Blick dem des Tschuktschen auf dem folgenden Gespann. Erstaunt stellte er fest, dass sich dessen Äußeres verändert hatte, der Schnitt seiner Kleidung und selbst sein Blick. John fand keine Erklärung dafür, bis Toko näher kam und ihm klar wurde, dass die Reihenfolge der Gespanne gewechselt hatte. Dabei dachte er, wie wenig sich diese Männer doch voneinander unterschieden und dass er lernen müsse, sie auseinanderzuhalten.
Toko wechselte ein paar Worte mit seinen Gefährten und blickte dann auf John, der so etwas wie ein Lächeln in dem gebräunten Gesicht des Tschuktschen zu entdecken glaubte, dessen Haut an den Bezug eines alten Ledersessels erinnerte. Er versuchte, das Lächeln mühsam mit frostkalten Lippen zu erwidern.
»Seht, wie er lacht!«, rief Toko überrascht, mit dem Finger auf den Verletzten deutend.
»Warum nicht?«, meinte Orwo. »Er ist doch auch ein Mensch. Sein Lächeln zeigt, dass es nicht zu schlecht um ihn steht. Vielleicht gelingt es uns tatsächlich, ihn lebend nach Anadyr und zurückzubringen und die Gewehre dafür zu kriegen.«
»Ja, wir müssen behutsam mit ihm umgehen«, sagte Armol. »Vielleicht ist es Zeit, ihn zu füttern. Frag ihn doch, Orwo!«
Sich auf die Lippen beißend, deutete Orwo zuerst auf seinen und dann auf Johns Mund.
Auf Johns zustimmendes Nicken – er hatte zwar keinen Hunger, doch es war Lunchzeit – ging Orwo zum Schlitten mit Johns persönlichen Vorräten. Die anderen Gespannlenker aber drehten ihre Schlitten um und bearbeiteten die Kufen so lange mit feuchten Fellstücken, bis eine neue Gleitfläche durch die sich bildende Eisschicht entstanden war. Das nötige Wasser dazu entnahmen sie flachen schottischen Whiskyflaschen, die sie unter den Pelzen auf dem nackten Leib trugen, und ließen es aus dem Mund auf die Felle rieseln. War der Wasservorrat erschöpft, füllten sie ihre Flaschen mit Schnee und ließen sie in den weiten Ausschnitt ihrer Pelze gleiten.
Bei der Vorstellung, dass das eiskalte Glas den nackten Körper berührte, schauderte John.
Inzwischen brachte Orwo den von Kapitän Grover sorgfältig gefüllten Vorratssack und öffnete ihn. Durch Zeichen bat er John, etwas auszusuchen. John entschied sich für ein Butterbrot mit Pökelfleisch und ein Stück Zucker.
Armol und Toko, die ihre Arbeit beendet hatten, traten näher und verfolgten gespannt die Fütterung des weißen Mannes.
»Was er für Zähne hat!«, begeisterte sich Armol. »Weiß und scharf wie ein Hermelin.«
»Ja«, meinte Toko. »Wenn man so einem zwischen die Zähne gerät, kommt man nicht wieder los.«
»So einer zerbeißt nicht nur Knochen, sondern auch Eisen«, fügte Armol hinzu.
John verging der Appetit – er fühlte sich schwach und beschämt.
»Ihr solltet weggehen«, bedeutete Orwo leise den Kameraden. »Ihr habt wohl noch keinen Menschen essen sehen? Er schämt sich vor uns.«
»Auch gut«, fügte sich Toko. »Komm, wir gehen«, rief er dem Kameraden zu. »Lassen wir den weißen Mann essen.«
John warf Orwo einen dankbaren Blick zu. »Thank you!«, sagte er und schluckte den letzten Bissen hinunter.
»Yes! Yes!«, nickte Orwo. »Es geht weiter«, fuhr er auf Tschuktschisch fort. »Bis zur Nacht müssen wir den Gebirgszug erreicht haben. Bei Ilmotsch werden wir im Warmen übernachten und uns an Rentierfleisch satt essen.«
Plötzlich verspürte John unerträglichen Durst. Vom trockenen kalten Lunch waren ihm Mund und Kehle wie ausgedörrt.
»Trinken«, sagte er, wobei er Schluckbewegungen andeutete und den Kopf zurückwarf.
Sofort fasste Orwo in den Ausschnitt nach der gleichen kleinen Flasche, wie sie seine Kameraden in Gebrauch hatten, entfernte mit den Zähnen den Pfropfen – einen schmutzigen Stofffetzen – und hielt sie dem Verletzten bereitwillig hin.
John verzog das Gesicht und kniff die Augen zusammen, ehe er den Flaschenhals an die Lippen setzte und keuchend mit gierigen Schlucken das warme Wasser trank. Dabei musste er alle Willenskraft aufbieten, nicht daran zu denken, dass diese Wärme vom Körper des alten Gespannlenkers stammte. Als er die Flasche absetzte, sah er Orwos breites und flaches Gesicht lächelnd vor sich, das dem stilisierten Porträt des Eskimos im Nationalen Universitätsmuseum in Toronto überraschend ähnlich sah.
Auch John lächelte dankbar. Etwas regte sich in ihm, das seinem Lächeln alles Gekünstelte und Konventionelle nahm und es aufrichtig und herzlich machte.
Die Lenker nahmen ihre Plätze wieder ein, und die Hunde zogen die Gespanne auf das Gebirge zu, das einen breiten Streifen des Horizonts mit seinen gezackten Gipfeln bedeckte und unerbittlich näher kam. Immer stärker, wie von unsichtbarer Riesenkraft verdichtet, leuchtete ringsum das Blau.
Blau schimmerten der endlose Schnee, blau die Hügel, die Anhöhen und Schneewehen und auch der Himmel mit seinen hell blinkenden Sternen und die Schlittenspuren, Hunde, Zugriemen und Tokos iltisfellumrahmtes Gesicht.
4
In der einbrechenden Dunkelheit, die alle Geräusche dämpfte, im rhythmischen Geschaukel der Hundeschlitten und bei dem anheimelnden Knarren der Riemen träumte John vor sich hin. Er dachte an die Heimat im letzten Herbst mit dem flammend bunten Ahornlaub, und längst Vergessenes erhielt Symbolkraft und erfüllte ihn mit ungeahntem Glück.
Ein schmaler Graspfad führte in eine schattige Gartenecke, die sich trotz kärglichen Baumbestandes stolz »Städtischer Park« nannte. Im Gras stand eine bunt bemalte Schaukel, auf der John und Jeannie, allen abfälligen Bemerkungen der Kinder hütenden Mütter zum Trotz, so gern schaukelten. Wenn sie den Kindern schließlich ihren Platz räumen mussten, legten sie sich ins Gras und beobachteten stundenlang die sich tummelnden Eichhörnchen.
Der Klang eines Hornes rief sie dann in die Wirklichkeit zurück. Der Vater hatte in eine Seemuschel geblasen, um die Hausgenossen zum Dinner zu sammeln.
Als der Weg merklich bergauf ging, stiegen die Lenker ab, um die Kräfte der Zugtiere zu schonen, jetzt bildete Toko wieder den Schluss der Karawane. Die Hand am Schlittenhorn, ging er neben seinem Gefährt her. Gern hätte er sich, als er im tiefen Schnee des Hanges versank, wenigstens mit einem Fuß auf die Kufen gestellt, um das klopfende Herz mit tiefen Atemzügen zu beruhigen.
Beim Anblick des träumenden weißen Mannes im bequemen Schlittenbett beschlich Toko dumpfe Gereiztheit. Er kämpfte gegen dieses Gefühl nicht an, er sagte sich auch nicht, dass da ein unglücklicher, kranker Mann auf dem Schlitten ruhte und dass sein Leben in ihrer Hand lag. Müde, hungrig und gereizt sah er in ihm nur die Ursache aller Mühsal. Toko dachte an die kräftigen weißen Zähne, die krachend den harten Zwieback zerbissen, an die weiße Kehle, durch die er gierig das Wasser geschluckt hatte, an die kalten blauen Augen und die Andeutung eines Lächelns … Doch alles verdrängte der Glanz der Winchesterbüchse, die sein Leben würdig wie das eines echten Mannes machen würde. Kein Wild würde ihm mehr entgehen, und er brauchte sich nicht mehr zu schämen. Mit einer guten Winchesterbüchse konnte man den Polarfuchs in der Tundra erlegen. Für ein scharfes Auge war es leicht, in den verschneiten Weiten den Polarfuchs auszumachen, der eine Mäusespur verfolgte. Mit einer Winchesterbüchse würde er bis zum Frühjahr drei Dutzend Polarfüchse erbeuten, sie gründlich gegerbt in den kalten, trockenen Wind gehängt haben, der ihr weißes Fell noch weißer und flaumiger machte.
Wenn dann das Eis zurückwich und in der Ferne die Segelschiffe der weißen Männer auftauchten, konnte man im Hochgefühl der hinter einem herwehenden weißen Schwänze ruhig zum Ufer hinabgehen. Wenn sich der Händler dann mit gierigen Augen in die Fuchsfelle verkrallt hatte, konnte man genug Tabak verlangen und eine Tabakspfeife, ein Messer und Glasperlen für die Frau.
Vielleicht aber wartete man überhaupt nicht auf die Ankunft eines Schiffes, sondern machte sich mit dem Hundeschlitten auf den weiten Weg nach Irwytgyr, zur alten Siedlung Uellen. Händler Carpenter, der dort wohnte, war fast zu einem Menschen geworden: Er hatte eine Eskimofrau geheiratet und Kinder mit ihr gezeugt. Er handelte gut und gerecht und versuchte nicht, einem Mann aus der Tundra unnötiges Zeug aufzuschwatzen.
Ja, eine Winchesterbüchse war eine gute Sache. Dafür lohnte es sich, mit dem weißen Mann in die Ferne zu fahren, um ihn nach Anadyr zu bringen.
In der zunehmenden Dunkelheit konnte John Tokos erhitztes, erschöpftes Gesicht, umrahmt von der dichten Iltisfellmütze, kaum noch erkennen. Armol, der an der Spitze fuhr, feuerte schreiend und mit der Peitsche knallend die Hunde an. Mühsam und keuchend stimmte von Zeit zu Zeit Orwo, für John unsichtbar, in die Rufe ein.
Obwohl es immer noch bergauf ging, stürmten die Hunde plötzlich los. Unter dem Gewicht des aufsitzenden Orwo spannten sich knirschend die Riemen. Immer schneller wurde die Fahrt.
In der Schneewolke, die der Bremsstock zwischen den Kufen aufwirbelte, flitzte Armol vorbei. Obgleich er mit voller Kraft bremste, stürmten die Hunde weiter, als hätten sie keinen langen Tagesmarsch durch die verschneite Tundra hinter sich.
Man hörte Menschenstimmen. Ein Unbekannter in einem langen Kasack aus grob gegerbtem Rentierleder eilte Orwo zu Hilfe, klammerte sich an die Schlittenhörner und bremste das Gefährt, bis er vor einer Jaranga hielt, die aus dem Nichts aufgetaucht schien.
Den Schmerz verbeißend, reckte John den Kopf aus der Deckung und schaute sich neugierig um. Die Jarangas sahen ganz anders aus als die Bauten an der Küste; sie waren kleiner und ohne Holzwände. Das aus zahlreichen kurz geschorenen Rentierfellen zusammengenähte Dach ging unmittelbar in die Wände über. An seinen Rändern war es mit großen Steinen beschwert und zur Sicherheit mit festgestampftem Schnee umgeben. Die langen hölzernen Stangen, die das Gerüst der Jaranga bildeten, ragten aus der Mitte des Daches, über dem anheimelnd Rauch aufstieg.
Das Nomadenlager der Rentiertschuktschen, von dem John schon gehört hatte – einen von ihnen hatte er in Enmyn sogar zu Gesicht bekommen –, war erreicht. Jener Tschuktsche hatte sich nicht entschließen können, an Deck zu gehen, und hatte das Treiben der weißen Männer lieber aus der Ferne beobachtet. Obwohl er weder aus seiner Neugierde noch aus seiner Verwunderung einen Hehl machte, schien er etwas ängstlich zu sein.
Anders diese Rentierleute. Nachdem sie ein paar Worte mit den Ankömmlingen gewechselt hatten, umringten sie Orwos Schlitten und betrachteten den Verletzten.
»Sitzt da wie ein erfrorener Rabe«, sagte einer.
»Und diese Wolle im Gesicht.«
»Wie weiß sein Schnurrbart ist!«
»Das ist doch Reif.«
»Eingemummelt wie ein altes Weib.«
»Macht, dass ihr fortkommt!«, schrie Orwo die Aufdringlichsten an.
John, der kein Wort verstand, spürte, dass man sich über ihn lustig machte.
Hass stieg wie eine dunkle Wolke in ihm auf. Er dehnte die vom langen Sitzen steif gewordenen Muskeln, richtete sich auf und stellte sich auf die Beine. Dass er sich ohne fremde Hilfe bewegen konnte, hätte ihn fast zu einem Freudenruf veranlasst. Doch er beherrschte sich, lächelte nur triumphierend und machte mit vor Schwäche zitternden Beinen einige unsichere Schritte.
»Sieh da, er geht!«, rief Toko überrascht.
Als er John in die Augen blickte, sah er in ihrem kalten Blau ein warmes Licht, wie das einer Tranlampe, die, in den Uferfels gehauen, Jägern und Wanderern durch die Schollenberge den Weg zur Küste weist.
Es war der Blick eines Menschen, der erschöpft das lang ersehnte Ufer erreicht und die Brust dehnt, weil er wieder festen Boden unter den Füßen hat … Es war der Blick eines Menschen, der zum ersten Mal wieder Freude empfindet.
Toko lächelte ihm zu.
Die bandagierten Hände vorgestreckt, folgte ihm John zum Eingang der Jaranga, der so niedrig war, dass sie sich tief bücken mussten. Schon von Weitem hatte er den anheimelnden Geruch des warmen Rauches wahrgenommen. Die Hütte war mit ihrem Dunst von Wärme und Rauch wider Erwarten wenig verräuchert. Der Rauch erhob sich über der Feuerstelle, ballte sich unter der kuppelartigen Felldecke und entwich dann durch eine Öffnung, die den Blick auf den dunklen Abendhimmel freigab.
Im Inneren der Behausung hieß ihn Orwo auf einem niedrigen Sitz, einer langen, mit Rentierfellen bedeckten Bohle, Platz nehmen. Der Sitz war unbequem, und John rückte mehrmals hin und her, um eine bequemere Stellung zu finden.
Unweit vom Eingang der geräumigen Jaranga brannte ein helles Feuer, das den Raum gut erleuchtete. In einem großen rußgeschwärzten Kessel, der anscheinend aus Übersee stammte, brodelte über der Feuerstelle eine Suppe. Trotz des scharfen Rauchgeruchs nahm der ausgehungerte John den Duft gekochten Fleisches wahr.
Zwei Frauen, bis an die Hüften nackt, hantierten beim Schein der Flammen. Mit ihren schmalen glänzenden Schultern, der entblößten Brust und dem langen, ins Gesicht fallenden, zottligen schwarzen Haar erinnerten sie an Nixen. Sie trugen weiche Fellhosen und ebenfalls aus Fell gefertigte, bestickte Schuhe.
Mit einem erschreckten Blick auf John begannen die Tschuktschenfrauen zu tuscheln. Sicherlich war von dem seltsamen Gast die Rede, den sie von Zeit zu Zeit prüfend musterten. Ringsumher an den Wänden lagen Säcke aus Rentierleder, offensichtlich zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, hölzerne Gefäße und Ballen mit Rentierfellen. In einer Ecke sah man einen Haufen frisch abgezogener Rentierläufe, von denen noch die Sehnen herabhingen, und einen enthäuteten Rentierkopf, wohl zur Mahlzeit bestimmt, mit trüben, glasigen Augen.
Angeekelt wandte sich John ab. Im dünnen Rauch der Feuerstelle hingen Rentierschinken an den Querbalken unter der Decke.
Hinter seinem Rücken befand sich der durch Rentierfelle abgeteilte quadratische Schlafraum; bis auf eine erloschene Tranlampe war er leer.
Neugierige erschienen am Eingang, zuerst die Kinder. Ohne die winzigen Knopfnasen und oliv schimmernden kleinen Augen hätte man sie in ihren Pelzen und pelzverbrämten Kapuzen für Bälle halten können. Immer wieder drängten die Erwachsenen sie zurück, vor allem Frauen, die den Kopf durch den Eingang steckten und die Hausfrau irgendetwas fragten. Dabei hatten sie aber nur John im Auge, den sie im Schein des Feuers betrachteten.
Von draußen hörte man Männerstimmen. Orwo, Armol und Toko traten ein, gefolgt von fremden Männern, vermutlich den Bewohnern des Nomadenlagers. Während Toko den Sack mit Johns Lebensmittelvorräten auf dem Rücken schleppte, trug Orwo dessen Seemannskiste.
»Wir werden hier schlafen«, wandte sich Orwo an John. »Wind kommt den Berg herunter, es gibt schlechtes Wetter.«
»Ich muss mal hinaus«, murmelte John.
Zunächst verstand Orwo den Sinn seiner Worte nicht, sodass John sie mehrmals wiederholen musste.
»Da ist nichts zu übersetzen, ich verstehe, was er meint«, sagte Toko und bedeutete John, ihm zu folgen.
Gemeinsam standen sie in der Stille unter dem sternenübersäten unermesslichen Himmelsgewölbe. John hätte nie gedacht, dass Sterne so groß und strahlend sein konnten. In ihm von Kindheit an vertrauten Bildern geordnet, leuchteten sie vom Firmament. Den Blick zum Himmel gerichtet, bemühte sich John, Tokos kalte Finger nicht zu beachten. Er grübelte darüber nach, um hier zu überleben, müsse er sich überwinden und lernen, sich in den Geisteszustand dieses Wilden zu versetzen, der mit einer so einfachen Sache wie der eines Hosenknopfes nicht fertig wurde.
Toko, der halblaut vor sich hin redete, schien zu fluchen. Doch John brauchte gar nicht hinzuhören, denn er verstand ihn sowieso nicht.
Endlich hatte es Toko geschafft. Wozu die vielen Knöpfe, wo ein einziger ausreichte, dachte er. Wahrlich, die Weißen waren knauserig, wo sie großzügig sein konnten, und verschwenderisch, wo es nicht angebracht schien. Toko machte Johns Pelzmantel zu und blickte zu seinem Träger auf. Mit zurückgeworfenem Kopf starrte dieser zu den Sternen empor, die sich in seinen kalten Augen spiegelten. Seltsam traurig sah er aus, als hätte er sich in einen anderen verwandelt, während Toko an seinen Knöpfen hantierte. Rätselhaft wie ein Schamane erschien er Toko, der ihm beunruhigt einen leichten Stoß versetzte.
Der weiße Mann fuhr zusammen, und Leben kehrte in seine Augen zurück. Die wenigen Worte, die er an Toko richtete, hörten sich an wie ein Dank.
Wieder in der Hütte, forderte Orwo John auf, die Schlafkammer aufzusuchen, deren Vorderwand, eine Felldecke, bereits herabgelassen war, sodass John hineinkriechen musste.