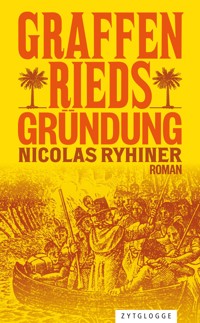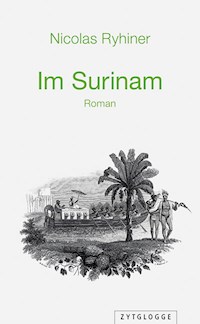
25,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sklavenhalter, Bürger, Bigamist Der Basler Handelsherr und Plantagenbesitzer Johann Rudolf Ryhiner erschiesst sich am 29. Juli 1824 in seinem Sissacher Landgut Schloss Ebenrain. Ihm droht eine Anklage wegen Bigamie, die nach geltender Rechtsprechung mit lebenslangem Zuchthaus bestraft wird. Er sieht Ruf und Leben zerstört. Als junger Mann hat er in Surinam Plantagen aus dem Familienbesitz übernommen. Die goldenen Zeiten des Kolonialismus neigen sich jedoch ihrem Ende zu, ein Verbot des Sklavenhandels steht unmittelbar bevor. Umtriebig versucht sich Johann Rudolf den neuen Zeiten anzupassen. Als er schliesslich ins heimatliche Basel zurückkehrt, ist dort nichts mehr, wie es war. Er baut neue Geschäfte auf, heiratet standesgemäss und ist respektierter Bürger. Dass er in Surinam bereits verheiratet ist und dunkelhäutige Kinder hat, kann er lange verbergen. Ausgehend von der dramatischen Nacht des Freitodes erzählt der temporeiche und atmosphärisch dichte Roman das Leben Johann Rudolfs rückwärts und zeichnet ein Sittenbild der Basler Oberschicht im frühen 19. Jahrhundert. Virtuos erzählter Roman nach historischen Begebenheiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Der Roman erzählt die Geschichte rückwärts. Ausgehend von der Nacht vor der unausweichlichen Selbsttötung des Handelsherrn und Plantagenbesitzers Johann Rudolf Ryhiner am 29. Juli 1824 auf seinem Landgut Schloss Ebenrain zu Sissach. Schritt um Schritt rückwärts, zu den Weggabelungen seiner verhängnisvollen Lebensreise, von Basel nach Surinam an die Küste Guayanas, und zurück, ins Land seiner wohlbehüteten Kind-heit, von wo er einst, angelockt von den Verheissungen der fremden Welt, auszog ein anderer zu werden.
Ein temporeicher, virtous erzählter Roman nach historischen Begebenheiten. Das Basler Bürgertum vor dem Hintergrund der Kolonialgeschichte des frühen 19. Jahrhunderts
NICOLAS RYHINER
IM SURINAM
Der Autor und der Verlag danken herzlichfür die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2019 Zytglogge Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Coverbild: Albert von Sack: Beschreibung einer Reise nach Surinam und des Aufenthaltes daselbst in den Jahren 1805, 1806, 1807 so wie von des Verfassers Rückkehr nach Europa über Nord-Amerika nebst einer zweiten Reise dahin 1810-1812. Haude und Spener, Berlin, 1821, Universitätsbibliothek Basel.
e-Book: mbassador GmbH, Basel
ISBN epub: 978-3-7296-2272-2
ISBN mobi: 978-3-7296-2273-9
www.zytglogge.ch
Nicolas Ryhiner
Im Surinam
Roman
Für Béatrice
Sissach, d. 4. August 1824.
Am Donstag kam ich um 3 Uhr nachmittags von der in Zunzgen gehaltenen Vorkinderlehre nach Hause und vernahm gleich beym Eintritt in dasselbe von meinem Töchterlein: Herr Ryhiner auf dem Ebenrain habe sich in seinem Zimmer erschossen. Ich konnte u. wollte erst dieser Nachricht keinen Glauben beymessen; als aber ich derselben gewiss versichert war, lief ich, laut wehklagend und jammernd, die Treppe hinauf. Ich begab mich sogleich zum Herrn Bezirksphysikus Heinimann und von da zu Herrn Statthalter Forcart, um bestimmte u. genaue Erkundigung über diesen erschütternden Vorfall einzuziehen. Das Visum et repertum der Ärzte hörte ich ablesen; niemand aber konnte sagen, was Herrn Ryhiner zu diesem entsetzlichen Entschluss gebracht. Und so steht es in Hinsicht der Beweggründe noch bis auf den heutigen Tag. Nur so viel weiss man, dass er 6–8 Wochen vorher in eine finstere Schwermuth verfallen war, in welcher ihm alle seine vorigen Liebhabereyen verleidet waren. Man schrieb es aber seiner Unpässlichkeit zu und dachte nicht von ferne an das, was geschehen ist. Hingegen sagte mir Freund Theophile Passavant: er habe 6 Wochen vorher Herrn Ryhiner gesprochen und nachher seinem Vater gesagt: es wundere ihn nicht, wenn Herr Ryhiner sich selbst entleiben würde.
Am Freitag früh ersuchte mich Herr Hauptmann Ryhiner, Onkel des Verstorbenen: ich möchte bey seinem Leichenbegängnis beym Grabe ein Wort des Trostes sprechen. Ich antwortete, ich dürfe diesen Auftrag nicht übernehmen, ohne vorher mit Herrn Antistes gesprochen zu haben, worauf ich mich sogleich auf den Falkenrayn begab.
Herr Antistes Rath ging dahin: mich keineswegs zu weigern, ein Gebet um Trost in dem Leidhause zu halten, weil diess heilige Pflicht des Seelsorgers gegen die am Verbrechen des Selbstmordes ganz Unschuldigen und Trostes bedürftigen Hinterlassenen sey. Herr Hauptmann Ryhiner schien auch ganz zufrieden mit diesem Entscheid des Antistii zu seyn. Freund Passavant kam noch Nachts 10 Uhr zu mir. Ich las ihm mein eben ins Reine gebrachte, 4 Octavseiten eng geschrieben enthaltendes Gebet vor. Er billigte es ganz und erklärte es für tröstlicher als das seinige, das er auf den Fall verfertigt hatte, wenn ich mich weigern würde, ein Gebet zu halten.
Um halb 4 Uhr früh bey der Morgendämmerung war ich nebst sämtlichen Autoritäten und einigen anderen Einwohnern von hier abgeredtermassen schon auf dem Ebenrain und durfte nicht lange warten, so war alles in Ordnung. Ich verlas nun, vor einem Tisch mit 2 Lichtern stehend, im Sommerhaus, bey offenen Thüren, in Gegenwart der Verwandten, der die Leiche begleitenden Einwohner, der 15 um den Sarg stehenden Trägern und des Dienstpersonals mein geschriebenes Gebet. Es herrschte feyerliche Stille und allgemeine Rührung während demselben. Da nur wenige Personen die Zeit des Leichenbegängnisses erfahren hatten, so liess sich unterwegs u. auf dem Gottesacker fast kein Mensch blicken. Herr Statthalter hatte befohlen, dass man Herrn Ryhiner in der Kirche begraben solle und wohnte selbst dem Grabmachen bey. Er liegt jetzt zwischen 2 Kindern. Zum Glück traf die Reihe gerade den hintern Kirchhof, über welchen kein gangbarer Kirchweg führt.
Frau Ryhiner, die sich jetzt in ein Bad bey Thun für einige Wochen begeben hat, schikte mir gestern Hundert Neuthaler für den hiesigen Armenseckel. Überhaupt hat sie und ihr unglücklicher Mann sich immer sehr wohltätig gegen die hiesigen Armen bewiesen, so dass H. Ryhiner von denselben, so wie überhaupt von den Leuten hiesigen Orts, denen er viel zu verdienen gegeben hat, sehr bedauert wird.
Am gleichen Samstag hatte ich auch um 10 Uhr 2 alten Witwen, die zusammen 167 Jahre gelebt haben, die Leichpredigt zu halten. Ihr Grab konnte an einem von Herrn Ryhiner etwas entfernten Orte gemacht, welches ihren hinterlassenen Kindern sehr lieb war.
Hiermit schliesse ich mit Bitte um euere Fürbitte für Euren armen
D.B.
Aus den Pli-Briefen von Daniel Burckhardt-Linder,
Pfarrer in Sissach von 1812–1833.
PROLOG
Vorhang auf! Nennt mich Vater, und ihr werdet sein meine Kinder fortan – wie die Herrnhuter Pfaffen, die elenden Seelenfänger, die Missionare kennen sich aus bei den Negern. Sie sollen Vater zu mir sagen, pater noster, das ist besser als Sir. Respekt sollen die Sklaven vor mir haben. Respekt, von allem Anfang an. Ich werde ankommen auf meiner Plantage und euer Vater sein. Nennt mich Vater! Auch wenn ich ein junger Schnösel bin aus Basel. Und Johann Rudolf Ryhiner heisse. Euer Vater, und wenn ich weiss bin und ihr alle schwarz.
Kotzübel war mir bei der Überfahrt, sterben wollte ich, bevor ich überhaupt erst ankam – aber dann wird’s grünlich, das Meer, das vorher blau war, der lange Streifen von Guyanas dunklen Wäldern zeigt sich, der Wind lässt nach, man setzt die grossen Segel, Schwärme roter Flamingos ziehen über die Küste, Schmetterlinge kommen an Bord, Wohlgerüche von Millionen Blüten – alles weg, alles vergessen, was beschissen war bisher im Leben, alles neu, alles mein, alles gross.
Die Mündung der beiden Flüsse, der breite Strom, Delphine mit rosa Bäuchen und überall die farbigen Barken mit den nackten Rudernegern. Weisse Häuser, und die Mühlen mit dem langen Schornstein, versteckt unter dichtem Gewächs, Zuckerplantagen, Kaffeeplantagen an allen Ufern, gleich dahinter fängt der Urwald an. Träge Fluten, die Mündung vielleicht eine Viertelstunde breit. Weg ist die Eiszeit, weit weg der zugefrorene Rhein, das Grau, das ewige Grau meiner Vaterstadt. Meiner zugeknöpften Jugend.
Mein Vater, beerdigt, im Apothekerhimmel wird er schweben, bei seinen wohlanständigen Freimaurern, den wohltätigen, wohlwollenden, allwissenden. Zu dir werd ich es wohl nicht schaffen, heute Nacht, in deinen Himmel, wenn ich mir gleich die Kugel durch den Kopf jage.
Mehr Brennholz, Hänsler, viel mehr Brennholz! Hörst du, Hänsler, was ich befehle? Her mit den Scheiten, gib ihm Zunder, heute wird der Ofen eingefeuert, dass es bollert und lodert und kracht, ja, auch wenn es Juli ist, in den hundigen Hundstagen dieses vermaledeiten Jahres Vierundzwanzig und eine laue Nacht ist, mir ist kalt. Seit ich zurück bin, hier im Land der Väter, frier ich mir den Arsch ab, Hänsler, verstehst du? Bring ein ganzes Ster herauf und heize tüchtig jeden Ofen ein im Haus! Ich friere! Hänsler, wird’s bald? Gleich hol ich den Ochsenziemer und versohle dir das Fell, du Krüppel, wenn du nicht vorwärts machst, Hänsler, ich jag dich noch zum Teufel, du Nichtsnutz, und wenn es meine letzte Tat ist, dann kannst du klagen beim Gericht, ja, das ist modern, das Klagen, das Gesinde klagt und das Schiedsgericht, das gerechte, fällt dann ein Urteil zu deinen Gunsten und zu deinem neuen Recht, wie im Fall des alten Gärtnerehepaares, den unflätigen Lupsigers, es richtet und stellt fest, der grausame Herr vom Ebenrain zu Sissach habe die armen Entlassenen viel zu hart und – wie in den Prozessakten festgehalten – «nach amerikanischen Grundsätzen zu behandeln können geglaubt». Frechheit. Und der Patron wird genötigt, dir für deine Untauglichkeit noch 15 Louisdor zu zahlen.
Neue Zeiten, neues Recht. Ich stimme dem ja zu, zum Teil, ich bin kein Unmensch. Ich weiss, es ziemt sich nicht, Rousseau, Voltaire, und so weiter, und so fort. Bewaffnete Neutralität und des Volkes Wille, das ist die neue Formel. Ich bin kein Politiker. Früher stand bei der Linde, am Ende des Parks der Galgen, beim Glünggisbühl wurde Gericht gehalten und der Henker waltete seines Amtes. Aber das war lange vor meiner Zeit, und auch vor deiner, Hänsler, es soll ja gut sein, so wie es ist. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Ich bin kein Lateiner, aber der Spruch wird einem ja eingetrichtert, im humanistischen Gymnasium auf Burg, den werd ich nie mehr los, ich war ein schlechter Schüler, habe Latein gehasst, Mathematik geschwänzt und nichts studiert, ich bin zur Schande meines Vaters kein Akademiker geworden, habe zu seinem Verdruss die Apotheke meiner Vorväter am Fischmarkt nicht übernommen, war der Schreck der Basler Gesellschaft, ich hab mich schlecht aufgeführt und war vorlaut, wie es hiess.
Nicht wie Jakob, mein grosser Bruder. Der hätte die Apotheke übernommen. Wenn er gelebt hätte, wenn … Ich hab stattdessen Karten gespielt. Und brav gewartet bis zu meiner Volljährigkeit und auf Vaters Tod. Statt wie Jakob zu studieren, wenn er nicht gestorben wäre, als ich zur Welt kam. Wenn.
Ich hab mich, gehorsam wie ein guter Sohn, in Handelshäusern kundig gemacht, bin Kaufmann geworden, bevor ich aufbrach in die Neue Welt. Da hat man einträgliche Plantagen, Hänsler, hörst du. Geerbt von Mutters Faesch’schen Seite, in Surinam, und keiner kümmert sich darum, keiner fährt hin, verstehst du, zu unkommod, zu viel der Anstrengung, zu fremd, das Ganze, jeemerli, jeemerli. Und dann das Sklavenproblem, jeemernaiau, wir als gute Christen, ist das noch zu verantworten, heutzutage, mit dem humanistischen Gedanken und den Engländern? Ja, ich kann’s ja nachvollziehen, mit all den Abolisten überall, die werden den Sklavenhandel wohl bald ganz aufheben. Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen, und ja, es lebt sich ja ganz anmutig im Surinam, aber doch lieber hier in den Schorenmatten auf dem Landgut mit dem Namen Zum kleinen Surinam, ach wie kummlig, direkt vor den Toren der eigenen Stadt, verstehst du, im Surinam, das man, wohlbemerkt, aus den Erträgen aus Übersee finanziert.
Und dann die Aufstände, sagen sie und machen sich in die Hosen, man kann doch nicht mehr, wie zu alten Zeiten, wie der alte Faesch, einfach durchgreifen und die Neger köpfen, wenn sie fliehen wollen? Sagt ja keiner mehr, man soll sie köpfen, verstehst du – und nein aber auch, das feuchte Klima und die Schlangen, die Seekrankheit, das Tropenfieber und die vielen Mücken, pfui Teufel!
Aber vorbei ist vorbei, jetzt ist eh alles aus, Hänsler. Ich hab das Spiel verloren. Obwohl ich gute Karten hatte. So ist das Leben. Es hätte anders kommen können. Aber hier ist, was jetzt ist. Alles was ich dir jetzt sage, hätte anders sein können, ich setze das, Hänsler, verstehst du, dies ist eine Setzung, wie bei Kant, sagen die Akademiker, wenn sie besoffen sind.
Hier, nihilo trotzquam, die Geschichte: Der fiese V. spielt dabei den Judas. V., genannt der Pfau. Pokulieren mit Studenten, Künstlern, Musen, man zieht durch die Gassen, endet im Drei Könige am Rhein, frühmorgens bin ich voll, kann nicht mehr gehen. V. nimmt ein Zimmer im Gasthaus, schleppt mich rauf, legt mich aufs Bett und zieht mich aus, zieht mir die Hose runter und will mich küssen. Ich hau ihm ordentlich die Faust ins Gesicht, damit er merkt, ich bin kein warmer Bruder wie er einer ist, und sag ihm alle Schande. Er setzt sich an den Bettrand und heult sein Elend in die Nacht. Ich schlafe ein, er zückt sein Skizzenheft, zeichnet mich schamlos im Geheimen, schlafend, nackt und wehrlos ab. Er zeigt die Blätter in der Folge jedem, der sie sehen will, man lacht sich über mich den Buckel voll in Basel.
Ein paar Jahre später wird er dann, weil er’s auf die Spitze treibt mit seiner Herrenreiterei und dem weibischen Getue, von der Familie fortgeschickt, auf ausgedehnte Reisen nach Westindien, Amerika und Mexiko, mit seinem Skizzenblock, er ist ja wirklich ein sehr begabter Zeichner, aber Päderasten will man keine in unseren Kreisen, besonders wenn sie auffällig werden. Tunichtgute schickt man in die Kolonien, dort sollen sie machen was sie wollen. Das war immer schon so, seit es die neuen Länder gibt.
Nicht aber bei mir, Hänsler, nicht in meinem Fall. Ich musste meine Setzung machen auf dieser Welt, ich hatte Anspruch auf meine eigene Setzung, verstehst du. Nicht erobern, die Welt, nicht neu erfinden, aber setzen, meinen eigenen Anteil hineinsetzen. Wie beim Kartenpiel. Meine Runde. Mein Einsatz. Mein Risiko. Und ich hab’s versaut, das Leben, mit meinem Spiel. Ich hab verloren. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Rien ne va plus.
Bring mehr Brennholz, Hänsler – ich komme also an, wie gesagt, Schwärme von kleinen Delphinen mit rosa Bäuchen, und so weiter und so fort, erste Mückenstiche, naturgemäss, und die schwüle Luft, die schweren Düfte, die grosse Hitze, ich streife meinen Rock ab und ziehe meinen Hut, Paramaribo! Ja, Paramaribo! Stehe in aufgewühlter Stimmung an Deck, im blossen Hemd: Endlich, das Land meiner Sehnsucht! Hier beginnt die Unendlichkeit. Ich rauche meine erste Zigarre in den Tropen.
Man geht vor Anker. Eine Viertelstunde flussaufwärts, majestätisch, in buntfarbiger Kajütenbarke, reiches Schnitzwerk, Vergoldungen, mit Jalousien an den Fenstern. Acht Ruderneger in Livree, hoo-hiss, hoo-hiss. Die Häuser am Ufer stehen erhöht auf Stelzen, die meisten aus Holz, wenige aus Backstein, meist perlenfarbig, die Läden und Türen gefirnisst in grün, Baumriesen erheben sich dahinter, Melonenbäume, übersät mit duftenden Blüten, Kokospalmen, das Hinterland ist fruchtbar und satt, man ahnt sie, die unendlichen Wälder, von fern das Geschrei der Affen, die Rufe der tropischen Vögel.
In einer kleineren Barke geht’s weiter, vorbei an der Siedlung, wo aller Wald ausgerottet ist: Sieht fast ein wenig aus wie in einer reichen Gegend Hollands, so musst du dir das vorstellen, Hänsler, wenn nicht die exotischen Gewächse und die schwarzen Sklaven die Illusion stören würden. Die letzte Etappe der Reise, am rechten Ufer des Flusses Commewijne entlang, bei der Mündung, jetzt also dem Ziel entgegen: Meine Plantage Charlottenburg.
Gezirp von Grillen, es sirrt die Luft. Die Allee mit den Zitronen- und den Orangenbüschen, die Pampelmusebäume, das Wohn- und das Gästehaus, wie beschrieben in den Briefen, und dennoch weit anmutiger anzusehen in Wirklichkeit als auf den Skizzen meines Direktors, dem alten Haudegen Bödeker, der mich schon erwartet mit seinem Willkommenstrunk.
Bödeker, danke für die Ehrerweisung, ganz meinerseits, die Ehre, endlich die Gelegenheit zu haben, Sie kennenzulernen, in persona, quasi. Deutschen Riesling hätte ich hier zuletzt erwartet, beim Gehalt von 5000 Livres jährlich, die er von uns verlangt, allerdings nicht unbedingt erstaunlich, wie ich meine, nicht wahr, Hänsler. Er scheint es etwas gênant zu finden, dass ich für’s Erste im Gästehaus unterzukommen wünsche, während er weiterhin im Haupthaus residiert – Keine Umstände meinetwegen, mein Bester. Man wird sehen, wie die Dinge sich in Zukunft entwickeln. Er weist mir seine schönste kleine Sklavin zu, die für mein Wohl zu sorgen hat, nebst einem Koch und einem weiteren Haussklaven.
Dann der abendliche Appell der Arbeitssklaven im Park. Meine kleine Rede zur Begrüssung sprech ich in einer Art Neger-Englisch, es soll so klingen wie das Pidgin, das hier alle reden. Das Kirchenlatein der Kolonien. Call me Vater,you my black sons and dotters now. Das versteht doch jeder, Hänsler, nicht wahr? Call me Vater,you my black sons and dotters now. Seit die Investoren den Kolonialherren gleichgestellt sind, die Franzosen, die Venezier, die Schweizer, hat man sich auf dieses merkwürdige Kauderwelsch geeinigt. Seit die Briten die Kolonie besetzt haben, sowieso, vorher sprach man Holländisch. mijnheer statt Sir, verstehst du, Hänsler, mijnheer.
Mehr als die Hälfte der Weissen sind Juden aus aller Herren Länder, Sklavenhändler aus Tradition, aber auch Pflanzer, Siedler oder Krämer. 1 Weisser auf 40 Mohren, die eingeborenen Wilden nicht mit eingerechnet, da braucht es Truppen, Hänsler, um die Ordnung zu erhalten. Überall besoffene Soldaten, gelangweilte Offiziere, auf allen Wegen, auf allen Plätzen, in jedem Kaff, verstehst Du, Plage und Notwendigkeit. Gesindel jedenfalls, in Überzahl.
Als erstes beschaffe ich mir ein Pferd. Bei all dem Pack bin ich nur beritten unterwegs auf Inspektion von einer Plantage zur anderen. Ich pflege den Kontakt nur zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des Landes, das kennst du ja von mir, Hänsler, was? Sir Charles, Graf Bentinck suche ich als ersten auf, den Gouverneur, ein geistreicher Mann, er war es übrigens, der statistisch erheben liess, was hier die Anteile der verschiedenen Rassen sind. Ausserdem, nicht wahr, sind die Kontakte unter den Pflanzern hier merkwürdig rar. Man sondert sich ab, bleibt in seinem eigenen Reich. Argwohn, Misstrauen, Neid? Ich weiss es nicht, Hänsler. Dennoch ist Gastfreundschaft hier das Mass aller Dinge, verstehst du. Die Etikette besagt, dass jeder zu beliebiger Tageszeit auf einer Plantage erscheinen kann, du wirst freundlich empfangen, wirst fürstlich bewirtet, hast Anspruch auf ein Gastbett, und bleibst, so lange du willst. Aber genutzt wird das Recht nur selten. Auch das ist Teil der Etikette.
Und dann Belle, Hänsler, da ist Belle, meine kleine Servantin, ich nenne sie Belle, weil sie ein Bild von einem schwarzen Mädchen ist, mit ihren wulstigen Lippen, in der weissen Spitzenschürze, wie sie dasteht und knickst, mit ihren grossen Augen, wenn ich sie rufe, Bödeker hat ihr Manieren beigebracht, das muss man ihm lassen, sie ist allerliebst. Und jetzt, verstehst du, möchte ich nicht jeden Abend mit Bödeker verbringen und mich mit ihm auf der Veranda betrinken. Genever kippen bis zum Umfallen, jeden Abend. Er fängt schon am Morgen damit an. Ich halte ihn mir auf Distanz, so gut es geht.
So kommt es, dass ich mich mit Belle unterhalte, abends, ich bringe ihr das Kartenspiel bei, wir radebrechen und palavern miteinander, es gibt dabei viel zu lachen, Belle, anfangs, als sie in meine Dienste kam, ein erschrecktes, verschämtes Häuflein Elend, blüht auf, lacht verschmitzt und auf den Stockzähnen, wenn sie mir einen ihrer Scherze serviert, kurz, sie ist mir ans Herz gewachsen im Lauf der Zeit. Und das, Hänsler, gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Zu unterbinden. Abwürgen die Gefühle. Auch wenn ich in den Kolonien bin und tun und lassen kann, was ich nur will. Keiner macht mir hier Vorschriften, jeder Pflanzer hält sich eine Missi als Konkubine, eine schwarze Surrogattin, wie man sagt, kein Mensch dreht einem einen Strick daraus.
Der Sinn steht mir nach Höherem, ich bin aufgebrochen, mich in dieser neuen Welt zu behaupten. Belle, I go away long time. Jetzt pass auf: Sie bringt mir eine Schnur, ich solle so viele Knoten machen, wie ich Nächte fort sein würde. Was soll ich machen, Hänsler. Ich nehme die Schnur und schneide sie entzwei. So mache ich mich denn auf, den tiefen Dschungel zu erkunden, zu Fuss, nur mit meiner Flinte, in der ersten Zeit noch in Begleitung eines schwarzen Jägers, der mich führt, Mambo, flussaufwärts in den Urwald. Dann bald allein, auf mich selbst gestellt, um einzudringen ins grüne Herz der Finsternis, die Unendlichkeit zu suchen.
Das Meer ist mir fast zu offenkundig unendlich. Den Elementen ausgesetzt, bist du bei der Überfahrt nur der Passagier, du bist in einer Nussschale im ewigen Nichts, verdammt dazu, dich mit Gottvertrauen der Kunst des Kapitäns auszuliefern. Nicht im Dschungel. Von Anfang an, Hänsler, bist du auf dich selbst gestellt, stösst vor in die geheimen Tiefen des Daseins, hinein ins dunkle Innere der Welt.
Nächte in der Hängematte, im leuchtenden Schwarz aus Umbra und Blau, umgeben vom Duft der Orchideen, lange Bulben weisser Blumen im Geäst, liegst du schaukelnd über mannshohen Mimosen, unter dir im feuchten Dunst des Waldes Moose und Farne, liegst zugedeckt und eingewickelt in feines Tuch, um dich vor den Mückenschwärmen zu schützen, ob’s dich schaudert oder nicht, ist denen egal, die Nacht flirrt vom Lufttanz tausender kleiner Feuerfliegen, liegst da, lauschst dem Gezirpe der Zikaden, der Musik von ungezählten Kröten, dem Wehruf der Nachtvögel, rabengrosse Fledermäuse schwirren fiepsend um dich herum, du hörst den Schrei der Brüllaffen, der hallt und hallt wider, und manchmal durchbricht ein Donnergetöse das Rauschen, wenn ein alter Baum fällt, der morsche Stamm des Riesen durchs Geäst stürzt und das Buschwerk niederreisst, bevor er am Boden krachend auseinanderfällt.
Im Morgengrauen weckt dich das gellende Geschrei der Wackagos, dann hörst du schrill die Flötenrufe kleiner Vögel, bis zum Sonnenaufgang schwillt es immer weiter an, bei Tageshelle beginnt das höllische Konzert der Papageien und der Affen in den Wipfeln. Jagd und Tarnung, ich schlage mich also durch den dichten Buschwald, werde geplagt von Stichen, Bissen, Wunden von allerlei Gewürm und unbeschreiblichem Geziefer, aufgeschwollen und aufgedunsen die Haut, voller Blasen, Risse, Schrunden und eiternden Geschwüren, in der schwülen Hitze wate ich im Morast durch das Sumpfland oder rudere im Einbaum auf den Flüssen.
Fische gibt der Fluss in rauen Mengen her, kannst dir ja vorstellen, bei dem vielen Gewürm gedeihen die prächtig, nur vor den Piranhas muss man sich in Acht nehmen und vor den Alligatoren. Man isst, was Gott einem vor die Flinte schickt, Wild, Hänsler, gibt es in Hülle und in Fülle im Wald. Amardillos und Nasenbären, Wasserschweine, Hirsche und alle Arten von Federwild. Alles, was da kreucht und fleucht, kannst du essen, man kann auch Cabbiswürmer braten, daumendicke, fingerlange Würmer, eine Delikatesse, wohlbemerkt, wie das Fleisch von Schildkröten oder von gewissen Schlangen, wenn man sie zuzubereiten weiss.
Fressen und gefressen werden. Bleib wachsam, auch im Schlaf. Es lauert nicht nur der Jaguar in Schilfgras, es gibt auch menschliche Räuber, Hänsler. Wie oft erzählt man sich hier nicht die Geschichte vom Soldaten Willems, Willems verirrt sich im Busch, wird von Saramaccanern überfallen, entlaufenen Sklaven, die tief im Urwald wohnen, beim Häuptling findet man später die goldene Uhr des armen Opfers, der Mohr trug die Soldatenuniform am Leib, samt Kriegsmedaille. Er prahlt damit, ihn verspeist zu haben.
Diese Dörfer muss man meiden, auch um die Siedlungen der Indianer machst du besser einen weiten Bogen. Die Wilden und die Mohren stecken unter einer Decke hier im Busch, nur die Missionsstationen entlang der Flüsse sind sicher, die kann man ruhig aufsuchen, und die Judendörfer, natürlich auch die Forts und Posten der Briten.
Hänsler, bist du noch da, Kanaille? Ja, lass die Funken sprühen, dass es kracht in der Glut, mit dem Balg, mehr Zug, mach Wind! Eines Tages, gegen Ende der Trockenzeit im April, nach einem Bad im Fluss, hörst du, zieh ich am Ufer meine Kleider an, steig in meine Stiefel, und plötzlich an der Wade, ein stechender Schmerz, scharf, spitz, wie von einem Giftpfeil. Im Moment der ersten Schreckensstarre fühl ich am Bein ein Krabbeln und zugleich den zweiten Stich. Ich reiss den Stiefel vom Bein und seh eine Spinne, wie sie blitzschnell flieht, fingerlange Beine, von der Grösse einer Baumnuss ihr braungrauer Körper, und schon ist sie im Unterholz verschwunden. Kleine rote Wunden, wo sie zubiss, ringsum gelblich verfärbte Haut, ein Gefühl der Taubheit breitet sich aus, soll ich das Bein abbinden wie bei einem Schlangenbiss? Ein schier unerträglicher Schmerz strahlt bis zum Knie und hinauf das Bein, hoch zum Unterleib, zum Bauch, es rast das Herz, der Schweiss bricht durch alle Poren, es schwinden mir die Sinne, kann kaum mehr atmen, Tränen füllen meine Augen, kann nichts mehr sehen, bin blind, alles flimmert jetzt und flirrt, es wird mir sterbenselend, ich kann nicht kotzen, hab Muskelkrämpfe, es schüttelt mich wie im schlimmsten Fieber. Das hält der Mensch nicht aus, Hänsler. Es kann nur der Tod noch folgen, jetzt. Es geht zu Ende mit meinem Leben. Ich schnappe nach Luft wie ein Ertrinkender. Als nächstes wird es dunkel, ich liege da gelähmt, geplagt von Schmerzen am ganzen Körper. Es ist kalt, ich zittere. – Bist du das, Jakob?, frage ich. Wie bist du denn hierhergekommen? Und Vater, du, im Urwald? Nachts? Sind wir alle da, wir drei? Jakob hat die Apotheke übernommen, sagst du? Dann ist ja alles wieder gut. Und ich kann sterben. Ich hab ihm auf der Welt den Platz genommen, jetzt hat er sie für sich allein. Schön.
Ruhe finden kann ich trotzdem keine. Mag sein, vielleicht ist hier nicht der Ort dafür, es ist mir ja auch schrecklich peinlich, muss ich gestehen, und der Zeitpunkt ist sowieso der falsche. Das hat alles nichts mit Belle zu tun, glaubt mir, es war der Kuss der Spinne, es geht euch auch gar nichts an, im Übrigen. Ich habe noch ein Schamgefühl. Halt!, macht, dass ihr wegkommt, das geht zu weit, ich muss euch schon sehr bitten! Wo bleibt der Anstand, schaut nicht so! Ich lebe hier mein Leben, verschwindet jetzt, geht dorthin zurück, wo ihr hingehört, zurück nach Basel, ich bin dir keine Rechenschaft mehr schuldig, Vater, und dir schon gar nicht, Bruder.
Furchtbar, Hänsler, es ist wie beim Gehängten am Galgen, ich bin erregt und habe einen Steifen, und der tut weh, so weh! Ich spüre, wie vulkanisch alle Säfte steigen, niese, spucke, die Tränen fliessen, ein Krampf schüttelt mich, ich berste. Belle! Und du, Hänsler, steh nicht so rum mit deinen Glotzaugen, mach endlich Feuer.
Die ganze Nacht liege ich da, gelähmt, gekrümmt vom Schmerz und in Tränen, bis mich am Morgen ein Trupp Söldner auf Patrouille entdeckt.
Sie tragen mich auf einer Bahre, bringen mich ins Fort, wo mich ein Arzt mit Chinin und Morphin versorgt und mir die Wunden säubert. Man bringt mich zurück nach Paramaribo und auf meine Plantage. Ein Bett, mein Bett, mein Königreich für ein Bett. Schlafen, die ganze Regenzeit hindurch, nur schlafen!
Alles ist ausgedörrt, verwelkt die ganze Blumenpracht, nur noch weisse Kaktusblüten leuchten da und dort, die ihr Parfüm in der heissen Luft verströmen. Acht Monate ohne einen Tropfen Regen, die Binnenflüsse führen kaum mehr Wasser, die Palmen matt, mit welken Blättern. Fahles Licht kommt durch die Baumkronen, scheint unter den Bäumen, Risse im harten, staubigen Boden, die Luft scheint stillzustehen. In den Fenstern bewegen sich nicht einmal mehr die feinen Sassinetten hin und her. Nur die Wanduhr tickt. Hunde bellen.
Weisse Riesenwolken formen sich am Himmel und verhüllen das Abendlicht. Schwarze Strahlen, fächerförmig, leuchten aus der letzten Sonne. Mit dem ersten Donnerschlag platzt der Regen in grossen Tropfen aus der Wolkenwand und legt sich wie ein Kettenvorhang über das trockene Land, prasselt auf Wald und Höfe, pladdert wuchtig auf die Dächer. Jetzt kann ich endlich schlafen.
Als ich die Augen wieder öffne, Hänsler, steht Belle am Bett und reicht mir Tee. Ein leerer Blick und schaut zu Boden. Stützt mit den Händen das Kreuz und seufzt. Unter der Schürze zeigt sich deutlich eine Wölbung. Hänsler, Sie trägt mein Kind im Bauch. Sie knickst und geht zur Tür hinaus. – Belle? – Ja, mein Vater. – Ich bin nicht dein Vater. – Wer denn sonst, mein Vater? – Ich bin der Vater deines Kindes. – Ja. – Was soll aus ihm denn werden? – Ich weiss es nicht, mein Vater, was soll ich tun? – Wir werden sehen. Sie knickst und geht zur Tür. So plötzlich der Regen einsetzt, so plötzlich hört er auf. Nebelschwaden ziehen den Fluss entlang, der Waldboden dampft, die Baumriesen sind vom Dunst verschleiert. Mit den letzten Tropfen posaunt der Kwau seinen schrecklich falschen Warnruf in den Wald und wieder beginnt das Konzert der tausend Papageien.
Jetzt aber, Hänsler, pass auf: Es hatte sich etwas verändert bei mir, in meinem Wesen seit dem Spinnenbiss, seit ich vom Tod auferstanden bin. Das arme Ding kann doch nicht Bödekers Sklavin bleiben, mit dem Kind. Solche Bälger, das kennt man zur Genüge, wachsen auf wie die Lilien auf dem Feld, es kümmert sich kein Mensch um sie. Streunen wie die herrenlosen Hunde durch die Gassen. Mit all den armen Mestizlein, von den betrunkenen Soldaten und ihren Missis, die keiner haben will. Aus ihnen kann doch gar nichts werden, verstehst du?
Noch am selben Abend bin ich bei Bödeker zum Essen und sitze mit ihm bei Genever und Zigarre auf der Veranda. Es ist Vollmond, die Feuerfliegen tanzen. Ich komme mir vor wie ein Debütant, sollte ich bei ihm um Belles Hand anhalten, es ist völlig absurd, Hänsler, aber ich bin aufgeregt, viel zu aufgeregt in einer Lage, in der ich ja eigentlich sein Vorgesetzter bin. Verlegen reibe mir die Hände, suche nach der rechten Formulierung, wische mir den Schweiss von der Stirn. Ob jetzt wohl der günstige Zeitpunkt ist für meine Frage, ob Bödeker mir wohlgesinnt ist? Was habe ich diesem Herrn denn überhaupt meine Absichten zu erklären? Ich stosse hervor – Bödeker, ich heirate. – Ach, Glückwunsch, wenn das nicht eine gute Nachricht ist! – Ich kauf sie Ihnen ab, die Braut, ich kauf sie frei, sie soll ein freier Mensch sein, wenn sie mein Kind gebiert. Schweigen. Bödeker pafft Ringel in die Nacht. Nimmt einen Schluck Genever.
– Was soll sie denn kosten? Nennen Sie mir einen vernünftigen Preis! Bödeker schaut mich an und wiegt den Kopf. – Heirat allein macht sie noch lange nicht zur mündigen Person, wie Sie wissen. – Just aus diesem Grund will ich sie ja freikaufen. Bödeker zwinkert mir mit glasigen Äuglein vertraulich zu, sie sind rot und blau unterlaufen im aufgedunsenen Gesicht. Er wird jetzt philosophisch. – Haussklaven besitzen so gut eine unsterbliche Seele wie wir, sie sind keine minderen Wesen wie die Tiere, aber sie bleiben uns untertan. – Mag sein, Bödeker, mag sein. Wieviel also wollen Sie für sie haben?
Er hat sich in der Frage wohl längst entschieden, er grunzt selbstzufrieden, sagt – Den Balg können Sie von mir aus behalten, die Mutter bleibt in meinem Besitz. Ich hab sie erst letztes Jahr erstanden, sie ist mein bestes Stück.
Das ist sein letztes Wort, er lässt sich nicht erweichen. Auch wenn ich bereit bin, für Belle einen hohen Preis zu zahlen, ich kann nur das Kind freikaufen. Tja. Am 15. November 1808 kommt ein Büblein zur Welt, Jan Harry, dem ich meinen Familiennamen gebe, ganz offiziell, und das ich adoptiere. Ich bin ein Mann der Ehre, wie du weisst. Unvermeidlich, dass ich mich im Gegenzug nun von Bödeker trenne, er wird entlassen.
Bleibt Belle, die mir kurz vor Weihnachten mein Söhnlein überbringt, mich mit leerem Blick ansieht – Weisst du, Vater, warum Zucker klebrig ist? Weil er mit Sklaventränen gemacht ist, darum. Ich werde sie nie mehr wiedersehen.
Jetzt muss im Handumdrehen eine Missi her, was soll ich tun. Dank meiner Beziehungen zu den höchsten Kreisen kann ich noch vor Heiligabend eine gebildete Mestizin mit besten Referenzen in meine Dienste nehmen, eine Freie überdies, namens Groenberg. Ich ziehe um ins Haupthaus und bin von einem Tag zum anderen nun mein eigener Direktor, bin der Gutsverwalter.
Sie, diese Groenberg, macht ihre Sache gut, sie erweist sich als wahre Perle, steht dem Haushalt vor und ist zugleich dem kleinen Jan Harry so gut wie eine Mutter. Ich schalte und walte derweil im Kontor, überwache die Arbeit auf den Feldern, ich bin, noch bevor der Morgen graut, beim Appell zugegen, wenn der Captain seine Tagestrupps zusammenstellt, inspiziere die Quartiere der Sklaven, sehe zu, dass alles seine Ordnung hat, rüge da und dort den einen oder anderen oder spreche eine Strafe aus, wo sich Liederlichkeit einzuschleichen droht, wie bei dir, so sind die Dinge nun mal bestellt, Hänsler. Ich reite auf der Militärstrasse flussaufwärts zur anderen Plantage, gebe Anweisungen neue Felder anzulegen und kaufe frische Arbeitssklaven auf dem Markt.
Abends, nach getaner Feldarbeit, gibt es erneut Appell im Park und die Besprechung mit dem Captain für den nächsten Tag. Die Groenberg, fällt mir jetzt immer mehr auf, ist eine rassige Frau, sie hat Klasse, eine recht elegante Erscheinung, wie sie umherschreitet im Haus, in gemessenem Schritt, lächelnd und stets mit gesenktem Blick, ganz anmutig in ihren Bewegungen, grossgewachsen, aufrecht, sie dürfte eine geschmeidige Tänzerin sein. Dafür habe ich ein gutes Auge.
Conte Contarini lädt wie jedes Jahr zum venezianischen Maskenball. Der einzige Anlass von Bedeutung hier im Urwald. Ich, gedankenlos, platze mit der Frage heraus, ob sie mich begleiten möchte. – Groenberg, wollen Sie mit mir tanzen? – Wenn Sie mich heiraten, die Antwort! Wenn Sie mich heiraten! Das kommt ja wohl nicht infrage, im Leben nicht, aber ich nehme sie mit zum Ball.
Sie kommt gekleidet wie eine Königin. Trägt die Maske der moretta muta, der kleinen schwarzen, stummen Dienerin. Die schwarze Seidenmaske wird von innen mit einem angenähten Knopf zwischen den Zähnen festgehalten, so braucht sie den ganzen Abend nicht zu reden und bleibt für alle unerkannt im Flackerlicht der Kerzen. Das macht sie so begehrenswert. Jeder will mit ihr tanzen. Wer ist die unbekannte Schöne? Fragt sich jeder, verstehst du, Hänsler. Sie tanzt den ganzen Abend. Die Passacaglia jedoch gewährt sie keinem anderen Tänzer, wenn die Passacaglia gespielt wird, schaut sie in meine Richtung, und ich fordere sie zum Tanz. Schwer und tragend, voller Sehnsucht. Seidenweich ihre dunkle Haut und diese blauen Augen hinter der schwarzen Maske. Sie trägt sie noch immer, als wir nach dem Ball nach Hause fahren, knickst und macht sich auf zum Negerpoort, dem Hauseingang für die Sklaven. Ich halte sie zurück, nehme sie in meine Arme und trage sie durch den Haupteingang ins Haus.
Groenberg wird meine Frau, es ist unvermeidlich, Hänsler. Unvermeidlich. Auch durch Heirat, wenn sie es will. Hier im Busch ist alles möglich.
In meiner neuen Welt sind wir jetzt das Königspaar. Ich kleide mich wie ein Dandy, lasse mir Anzüge schneidern, nach der neuesten Mode mit langen engen Hosenkleidern, trage Seidenschals wie ein englischer Snob, etwas zu theatralisch für die Tropen, mag sein, sogar auch Handschuhe, um mich von den anderen Gentlemen zu unterscheiden. Ich hab etwas erreicht in meinem Leben. Man spricht von uns. Das bestgekleidete Paar der Siedlung. Wir geben Gesellschaften, musikalische Abende, Rezitals europäischer Künstler. Wir setzten neue Massstäbe, die Geschäfte blühen.
Die Groenberg schenkt mir Ende Jahr einen Sohn. Jakob Rudolf ist ihr neuer Hahn im Korb.
Hörst du überhaupt noch zu, Hänsler? Jetzt kommt’s: Die Groenberg blüht auf, die Groenberg hält Hof, noch immer ist sie tüchtig, führt den Haushalt, aber um eine Umdrehung vielleicht zu forsch, in ihrer Rolle als meine Gattin zu kühn in ihrem Eigenwillen, und sie nimmt sich Freiheiten, die ihr nicht gebühren, verstehst du, Hänsler. Für den kleinen Jan Harry nimmt sie sich eine Missi. Ihr Benehmen, ihre ganze Haltung, wie soll ich sagen. Übertrieben ihre Art, etwas zu grotesk. Ich muss sie in die Schranken weisen. Naturgemäss. Ihre Stellung muss sie erst noch finden. Den passenden Auftritt üben benötigt seine Zeit, verständlicherweise.
Auf meine Anweisung hin jedenfalls hat sie vorerst wieder zu Hause zu bleiben. Man will ja nicht zum Gespött der Leute werden. Groenberg ist einsichtig, scheinbar. Pariert, sie fügt sich, vordergründig. In Wahrheit geht sie, wie man bei den Pferden sagt, hinter dem Zügel, sie igelt sich ein, sozusagen, hinter vorgespieltem Gehorsam mit trotzigem Widerstand. Ich gehe derweil meiner Arbeit nach, fühl mich wie ein Fisch im Wasser. Die Geschäfte florieren.
Groenberg beginnt zu trinken. Erst heimlich, dass es kaum auffällt, es trinkt hier ja jeder Schnaps, vom Söldner bis zum Pfaffen, du kannst dir gar nicht vorstellen, in welchem Masse, Schnaps ist eine Währung, nicht viel wert, ein Brennstoff wie die Kohle, Schnaps schlägt die Zeit hier tot, gebrannter Zuckerrohr für die Sklaven, zur Betäubung, der Genever als Seelenbalsam für die Pflanzer, aber mit der Zeit fällt es jedem auf, der ihr begegnet, sie trinkt am helllichten Tag. Und schon am Morgen, wie einst Bödeker.
Ich nehm ihr die Flasche weg, verbiete ihr zu trinken. Lasse den jungen Indianer kommen, den Heiler mit dem feurigen Blick, auf ihren Wunsch, der gibt ihr bittere Wurzeln zu kauen, bis sie kotzt. Sie glaubt an seinen Hexenzauber. Er tanzt und brüllt wie ein Affe, faucht wie der Jaguar, schreit wie eine Harpyie in meinem Haus herum, bis ich ihn hinauswerfe. Auch wenn er scheinbar mit den bösen Geistern ringt, die Groenberg besetzen, hier wohnen Christenmenschen, keine Wilden, ich bitte dich!
Groenberg will sich bessern, wie sie sagt, mir nicht eine Schande sein. Sie will die stolze Gattin an meiner Seite sein, sie treibt mich an, weitere Ländereien zu kaufen, grössere Mühlen zu bauen, mit einem Heer von Sklaven. Und sie die Herrin neben mir. Eine ganze Weile geht das gut, Groenberg ist in ihrem Element, überwacht mit scharfem Blick die Arbeiten in Haus und Hof. Sie kümmert sich um alles, mit grossem Eifer.
Sie beginnt jetzt, mich zu kritisieren, Hänsler. Und jetzt pass auf: Sie schlägt mit der Peitsche auf die Sklaven ein. Ich sei zu wenig streng, hätte nicht den Mut und den Ehrgeiz meiner Vorfahren, den ersten Pflanzern, nicht den nötigen Pioniergeist, um wirklich Grosses zu leisten.
Dann, eines Tages, reite ich nachmittags früh nach Hause zurück, und da, im Park, ich seh’s von Weitem, der junge Indianer sitzt in meinem Sessel auf der Veranda und trinkt gemütlich Genever mit der Groenberg. Ich reite zum Stall, geb mein Pferd ab und, zurück im Park auf der Terrasse keine Spur mehr vom Indianer, sein Glas und die Flasche sind verschwunden, mein Sessel leer, die Groenberg sitzt alleine da und wippt im Schaukelstuhl, ein Glas Genever in der Hand. – Ich hab mir heut ein Gläschen Schnaps genehmigt, ausnahmsweise, zum Aperitif, mein Schatz. Magst du mit mir trinken, auf unser Wohl? Ich will noch ein Kind von dir!
Wir schweigen, lauschen dem Wind, dem Rauschen der Blätter vor dem Regen. Die Wolken ziehen vorüber. Nachts ist es noch immer schwül, das Gewitter will sich nicht entladen, wir schweigen, Hänsler, es ist spät als wir uns im fahlen Schein der Öllampe ausziehen, schweigen noch immer, lauschen den Orchesterstimmen der Nacht im nahen Wald. Die Hunde bellen im Hof.