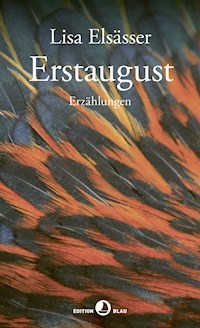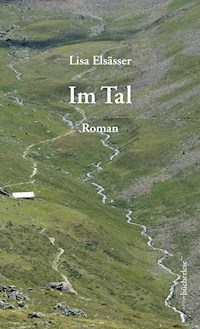
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition bücherlese
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das letzte Abendlicht wandert über die Berge, als sich die Frau auf den Weg zu einer einsam gelegenen Hütte im Tal macht. Sie kennt den Ort, die Hütte, den Bauern, der ihr die Hütte überlässt. Im Tal hat sich in den vielen Jahren seit ihrem letzten Besuch nichts verändert. Die Zeit scheint stillzustehen. Im Gepäck hat sie zwei, drei Bücher, vor allem aber Erinnerungen an Menschen, die ihr nahestehen. An einige von ihnen schreibt sie lange Briefe, die sie nicht abschickt. Die Umgebung ist still, so still, dass in ihr jedes erzwungene Reden wie eine Ruhestörung erscheinen würde. Sie wacht und schläft, streift mit schweren Wanderschuhen durch die Natur, beachtet deren vielfältige Erscheinungen mit Aufmerksamkeit. Mal sitzt sie in der Hütte, mal davor, dann wieder am Bach. Sie kocht einfache Mahlzeiten, die sie wie die gemeinsamen Wanderungen hie und da mit dem Bauern, einem introvertierten Talbewohner, teilt. Nichts Spektakuläres geschieht. Oder doch? Es ist eine der mondhellen Nächte, als sie mit dem Bauern zu einem im Tannendunkel versteckten See wandert und dort von einer unerhörten Begebenheit erfährt. Eine zunächst ruhig fließende Geschichte, die sich den subtilen Beobachtungen der Protagonistin widmet. Dann ein überraschender Verlauf mit einem unerwarteten Ende. Beeindruckend präzise gearbeitet. Sparsam und zugleich reich. Ein Widerspruch? Durchaus nicht. Die Autorin zeigt uns, wie so etwas geht, und sie demonstriert einmal mehr, was Sprache vermag. Lisa Elsässer, die auch als Lyrikerin reüssierte, handhabt die Sprache wie ein musikalisches Instrument, mit dem sie einen sorgfältig komponierten, suggestiven Erzählstrom erzeugt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Elsässer
Im Tal
Roman
Vorbemerkung
Die erste Geschichte wurde 2011 im Erzählband Die Finten der Liebe unter dem Titel Bügelfalte V4 im Zytglogge-Verlag veröffentlicht. Nun ist sie, mit Genehmigung des Verlags, zum »Auftakt« des Buches Im Tal geworden.
Lisa Elsaesser. Oktober 2021
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
I
Als ich ankam, fielen die ersten Tropfen. Den Schlüssel brauchte ich nicht. Die Hütte war offen. Ich trat ein. In den einzigen Raum, den es gab. Es war alles so, wie er es mir geschildert hatte, der Bauer, als er mir den Schlüssel übergab.
Zuhinterst im Tal, zwischen felsigen Steinbrocken, zwischen Tannen und Föhren stand das Häuschen. Es hatte eine Türe, ein einziges Fenster. Nach hinten war es in den steil aufsteigenden Hang gebaut. Er hatte gesagt, wegen der Lawinen liege es so dicht am Hang. »Im Hang«, sagte er, »Sie können es nicht verfehlen, es gibt nur dieses eine, und was, um Himmels Willen, wollen Sie dort und alleine und tagelang«, so sagte er das, atemlos.
Ich stellte den Rucksack auf den Boden, öffnete das kleine Fenster, hörte die Regentropfen auf dem Dach. Sonst war es still. Nebel verhinderte die Sicht. Die Spinnen im Raum ließ ich in ihren Netzen. Sie zappelten, wenn ich zufällig an ihre gewobenen Fäden stieß. Sonst war es sauber. Eine Petrollampe stand auf dem Tisch. Die mitgebrachten Kerzen stellte ich kreisförmig um die Lampe. Ich zog meine Schuhe aus, legte mich aufs Bett und wartete auf die Dunkelheit, die Nacht. Beim langen Fußmarsch hatte sich eine große, dicke Blase gebildet. Sie schmerzte und erinnerte mich an die Wetten, die wir als Kinder beim Blasenschlagen der Kaugummis geschlossen hatten. Die Blase an der Ferse war rund und groß, gefüllt mit Wundflüssigkeit. Sie ließ sich leicht bewegen, fühlte sich kalt an, nur die Haut brannte. Ich legte mich auf die Seite, vergrub das Ohr, mit dem ich gut hören konnte, ins Kissen. Mit dem schlechten Ohr war das Huschen einer Maus zu hören. Dann schlief ich ein. Träume weckten mich. Je mehr ich versuchte, die Bilder zu finden, desto mehr entglitten sie mir, wurden unkenntlich, waren bloß noch, wie durch ein Gerüst hindurch, in Einzelteile aufgelöste Schatten, die im ersten Licht des Morgens verschwanden. Die Wundblase war leer. Geschrumpft lag die Haut auf dem roten, runden Kreis.
Es würde andauern, das Wetter, so wie das Tal aussah. Eine äußere Störung, die meine Unbehaglichkeit in einen Zustand trieb, für den ich keinen Namen hatte. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass die fallenden Tropfen, anhaltend, aber ruhig, anfingen, mich zu verstören.
Das dicke Grau hatte sich leicht himmelwärts verzogen. Sonst glich der Morgen dem Vorabend. Grau die Decke im zögernden Morgenlicht. Dann hörte es auf zu regnen. Ich trank einen Kaffee, legte die mitgebrachten Nahrungsmittel auf den Tisch, öffnete lustlos die Packung mit den Haferflocken, füllte die Schale mit Milch, leerte Flocken dazu, ein Paar getrocknete Beeren, aß jedoch nichts, stand auf, öffnete die Tür und lief barfuß ins nasse, kurze Gras vor der Hütte. Es war moosig, weich, kalt. Von ferne das Rauschen des Baches, er war nicht zu sehen. Unten, wo sich die beiden Talseiten in die Vertiefung schoben, fraß sich das Wasser durch die Geschiebe von Stein und Ewigkeit.
Ich fing an, mich kreisförmig auf der Wiese zu bewegen, immer weitere Kreise, das Drehen immer schneller, sprang in die Mitte zurück, stand da, eingekreist von mir selbst, atmete den Geruch, der entsteht, wenn Regen sich mit den aus dem Boden strömenden Stoffen verbindet, und wünschte mir das Rollen einer Steinlawine am gegenüberliegenden Hang.
Drinnen in der Hütte setzte ich mich an den Tisch, schepperte mit dem Stuhl auf dem harten Holzboden, schlang gierig die Flocken in mich hinein, leckte zum Schluss das Schüsselchen leer. Langsam bewegte sich meine Zunge über den weißen Boden des Emaillegeschirrs, und ich hörte mir zu, hörte diesem unsinnigen Leerschlecken zu, das mich an die schwarz-weiß gefleckte Katze erinnerte, die ich als Kind als meine Katze zu bezeichnen pflegte und aus derem Lecken ich so etwas wie eine ganz persönliche Mitteilung an mich zu erkennen meinte. Was wollte mir die Tasse mit der in ihr kreisenden Zunge sagen?
Die Nahrungsmittel warf ich wieder in den Rucksack, schnürte ihn zu und stellte die Milch in die gemauerte Ecke. Es war kühl dort. Ich konnte sie auch vergessen, einfach hier stehen lassen.
Der Weg, auf dem ich hergekommen war, war verschwunden. Er schien sich nachts ins Nichts aufgelöst zu haben. Die steinige Landschaft, zur trägen Lächerlichkeit geworden, stellte sich mir in den Weg. Vor mir wuchs das Holz, das Gestrüpp, selbst die Steine schienen über Nacht gewachsen zu sein. Die Risse im Boden, die gestern noch ausgesehen hatten wie feine Nähte, waren offene, klaffende Furchen.
Ich hätte in die andere Richtung gehen können. Ganz nach hinten, wo gestern, vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren durch die Erosion im Gestein ein Riss, eine Rinne entstanden war und sich das Wasser in die tieferen Lagen gefressen und mit der Zeit ein Bachbett gebildet hatte. Ich hätte vor dem Berg stehen, die Quelle des Wassers beobachten können, das nach unten in die breite Talebene floss.
Ich setzte mich auf einen Stein und zählte die Punkte auf den Flügeln eines Marienkäfers. Punkte, wie die Augen meines Kindes, wie die Anzahl seiner Jahre. So alt wie mein Kind, dachte ich. So hatten sie das immer gesagt, die Erwachsenen, als ich selbst noch Kind war und wissen wollte, was die schwarzen Punkte auf den roten Flügeln bedeuteten. Sie würden das Alter des Käfers bezeichnen.
Wie angewachsen saß ich auf dem Stein. Mein Körper schmerzte, als ob sich die sechs schwarzen, runden Tupfen in ihn eingebrannt hätten. Sachte versuchte ich, den Körper des Käfers anzufassen. Als gelänge mir die Zärtlichkeit erst hier und jetzt, in diesem gottverlassenen Tal wollte ich den Käfer auf meinen Handrücken locken. Er flog davon.
Die letzte Nacht, zu Hause im Bett, hatte ich das gleichmäßige Atmen neben mir gehört und musste selbst eingeschlafen sein.
Mutter!
Hatte das Kind gerufen? Das Wort kam von weit her. Aus einem gelben Kleid mit roten und violablassen Tupfen. Kleine Hände klammerten sich an den Saum. Dann war es kein gelbes Kleid mehr, sondern eine dunkle Ratlosigkeit, die sich zwischen Traum und Erwachen bewegte wie ein fließender Stoff, als müsste dieser ein endgültiges Wachwerden verhindern und das Wort Mutter wieder versenken in der Falte des Traums.
Schlagartig war ich wach. Alles war ruhig. Mutter, sagte ich. Zu mir, zu ihr. Ich sprach uns an. Beide waren wir im Zimmer. Dein schönes Kleid, hast du es noch? Ich stopfte mir den Zipfel des Leintuchs in den Mund. Er roch nach den Astern, die auf ihrem Leintuch gelegen hatten, als sie starb. Es war Herbst, die Farben waren ein schöner Kontrast zu ihrem weißen, toten Gesicht, ein Kontrast jetzt in dieser Nacht, in der sie und ich am Rand eines Bettes Zuflucht suchten in einem Traum, im Traum einer Nähe, in einer Vorstellung von Nähe, Nähe, die zwischen uns nie möglich gewesen war. Das gelbe Kleid verschwand im Dunkel der Nacht. Aber ich wusste, es hatte dieses Kleid gegeben.
Ich konnte nicht mehr schlafen, ging ans Bett des Kindes. Es schlief, den einen Arm über dem Kopf, im andern Arm das Stofftier. Ich stand da, schaute, wollte das Kind nicht wecken. Hörte seinen Atem, der mir vorkam wie die Koloratur einer Geschichte, die dieser kleinen Stimme erlaubt, sich nicht an andere, sondern nur an ihre eigene Vorgabe von laut oder leise zu halten. Ein schmerzendes Schlucken zwang mich auf den Stuhl, auf dem ich ihm am Abend vorgelesen hatte. In mein Vorhaben und die Entschlossenheit, auf unbestimmte Zeit alleine wegzugehen, mischte sich Unsicherheit, und die Angst, zu bleiben, trieb mich, aufzustehen. Ich floh aus dem Kinderzimmer, legte mich wieder ins Bett.
Oben, in der Ecke des Zimmers blinkten rote Lampen. Sie drehten sich im Kreis. Aus dem Badezimmer bewegte sich langsam eine schwarze Spinnenstraße auf mein Bett zu. Hintereinander krabbelten sie, dick und furchterregend, in meine Nähe, schreckten und weckten mich auf. Die Decke, der Boden, alles war wie immer.
Im ersten, bläulich wirkenden Licht verließ ich das Haus. Alles war noch still.
An einer Waldlichtung hatten Ameisen einen Hügel gebaut. Einen Frauenstaat, aus einem komplexen Gang- und Kammersystem. Zuversicht erfüllte mich, am richtigen Ort zu sein. Ich ertappte mich dabei, dass ich anfing, zu ihnen zu sprechen.
Der Himmel hatte sich nicht gelichtet. Das Grau des Nebels klebte auf den Tannen. In den Einschnitten der Felskuppen sah er aus wie Staublawinen, an Ort und Stelle bleibend, nur dunkler gefärbt. Da und dort waberten Schwaden durchs Gestrüpp und formten Figuren, die Urtieren glichen.
Tag, nie richtig Tag, es wurde einfach Abend, dann Nacht. Ich setzte mich an den Tisch, stellte drei Schalen hin, die Esswaren. Eine Kerze brannte, flackerte an die Schalen, ein unwirklicher Schein, trostlos, das einzig sich Bewegende im Raum.
Wir saßen da, an diesem Tisch, vor den leeren Schalen. Sie hatten ihren Tod vergessen. Ich hatte mein Leben vergessen, starrte benommen in ihre Anwesenheit. Ihre Gesichter schoben sich ineinander. An das erinnere ich mich nicht, sagte ich, erinnere mich nicht, dass ihr euch jemals so nahe wart. Wünschte mir ihr Verschwinden, ihr Bleiben, wünschte, von meinem Leben zu erzählen, das wie ihres geworden, ihre Sprache und ihr Handeln übernommen hatte, ein Leben, dem die Fülle, wenn auch nur die einer Tasse, den Garaus macht. Für einen Moment war ich versucht, ihnen die Schalen zu füllen, war versucht, mich zu ihnen, in ihre Mitte zu setzen, streckte meine Arme zu ihnen hin und zog sie wieder zurück, versteckte sie hinter dem Rücken, hinter meinem Zorn. Die Kälte, sagte ich.
Am empfindlichsten spürbar war sie damals im Sommer, wenn draußen das Leben erwachte. Hausfriedensbruch hieß, zu viel Leben und zu viel Wärme durch die Fenster lassen. Sie blieben geschlossen, als Regulation der inneren Kühle. Bei großer Hitze im Sommer wirkte das Haus mit seinen geschlossenen Fensterläden wie ein unbewohntes Gefängnis. Nur die Geranien auf dem Balkon sprachen in ihrem flimmernden Rot. Ich hätte sie gerne geköpft, wenn ich vor ihrem ineinanderwachsenden Tuscheln, ihrem über die Balustrade hängenden Leichtsinn stand. Abends spät dann ein kurzer Luftzug durch das Haus, wenn das Leben wieder aus den Gassen verschwunden war. Ich lauschte meinem eigenen Herzschlag und wartete auf die tapsigen Schrittchen des kleinen Bruders, der sich nachts in meine Bauchkuhle bettete und an seinem Daumen sog.
Kalt! Zwischen ihnen und mir eine erschöpfte Stille, als ob sie sich verausgabt, nutzlos angestrengt hätte für ein Geräusch und, als ob ich ihnen befohlen hätte, wieder zu leben, flüsterte ich: Ihr müsst nicht wieder, einmal genügt!
Ich stand auf, umkreiste sie mit fragenden Blicken, wollte sie umarmen, von mir stoßen, beides zusammen gleichzeitig, ich lächelte, lachte, konnte nicht aufhören, immer lauter wurden die Töne. Es schüttelte mich und gleichzeitig die Tasse, bis sie halb leer war, die Milch über den Tisch rann und im rohen Holz versickerte. Ich spielte nah an der Tasse mit dem weißen Milchschaum, versuchte, das Rinnsal zu ihnen hinzubewegen. Eine Spannung herrschte im Raum, die jederzeit bersten konnte. Dann hörte ich ein Klopfen, den Puls, sein unsinnig sich steigerndes Trommeln, das mir den Atem verschlug. Plötzlich fiel alles in sich zusammen. Ich in mich und alle Geschichten fielen ineinander zu einer einzigen Geschichte, sah mich und den Raum zerfallen, das Dach sich heben. Hier war der nachgebaute Ort: die kleine Hütte, karg, eng, einsam und doch Geborgenheit für Trauer. Ich war wieder Kind. An seiner Brille, die es trug, erkannte ich mich. Brennende Gläser. Die Brille war so scheußlich, dass ich täglich ausgelacht wurde und sie nicht mehr tragen wollte. Der Beweis war erbracht, dass hinter der Sehschwäche die Stärke einer Simulantin lag. Das eine Auge blieb zurück, und das Zurückliegende wurde nun durch die Gläser der Nacht vergrößert.
Ich saß ihnen wieder gegenüber, stumm und irritiert wie als Kind, wenn ich etwas in ihren Augen sah, das ich nicht benennen konnte. Als ob da, fein ineinander gesponnen, immer mehrere Schichten keine Eindeutigkeiten lesen ließen, nicht die der Liebe, nicht ihr Gegenteil, nicht die Nuancen zwischen ihr und ihrem Gegenteil. Von allem Ungenaues, Verstörendes.
Der Tisch bekleckert vom fließenden Wachs, die Ritzen gefüllt, meine Hände lagen in der Wärme dieser sich langsam verändernden, weichen Schicht.
»Nennt man das Leben?!«, schrie ich laut in ihre Richtung und erschrak, war allein im Raum.
Ich löste die Wachsschichten von meinen Fingern, brach die hart gewordenen Plättchen in kleine Stücke, blies die Kerze aus, deren Docht sich im flüssig gewordenen Parafin langsam ertränkte und hörte auf die Irritation des Bachs, dessen Rauschen lauter und heftiger wurde, bis zum Grollen hin. Er tat, was der Zorn des Gewitters ihm auftrug: mehr Wasser, mehr Geröll, mehr von allem. Was das anschwellende Wasser erfassen konnte, donnerte jetzt durch den Lauf. Als erinnerte ich mich dadurch noch mehr an meine Erinnerungen, hob sich auch meine Stimme, als müsste sie das alles von weit innen durch den Schlund treiben, über den ich jede Kontrolle verloren hatte.