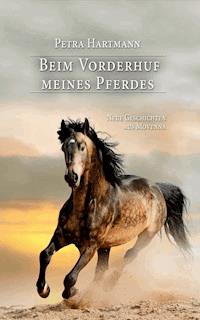3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein Indianer taucht in dem verschlafenen Küstenstädtchen Kitty Hawk auf. Die Witwe Murdoch ist überzeugt, dass der Fremde ein Kundschafter ist und bald seine roten Spießgesellen zum Morden und Plündern mitbringen wird. Doch Junger Adler hat andere Pläne. Er träumt vom Fliegen und wartet auf das Eintreffen zweier verrückter Fahrradhändler. Karl-May-Fans kennen Junger Adler bereits aus dem Roman Winnetous Erben. Die Vorgeschichte zu diesem Buch wird nun von Petra Hartmann erzählt. Die Printausgabe des Buches umfasst 282 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Im Wilden Westen NordamerikasDAS HERZ DES DONNERVOGELS
In dieser Reihe bisher erschienen
2201 Aufbruch ins Ungewisse
2202 Auf der Spur
2203 Der schwarze Josh
2204 In den Fängen des Ku-Klux-Klan
2205 Heiße Fracht für Juarez
2206 Maximilians Gold
2207 Der Schwur der Blutsbrüder
2208 Zwischen Apachen und Comanchen
2209 Der Geist von Rio Pecos
2210 Fragwürdige Gentlemen
2211 Jenseits der Grenze
2212 Kein Glück in Arizona
2213 Unter Blutsbrüdern
2214 Im Land der Saguaros
2215 Der Schatz der Kristallhöhle
2216 Das Gold der Apachen
2217 Bloody Fox
2218 Das Herz des Donnervogels
2219 Blutige Schluchten
Petra Hartmann
Das Herz des Donnervogels
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannHerausgeber: H. W. SteinTitelbild: Mario HeyerUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-449-7
Feuerkopf
Natürlich war ich wieder der Letzte, der den Neuankömmling zu Gesicht bekam. Bei den beiden verrückten Brüdern im letzten Jahr war das so gewesen, und im vorletzten Jahr, als Reverend Allan ankam, auch. Ich meine, gut, vielleicht macht es ja wirklich nicht so einen großen Unterschied, ob man einen Neuen als Erster sieht oder eben als zwanzigster. „Die werden dir schon nichts weggucken“, sagte Mum oft. Aber manchmal hatte ich eben doch das Gefühl, dass ich etwas verpasst habe. Dass den Leuten, wenn sie von Bord gehen, irgendwie unterwegs, auf dem Weg hier herüber zur Poststation, auch wenn das ja nur ein paar Schritte sind, dass ihnen da vielleicht doch ein bisschen was weggeguckt wird. Und wenn sie dann hier hereinkommen, dann sind sie schon nicht mehr ganz so neu, dann fehlt ihnen ein bisschen was von dem, was sie mitgebracht haben nach Kitty Hawk, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist so, als ob die anderen, die vor mir gucken durften, das alles schon mit den Augen in sich reingeguckt haben. Oder vielleicht nutzt sich das Neue ja auch ganz von selber ab. Wenn die neuen Leute von Bord gehen und die paar Schritte hier herüber, und wenn sie auf diesen paar Metern schon alles gesehen haben, was unser Kitty Hawk zu bieten hat, den Lagerschuppen im Hafen, die paar lausigen Fischerhütten, die kleine Holzkirche und eben das hier: Mister Tates Poststation mit dem kleinen Store und dem noch kleineren Schankraum, den wir hier großzügig Saloon nannten. Wenn sie das alles gesehen haben, dann geht das, was sie von draußen mitgebracht haben, ganz schnell aus ihren Augen verloren. Und wenn sie sich dann bis hierher in den Saloon geschleppt haben, dann schauen sie schon genau so trübe aus der Wäsche wie die paar alten Fischer, die hier hocken und ihren Brandy schlucken, um sich dieses Nest Kitty Hawk schöner zu saufen.
So war das auch an dem Tag wieder. Es war Anfang September, später Nachmittag, und ich höre gerade so Minnie Miller draußen rufen: „Das Postschiff kommt!“, und wie ich mich eben wegschleichen will und zur Tür raus, runter zum Anleger, da hat mich Missis Tate schon am Schlafittchen wie ein Karnickel. Fehlte bloß noch, dass sie mich hochhob und durchschüttelte. „Oh nein, Fred O’Connor, das hast du dir so gedacht“, sagte sie. „Ab in die Küche mit dir, und hilf mir gefälligst, du rotschöpfiger Nichtsnutz.“
Das fand ich nicht nett von ihr. Oh, nicht dass ihr jetzt denkt, Missis Tate wäre irgendwie bösartig oder gemein zu mir. Die Tates sind in Ordnung, und der Job war auch in Ordnung, und ich musste ja auch froh sein, dass ich mir in William Tates Poststation ein bisschen was dazuverdienen konnte. Mum und Dad hatten es halt nicht so dicke mit uns acht Kindern.
Aber wenn sie mich einen rotschöpfigen Nichtsnutz nannte, das mochte ich nicht so. Wir O’Connors hatten eben alle rote Haare. Alle. Als ob daran etwas verkehrt war. Jedenfalls war es dann wieder einmal so, dass ich in der Küche saß und Kartoffeln schälte für die Crew vom Postboot und für die Passagiere, die das Boot vielleicht mitgebracht hatte, während alle anderen unten am Anleger standen und dem Schiff entgegensahen. Und ich konnte nur hoffen, dass Mum diesmal recht hatte und dass, falls irgendwelche Neuen an Bord waren, dass die anderen mir von denen nicht alles weggucken würden.
Als die Männer vom Postschiff ihre Ladung gelöscht hatten – es war eine Menge Ware für Mister Tates Store dabei –, da war ich natürlich längst wieder drüben im Saloon. Und jetzt saßen sie da, schaufelten Missis Tates Kartoffeleintopf in sich hinein, und der Brandy floss in Strömen und lockerte ihnen die Zunge. Die erste Runde für die Mannschaft ging wie immer aufs Haus, da ließ sich der Postmeister nicht lumpen. Vor allem, weil die Postschiffscrew immer für volles Haus sorgte. Kaum ein Einwohner von Kitty Hawk wollte sich doch die Neuigkeiten entgehen lassen, die die Jungs aus Norfolk mitbrachten. Auch diesmal war die Stube wieder gerammelt voll. Mister Tate konnte zufrieden sein.
„Und der Indianer hat wirklich nicht gesagt, was er hier will?“, fragte gerade Witwe Murdoch misstrauisch.
Holla. Ich spitzte die Ohren. Ein echter Indianer? Na, das war ja mal eine Neuigkeit.
„Kein Sterbenswort“, versicherte Käpt’n Charley und tat einen tiefen Zug. „Reden tun sie ja nie viel, diese Roten, aber der hier ist wirklich ein besonders hartgesottener Bursche. Ich dachte fast, mir fallen die Ohren ab vor lauter Wundern, als er mich plötzlich ansprach im Hafen. Ob wir das Postschiff nach Kitty Hawk sind, hat er gefragt. So richtig in fließendem Englisch, wie wenn ein Christenmensch mit dir redet, hat er die Passage gebucht, hin und zurück. Aber dann unterwegs: kein Wort mehr. Wie sie halt sind, diese Indsmen.“
„Hat er denn wenigstens ordentlich bezahlt?“, fragte Will Tanner. Sein Gesicht war leicht gerötet wie immer, wenn er schon ziemlich viel Brandy gebunkert hatte.
„Tscha, das will ich wohl meinen.“ Käpt’n Charley strich sich zufrieden den Bart, ganz wie einer, der das Geschäft seines Lebens gemacht hatte.
„Aber was will er hier?“, bohrte Witwe Murdoch nach. „Ein Indianer in Kitty Hawk. Das hat es doch noch nie gegeben.“
„Was immer es ist, er wirkte jedenfalls sehr entschlossen“, ließ sich nun Steuermann Pete vernehmen. „Wie der dagesessen hat, die ganze Fahrt über, das sage ich euch, der hat was vor. Dieser Blick. Nee, wirklich, diese Augen, das ist keiner, der sich von irgendwas abbringen lässt. Ein junger Bursche ist er ja noch. Aber was der will, das erreicht er auch, das sage ich euch.“
„Um Himmels willen, es wird sich doch nicht etwa um einen Kundschafter handeln! Wenn der nun unser Dorf ausspionieren will? Und dann am Ende, dann winkt er einmal oder pfeift oder was weiß ich, was diese Wilden so tun, und plötzlich brechen tausend rote Teufel aus den Dünen hervor und überfallen uns und rauben, morden, plündern, brandschatzen, vergewaltigen, foltern, skalpieren ... Herrje, man hat so schlimme Sachen gehört!“
Käpt’n Charley lachte gutmütig. „Aber doch nicht in Kitty Hawk, meine beste Missis Murdoch. Was wollen die Roten hier schon klauen?“
„Aber wenn er doch so entschlossen aussah ...?“
„Ach was, entschlossen. Was der Pete sich wieder zusammenreimt. Seekrank ist der gewesen, das ist alles. Ich hab doch noch gesehen, wie er die Reling umklammert hat. Ganz weiß sah man seine Fingerknöchel unter der roten Haut. Und die Zähne hat er fest zusammengebissen. Das ist so, wenn man seekrank ist. Nee, gespuckt hat er nicht, das nein. Hat sich ganz gut gehalten fürs erste Mal, das muss man ihm zugestehen. Na gut, sagen wir halt, er war entschlossen. Aber wozu, das müssen Sie ihn schon selber fragen.“
„Ich? Reden mit diesem Wilden? Und dann kriegt er plötzlich sein Skalpmesser raus und – neenee, das sollen mal schön die Männer machen. Aber wissen würd’ ich’s schon gern ...“
Sie brach ab. Plötzlich war es totenstill im Saal. Selbst die Seeleute, die ihn schon kennengelernt hatten, hielten den Atem an und blickten wie gebannt zur Tür. Und da stand er. Ich konnte nicht anders. Ich glotzte. Ich starrte ihn an, wie ein Dorftrottel ein zweiköpfiges Kalb anstarren würde. Die Augen kamen mir bestimmt wie Missis Tates Fleischbälle aus dem Kopf, und ich schämte mich dafür, dass ich so dastand und einfach nur blöd gaffte, aber ich konnte nicht anders. Und wie ich so dastand und gaffte, da ging mir durch den Kopf, dass Mum diesmal recht gehabt hatte. Dieser Indianer war vom Postboot bis hierhergekommen, und er hatte sich augenscheinlich Zeit damit gelassen, den Ort in Ruhe anzugucken. Auf dem Weg hierher mussten ihn schon alle anderen Dorftrottel von Kitty Hawk angestarrt haben wie ein zweiköpfiges Kalb. Aber so sehr sie auch gestarrt haben mochten, nein, sie hatten ihm nichts weggucken können. Dieser Rote war wirklich neu. Unfassbar neu.
Er war noch recht jung, zumindest nicht viel älter als ich, nicht übermäßig groß und von eher schlanker Statur. Das lange, schwarzglänzende Haar fiel offen auf Schultern und Rücken nieder, eine schmückende Adlerfeder, die vom Rang oder von den Taten des Mannes kündete, suchte ich vergebens. Hatte Reverend Allan nicht erzählt, dass die Roten immer Federn im Haar trugen? Allenfalls die Kette aus Vogelkrallen, die er um den Hals trug, mochte eine Art Auszeichnung darstellen. Ein Riesenbiest musste das gewesen sein, das er da erlegt hatte. Das Jagdhemd aus hellem Büffelleder war schlicht, aber reinlich. Dazu trug er lederne Leggins und Mokassins, denen man ansah, dass er bereits lange Strecken zu Fuß zurückgelegt hatte. Stickereien aus Perlen oder Stachelschweinborsten, wie ich sie einmal in Norfolk auf dem Plakat einer indianischen Zirkustruppe gesehen hatte, fehlten. Immerhin, ich sah an den Nähten auch keine Skalplocken getöteter Feinde. Missis Murdochs Befürchtungen schienen also unbegründet. Nur einen Schmuck wies dieses Jagdhemd auf, und das war sonderbar genug. Es war ein knapp handtellergroßer zwölfzackiger Stern aus dunklerem Leder, den der Fremde auf der linken Brustseite trug. Ein Sheriffstern? Hatten denn auch die Roten ihre Sheriffs? Wer konnte das schon sagen?
Im Gürtel trug er das unvermeidliche Jagdmesser und einen kleinen ledernen Beutel, im Arm eine recht gute Winchester, und an einem Lederriemen über der Schulter ein in eine Lederdecke eingeschlagenes Bündel, das wohl seine restlichen Habseligkeiten barg. Reisegepäck eben, Käpt’n Charley oder Steuermann Pete hätten wohl einen Seesack über der Schulter hängen gehabt.
„Good evening, Mesch’schurs“, grüßte der Rote gelassen in die Runde. Und an mich gewandt fügte er halblaut hinzu: „Ein Bier bitte, Junge. Und etwas zum Essen, wenn möglich.“
„S-sofort, Mister. Sir“, stotterte ich. Ich fühlte, wie ich knallrot anlief, und duckte mich über den Zapfhahn. Sagte man zu einem Indianer Mister? Wohl kaum. Wie peinlich.
„Nicht so rasch, junger Mann!“
Missis Tate baute sich vor dem Fremden auf, stemmte die Hände in die Hüften und musterte ihn prüfend von oben bis unten. „Kannst du überhaupt bezahlen? Du haben Geld? Dollar? Münzen?“
Der Indianer ließ sich von der resoluten Posthalterin aber in keiner Weise einschüchtern. Gelassen lächelnd griff er in den kleinen Beutel, den er am Gürtel trug, nahm etwas heraus und drückte es ihr in die Hand. „Ich hoffe, das wird fürs Erste reichen, Ma’am“, sagte er mit sanfter, freundlicher Stimme. „Des Weiteren wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie ein Zimmer für mich hätten. Ich gedenke, einige Monate in Kitty Hawk zu bleiben.“
Und jetzt quollen wahrhaftig auch Missis Tate die Augen wie Kartoffelklöße aus dem Kopf. Fassungslos starrte sie auf den kleinen, vielleicht taubeneigroßen gelben Stein in ihrer Hand, dann schlossen sich ihre Finger wie ein Schraubstock darum, und sie rief mit überkippender Stimme: „Selbstverständlich, ja, selbstverständlich haben wir das. Fred, los, ein großes Bier für den Herrn und einen Teller Eintopf, aber sofort. Und dann richte Zimmer drei für ihn her. Nun mach doch endlich, du nichtsnutziger Rotschopf!“
Als ob ich nicht schon fliegen würde wie eine Schwalbe beim Nestbau. Immer hin und her hinter dem Tresen, vom Zapfhahn zu den Tischen, vom Tisch in die Küche, den ganzen Nachmittag war ich doch schon gelaufen. Und überhaupt – Zimmer Nummer drei ... Das klang ja fast so, als hätten wir hier ein richtig großes Hotel in Kitty Hawk. Dabei gab es eigentlich nur ein einziges Zimmer zu vermieten, und das hatten die beiden verrückten Brüder aus Dayton im letzten Jahr schon vorbestellt. Daneben lag die Kammer, in der die Crew des Postschiffs untergebracht war, eigentlich ein viel zu kleiner Raum für die ganze Mannschaft. Und Zimmer Nummer drei, damit musste sie wohl die kleine Rumpelkammer meinen. Ich fluchte innerlich. Es würde nicht so einfach sein, das verstaubte Zimmer in eine ordentliche Unterkunft zu verwandeln. Auch nicht für einen Roten, der normalerweise in einem Zelt hauste. Aber was wusste ich schon, wie unser Besucher zu schlafen pflegte?
Ich sollte recht behalten. Zimmer Nummer drei erwies sich als nahezu unbewohnbar. Und als ich nach einer guten Stunde Arbeit zumindest die gröbsten Ansammlungen von Staub, Spinnweben und Rattenkot hinausgeschafft hatte, sah es noch immer wie ein übler Dreckstall aus, den man nicht einmal einem Indianer anbieten konnte. Um wie viel weniger einem solchen Indianer?
Trotzdem, es musste wohl sein. Und was immer auch den Roten nach Kitty Hawk getrieben hatte, es würde wohl wichtig genug sein, um ihn auch dieses Zimmer Nummer drei aushalten zu lassen. Jedenfalls, als ich ihn wenig später die Treppe hinauf und den dunklen Flur entlangführte, dann die Zimmertür aufstieß und sagte: „Bitte sehr, Ihr Zimmer, Sir“, da ließ er sich nichts anmerken, falls ihn der Anblick in irgendeiner Weise schockiert haben sollte.
„Dankeschön, Junge“, sagte er ruhig. Dann lächelte er. „Aber den Sir, den lass mal ruhig weg. Ich vermute, ich bin gar nicht so viel älter als du.“
Ich schluckte. Und dann sprudelte aus mir die dumme Frage hervor, die ich schon die ganze Zeit über auf der Zunge gehabt hatte: „Bist du – bist du Winnetou?“
Ein leichter Schatten flog über sein Gesicht. „Der Cincakize, der Apache? Nein. Winnetou ist tot. Schon seit Jahren.“ Er warf sein Reisebündel auf das alte Sofa, aus dem prompt eine Staubwolke aufstieg. „Ich werde Wanbeli-teca genannt. In der Sprache der Bleichgesichter heißt das so viel wie Junger Adler.“
„Wa-bli-te-tscha ...“, versuchte ich. Dann gab ich auf. „Ich werde Junger Adler zu dir sagen, wenn es dir recht ist. Das andere ist zu schwer für mich. Ich bin Fred. Fred O’Connor.“
„Fe-do-ko...“, sagte der Junge Adler, und ich bin mir fast sicher, dass er sich ein wenig über mich lustig machte. „Ich werde Natah-luta zu dir sagen, das ist einfacher für mich.“
„Was heißt ...?“ Ich spürte, dass ich schon wieder rot wurde.
„Roter Kopf“, sagte er grinsend. Dann zog er die Tür langsam hinter sich zu. „Gute Nacht, Natah-luta“, hörte ich noch. Dann stand ich allein auf dem dunklen Flur mit meinem glühenden Kopf.
„Gute Nacht, Junger Adler“, murmelte ich.
Wind in den Dünen
Am nächsten Tag war natürlich der Junge Adler das große und einzige Gesprächsthema in ganz Kitty Hawk.
„Habt ihr schon gehört, ein echtes Goldnugget, so groß wie ein Taubenei ...“, hörte ich Ellen Bender hinter vorgehaltener Hand zischen.
„Möchte nicht wissen, wo der Bursche das herhat“, brummte Joe Frazer verdrossen. „Unsereins rackert sich sein Leben lang ab und bringt es zu nichts, und diesen Wilden fällt es einfach in den Schoß.“ Joe Frazer war damals beim Goldrausch in Alaska mit dabei gewesen, aber außer ein paar erfrorenen Zehen und seiner verwünschten Trunksucht hatte er nichts mit nach Hause gebracht.
„Na, die Tates werden jedenfalls ihr Auskommen haben mit so einem Gast“, lästerte Missis Jones. „Ich sag’s ja immer, der Teufel macht immer auf den größten Haufen.“
Natürlich sagte sie nicht macht, sie sagte ein anderes Wort, aber das schreibe ich hier nicht hin. Um ehrlich zu sein, ich war ziemlich entsetzt, dass die fromme alte Frau so ein schlimmes Wort überhaupt kannte.
Ich ging weiter und tat so, als hätte ich nichts gehört. Aber im Weggehen blieb mir dann doch noch Will Tanners Stimme im Ohr hängen: „Und recht ist es doch nicht, dass so ein Wilder so viel Gold mit sich herumträgt, während ein anständiger Christenmensch darben muss.“ Will Tanner hatte schon wieder ordentlich einen im Kahn. Er lallte, wie er es meistens tat, deshalb war ich nicht ganz sicher, ob er am Ende wirklich gesagt hatte: „Na, der Kerl soll mir mal im Dunkeln begegnen.“ Aber später, als ich ein bisschen darüber nachgedacht habe, war mir doch klar, dass er genau das gesagt hatte.
Ich half Mister Tate und der Mannschaft beim Verladen der Sachen, die sie mit nach Norfolk nehmen sollten. Dann legte das Postboot ab, und wir würden es wohl für zwei Wochen nicht wieder sehen.
Der Indianer war nicht mehr auf seinem Zimmer, als ich zurück in die Poststation kam. Und als ich Missis Tate fragte, wohin der Junge Adler gegangen war, meinte sie nur: „Wer? Ach, der. Keine Ahnung, der ist schon früh raus. Ohne Frühstück.“
Ich fand ihn schließlich am Meer. Und das war komisch, wie er da so stand und aufs Wasser hinausblickte. Ich meine, was wollte er da am Meer? Wie er so dastand, vollkommen unbewegt, nur sein langes schwarzes Haar flatterte im Wind, ganz so wie die Mähne eines wilden Pferdes, und sein Büffelhemd blähte sich in den heftigen Böen und sah aus wie ein großes helles Segel. Manchmal bückte er sich und hob etwas Sand auf. Den ließ er dann durch die Finger rinnen und sah zu, wie die Körner weit davonflogen.
Ich duckte mich tief in den Strandhafer. Dann, als der Junge Adler sich auf den Weg in die Dünen machte, folgte ich ihm in großem Abstand. Was tat er da nur? Wenn er, wie Witwe Murdoch befürchtete, einen Überfall auf Kitty Hawk plante, dann war er inzwischen viel zu weit weg vom Dorf. Und da oben auf den Hügeln und zwischen den trockenen Strandgrasbüscheln gab es weiß Gott nichts zum Plündern, Rauben, Morden, Sengen und Brandschatzen. Überhaupt – wo waren seine Leute? Ganz allein konnte er selbst so ein kleines Nest wie Kitty Hawk nicht überfallen wollen. Nicht einmal die Witwe Murdoch konnte das ernsthaft glauben.
Da, nun stand er oben auf dem Kamm der höchsten Düne. Er breitete die Arme aus und ließ sich den Wind ins Gesicht wehen. Da oben herrschte eine steife Brise, noch heftiger als hier unten im Gras, und ich musste fast befürchten, dass es ihn von dort oben wegpustete. Aber er stand einfach nur da, die Arme weit ausgebreitet, und als der Wind jetzt wieder in sein Büffelhemd griff, da sah es nicht mehr aus wie ein Segel, nein, wie Flügel sah das aus, wie ein junger Adler, der oben im Horst an der Felswand hockt und die Flügel ausbreitet, und gleich wird er sich hinabstürzen in den Abgrund und zum ersten Mal im Leben fliegen.
Dann ging er weiter. Immer weiter auf dem Kamm der Düne entlang, dann wieder runter ins Tal, hoch auf einen neuen Hügel. Und immer wieder riss er Büschel des Strandgrases aus und ließ sie fliegen, sah ihnen hinterher und beobachtete, wo sie landeten. Und noch etwas sah ich: Wann immer eines der Büschel gelandet war, dann zog er ein kleines Notizbuch unter seinem Hemd hervor und kritzelte mit einem Bleistift etwas hinein.
Jetzt, wo ich das alles hier aufschreibe, muss ich mich ein wenig darüber wundern, dass ich mich gar nicht wunderte darüber, dass der Junge Adler offenbar schreiben konnte. Ich wunderte mich nur darüber, wie er in den Dünen hin und her stieg, und ich fragte mich, was er dort suchen mochte. Und es dauerte eine Weile, bis es mir klar wurde: Es war der Wind, den er suchte. Warum auch immer. Wenn man wie ich in Kitty Hawk aufgewachsen ist, will einem das erst gar nicht so recht in den Kopf passen, dass sich jemand für den Wind interessierte. Ich meine, ernsthaft jetzt, was konnte schon so Besonderes daran sein, wie es bei uns in den Dünen wehte und brieste? Das hatten wir den ganzen Tag lang, das ganze Jahr über heulte der Wind dort herum. Draußen auf dem Meer, ja, das lasse ich noch gelten. Die Fischer mussten immer wissen, woher der Wind wehte. Aber in den Dünen? Da nützte er nicht einmal was. Und im Herbst ging es bald wieder richtig los mit den Stürmen. Das war ein Ärgernis manchmal. Aber das war normal, keiner von uns hatte je einen Gedanken auf den Wind vor unserer Haustür verschwendet. Und nun kam dieser rote Postboot-Passagier hierher, ließ büschelweise Gras durch die Luft wehen und ... Und was eigentlich?
Der heisere Schrei eines Seeadlers lenkte mich ab. Eben zog das gewaltige Tier über uns hinweg, ein schwarzer Schatten mit breiten, weit ausgespannten Flügeln. Trotz des Sturms, der hier unten in wilden Böen am Strandhafer riss, schien das Tier dort oben fast unbewegt. Die Flügel ausgebreitet, starr und breit wie ein schwarzes, fliegendes Brett, glitt er dort gemächlich über den Himmel, stieg langsam höher, als hätte er eine Ewigkeit lang Zeit, immer am Rand des Sturms entlang, und ließ sich vom Wind aufwärts tragen.
Meine Augen suchten den Jungen Adler. Aber sosehr ich auch die Düne absuchte, auf der er eben noch gestanden hatte – der Indianer schien plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Wo um alles in der Welt ...?
„An einen Indianer kannst du dich nicht anschleichen, Natah-luta“, sagte plötzlich eine Stimme hinter mir.
Mein Herz wäre fast stehen geblieben.
„Jesses! Hast du mich erschreckt!“, entfuhr es mir. Ich spürte, wie ich schon wieder rot wurde. „Ich habe dich gesucht“, gab ich zu. „Und du? Was suchst du hier in den Dünen?“
Der Junge Adler blickte hoch zu dem mächtigen Raubvogel, der über uns seine Kreise zog. Seine Augen hatten einen seltsamen Glanz angenommen.
„Ich suche das da“, sagte er leise.
„Den Adler?“
„So ähnlich.“
Wir stapften am Ufer entlang, immer hart an der Wasserkante, aber der Junge Adler hatte das besondere Talent, dass das Meer seine Mokassins nie berührte, auch wenn die Wellen jetzt wegen der herannahenden Flut immer höher und höher am Strand hinaufleckten. Ich beschattete meine Augen mit der Hand und schaute aufs Meer hinaus. Meine Brüder George und Patrick waren irgendwo da draußen mit ihrem Fischerboot. Doch der Junge Adler schaute nicht auf die Wellen. Er behielt nur immer den Seeadler im Auge, wie er mit starren Flügeln am Rand des Windes immer weiter aufwärts glitt.
„Die Leute im Ort reden über dich“, sagte ich.
„So?“
„Ja. Es gab noch nie einen Indianer in Kitty Hawk.“
Als sei er gegen eine Mauer geprallt, blieb der Junge Adler plötzlich stehen. Seine schwarzen Augen funkelten mich drohend an, und fast hatte ich Angst, dass er mich skalpieren wollte. Ich wich zurück. Doch dann verschwand das Glühen aus seinen Augen wieder, und sein Gesicht nahm den alten gleichmütigen Ausdruck an. Aus schmalen Augen beobachtete er weiter den Aufstieg des Seeadlers.
„Hab ich ... etwas Falsches gesagt?“, fragte ich.
Er lächelte nachsichtig. Wie wenn einer ein Kind ansieht, das etwas Dummes getan hatte. Oder das gerade Bonbons gemopst hatte.
„Das hier war alles früher Indianerland. Bevor die Weißen kamen. Der Stamm, der früher hier gelebt hat, hat an diesem Strand im Herbst immer Gänse gejagt. Die roten Männer nannten das Land hier Chiceawk. Das heißt so viel wie Gänsejagdrevier. Aber die alten Jäger sind verschwunden. Sie sind lange tot. Nur den Namen habt ihr noch behalten für diesen Ort.“
„Oh.“
Wir gingen schweigend weiter. Jetzt im Herbst war die Saison für die Gänsejagd, und es waren auch schon einige Schwärme bei uns gelandet und wieder weitergezogen. Konnte durchaus sein, dass diese – wie hatte er sie genannt? Killy-Honk-Indianer? – hier gute Beute gemacht hatten. Aber, hol’s der Teufel, der Junge Adler war doch nicht die weite Strecke übers Meer gekommen, um hier am Arm der Welt auf dem verlorenen Land seiner Vorfahren ein paar Gänse zu schießen. Das konnte er dort, wo er herkam, bestimmt tausendmal bequemer haben. Wo immer das auch sein mochte.
Wieder starrte er angestrengt in den Himmel. Hochfliegende weiße Federwolken kamen vom Meer aus auf uns zu. Der Wind, der sie vor sich hertrieb, musste ein ganz ordentliches Tempo haben, und er zerfieserte und zerfaserte sie in winzig kleine Fetzen.
Der Junge Adler befeuchtete seinen Zeigefinger mit Spucke und hielt ihn in die Luft. Er nickte befriedigt, wie jemand, der es sich schon immer gedacht hatte, dass hier ein starker Westwind weht. Wieder rupfte er ein paar Grashalme aus und ließ sie über den Strand fliegen, machte dann eine Notiz in seinem Büchlein und sah sich suchend um. Dann begann er, den nächsten Dünenhang zu erklimmen. Und plötzlich wusste ich, was Steuermann Pete gemeint hatte, als er sagte, der Indianer habe so verdammt entschlossen ausgesehen. Die Art, wie sich sein Unterkiefer vorschob, die Art, wie er aus schmalen Augenschlitzen den Hügelkamm fixierte, die festen, sicheren Schritte, mit denen er sich zum Gipfel nach oben kämpfte, all das zeigte mir ganz deutlich, dass der Junge Adler ein Ziel verfolgte, von dem er sich nicht abbringen lassen würde. Und ich hatte inzwischen auch eine Ahnung, wo dieses Ziel lag.
„Du willst ... du willst in die Kill-the-Devil-Hills“, keuchte ich. Ich hatte Mühe, mit ihm Schritt zu halten. Dabei rannte er nicht einmal übermäßig schnell, er stieg nur zügig und sicheren Fußes den Hügel hinauf, während ich immer wieder auf dem Sand ausglitt oder über Grasbüschel stolperte.
„Die Tötet-den-Teufel-Berge? Sagt ihr so dazu?“ Der Junge Adler sprach gleichmütig, sein Atem war kein bisschen schneller geworden, trotz der Anstrengungen beim Aufstieg. Und jetzt stand er oben auf der Kuppe und blickte auf die sandigen, grasbewachsenen Hügel, die vor uns lagen.
„Ja!“, stieß ich hervor. Ich brauchte eine Weile, bis ich wieder zu Atem kam. Dann holte ich tief Luft, stolz darauf, dass es etwas gab, von dem ich als Einheimischer doch mehr wusste als er. „Das hier war nämlich früher mal Piratenland. Blackbeard, der fürchterliche Seeräuber, und seine Kumpane hausten hier in den Dünen und führten ihr wildes, gesetzloses Leben. Wann immer Soldaten und Piratenjäger sie verfolgten, tauchten sie in den Hügeln unter und waren wie vom Erdboden verschluckt. Kein Gesetzeshüter hat sie jemals gefunden.“
Der Junge Adler lächelte. „Die weißen Männer waren noch nie gut im Spurenlesen. Ein Jäger der Lakota hätte sie ganz sicher gefunden.“
Er spähte vom Hügel hinunter und prüfte gewissenhaft den Wind. Als er sah, wie weit die Grashalme davonsegelten, nickte er zufrieden. „Washté“, murmelte er leise.
„Was heißt wasch-teh?“
„Sehr gut.“
„Das da unten war aber gar nicht gut. Es war ein Ort für Gesetzlose. Diebe und Mörder. Und Blackbeard, der Piratenkapitän, war obendrein auch noch total verrückt. Wenn er zusammen mit seinen Seeräubern ein Schiff überfiel, weißt du, was er dann gemacht hat? Er steckte sich Lunten in seinen schwarzen Bart. Und die hat er dann angezündet. Wenn er so von Rauch und Feuer umlodert die fremden Schiffe gestürmt hat, das muss furchtbar ausgesehen haben. Alle haben eine Heidenangst vor ihm gehabt.“
Der Junge Adler lachte leise. Dann stieg er den Dünenhang auf der anderen Seite wieder hinab und steuerte den nächsten Sandhügel an.
„Dann ist hier unten ein Handelsschiff gestrandet“, erzählte ich weiter. „Es war Sturm. Der Segler hatte überhaupt keine Chance. Der Wind und die Wellen haben das Schiff auf den Strand geworfen und es zerbrochen. Da witterten die Räuber natürlich sofort fette Beute. Sie kamen heran und wollten das Schiff ausplündern und die Seeleute umbringen. Aber die haben sich gewehrt und aus allen Rohren zurückgeschossen. Mindestens einer der Seeräuber, sagt man, kam dabei ums Leben. Und er soll hier in den Dünen immer noch spuken. Die anderen sind geflohen. Seitdem heißt das Land dort hinten Kill-the-Devil-Hills. Die Piraten hat man seitdem nicht mehr gesehen. Aber es geht das Gerücht um, dass der alte Schwarzbart hier seinen Schatz zurückgelassen hat, den niemand finden kann.“
Der Junge Adler hatte mir höflich zugehört, seine Geschwindigkeit jedoch nicht verringert. Er schritt voran mit der gleichen Entschlossenheit, mit der er auf dem Postschiff wohl auch der Seekrankheit getrotzt hatte. Schließlich hatte er den Fuß des Hügels erreicht und wandte sich mit zügigen Schritten der schmalen Schneise zwischen zwei weiteren Dünen zu. War es der Schatz des Piraten, den er suchte? Ich schüttelte den Kopf, als mir der Gedanke kam. Der Indianer trug einen Beutel mit taubeneigroßen Goldnuggets am Gürtel und gab die Dinger weg, als wär’s ein Mäusedreck, da würde er sich kaum für zusammengeraubten Piratenplunder interessieren. Es war der Wind, den er suchte, das war mir schon klar geworden. Aber was bezweckte er an seinem Ziel?
Vor uns öffneten sich die Dünen. In endloser Weite, mehr als hundert Meilen lang und vollkommen offen, breitete sich vor uns erneut der Strand aus. Eine schier grenzenlose helle Fläche unter dem Wind.
„Uff!“
Der Junge Adler war stehen geblieben. Ich musste gar nicht mehr neben ihn treten und sehen, was er sah. Natürlich, ich hatte es ja irgendwie geahnt. Vor uns der weite, flache Strand. Linker Hand der gut vierundzwanzig Meter hohe Berg, die höchste Erhebung der Kill-the-Devil-Hills. Wir nannten ihn schlich den Kill-the-Devil-Hill. Und dort, flach in die Dünen hinein gekauert und vom Sand der vergangenen Monate fast vollkommen zugeweht, die Holzhütte und der alte Wellblechschuppen der verrückten Brüder. Ich war wirklich blind gewesen.
„Washté“, flüsterte er. „Lilla washté. Sehr gut.“ Und die Art, wie er jetzt zügig und zielstrebig auf die Reste des alten Camps zuschritt, zeigte mit, dass er die ganze Zeit über genau gewusst hatte, wonach er suchte.
Der Schuppen war leer. Als der Junge Adler die Tür zu der großen Wellblechbaracke aufstieß, flutete grelles Sonnenlicht hinein. Staub und Sand tanzten in der Luft wie der Goldstaub des irren Piraten. Es sah irgendwie unwirklich aus, ein bisschen wie verzaubert. Sehr schön. Aber es war auch unheimlich, wie sich die Schatten im hinteren Bereich zusammenzogen, wo das Licht nicht hinkam, wie ein Geheimnis, das die leere Baracke für sich behalten wollte.
Der junge Adler stapfte durch den feinen Sand, der sich am Boden der Halle fast knöcheltief angesammelt hatte. Seine Fußstapfen waren tief und seltsam breit wie die Spur eines Fabelwesens. Das Quietschen und Kreischen der Blechtür, die vom Wind in den Angeln hin und her geworfen wurde, machte, dass sich mir die Haut auf dem Rücken unangenehm zusammenzog, und die Art, wie das Wellblechdach über uns im Sturm bebte und das Echo zurückwarf, war einfach zu gruselig. Doch den Jungen Adler schien das nicht zu stören. Seine Augen leuchteten, als er durch die Halle schritt, und sein Gesicht glänzte. Hatte man nicht immer gesagt, dass sich die Roten Freude oder Schmerz gar nicht anmerken lassen dürfen? Immer nur ein unbewegtes Pokerface zeigen, egal wie es in ihnen aussah. Der Junge Adler schien davon nichts zu wissen. Oder es war ihm egal. Als er in der Mitte der Halle angelangt war, breitete er die Arme aus und drehte sich einmal um die eigene Achse.
„Sieh dir das an, Natah-luta. Hier ist der Ort, an dem das große Geheimnis wahr wird. Der Mensch wird fliegen wie ein Adler, kleiner Bruder. Das ist es, was der Große Geist beschlossen und in unsere Hand gegeben hat.“
Ich dachte an die beiden verrückten Fahrradhändler, die im vergangenen Jahr hier versucht hatten, sich auf alle möglichen und unmöglichen Arten den Hals zu brechen. In deren Augen hatte ich genau den gleichen unheimlichen Glanz gesehen wie jetzt in den Augen des Jungen Adlers. Ich holte tief Luft. Wie er dastand, mitten in dem Wellblechschuppen, mit weit ausgebreiteten Armen, umstrahlt von dem gelben, scharfgeschnittenen Sonnenlicht, in dem die Staubkörner noch immer auf und ab tanzten, dazu das Scheppern und Donnern der Tür und das Heulen des Windes in dem bebenden Blechdach, da musste ich an die Geschichte von Moses denken, die uns Reverend Allan in der Sonntagsschule erzählt hat. Der muss da nämlich genau so gestanden haben, der Moses, als er von diesem Berg runterkam und gerade mit Gott gesprochen hatte.
„Der Mensch ist kein Vogel“, sagte ich. „Kein Mensch kann fliegen wie ein Adler. Du wirst dir nur den Hals brechen.“ Das hatte Mum zu mir gesagt, als die beiden Brüder im letzten Jahr ihre Versuche begonnen hatten. Und meine Mum war eine kluge Frau.
„Das werden wir ja sehen, Natah-luta“, sagte der Junge Adler und lächelte sein nachsichtiges Lächeln. „Los, komm, lass uns nachsehen, was nebenan in der Hütte ist.“
Die Hütte war allerdings nicht ergiebiger als der Schuppen. Sie war klein, bot gerade mal genug Platz für zwei Betten oder ihre Überreste, eine Feuerstätte und ein paar Regalbretter, leer natürlich, dazu ein wackeliger Tisch, zwei Stühle, nichts weiter. Wenn der Junge Adler enttäuscht war, ließ er sich davon zumindest nichts anmerken. Im Gegenteil, er blickte all diese Dinge mit einer Achtung an, als handele es sich um heilige Gegenstände. Selbst Reverend Allan machte kein so weihevolles Gesicht, wenn er den Abendmahlskelch in beide Hände nahm und ihn hochhob.
Dann untersuchte der Junge Adler den Platz draußen. Immer wieder schritt er den Raum zwischen dem Hügel und den letzten Ausläufern der Flut ab. Da war sehr viel Platz, um sich den Hals zu brechen. Wenn auch der weiche, rieselfeine Sand bestimmt viele Stürze dämpfte und die schlimmsten Brüche verhindern würde. Doch, das hatten sich die beiden Irren schon gut ausgesucht.
Manchmal, wenn der Indianer ein Stück Treibholz fand, hob er es auf und trug es weit den Strand hinauf bis dahin, wo die Flut ganz sicher nicht mehr hinkam. Bretter, Leisten, zerbrochene Planken. Es war eine ganz ansehnliche Sammlung, die er dort aufhäufte. Er arbeitete konzentriert. Manchmal drehte er eines der gefundenen Bretter minutenlang in den Händen hin und her, bevor er sich entschied, an welcher Stelle er es ablegen wollte.