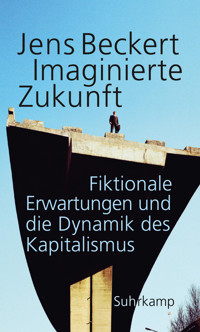
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im kapitalistischen Wirtschaftssystem richten Konsumenten, Investoren und Unternehmerinnen ihr Handeln auf die Zukunft aus. Diese birgt Chancen und Risiken, ist aber vor allem eines: ungewiss. Wie gehen die Akteure mit dieser Ungewissheit um? Ökonomen beantworten diese Frage mit verschiedenen Theorien, die auf die Berechenbarkeit des Marktes setzen. Dadurch wird die Nichtvorhersagbarkeit der Zukunft unterschätzt.
Jens Beckert nimmt die temporale Ordnung des modernen Wirtschaftslebens ernst und entwickelt einen neuen Blick auf die Dynamik des Kapitalismus. Im Mittelpunkt seiner Untersuchung stehen die fiktionalen Erwartungen der Akteure – Imaginationen und Narrative darüber, was die Zukunft bringt. Mit den Instrumenten der Soziologie und der Literaturtheorie liefert er eine umfassende Typologie dieser Erwartungen, untersucht ihre Funktionsweisen in Bereichen wie Geld, Innovation und Konsum und zeigt vor allem, wie mächtig sie sind. Fiktionale Erwartungen sind der Treibstoff der Ökonomie, können diese aber auch in tiefe Krisen stürzen, wenn sie als hohle Narrative entlarvt werden. Dann platzt die Blase. Ein fulminantes Buch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Jens Beckert
Imaginierte Zukunft
Fiktionale Erwartungen und die Dynamik des Kapitalismus
Aus dem Englischen von Stephan Gebauer
Suhrkamp
5Für Annelies und Jasper
– die so viel Glück in mein Leben gebracht haben.
9Vieles von dem, was wir erleben, hängt weniger von den tatsächlichen Umständen des Augenblicks als von den vorweggenommenen zukünftigen Ereignissen ab.
William Stanley Jevons, The Theory of Political Economy
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
7Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Motto
Inhalt
1 Einleitung
I Entscheidungen in einer ungewissen Welt
2 Die temporale Ordnung des Kapitalismus
3 Erwartungen und Ungewissheit
4 Fiktionale Erwartungen
II Bausteine des Kapitalismus
5 Geld und Kredit. Das Versprechen zukünftigen Werts
6 Investitionen. Imaginierte Gewinne
7 Innovation. Imaginationen der technologischen Zukunft
8 Konsum. Wert durch Bedeutung
III Instrumente der Imagination
9 Prognosen. Die Erschaffung der Gegenwart
10 Wirtschaftstheorien. Kristallkugeln für die Berechnung der Zukunft
11 Schluss. Die verzauberte Welt des Kapitalismus
Dank
Literatur
Register
Anmerkungen
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
9
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
111 Einleitung
Die längste Zeit in der Geschichte der Menschheit änderte sich wenig am wirtschaftlichen Wohlstand. Erst in der industriellen Revolution begann dieser dramatisch zu steigen. Die rasant wachsende wirtschaftliche Produktion brachte uns beispiellosen Reichtum (siehe Abb. 1.1). Diese Entwicklung war anfangs auf wenige europäische Länder und Nordamerika beschränkt, aber im Lauf des 20. Jahrhunderts erfasste sie fast sämtliche Weltregionen. Heute ist die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung fast der gesamten Welt von der kapitalistischen Dynamik bestimmt, in der Form von Wachstum als auch sich periodisch wiederholenden Krisen. Wie ist die außergewöhnliche Dynamik der kapitalistischen Wirtschaft zu erklären?
Die Forscher des Kapitalismus führen den rasanten Wohlstandszuwachs seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auf eine Vielzahl von Faktoren zurück, darunter technologischer Fortschritt, institutioneller Wandel, Arbeitsteilung, Ausweitung des Handels, Kommodifizierung, Wettbewerb, Ausbeutung, Wachstum der Produktionsfaktoren und kulturelle Entwicklungen.1 Die tiefen Krisen, in die der Kapitalismus wieder und wieder stürzt, werden auf Überakkumulation, Versagen der Regulierung, mangelnde Investitionen und schwachen Konsum, psychologische Faktoren sowie Fehleinschätzungen von Risiken zurückgeführt.2
So umfassend diese Erklärungen sind, lassen sie doch einen weiteren, nicht weniger wichtigen Aspekt der kapitalistischen Dynamik weitgehend außer Acht: ihre temporale Struktur. Veränderungen der zeitlichen Orientierung der Akteure und die 12Erweiterung des Zeithorizonts in eine unbekannte wirtschaftliche Zukunft sind wesentliche Bestandteile der Entstehung der kapitalistischen Ordnung und ihrer Dynamik. Das gilt für wirtschaftliche Expansions- und Krisenphasen gleichermaßen. Der Kapitalismus ist ein System, in dem die Akteure — seien sie Unternehmer, Investoren, Arbeitskräfte oder Konsumenten — ihre Aktivitäten auf eine Zukunft ausrichten, die sie als offen und ungewiss wahrnehmen, auf eine Zukunft, die sowohl unvorhersehbare Chancen als auch unkalkulierbare Risiken birgt.
Abb. 1.1: Wachstum des globalen Pro-Kopf-BIP. Datenquelle: Maddison (2001: S. 264, Schaubild B-21).
Das Wachstum von Wettbewerbsmärkten und die Ausweitung der Geldwirtschaft haben diese temporale Ausrichtung auf eine offene Zukunft in das institutionelle Gewebe von Wirtschaft und Gesellschaft eingeflochten. Aber sie ist auch in der einzigartigen Fähigkeit des Menschen verankert, sich eine zu13künftige Welt vorzustellen, die anders sein wird als die gegenwärtige. In dem Bemühen, Gewinne zu erzielen, ihr Einkommen zu erhöhen oder ihren sozialen Status zu verbessern, erzeugen Akteure Imaginationen einer wirtschaftlichen Zukunft und richten ihre Entscheidungen danach aus, ob sie diese Zukunft verwirklichen oder vermeiden wollen. Wir müssen die zeitliche Disposition der wirtschaftlichen Akteure in Bezug auf die Zukunft und die Fähigkeit, diese Zukunft mit kontrafaktischen wirtschaftlichen Imaginationen zu füllen, unbedingt berücksichtigen, wenn wir verstehen wollen, wie sich der Kapitalismus von vorhergehenden Wirtschaftsordnungen unterscheidet und wie seine Dynamik möglich wird. In diesem Buch untersuche ich die Bedeutung imaginierter Zukünfte für die Dynamik des Kapitalismus.
Die Zukunft zählt
Indem wir Bildern der Zukunft eine tragende Rolle in unserem Verständnis des Kapitalismus zuweisen, weichen wir von den Ansichten ab, die die meisten zeitgenössischen Soziologen und Politikwissenschaftler der Analyse wirtschaftlicher Abläufe zugrunde legen. In den letzten dreißig Jahren ist der Grundsatz »Die Geschichte zählt« zum Schlachtruf des historischen Institutionalismus und Teilen der Soziologie geworden. Zur Erklärung gegenwärtiger Resultate untersuchen die historischen Institutionalisten langfristige strukturelle Pfade, die Entwicklungslinien formen und gegenwärtige Entscheidungen prägen (Mahoney 2000). Die institutionellen Pfade unterscheiden sich von Land zu Land, doch es ist nicht leicht, einen einmal eingeschlagenen Pfad zu verlassen: Im Allgemeinen ändern nur externe Schocks seinen Verlauf. Die soziologischen Institutionalisten betonen zwar die Bedeutung von Kognition, richten ihren Blick jedoch ebenfalls in die Vergangenheit, indem sie den gesellschaftlichen Wandel als Prozess der isomorphen Anpassung an exis14tierende institutionelle Modelle betrachten (DiMaggio und Powell 1991).3 Politikwissenschaftler und Soziologen sind sich darin einig, dass die gegenwärtigen Ereignisse von den vergangenen Geschehnissen geprägt sind.
Aber nicht alle sozialwissenschaftlichen Disziplinen stimmen der Einschätzung zu, die Gegenwart werde im Wesentlichen von der Vergangenheit bestimmt. In seiner Auseinandersetzung mit dem Konzept der Temporalität in der Soziologie hat Andrew Abbott darauf hingewiesen, dass Soziologen und Ökonomen gegensätzliche Strategien verfolgen, um gegenwärtige Ereignisse zu erklären. »Während die Soziologen die gegenwärtigen Ereignisse als Ergebnis vergangener Geschehnisse betrachten, schließen die Ökonomen von der Zukunft rückwärts auf die Gegenwart: Die Entscheidungen werden anhand des gegenwärtigen Werts der erwarteten zukünftigen Belohnungen erklärt.« (Abott 2005: 406) Arjun Appadurai (2013: 286) sieht es ähnlich: »Die Ökonomie hat sich als wichtigstes sozialwissenschaftliches Feld etabliert, in dem modelliert und vorausgesagt wird, wie Menschen ihre Zukunft konstruieren.« Während die wirtschaftswissenschaftliche Forschung demnach die Zukunft in ihren Erklärungsmodellen berücksichtigt (siehe Kapitel 3), ist dies in den soziologischen und politikwissenschaftlichen Analysen des wirtschaftlichen Handelns nicht der Fall. Ich argumentiere in diesem Buch, dass die Fähigkeit zur Imagination zukünftiger Zustände in der Soziologie und der politischen Ökonomie eine sehr viel größere Rolle spielen sollte, insbesondere für die Untersuchung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung.
Selbstverständlich existiert die Fähigkeit des Menschen, sich eine Vorstellung von einer möglichen Zukunft zu machen, unabhängig vom Kapitalismus. Imaginationen zukünftiger Zustände sind unerlässlich, um die Entwicklung der Moderne im Allgemeinen zu verstehen, und sie existieren (wenn auch in unterschiedlicher Form) auch in traditionellen Gesellschaften. Beispielsweise entwirft die religiöse Eschatologie Zukunftsvorstellungen, die von der wirtschaftlichen Entwicklung unabhän15gig sind. Desgleichen ist die Ausrichtung der kapitalistischen Wirtschaft auf eine offene wirtschaftliche Zukunft nicht auf die Ebene der Handlungsorientierung beschränkt: Die kapitalistische Wirtschaft institutionalisiert bestimmte Formen des systemischen Drucks, die eine temporale Ausrichtung auf wirtschaftliche Chancen und Risiken in der Zukunft erzwingt. Um den Einfluss der temporalen Ausrichtung der Akteure auf die wirtschaftlichen Abläufe wirklich verstehen zu können, müssen wir diesen institutionalisierten Druck genau untersuchen.
Im Kapitalismus erzwingen insbesondere zwei institutionelle Mechanismen eine Ausrichtung der Akteure auf die Zukunft: Wettbewerb und Kredit. Der mit der Ausbreitung des Wettbewerbs auf dem Markt einhergehende unablässige Wandel der Umwelt zwingt die Akteure, wachsam zu bleiben und auf Bedrohungen anderer Akteure zu reagieren, die von den gängigen Praktiken abweichen. Sie müssen nach neuen Chancen Ausschau halten und andere Wege suchen, um sich gegen die wahrgenommenen Bedrohungen zu wehren. Sie müssen sich unentwegt weiterentwickeln, um nicht zurückzufallen. Der Wettbewerb zwingt die Unternehmen, ihre Produktion effizienter zu gestalten und unablässig neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wenn ein Unternehmen seine Produktivität erhöht und neue Produkte anbietet, zwingt es seine Konkurrenten, ebenfalls Innovationen voranzutreiben, ihre Produktionsmethoden effizienter zu gestalten und noch bessere Produkte zu entwickeln. Der Wettbewerbsdruck ist auch auf die Beschäftigten übertragen worden, deren berufliche Aussichten und sozialer Status von ihrem Erfolg auf dem Arbeitsmarkt abhängen. Der Wettbewerb zwingt sie, neue Erfordernisse auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen sowie markttaugliche Fähigkeiten zu erwerben und zu erhalten (Kapitel 6). Der Druck wird ebenfalls auf die Konsumenten ausgeweitet, die ihren sozialen Status durch den Erwerb immer neuer Konsumgüter bekräftigen (Kapitel 8).
Die »expansive Dynamik des Kapitalismus« (Sewell 2008) wird darüber hinaus durch die Kreditfinanzierung der Investi16tionen institutionalisiert. Kredit verschafft wirtschaftlichen Akteuren den Zugang zu Ressourcen, auf die sie keinen »normalen Anspruch« haben (Schumpeter [1912] 2006: 214). Begründet wird der Anspruch nur durch den zukünftigen Erfolg. Der Kredit ist eine tragende Säule des kapitalistischen Wachstums, denn er gibt den Unternehmen die Möglichkeit, ansonsten unmöglichen wirtschaftlichen Aktivitäten nachzugehen, indem sie in der Gegenwart Geld einsetzen, das sie erst noch verdienen müssen. Gleichzeitig zwingen die Zinsen, die für die Kredite zu zahlen sind, die Unternehmen, Produkte zu erzeugen, deren Marktwert die Kosten der zu ihrer Erzeugung erforderlichen Investitionen übersteigt. Den »Anspruch« auf Kapital muss man durch eine Vergrößerung des wirtschaftlichen Werts erwerben. Auf diese Art eröffnet der Kredit Wachstumschancen und erzwingt zugleich das Wachstum. Unternehmen, die nicht imstande sind, ausreichende Überschüsse zu erwirtschaften, verlieren den Zugang zu Kreditkapital und werden schließlich aus ihrem Markt gedrängt.
Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Wettbewerb sowie das Finanzsystem eröffnen Chancen und erfordern gleichzeitig dynamische Veränderungen. Die Akteure sind gezwungen, den Chancen nachzugehen, die sie in der imaginierten Zukunft sehen. Diese »Rastlosigkeit« (Sewell 2008) sorgt für ein »dynamisches Ungleichgewicht« in den kapitalistischen Volkswirtschaften (Beckert 2009), welches durch die dezentralisierten Entscheidungen der Marktteilnehmer, die innerhalb der institutionellen Grenzen von Wettbewerbsmärkten und Geldwirtschaft handeln, in Bewegung gehalten wird. Die kapitalistischen Volkswirtschaften destabilisieren und stabilisieren sich selbst, indem sie ihre historisch gewachsene Struktur ständig aushöhlen: Die Unternehmen suchen unermüdlich nach neuen Möglichkeiten, Gewinne zu erzielen, ihre Beschäftigten versuchen, auf der Karriereleiter nach oben zu klettern, die Verbraucher streben nach neuen Konsumerfahrungen. Um in einer Umgebung zu überleben und Erfolg zu haben, deren gegenwärtige Gestalt nicht lan17ge Bestand haben wird, müssen Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Konsumenten ihren Blick unablässig in eine ungewisse Zukunft richten.
Obwohl die Ausrichtung auf die Zukunft ein grundlegender Bestandteil des Kapitalismus ist, spielt sie in der Erforschung des Kapitalismus keine zentrale Rolle. Sie wird in der populären Kultur sehr viel häufiger aufgegriffen als in den Sozialwissenschaften. Der »amerikanische Traum« ist die vielleicht bedeutsamste kulturelle Ausprägung von Zukunftsimaginationen, die sich auf die wirtschaftliche Einstellung und Motivation auswirken. Der Traum von auf Chancengleichheit beruhender sozialer Aufwärtsmobilität ist ein zentraler Motivator und ein Integrationsfaktor in der amerikanischen Gesellschaft. Aber trotz der offenkundigen Bedeutung solcher Zukunftsbilder sind nur wenige Soziologen zu dem Schluss gelangt, dass diese Imaginationen ein zentraler Bestandteil der kapitalistischen Dynamik sind. Zwei wichtige Ausnahmen sind Max Webers Untersuchungen der protestantischen Ethik ([1920] 1986) und Pierre Bourdieus Analysen (2000, 2010), insbesondere seine Darstellung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels in Algerien Mitte des 20. Jahrhunderts (siehe Kapitel 2). Gelehrte aus anderen Fächern haben sich mit der Rolle von Zukunftsbildern im Allgemeinen und der Rolle der Imaginationen im Besonderen befasst. In der Wirtschaftswissenschaft hat George Shackle (1979) der wirtschaftlichen Funktion der Imaginationen eine herausragende Bedeutung beigemessen und damit viele der in diesem Buch vorgebrachten Argumente vorweggenommen. In jüngster Zeit hat Richard Bronk (2009) die These aufgestellt, dass unsere Vorstellungen von der unbestimmten Zukunft wesentlich zur Strukturierung unseres wirtschaftlichen Verhaltens beitragen. Bronk setzt sich eingehend mit den Arbeiten wichtiger Ökonomen und Philosophen seit der Aufklärung und mit der Rolle der Imaginationen in ihrem Denken auseinander. Der Anthropologe Arjun Appadurai (1996, 2013) hat die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung fiktionaler Zukunftserwar18tungen für die Entstehung des modernen Subjekts und für die politische Partizipation gelenkt. Benedict Anderson beschäftigt sich in seinem mittlerweile klassischen Werk Die Erfindung der Nation (2005) mit der Rolle von Imaginationen im Prozess der Nationenbildung, aber er konzentriert sich nicht auf die Zukunft, sondern auf Vergangenheit und Gegenwart. Es hat auch Versuche gegeben, das Konzept der imaginierten Zukunft in die allgemeine Soziologie einzuführen (siehe Kapitel 3).4 Hier sind insbesondere die Arbeiten von Alfred Schütz (1971), Niklas Luhmann (1990) und Cornelius Castoriadis (1984) zu nennen. In jüngerer Zeit hat Ann Mische (2009, 2014) das Projekt einer Soziologie der Zukunft in Angriff genommen und diejenigen soziologischen Ansätze kritisiert, die das gegenwärtige Handeln der Menschen ausschließlich im Licht der vergangenen Geschehnisse erklären.5 Schließlich findet in einigen soziologischen Spezialgebieten eine intensive Auseinandersetzung etwa mit der Frage statt, wie sich Vorstellungen von der Zukunft auf die Entstehung neuer Technologien auswirken (siehe Kapitel 7). Diese entwickeln sich auf der Grundlage von Imaginationen weiter, die »eine kulturelle Ressource sind, die eine neue Lebensführung ermöglichen, indem sie positive Ziele projizieren und versuchen, diese zu erreichen« (Jasanoff und Kim 2009: 122).
In diesem Buch argumentiere ich gestützt auf diese grundlegenden Beiträge, dass Imaginationen der Zukunft ein unverzichtbares Element der kapitalistischen Entwicklung sind, und dass die kapitalistische Dynamik von den Zukunftserwartungen abhängt. Selbstverständlich sind die institutionellen Pfade, die aus der Vergangenheit in die Gegenwart führen, relevant, aber ausgehend von den zuvor erwähnten Beiträgen wären die Soziologen gut beraten, der Zukunft und insbesondere den Vorstellungen, die sich die Akteure davon machen, größere Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei sind die temporale Ausrichtung der Akteure und ihre Vorstellungen von der Zukunft weit über den in diesem Buch untersuchten Bereich der Wirtschaft hinaus bedeutsam und könnten zur Grundlage eines neuen sozio19logischen Paradigmas werden. Dies ist die zentrale Hypothese dieses Buches: »Die Geschichte zählt«, aber die Zukunft ist nicht weniger wichtig.
Mikrogrundlagen
Die Untersuchung wirtschaftlicher Phänomene ist ein wichtiger soziologischer und politikwissenschaftlicher Forschungsbereich. Aber die Wirtschaftssoziologen und die politischen Ökonomen wählen oft unterschiedliche Analyseebenen. Die Wirtschaftssoziologen untersuchen zumeist die »Einbettung« des wirtschaftlichen Handelns, um zu zeigen, dass wirtschaftliche Resultate nur im Kontext des sozialen Lebens — in ihrer Beziehung zur Gesellschaftsstruktur, zu den Institutionen und zur Kultur — erklärt werden können, und um herauszuarbeiten, wie das soziale Leben die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die Überzeugungen der Akteure prägt. Oft wird Einbettung als Mittel zur Verringerung von Ungewissheit betrachtet. Die Wirtschaftssoziologie konzentriert sich auf die Analyse der Mikro- und Mesoebene und arbeitet häufig mit Fallstudien, die Aufschluss über die unterschiedlichen Formen der Einbettung des wirtschaftlichen Handelns in einem konkreten Bereich der zeitgenössischen Wirtschaft geben.
Im Gegensatz dazu zielt der Zugang der politischen Ökonomie auf die Erklärung der Phänomene auf der Makroebene. Untersucht wird die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung in ihrer Beziehung zum Staat und zu den vorherrschenden Interessengruppen. In zahlreichen einschlägigen Studien wurde versucht, die institutionellen Unterschiede zwischen den entwickelten kapitalistischen Systemen und die makroökonomischen Auswirkungen dieser Unterschiede zu erklären (Hall und Soskice 2001b). In jüngerer Zeit weckt die Untersuchung des Kapitalismus als solchem (erneut) beträchtliches Interesse (Streeck 2011).
20Einige institutionentheoretische Ansätze der politischen Ökonomie beruhen auf der Annahme, zur Beschreibung von Veränderungen auf der Makroebene — im Rechtswesen, in der Konsumnachfrage, in der Inflation, in der Verteilung des Wohlstands oder in den Technologien — sei keine spezifische Untersuchung des Verhaltens der Akteure erforderlich (Thelen und Steinmo 1992). Mit anderen Worten: Diese Autoren sehen keine Notwendigkeit, auf die sozialen Interaktionsprozesse einzugehen, die den beobachteten Entwicklungen auf der Makroebene zugrunde liegen. Beispielsweise werden individuelle Entscheidungen und kollektive Ergebnisse unter Rückgriff auf die Verteilung von Machtressourcen erklärt (Hall und Taylor 1996; Korpi 1985). In anderen Theorien zur politischen Ökonomie spielen die mikroökonomischen Grundlagen der wirtschaftlichen Dynamik sehr wohl eine Rolle, aber sie beruhen auf der Annahme, die Akteure handelten durch und durch rational oder folgten kognitiv determinierten Skripten (Hall und Taylor 1996; Korpi 1985; McDermott 2004; Shepsle 2006).
Die von der politischen Ökonomie untersuchte kapitalistische Entwicklung ist auch das Thema dieses Buches,6 jedoch liefert es weder eine neue strukturelle Erklärung der kapitalistischen Dynamik noch eine verfeinerte rationale Entscheidungstheorie, eine Verhaltenstheorie oder eine Machtressourcentheorie. Stattdessen untersuche ich, wie die Makrodynamiken in der sozialen Interaktion und den Interpretationen der gesellschaftlichen Wirklichkeit verwurzelt sind. In diesem Sinn stützt sich das Buch auf jene wirtschaftssoziologischen Untersuchungen, die sich auf die Interaktionsebene konzentrieren, die aber hier lediglich der Ausgangspunkt für den Versuch ist, die kapitalistische Dynamik an sich zu verstehen und zu erklären.
Ich gehe also von einer Mikroperspektive aus und nutze die Handlungstheorie als Ausgangspunkt. Jede Analyse der kapitalistischen Dynamik, die der Offenheit der Zukunft Rechnung trägt, muss, so behaupte ich, von den sozialen Interaktionen in der Wirtschaft ausgehen. Eine Analyse von Zukunftsimagina21tionen als Quelle der kapitalistischen Dynamik hat sich auf die sozialen Interaktionen zu konzentrieren, die sowohl den Expansionsphasen als auch den plötzlichen Krisen der kapitalistischen Volkswirtschaften zugrunde liegen. Die Zukunft findet durch die in den Akteuren verankerten Vorstellungen von der sozialen Welt Eingang in die sozialen Interaktionen, wobei diese Vorstellungen sozial geformt werden und daher nicht als rein individuelle betrachtet werden dürfen.
Um ein Verständnis der kapitalistischen Dynamik auf der Mikroebene zu entwickeln, bedarf es eines interpretativen Ansatzes, der es uns ermöglicht, Wirtschaftssoziologie und politische Ökonomie zusammenzuführen. Dafür können wir im Wesentlichen in der Soziologie entwickelte Instrumente verwenden, untersuchen damit jedoch eine Frage, die in der gegenwärtigen Forschung vor allem in der politischen Ökonomie behandelt wird.
Das impliziert, dass dieses Buch auch an ökonomische und politikwissenschaftliche Ansätze anknüpft, die versuchen, die Mikrofundamente makroökonomischer Prozesse herauszuarbeiten. Makroökonomische Entwicklung und kapitalistische Dynamik können jedoch nicht in der Theorie rationalen Handelns verankert werden (vgl. Kapitel 3). Die Annahme, Entscheidungen in wirtschaftlichen Kontexten könnten als Ergebnisse rationaler Kalkulation verstanden werden, die auf vollkommener Kenntnis aller (verfügbaren) Informationen beruhen, ist weithin kritisiert worden. Ein wichtiger Einwand gegen diese Annahme betrifft die Frage der Ungewissheit: Aufgrund der Komplexität von Situationen, in denen Entscheidungen gefällt werden, aufgrund unvorhersehbarer Effekte der Interaktionen, aufgrund der von nicht vorhersehbaren Innovationen geschaffenen neuen Bedingungen und aufgrund der Kontingenz der Entscheidungen anderer Akteure können zukünftige Zustände der Welt nicht vorausgewusst werden. Insbesondere unter Bedingungen des raschen wirtschaftlichen Wandels oder in Krisensituationen (Bronk 2009, 2015), die den modernen Kapitalismus ausmachen, herrscht Ungewissheit.
22Dieser Einwand gegen rationale Entscheidungstheorien unterscheidet sich von der in der soziologischen Theorie vorgebrachten Kritik, die häufig auf der Feststellung beruht, dass einige wirtschaftliche Entscheidungen eben »nichtrational« sind, das heißt auf Gewohnheit und Routineabläufen beruhen, inkonsistent oder normativ auf andere Ziele als die Nutzen- oder Gewinnmaximierung gerichtet sind (Beckert 2002). Zwar spielen Routinen, Fehler und wertrationales Handeln zweifellos ebenfalls eine Rolle in den zeitgenössischen Wirtschaftsabläufen (Beckert 1997; Camic 1986; Etzioni 1988), aber sie sind von begrenzter Relevanz, wenn unser Ziel darin besteht, ein Wirtschaftssystem zu verstehen, das die Nutzenmaximierung legitimiert und seine Akteure entsprechend sozialisiert.
Wenn Akteure jedoch zumindest beabsichtigen, zu maximieren, was sie als Nutzen verstehen, und ihre Ziele, Mittel und Bedingungen für das Handeln entsprechend abwägen, beruhen ihre Entscheidungen zwangsläufig auf der Erwartung vermuteter Ergebnisse. Erwartungen werden hier als der zukünftige Wert verstanden, den wirtschaftliche Akteure einer gegebenen Variable beimessen (vgl. auch R. Evans 1997: 401). Die Theorie des rationalen Handelns versagt nicht, weil die Akteure in Wahrheit nicht bestrebt wären, ihren Nutzen zu maximieren, sondern weil die Theorie die Konsequenzen der Ungewissheit nicht erfassen kann. Wie Theorien der begrenzten Rationalität betonen, verfügen die Akteure oft einfach nicht über ausreichende Informationen oder Berechnungskapazitäten, um Entscheidungen fällen zu können, die ihren Nutzen optimieren würden. Unter Bedingungen von Ungewissheit kann man die Parameter und Wahrscheinlichkeiten, die eine Wahl des optimalen Vorgehens ermöglichen würden, nicht kennen.
Seit Frank Knight ([1921] 2006) die Unterscheidung zwischen Risiko und Ungewissheit eingeführt hat, ist Ungewissheit ein wichtiges Konzept in der Mainstream-Ökonomie, aber auch ein wichtiger Bezugspunkt für abweichende Meinungen in Ökonomie und Wirtschaftssoziologie.7 Ausgehend von der Annah23me, dass die optimale Entscheidung berechnet werden kann, hat die Mainstream-Ökonomie alle ihre Bemühungen auf die Entwicklung einer Konzeption gerichtet, welche Ungewissheit — im von Knight definierten Sinn — ausschalten kann, indem sie sie auf ein berechenbares Risiko reduziert (Beckert 1997, Hodgson 2011). Hingegen erklären Wirtschaftssoziologen und Verfechter heterodoxer Ansätze in den Wirtschaftswissenschaften, die Berücksichtigung von Ungewissheit habe sehr viel größere Auswirkungen als von der herkömmlichen Ökonomie eingestanden und könne ein neues Verständnis wirtschaftlicher Phänomene ermöglichen.
Fiktionale Erwartungen
In diesem Buch nutze ich die Erkenntnisse über die Grenzen der rationalen Entscheidungstheorie in von Ungewissheit gekennzeichneten Situationen als Ausgangspunkt für eine Theorie der kapitalistischen Dynamik. Wenn das Handeln der Akteure auf die Zukunft gerichtet ist und die Ergebnisse dieses Handelns ungewiss sind, wie können Erwartungen dann definiert werden? Welchen Charakter haben Erwartungen unter Bedingungen der Ungewissheit? Dies ist die zentrale Frage, um deren Beantwortung es im Folgenden gehen wird. Wenn wir Ungewissheit ernst nehmen, anstatt sie mit dem Risiko gleichzusetzen, wird klar, dass Erwartungen nicht auf probabilistischen Einschätzungen zukünftiger Zustände der Welt reduziert werden können. Angesichts echter Ungewissheit dient eine Erwartung als Interpretationsrahmen, der eine Situation durch die Imagination von zukünftigen Zuständen der Welt und von Kausalbeziehungen anscheinend beherrschbar macht. Erwartungen werden auf Grundlage der Imaginationen der Akteure bestimmt.
Der Begriff der »fiktionalen Erwartung« bezieht sich auf die Bilder, die ein Akteur in seiner Vorstellung heraufbeschwört, 24wenn er über zukünftige Zustände der Welt nachdenkt, auf die Art, wie er sich die Kausalbeziehungen und die Handlungen ausmalt, mit denen er die Ergebnisse beeinflussen will. Der Begriff beinhaltet auch die über die materiellen Eigenschaften hinausgehenden symbolischen Charakteristika, die Akteure Gütern zuschreiben. Dies ist oft ein Merkmal der Beziehung von Akteuren zu Konsumgütern, aber es gilt auch für die Zuschreibung von Wert zu Dingen, die als Geld zirkulieren. Imaginationen zukünftiger Situationen und der dazu führenden Kausalbeziehungen sowie die Gütern zugeschriebenen symbolischen Eigenschaften dienen Akteuren als Interpretationsrahmen, die sie verwenden, um sich trotz der Unberechenbarkeit der Ergebnisse entscheiden zu können.
Wie wir in Kapitel 4 im Einzelnen sehen werden, sollte der Begriff »fiktional« nicht so verstanden werden, dass solche Erwartungen beliebig oder bloße Phantasien sind. Vielmehr bedeutet er, dass es sich bei Erwartungen bezüglich einer unvorhersehbaren Zukunft nicht um ein Vorauswissen handelt, sondern um kontingente Imaginationen. Von einem imaginierten zukünftigen Zustand motivierte Akteure planen ihre Aktivitäten ausgehend von dieser mentalen Repräsentation und den damit verknüpften Emotionen. Erwartungen unter Bedingungen der Ungewissheit und Gegenständen zugeschriebene symbolische Bedeutungen können als eine Art des Vorspiegelns oder als ein So-tun-als-ob betrachtet werden, das Zuversicht weckt und die Akteure dazu veranlasst, sich so zu verhalten, als ob die Imagination die »zukünftige Gegenwart« oder eine materielle Eigenschaft eines Guts wäre.8 Akteure verhalten sich so, als ob sich die Zukunft ihren Vorstellungen entsprechend entwickeln würde und als ob ein Gut die ihm symbolisch zugeschriebenen Eigenschaften tatsächlich besäße. Wirtschaftliche Entscheidungen weisen somit Merkmale von »Glauben-Machen-Spielen« auf. (Auch dieser Begriff wird in Kapitel 4 näher erläutert.)
Wie literarische Fiktionen sind auch fiktionale Erwartungen in der Wirtschaft dadurch gekennzeichnet, dass sie eine eigene 25Welt erzeugen, in die sich die Akteure hineinversetzen können (vgl. Kapitel 4). In der Entstehung fiktionaler Erwartungen findet eine »Verdopplung der Realität« statt (Luhmann 1996). Erwartungen und die Objekten zugeschriebenen symbolischen Bedeutungen sind Zukunftsbilder, an die ein Akteur glaubt und die er als Bezugspunkte für seine Entscheidungen verwendet. In der ökonomischen Praxis nehmen fiktionale Erwartungen die Form von Narrativen an und werden als Geschichten erzählt, die den Akteuren verraten, wie die Zukunft aussehen und wie sich die Volkswirtschaft ausgehend vom gegenwärtigen Zustand in Zukunft entwickeln wird. Außerdem können die Geschichten Konsumgütern eine bestimmte Bedeutung zuschreiben und sie mit immateriellen Idealen verknüpfen. Hierfür greifen Narrative auf »Instrumente der Imagination« zurück: auf Theorien, Modelle, Pläne, Vermarktungsinstrumente und Prognosen (Kapitel 9 und 10).
Das Konzept der fiktionalen Erwartungen wird hier dem der »rationalen Erwartungen« gegenübergestellt, das besagt, dass die Erwartungen von Akteuren zumindest in ihrer Gesamtheit dem statistisch erwarteten Wert einer Variable entsprechen. Der Theorie rationaler Erwartungen zufolge verwenden Akteure alle verfügbaren Informationen, weshalb die Ergebnisse nicht systematisch von den Prognosen des vorherrschenden Wirtschaftsmodells abweichen werden. Das Konzept der Fiktionalität hingegen rückt die Offenheit der Zukunft in den Mittelpunkt, die dafür sorgt, dass alle Erwartungen kontingent sind. Die Kontingenz widerspricht der Möglichkeit, die Erwartungen seien in ihrer Gesamtheit zutreffend: Das Konzept der fiktionalen Erwartungen steht auch insofern im Gegensatz zu dem der rationalen Erwartungen, als es besagt, dass unter Bedingungen der Ungewissheit sehr unterschiedliche Erwartungen existieren können, und dass es nicht möglich ist, vorab zu bestimmen, welche von ihnen zutreffend sein wird. Mit anderen Worten: Die Zukunft ist ein »mehrdeutiges Gemälde, das eine Vielzahl von Interpretationen zulässt« (DiMaggio 2002: 90).
26Implikationen für das Verständnis des Kapitalismus
Fiktionale Erwartungen haben verschiedene Auswirkungen auf die Dynamik kapitalistischer Volkswirtschaften.
Erstens helfen sie den wirtschaftlichen Akteuren, angesichts von Ungewissheit zusammenzuarbeiten: Wenn sie die Überzeugung teilen, die Zukunft werde sich in eine bestimmte Richtung entwickeln und andere Akteure würden dementsprechend ein vorhersehbares Verhalten an den Tag legen, können sie diese Erwartungen heranziehen, um ihre Entscheidungen zu koordinieren. Imaginationen der Zukunft sind also ein wesentlicher Bestandteil der Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Indem sie das Handeln koordinieren, tragen sie auch zur Dynamik des Kapitalismus bei, da übereinstimmende Erwartungen — die »Rahmenangleichung« (Benford und Snow 1992) — als Grundlage für Entscheidungen über Investitionen und Innovationen dienen.
Eine damit zusammenhängende Implikation ist, dass Erwartungen Konsequenzen in der realen Welt haben. Da sie den Akteuren helfen können, ihre Bemühungen zu koordinieren, können sie sich auf die Zukunft auswirken. In der Soziologie wird dieses Phänomen anhand des Konzepts der selbsterfüllenden Prophezeiung (heute gemeinhin als Performativität bezeichnet) beschrieben (Merton [1949] 1995). Es ist insbesondere Gegenstand von Diskussionen im Bereich der sozialwissenschaftlichen Erforschung des Finanzwesens (Callon 1998b; MacKenzie 2006). Während das Konzept der Performativität mit seiner These, die Wirtschaftstheorie gestalte die Wirtschaft, von einer Angleichung der sozialen Welt an die Theorie ausgeht, werde ich in diesem Buch zeigen, dass die performativen Effekte von Erwartungen umfassender und vielschichtiger sind. Wirtschaftstheorien sind nicht der einzig relevante kognitive Rahmen, durch den wirtschaftliche Ergebnisse beeinflusst werden, und Erwartungen führen nicht zwangsläufig zur prophezeiten Zukunft: Viel27mehr ist der Einfluss von Theorien in einer von Ungewissheit und einer offenen Zukunft gekennzeichneten Welt vielfältig und seinerseits unvorhersehbar.
Die Kontingenz von Erwartungen ist auch eine Quelle der wirtschaftlichen Innovation, bringt sie doch trotz — oder besser: aufgrund — der Ungewissheit neue Ideen hervor. Da Erwartungen nicht auf die empirische Realität beschränkt sind (obwohl die Akteure, die diese Erwartungen hegen, möglicherweise das Gegenteil behaupten), können sie eine radikale Abkehr von der Gegenwart darstellen und eine kreative und stimulierende Kraft in der Wirtschaft werden (Bronk 2009; Buchanan und Vanberg 1991; Esposito 2010). Abweichungen von etablierten wirtschaftlichen Praktiken und Technologien beruhen auf Zukunftsimaginationen.
Schließlich bringt die Kontingenz der Erwartungen die Politik der Erwartungen hervor. Auch wenn die von ihnen ausgemalte Zukunft imaginär ist, geben Erwartungen den Anstoß zu realen Entscheidungen, die Verteilungswirkungen haben und daher zum Gegenstand von Interessenkonflikten zwischen Akteuren werden können. Verschiedene Akteure versuchen, die Erwartungen zu beeinflussen, unter anderem, indem sie die sozialen und politischen Strukturen gestalten, in denen Erwartungen entstehen. Inwieweit sie in diesem Bemühen erfolgreich sind, hängt von ihren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ressourcen ab. Tatsächlich ist dies eine der Hauptaufgaben von Unternehmen und politischen Akteuren sowie ein wichtiges Ziel von Sprechakten in der Wirtschaft. Die materiellen Interessen in der Wirtschaft werden von den Erwartungen von Konkurrenten, Konsumenten, Forscherinnen, Arbeitnehmern und Arbeitgeberinnen beeinflusst, weshalb die Politik der Erwartungen ein wichtiger Bestandteil der Mikrogrundlagen der kapitalistischen Dynamik ist. Die Macht der Akteure kommt in ihrer Fähigkeit zum Ausdruck, Erwartungen zu wecken und zu beeinflussen. Somit spielen fiktionale Erwartungen eine wichtige Rolle im Konkurrenzkampf. Das widerspricht der Theorie ra28tionaler Erwartungen, welche die Möglichkeit leugnet, Versuche zur Beeinflussung der Erwartungen könnten sich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse auswirken. Die Verfechter dieser Theorie erklären, die rationalen Akteure würden stets den intrinsischen Wert eines Wirtschaftsguts erkennen und könnten in ihren Erwartungen nicht manipuliert werden.
Diese Implikationen sind wesentlich für die Analyse der Rolle von Erwartungen in der kapitalistischen Dynamik. In den Kapiteln 5 bis 8, die den Hauptteil dieses Buchs bilden, wird erklärt, wie fiktionale Erwartungen das Handeln koordinieren, performative Wirkungen ausüben, zum Entstehen von Neuheiten beitragen und Gegenstand der Auseinandersetzungen zwischen Akteuren sind. Dies geschieht in Betrachtung von vier Schlüsselbereichen der kapitalistischen Wirtschaft: dem Geld- und Kreditwesen, den Investitionen, der Innovation und des Konsums.
Fiktionalität ist keineswegs ein zwar bedauerlicher, aber unbedeutender Bestandteil der fundamentalen Ungewissheit der Zukunft, sondern vielmehr ein konstitutives Element der kapitalistischen Dynamik einschließlich der Krisen des Systems. Eine Volkswirtschaft ohne Ungewissheit wäre zwar eine Wirtschaft ohne fiktionale Erwartungen, in der die Akteure vollkommen rational handeln könnten — aber sie wäre auch ein statisches, zeitloses System ohne Neues, in dem alles zur selben Zeit geschähe. Die mathematischen Modelle der allgemeinen Gleichgewichtstheorie brachten diese Vorstellung in den fünfziger Jahren zu ihrem logischen Abschluss (Arrow und Debreu 1954).
Im Gegensatz dazu erklärte Keynes ([1936] 2000), die Akteure müssten sich erstrebenswerte zukünftige Weltzustände ausmalen, damit sich die Wirtschaft trotz der Unberechenbarkeit der Ergebnisse weiterentwickeln könne. Keynes verwendete den Begriff der »Lebensgeister«, um die Vorstellung zu vermitteln, dass das Kalkül nicht der einzige Faktor sei, der das Wirtschaftswachstum vorantreibe und Krisen auslöse. Die Lebensgeister wirkten dem Gefühl der Unsicherheit entgegen, 29das die Akteure angesichts der Ungewissheit der Zukunft befalle und zu Untätigkeit und Stagnation führen könne. Wie die modernen Verhaltensökonomen gezeigt haben, neigen die Menschen dazu, ihre Erfolgschancen in wirtschaftlichen Unternehmungen erheblich zu überschätzen (Taleb 2008: 224). Ironischerweise ist diese übermäßige Zuversicht zugleich eine Voraussetzung für die Wachstumsdynamik des Kapitalismus — und sie steht im Widerspruch zum neoklassischen Postulat der Rationalität wirtschaftlicher Akteure. Keynes prägte auch den Begriff der »Liquiditätspräferenz«, um die Auswirkungen eines Mangels an Zuversicht in die Profitabilität neuer Investitionen zu beschreiben. Diese mangelnde Zuversicht lässt den Zeithorizont der Akteure schrumpfen, dämpft Investitionen und Konsum und führt zu einer reduzierten Nutzung der Produktionsfaktoren — zu, mit anderen Worten, Wirtschaftskrisen. Die evokativen Überschüsse fiktionaler Erwartungen sind das Lebenselixier des Kapitalismus.
Die sozialen Grundlagen fiktionaler Erwartungen
Wenn sie nicht ausschließlich auf Informationen beruhen können, woher genau kommen Erwartungen dann? Anders als die behavioristischen Erklärungsansätze behaupten, können wir Zukunftsbilder und zuversichtliches Handeln angesichts der Ungewissheit — oder den plötzlichen Verlust dieser Zuversicht — nicht richtig verstehen, indem wir uns auf kognitive Gesetzmäßigkeiten konzentrieren, die in übermäßiger Zuversicht, Verlustabneigung oder Entscheidungsheuristiken zum Ausdruck kommen. Vielmehr sind Erwartungen ein soziales Phänomen, wie Emile Durkheims Soziologie und der amerikanische Pragmatismus nahelegen.
Die Vorstellung, dass Erwartungen keine individuellen, sondern soziale Phänomene sind, lässt sich auf Emile Durkheim zurückführen, der in seiner Religionssoziologie untersuchte, 30wie religiöse Glaubenssysteme entstehen und gefestigt werden (Durkheim [1912] 2014). Durkheim erklärt, religiöse Überzeugungen seien kollektive Repräsentationen, die in Ritualen geformt und erneuert würden, zu denen die Mitglieder eines Clans zusammenkommen und in denen sie in einen Zustand der »kollektiven Efferveszenz« versetzt werden. Obwohl es auf den ersten Blick weit hergeholt zu sein scheint, das Verhalten intentional rationaler Akteure in den modernen kapitalistischen Volkswirtschaften mit dem von Mitgliedern ursprünglicher Stammesgemeinschaften zu vergleichen, gewährt Durkheims Analyse wertvolle Einblicke in die Entstehung und Dynamik der im Kapitalismus wirkenden Erwartungen. Diese Erwartungen werden ebenfalls durch kollektive Überzeugungen geformt, die in kommunikativen Praktiken entstehen, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Die Diskurse in Expertengemeinschaften und die Überzeugungen von Laien tragen wesentlich zur Entstehung von Zukunftsbildern im Kapitalismus bei. Solche Diskurse und die zu einem gegebenen Zeitpunkt vorherrschenden Imaginationen werden von einflussreichen Akteuren wie Unternehmen, Politikern, Experten und Medien geprägt.
Die Diskurse finden in kulturellen und institutionellen Rahmen statt, die von den Akteuren zur Deutung der wirtschaftlichen Welt herangezogen werden und ihre Erwartungen strukturieren. Sie beinhalten Wirtschaftstheorien und Institutionen sowie den Glauben an Konzepte wie Berechenbarkeit, Wirtschaftswachstum oder die Lösung von Problemen durch technologische Prozesse. In Imagined Communities (1983, deutsch als Die Erfindung der Nation, 2005) erklärt Benedict Anderson, wie Karten oder Lieferpläne in Zeitungen den Menschen dabei halfen, sich ihre Nation vorzustellen. Das gilt auch für die Vorstellungen, die sich Akteure von ihrer wirtschaftlichen Zukunft machen. Während die innerhalb dieser kognitiven Rahmen gebildeten Erwartungen auf die Zukunft gerichtet sind, werden die Rahmen selbst wesentlich von der Vergangenheit beeinfl31usst, und zwar in Form von Ressourcenverteilung, historisch gewachsenen kulturellen Normen, sozialen Netzwerken und der Verwendung historischer Informationen. Beispielsweise beruhen makroökonomische Prognosen auf der statistischen Auswertung vergangener Ereignisse. Einschätzungen der Zukunft werden im Allgemeinen von vergangenen Erfahrungen und ihrer Deutung sowie von etablierten Strukturen beeinflusst, was zur Folge hat, dass die Vorstellungen von der Zukunft in verschiedenen geschichtlichen Perioden, Ländern und sozialen Gruppen unterschiedlich sind. Die diskursive Konstitution von Erwartungen wird auch durch wirtschaftliche und soziale Stratifizierung strukturell geformt. Die Position in der stratifizierten sozialen Ordnung, etwa wirtschaftlich oder politisch einflussreicher Experten, beeinflussen die Konstruktion von Zukunftsbildern und die angeblichen Kausalbeziehungen, aus denen sich die vorgestellte Zukunft ergeben wird. So wie ein Priester die Gläubigen bei ihren religiösen Praktiken leitet, spielt die von Unternehmen durch Werbung und Lobbying sowie von den Massenmedien ausgeübte Macht eine wichtige Rolle in der Verbreitung wirtschaftlicher Imaginationen. Die von Durkheim beschriebene archaische Welt lebt in der kapitalistischen Moderne fort.
Wenn wir davon ausgehen, dass Erwartungen kontingent sind und von kollektiven Prozessen abhängen, die von Kultur, Geschichte und Machtbeziehungen geprägt werden, so haben wir es mit einem inhärent soziologischen Phänomen zu tun. Darüber hinaus hängt das Konzept der fiktionalen Erwartungen mit einem soziologischen Verständnis des Handelns zusammen, da es um die intersubjektiven Prozesse kreist, in denen Erwartungen entstehen und angefochten werden. Das Handeln wird hier nicht im teleologischen Sinn als etwas verstanden, das von einem Zweck angetrieben wird, der einem individuellen Akteur entspringt und abgelöst ist von den Umständen, die ihn hervorgebracht haben. Stattdessen wird es pragmatistisch als ein Prozess betrachtet, in dem Zwecke und Strategien 32in Abhängigkeit von kontingenten und sich wandelnden Interpretationen einer sich entfaltenden Situation entwickelt und korrigiert werden. Erwartungen und Ziele sind das Ergebnis eines Prozesses, der gestützt auf vergangene Erfahrungen und in Interaktion mit anderen im Lauf der Zeit voranschreitet und den Akteuren ermöglicht, Vorhaben, Pläne und Strategien zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. In diesem Sinn ähneln fiktionale Erwartungen Deweys »Zwecken in Sichtweite« (ends-in-view); dies sind »vorausgesehene Folgen«, welche »die gegenwärtige Überlegung beeinflussen« (Dewey [1922] 1931: 229). Das pragmatistische Denken betrachtet die Zukunft als Prozess, der sich nichtlinear entfaltet, während die Akteure ihn analysieren und auf der Grundlage ihrer Vorstellungen davon, wie die Zukunft aussehen wird, Entscheidungen fällen.
Überblick über das Buch
Der erste Teil des Buchs ist einer kritischen Auseinandersetzung mit den vorhandenen Zugängen zu Erwartungen in der Soziologie und den Wirtschaftswissenschaften gewidmet. Ziel ist es, ausgehend von dieser Rekonstruktion sowie einer Diskussion der temporalen Ordnung des Kapitalismus und ihrer Auswirkungen auf die zeitliche Ausrichtung der Akteure ein Konzept der fiktionalen Erwartungen zu entwickeln. Zunächst werte ich die einschlägigen Arbeiten von Soziologen, Historikern und Ökonomen aus, um anschließend zu zeigen, dass das Handeln der Akteure in der kapitalistischen Moderne vorwiegend auf eine offene Zukunft ausgerichtet ist.
Kapitel 3 beginnt mit einer kritischen Beurteilung der allgemeinen Gleichgewichtstheorie und der Theorie rationaler Erwartungen, den einflussreichsten Konzeptionen zur Frage der Erwartungen in der modernen Volkswirtschaftslehre. Es wer33den auch abweichende Vorstellungen von Ökonomen wie John Maynard Keynes, George Shackle und Paul Davidson behandelt, deren Theorien die von mir präsentierten Überlegungen zur Rolle von Erwartungen im wirtschaftlichen Handeln gewissermaßen ankündigen. Sodann werfe ich einen Blick auf die (begrenzte) soziologische Literatur zum Thema.
In Kapitel 4 entwickle ich das Konzept der fiktionalen Erwartungen und beschäftige mich mit der Frage der Fiktionalität in der Literaturtheorie, insbesondere bei John Searle (1975), und in der Kunstphilosophie (Walton 1990). Hier diskutiere ich auch die Verbindungen zwischen fiktionalen Erwartungen und Konzepten wie Hoffnung, Furcht, Glaube, Ideologie, Imaginationen, Ideen und Versprechen. Anschließend untersuche ich die politische Dimension der Erwartungen, die Politik der Erwartungen. Den Abschluss von Kapitel 4 bildet eine Auseinandersetzung mit den sozialen Quellen von Zukunftsbildern, wobei der pragmatistischen Handlungstheorie besondere Aufmerksamkeit gilt.
In Teil II, der das empirische Kernstück des Buchs bildet, wird das Konzept der fiktionalen Erwartungen Kapitel für Kapitel mit Blick auf vier Bausteine des kapitalistischen Wirtschaftssystems untersucht. Kapitel 5 ist der Funktion von Geld und Kredit gewidmet. Voraussetzung für das Operieren von Geld und Kredit ist der Glaube an die Stabilität des Geldsystems und an die zukünftige Verlässlichkeit der Schuldner. Der Glaube an die Stabilität des Geldsystems hängt von der Erwartung der Akteure ab, dass sie zu einem zukünftigen Zeitpunkt imstande sein werden, an sich wertlose Papier- und Metallstücke, also das, was man auch Zeichengeld nennt, gegen wertvolle Güter einzutauschen. Hier wird die Frage behandelt, wie diese »Fiktion der monetären Invariante« (Mirowski 1991: 580) aufrechterhalten wird und was geschieht, wenn der Glaube an den zukünftigen Wert des Geldes schwindet. Mit dem Geld verknüpft ist der Kredit, ein weiterer Baustein des Kapitalismus, der durch inhärente Ungewissheit gekennzeichnet ist, da es keine Gewissheit bezüg34lich der Bereitschaft und Fähigkeit eines Schuldners zur Rückzahlung seiner Schulden gibt. Die Beurteilung der mit Krediten verbundenen Risiken und der zukünftigen Geldwertstabilität sind fiktionale Erwartungen, die zumindest zum Teil institutionell verankert sind. Ob sie sich erfüllen, hängt von der Fähigkeit der Gläubiger und des Staates ab, die Einhaltung von Zahlungsverpflichtungen durchzusetzen.
Kapitel 6 ist den Investitionen gewidmet — in Werkshallen und Maschinen, in Kapitalanlagen und in Qualifikationen —, die ein weiterer unverzichtbarer Baustein des Kapitalismus sind. Diese Investitionen werden durch das Gewinnstreben oder im Fall von Qualifikationen durch die Erwartung von zukünftigem Einkommen, sozialem Status oder Arbeitsplatzsicherheit motiviert. Wie die hohe Fehlerquote zeigt, sind die Ergebnisse von Investitionen weitgehend ungewiss: Die Akteure können oft nicht im Voraus wissen, welche Investitionen ihren Nutzen maximieren werden, und müssen sich daher bei ihren Entscheidungen über spezifische Investitionen auf Imaginationen zukünftiger Zustände der Welt (sowie auf Konventionen) stützen. Insbesondere auf den Finanzmärkten wimmelt es von Beispielen für Investitionen, die auf fiktionalen Erwartungen beruhen, welche als Geschichten über die zukünftige Entwicklung von Vermögenspreisen vermittelt werden.
In Kapitel 7 untersuche ich Innovationsprozesse. Wirtschaftswissenschaftliche Wachstumstheorien führen das beispiellose Wachstum in den vergangenen 250 Jahren im Wesentlichen auf technologische Neuerungen zurück (Roemer 1990; Solow 1957). Schumpeter ([1912] 2006) richtete seinen Blick auf die Mikroebene und stellte fest, dass Innovationsprozesse von Imaginationen der Akteure inspiriert werden. In Anlehnung an Schumpeter untersuchen zeitgenössische Innovationsforscher den Ursprung des technologischen Fortschritts in »Projektionen« zukünftiger Welten. Gestützt auf diese Studien, zeige ich in dem Kapitel, welche Rolle fiktionale Erwartungen im Innovationsprozess spielen.
35Das letzte Kapitel von Teil II ist dem Konsum gewidmet. In wohlhabenden Konsumgesellschaften kann die Wirtschaft nur wachsen, wenn die Nachfrage immer weiter steigt und sich nicht darum schert, was zum Leben notwendig ist. Wie Konsumenten den Wert von Gütern oder Dienstleistungen einschätzen, hängt auch davon ab, welche symbolische »Leistung« sie sich von diesen Gütern nach dem Kauf erwarten. In wohlhabenden Gesellschaften beruht der Wert von Gütern zunehmend auf ihrer symbolischen Bedeutung, die kommunikativ erzeugt und aufrechterhalten werden muss. Der vorgestellte Wert, den Konsumenten käuflichen Produkten beimessen, ist ein weiteres Beispiel für eine fiktionale Erwartung.
In allen vier Kapiteln von Teil II spielt die Frage des Werts eine zentrale Rolle: Akteure streben nur nach Geld, Investitionen, Innovation und Konsum, wenn sie glauben, dass das, was sie durch den Austausch auf dem Markt erwerben, in Zukunft einen Wert haben wird. Ihre Werterwartungen nehmen verschiedenste Formen an: Sie akzeptieren Geld, weil sie an seine Kaufkraft in der Zukunft glauben; sie gehen Risiken mit Kapitalinvestitionen und Innovationen ein, weil sie Profit erwarten; sie kaufen Konsumgüter, weil sie von einer zukünftigen Befriedigung ihrer Wünsche träumen und sich sozialen Status von diesen Gütern erwarten. Wert und Zukunftsimaginationen sind eng miteinander verwoben. Der gegenwärtige Wert beruht auf fiktionalen Erwartungen bezüglich zukünftiger Ergebnisse; umgekehrt drücken fiktionale Erwartungen Annahmen bezüglich des zukünftigen Werts aus. Eine Untersuchung der Frage, inwieweit Wert auf den auf dem Markt erzeugten Erwartungen beruht, kann zu einer soziologischen Werttheorie beitragen (vgl. auch Beckert und Aspers 2011; Beckert und Musselin 2013).
Der letzte Teil des Buchs ist den Instrumenten gewidmet, die eingesetzt werden, um fiktionale Erwartungen zu wecken. In Kapitel 9 untersuche ich die Prognostik (makroökonomische Prognosen und technologische Projektionen) in ihrer Funktion 36als Technologie zur Erzeugung fiktionaler Erwartungen. Warum werden weiterhin beträchtliche Mittel für Wirtschaftsprognosen aufgewandt, obwohl sich diese als weitgehend unzutreffend oder fehlerhaft erwiesen haben? Die Antwort lautet: Weil sie Instrumente zur Erzeugung fiktionaler Erwartungen sind, die den Akteuren Entscheidungen unter Bedingungen der Ungewissheit erleichtern. In Kapitel 10 gehe ich der Frage nach, inwieweit Wirtschaftstheorien und ökonomische Modelle ebenfalls als Instrumente zur Erzeugung fiktionaler Erwartungen betrachtet werden können, die als kognitive Karten geeignete Darstellungen von Kausalbeziehungen liefern, anhand deren wirtschaftliche Akteure Vorhersagen zu den zukünftigen Konsequenzen ihrer gegenwärtigen Entscheidungen treffen können. Neben ihrer Funktion in der Koordinierung wirtschaftlicher Entscheidungen tragen technologische Prognosen und Wirtschaftstheorien auch zur Erzeugung von Neuheit bei und dienen als Werkzeuge der Politik der Erwartungen.
Der Schlussteil ist den Implikationen der in diesem Buch gesammelten Erkenntnisse für eine Theorie des modernen Kapitalismus gewidmet. Ich unterziehe Max Webers Deutung der Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft als Prozess von Rationalisierung und Entzauberung einer kritischen Prüfung. Weber ([1930] 1988) deckte die religiösen Motive auf, die der Entstehung des modernen Kapitalismus zugrunde liegen, glaubte jedoch, diese nichtrationalen Einflüsse würden in der weiteren Entwicklung des Systems verschwinden, und erklärte, das »stahlharte Gehäuse« selbstgetriebener wirtschaftlicher Mechanismen werde die Akteure schließlich zu einem instrumentell rationalen Verhalten zwingen. Seine Vorstellung von der Entwicklung des neuzeitlichen Kapitalismus hat großen Einfluss ausgeübt, aber die zentrale Rolle fiktionaler Erwartungen belegt, dass die kapitalistische Dynamik weiterhin teilweise von nichtrationalen Überzeugungen — von einer »säkularen Verzauberung« — angetrieben wird. Dies ist weder ein nebensächliches Phänomen noch eine romantisch verklärte Betrachtung des modernen 37Kapitalismus. Vielmehr rückt sie die Vorstellung vom »stahlharten Gehäuse« in ein neues Licht. Dieses Gehäuse und die Rastlosigkeit des Kapitalismus entstammen der Kolonialisierung selbst der kreativen und nicht wirtschaftlich motivierten Handlungen der Akteure.
Indem wir die allgemeinen Fragen der kapitalistischen Dynamik anhand der Prozesse der sozialen Interaktion in der Volkswirtschaft erkunden — ein für die Wirtschaftssoziologie typischer Zug —, stärken wir die Verbindung zwischen Wirtschaftssoziologie und politischer Ökonomie und zeigen, welchen Beitrag eine handlungstheoretisch angeleitete Wirtschaftssoziologie zum Verständnis makroökonomischer Prozesse leisten kann.
Dieses Buch ist ein »Essay« im formalen Sinn des Worts: Es stellt einen breit angelegten Versuch dar, eine neue Perspektive der kapitalistischen Dynamik zu entwickeln und eine Antwort auf die alte Frage zu geben, wie diese Dynamik mit der politischen und kulturellen Ordnung verknüpft ist. Weil es spekulativer ist und auch offener für Beiträge aus ganz verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen als viele Analysen des Kapitalismus, bringt das Buch (hoffentlich) neue Ideen in eine alte Debatte ein und ebnet den Weg für weiterführende empirische und theoretische Forschung.
39I Entscheidungen in einer ungewissen Welt
412 Die temporale Ordnung des Kapitalismus
Der Modernismus hält sich an Gegenwart oder Zukunft, jedoch niemals an die Vergangenheit.
Daniel Bell, Die kulturellen Widersprüche des Kapitalismus
Die Entstehung der kapitalistischen Wirtschaft lässt sich am besten anhand des Wachstums der Märkte und des monetären Austauschs verfolgen.1 Seit der frühen Neuzeit wuchsen die Märkte: Die Kommodifizierung beschleunigte sich, es konnten Größenvorteile genutzt werden, und der gewinnorientierte depersonalisierte Güteraustausch setzte sich durch. Auch die Arbeit wurde der Wettbewerbslogik des Marktmechanismus unterworfen, als im 19. Jahrhundert große Arbeitsmärkte entstanden. Die Ausbreitung der monetären Instrumente ermöglichte die Expansion kreditfinanzierter Investitionen und die Kalkulation der Kosten. Obwohl diese Prozesse in der frühen Neuzeit begannen, prägten sie erst im 19. und 20. Jahrhundert in Westeuropa und Nordamerika und später weltweit die wirtschaftlichen Abläufe.
Die auf den Kapitalismus spezialisierten Forscherinnen und Forscher haben die Voraussetzungen für die Entstehung kapitalistischer Märkte eingehend untersucht. In den historischen Darstellungen werden unantastbare Eigentumsrechte, eine starke staatliche Ordnungsmacht, die doppelte Buchführung, die Entwicklung von Arbeitsmärkten, die Errichtung von Infrastrukturen und die Einführung standardisierter Maßeinheiten hervorgehoben. Eine Voraussetzung, der weit weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist die Veränderung der tempo42ralen Disposition der Akteure, das heißt die Verschiebung der grundlegenden kognitiven Ausrichtung der wirtschaftlichen Akteure in Bezug auf die relevanten Zeithorizonte (Bourdieu 2000). Diese zeitliche Orientierung ist ein fester Bestandteil des Vorstellungssystems eines Akteurs und bestimmt sein Verhalten; die zeitliche Wahrnehmung ist historisch spezifisch und an sich ein Aspekt der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit (Luhmann 1976: 34).
In diesem Kapitel werde ich zeigen, dass die Entwicklung des Kapitalismus mit einem grundlegenden Wandel der temporalen Ausrichtung der Akteure einherging, genauer gesagt: mit einer veränderten Vorstellung von der Zukunft. Dieser Wandel der temporalen Ausrichtung war zugleich Ursache und Ergebnis der kapitalistischen Transformation. Die traditionellen Gesellschaften betrachteten die Zukunft im Allgemeinen als Teil einer zirkularen Wiederholung der Geschehnisse, die vielfach in Mythen kognitiv verarbeitet wurden. Diese Gesellschaften kannten Handelsbeziehungen und Märkte, aber sie kannten keine sich ausweitende Marktsphäre (Polanyi [1944] 1978). Anders als in den traditionellen Vorstellungen ist die Zukunft in der temporalen Disposition des Kapitalismus ein offener Raum; sie beinhaltet Chancen, die genutzt werden können, und Risiken, die in Betracht gezogen werden müssen. Kennzeichnend für den Kapitalismus ist, dass sich die Akteure »nicht in die Gegenwart fügen oder ihre Energien auf die Gegenwart beschränken, sondern an eine Zukunft glauben. Nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft ist die für dieses System charakteristische temporale Ausrichtung« (Moreira und Palladino 2005: 69). Tatsächlich ist der Kapitalismus ein Wirtschaftssystem, in dem die Gegenwart in erster Linie mit Blick auf die Zukunft beurteilt wird, die ihrerseits anhand von Imaginationen zukünftiger Zustände betrachtet wird, um sich eine Vorstellung von bisher nicht realisierten, aber möglichen Gewinnen und Verlusten zu machen. Wenn sich der moderne Kapitalismus »in die Zukunft einbettet« (Giddens 1999: 2), müssen wir diese temporale 43Ausrichtung und die entsprechenden Dispositionen der Akteure analysieren, um die für das Verständnis der kapitalistischen Dynamik benötigten Grundlagen auf der Mikroebene schaffen zu können.2
Enttraditionalisierung und Entstehung der Zukunft
Eine der besten Analysen der historischen Entwicklung des Kapitalismus unter dem Gesichtspunkt der sich wandelnden temporalen Dispositionen lieferte Pierre Bourdieu (2000) in seiner Beschreibung des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels in der algerischen Kabylei. Bourdieu führte seine Feldstudien zu einer Zeit durch, als die kapitalistische Wirtschaftsweise in der traditionellen kabylischen Gesellschaft Einzug hielt und die traditionelle Lebensart mit ihren herkömmlichen wirtschaftlichen Organisationsformen grundlegend veränderte. Der monetarisierte kapitalistische Wirtschaftskreislauf setzte die traditionelle Wirtschaftsweise der Region unter wachsenden Druck, was heftige Konflikte und Desorientierung zur Folge hatte. Anhand detaillierter ethnographischer Beobachtung und statistischer Analysen beschreibt Bourdieu den Wandel des wirtschaftlichen Lebens und die Auswirkungen der Veränderungen auf Familien- und Gemeindestrukturen. Besonders bemerkenswert ist jedoch seine Beschreibung der Zerstörung der zeitlichen Ordnung der Kabylen, die in erster Linie mittels der Ausweitung des monetarisierten Marktaustauschs durch eine neue ersetzt wurde.
Bourdieus Beschreibung der Beziehung zwischen der Entwicklung des Kapitalismus und dem Wandel der temporalen Ordnung war bahnbrechend. Er zeigt anhand einer Analyse des alltäglichen wirtschaftlichen Handelns, dass die Akteure sich mit Blick auf ihre Zeitorientierung neu ausrichten müssen, 44um in einem kapitalistischen System wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Diese temporale Neuausrichtung zerstört eine traditionelle Lebensführung, in der die Zukunft im Wesentlichen als zirkulare Wiederholung der Vergangenheit betrachtet wird. Dieses Zeitverständnis beruht auf der praktischen Erfahrung kreisförmiger Prozesse in der Natur: Was war, wird wiederkehren, und was sein wird, ist schon einmal da gewesen. Die Zukunft ist geschlossen. In der kapitalistischen Wirtschaft betrachten die Akteure die Zukunft jedoch nicht mehr als Fortsetzung einer auf der Vergangenheit beruhenden Gegenwart, sondern als deren unablässige Zerstörung, als »rastlosen« sozialen Entstehungsprozess (Sewell 2008; Wagner-Pacifici 2010), in dem die Akteure zwischen verschiedenen möglichen zukünftigen Entwicklungen wählen können, um ihr Verhalten an einem bestimmten Bild der Zukunft auszurichten. Diese durch die Ausweitung kompetitiver Märkte und die Ausbreitung des monetären wirtschaftlichen Austauschs angeregte Verschiebung der Handlungsdisposition der Akteure ist eine notwendige Begleiterscheinung der Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften.
Der Wandel der temporalen Ausrichtung bedeutet nicht, dass die traditionellen Gesellschaften der Zukunft gegenüber gleichgültig wären. Wie Bourdieu gezeigt hat, planten die algerischen Bauern ihre Zukunft schon vor dem Übergang zur kapitalistischen Wirtschaft sehr gewissenhaft. Aber sie planten eine zukünftige Versorgung mit »direkten Gütern« (Bourdieu 1979), das heißt mit Gütern, die eine Befriedigung ihrer Bedürfnisse in der Zukunft versprachen und einer in der Gemeinschaft vorherrschenden überkommenen »Logik der Ehre« entsprachen. Die Versorgung mit Lebensmitteln sowie Investitionen in Grundbesitz und Innovationen zur Verbesserung der Gerätschaften, die in der Landwirtschaft und im Haushalt zum Einsatz kamen, wurden auf diese Art geplant. Der individuelle Bauer »schreibt sich […] in die Dauer einer Welt ein, mit der [er] aufs Engste verbunden ist« (56). Die wirtschaftliche Zukunft ist als eine einzige organische Einheit mit der Gegenwart verknüpft und be45steht im Wesentlichen aus den Produkten, welche die nächste Ernte bringen wird, sowie aus Positionen der Ehre und des Ansehens, die man in der sozialen Ordnung anstreben kann. Um es mit der Begrifflichkeit von Karl Marx ([1885] 1963) zu sagen: Die traditionelle kabylische Wirtschaft könnte als »einfache Reproduktion« bezeichnet werden, das heißt als Produktion für eine statische Wirtschaft. Sie dient der »Reproduktion der Bindungen, Werte und Glaubensvorstellungen, die die Gruppe zusammenhalten« (Bourdieu 2000: 43).
Diese Einschätzung der Zukunft steht in starkem Kontrast zu der von Bourdieu beobachteten, sich nun entfaltenden kapitalistischen Wirtschaft: einer neuen wirtschaftlichen Formation, welche »die Bildung einer abstrakten und vermittelten Zukunft« voraussetzt (Bourdieu 2000: 34). Die kapitalistische Zukunft beruht auf Aussagen über weit entfernte zukünftige Zustände der Welt, die einen »imaginären Fluchtpunkt« darstellen (31); sie ist ein fernes Ziel, das auf Bildern möglicher Welten beruht und durch Berechnung und rationales Handeln angestrebt wird. Bei der Modernisierung der kabylischen Gesellschaft kollidierten diese gegensätzlichen Vorstellungen von der Zukunft miteinander.
Der Mehrheit der kabylischen Bauern fehlte die Disposition, die erforderlich war, um den Anforderungen der sich entfaltenden kapitalistischen Wirtschaft zu genügen. Die Folge waren tiefe soziale Konflikte. Ein Beispiel war der erbitterte Widerstand der Bauern gegen eine Beschäftigung mit der abstrakten Zukunft des Marktes, den sie als unwirkliche Welt betrachteten (Bourdieu 2000: 41f.). Jene, die sich Gedanken über ihre Zukunftschancen machten, galten als Bedenkenträger, die als »Partner Gottes« wahrgenommen werden wollten. Die Akteure waren skeptisch dem Geld gegenüber, das sie als »indirektes Gut« betrachteten, das an und für sich keine Befriedigung versprach. Das Versprechen eines zukünftigen Nutzens des Geldes wirkte auf sie »fremd, imaginär und unbestimmt« (36). Ähnlich kritisch sahen sie den Kredit, die wirtschaftliche Institution, die 46am wenigsten mit der Denkweise der vorkapitalistischen Wirtschaft zu vereinbaren war, denn der Kredit stützte sich nicht nur auf eine abstrakte Zukunft, sondern widersprach auch der Solidarität, indem er von einer vollkommen unpersönlichen Beziehung zwischen den Vertragspartnern ausging (39f.).
Dass die Bauern eine abstrakte und berechnete Zukunft ablehnten, zeigt sich auch daran, dass sie kein Interesse an Vorschlägen zur Verbesserung der Anbaumethoden zeigten. Bourdieu beobachtete, dass die von Außenstehenden angeregten Änderungen der Produktionsmethoden oft nur Unverständnis und Zweifel weckten, was daran lag, dass sie »auf einem abstrakten Kalkül beruhen und den unwirklichen Schein des Imaginären annehmen, weil sie ein Aussetzen der Bindung an vertraute Gewohnheiten verlangen« (Bourdieu 2000: 35). Er erklärt, nichts sei der vorkapitalistischen Wirtschaft fremder »als die Vorstellung von einer Zukunft als einem Feld des Möglichen, dessen Erforschung und Beherrschung dem Kalkül anheimgestellt wäre« (32).
Bourdieu ist nicht der einzige Kapitalismusforscher, der Veränderungen der temporalen Ordnung und die damit einhergehenden Konflikte als festen Bestandteil der kapitalistischen Entwicklung betrachtet. Viele Sozial- und Wirtschaftshistoriker haben solche Veränderungen untersucht, insbesondere im Kontext der Industrialisierung Europas. Besonders einflussreich war Edward P. Thompsons (1967) Studie über die Einführung neuer Regelungen mit Blick auf die Arbeitszeiten und die Arbeitsdisziplin im Verlauf der Industrialisierung Großbritanniens. Thompson zeigt, dass die für die industrielle Produktion erforderliche zeitliche Ausrichtung mit der temporalen Disposition der Arbeiter kollidierte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kamen Arbeiter oft zu spät, verließen den Arbeitsplatz vor dem Feierabend und erschienen an Montagen und religiösen Feiertagen überhaupt nicht zur Arbeit. Diese Probleme wurden gelöst, aber der Kampf der Gewerkschaften für eine Verkürzung des Arbeitstags zeigte, dass weiterhin eine Spannung zwischen der 47temporalen Ordnung des kapitalistischen Produktionssystems und der moralischen Ökonomie der Arbeiter bestand — und noch heute steht diese Spannung im Mittelpunkt zahlreicher Arbeitskonflikte. Thompsons Studie ist nur ein Beispiel für eine Vielzahl historischer Untersuchungen dazu, wie die Arbeitskräfte im Verlauf der Industrialisierung mit Uhren, Akkordlöhnen, Zeitplänen und Fließbändern diszipliniert wurden (Biernacki 1995; Le Goff 1960).3
Max Weber beschreibt in seinen frühen Studien über schlesische Bauern Ende des 19. Jahrhunderts (Weber [1923] 1981) einen weiteren Aspekt des traditionellen Widerstands gegen die kapitalistische Zeitordnung. Die schlesischen Großbauern versuchten, auf dem globalen kapitalistischen Markt Gewinne zu erzielen. Aber ihre Landarbeiter führten ein traditionelles Leben, und es gelang nicht, ihre Arbeitsdisziplin mit höheren Löhnen zu verbessern: Anstatt länger zu arbeiten, um ihren Lebensstandard zu erhöhen, entschlossen sich die Landarbeiter, die Arbeitszeit zu verkürzen, wenn die Löhne erhöht wurden. Anders als von den Grundbesitzern (und Ökonomen) erwartet, war es sinnlos, »einem Landarbeiter in Schlesien, der für Akkord ein bestimmtes Stück Land zu mähen hatte, mit Rücksicht auf die Steigerung seiner Arbeitskraft den Lohn verdoppeln zu wollen: Er hätte dann einfach seine Arbeitsleistung auf die Hälfte reduziert« (302). Auch die Weber, die im 19. Jahrhundert in Heimarbeit produzierten, arbeiteten mehr Stunden, wenn sie in einer Rezession geringere Preise für ihre Erzeugnisse erhielten, und verringerten den Arbeitseinsatz in wirtschaftlich guten Zeiten, wenn sie für ihre Erzeugnisse höhere Preise erzielen und ihre Familie mit geringerem Aufwand ernähren konnten (Kocka 2013: 68). Weder die schlesischen Landarbeiter noch die Weber machten ihre Entscheidungen von der Imagination einer Zukunft mit einem höheren Lebensstandard abhängig, sondern sie hielten an ihrer traditionellen Lebensart fest. Das bedeutet nicht, dass traditionelle Gesellschaften keine Zukunftsvorhaben kennen. Für sie ist die Zukunft jedoch kein offe48ner Raum, der mit einer anderen gesellschaftlichen Realität ausgefüllt werden kann. Stattdessen werden »etablierte Handlungsweisen dazu benutzt […], die zukünftige Zeit zu organisieren. Die Zukunft wird so gestaltet, ohne daß sich die Notwendigkeit ergibt, sie als ein eigenständiges Territorium zu formen« (Giddens 1996: 123).
Wie Max Weber beobachtet, schränkt eine traditionelle zeitliche Disposition die Entwicklung des modernen Kapitalismus ein: Der wirtschaftliche Rationalismus ist teilweise »von rationaler Technik und rationalem Recht«, gleichzeitig aber auch »von der Fähigkeit und Disposition der Menschen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler Lebensführung überhaupt abhängig. Wo diese durch Hemmungen seelischer Art obstruiert war, da stieß auch die Entwicklung einer wirtschaftlich rationalen Lebensführung auf schwere innere Widerstände« (Weber [1920] 1986). Das Marktsubjekt der kapitalistischen Wirtschaftsordnung muss sich von der Tradition befreien und sich systematisch um die Maximierung seines Gewinns oder Einkommens bemühen, indem es die in der Zukunft erkannten Chancen nutzt. Sonderbarerweise findet man diese Vorstellung auch in der Debatte über die Abschaffung der Sklaverei, die im 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten geführt wurde: Befürworter wie Gegner der Sklaverei machten sich Sorgen über das wirtschaftliche Verhalten der Sklaven, sollten diese befreit werden. Beide Seiten argumentierten, die befreiten Sklaven könnten nur produktive Mitglieder der amerikanischen Gesellschaft werden, wenn sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten nicht auf die Befriedigung ihrer unmittelbaren Bedürfnisse beschränkten, sondern sich auch um die Erfüllung »künstlicher Wünsche« bemühten, die auf Träumen von einem Leben jenseits der grundlegenden Erfordernisse beruhten. Die befreiten Sklaven würden also nur wirtschaftlich produktiv sein, wenn sie sich selbst in einer besseren Zukunft sehen könnten und von der Aussicht auf ein besseres Leben zur Arbeit motiviert würden (Oudin-Bastide und Steiner 2015: 161).
49





























