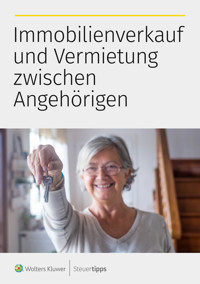
Immobilienverkauf und Vermietung zwischen Angehörigen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Insbesondere bei Verträgen mit Angehörigen kann Sie der Vorwurf der Liebhaberei treffen. Denn hier prüft das Finanzamt besonders gründlich, ob der Vertrag dem Drittvergleich (Fremdvergleich) genügt, das heißt, ob er in dieser Form auch mit einem fremden Dritten abgeschlossen worden wäre. Kommt das Finanzamt zu der Einschätzung, dass die Vereinbarung mit Angehörigen nicht dem Drittvergleich genügt, hat das Konsequenzen: Da meist eine geringere Miete als die marktübliche vereinbart wird, entstehen häufig Verluste. Diese Verluste erkennt das Finanzamt in diesem Fall nicht mehr an und für die Vergangenheit können die Verluste gestrichen werden, wenn die Steuerbescheide hierzu vorläufig ergangen sind. Besonders häufig passiert das, wenn Sie an Angehörige vermieten. Wir sagen Ihnen, wann das Finanzamt hellhörig wird und wie Sie Ihre Mietverträge mit Angehörigen richtig abschließen und durchführen müssen. Außerdem lesen Sie, wie Sie mit der verbilligten Vermietung, der Übertragung einer Immobilie an Angehörige und einer gemischten Schenkung Steuern sparen können. Für die Immobilienweitergabe in der Familie haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Häufig kommt eine Übergabe ganz ohne Gegenleistung infrage, also eine Schenkung. Ist die nicht gewünscht oder nicht möglich, kann auch ein Verkauf innerhalb der Familie ein sinnvoller Übertragungsweg sein. Gerade zwischen Eltern und Kindern wird hierbei selten ein Verkauf zum vollen Verkehrswert (Marktwert) der Immobilie durchgeführt. Oft kommt es zu einer Mischung aus Schenkung und Verkauf. Das ist immer dann der Fall, wenn zwar ein Kaufpreis gezahlt wird, dieser Preis aber unter dem Marktwert des Objektes liegt. Je nachdem, ob der Erwerb vollentgeltlich, teilentgeltlich oder unentgeltlich war, ergeben sich für die Abschreibung und andere Werbungskosten unterschiedliche Konsequenzen. Besitzt ein Familienmitglied eine oder mehrere Immobilien, kann das Anlass zu vielen Varianten steuerlicher Gestaltung sein. Nießbrauch und Wohnrecht bieten hierbei viele Möglichkeiten, die es erlauben, auch komplexe Wünsche der Familienmitglieder zu realisieren - von einer Einkommensteuerreduzierung über die Einflussnahme nach einer Immobilienübertragung bis zur Absicherung der Versorgung einer Generation. Wir stellen vor allem die Folgen und Möglichkeiten bei der Einkommensteuer dar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 by Wolters Kluwer Steuertipps GmbHPostfach 10 01 61 · 68001 MannheimTelefon 0621/[email protected]
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Angaben wurden nach genauen Recherchen sorgfältig verfasst; eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen.
Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verwenden wir allgemein die grammatisch männliche Form. Selbstverständlich meinen wir aber bei Personenbezeichnungen immer alle Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen geschlechtlichen Identität.
Alternative Streitbeilegung (Online-Streitbeilegung und Verbraucherschlichtungsstelle)Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wolters Kluwer ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Inhaltsübersicht
1 Vermietung an Angehörige
1.1 So wird das Mietverhältnis anerkannt
1.2 So werden alle Werbungskosten akzeptiert
1.2.1 Wann Sie entgeltlich vermieten
1.2.2 Marktmiete und Nebenkosten
1.3 Mit welchen Angehörigen werden Mietverträge anerkannt?
1.3.1 Sie vermieten an nicht unterhaltsberechtigte Angehörige
1.3.2 Noch cleverer: Sie vermieten an einen Unterhaltsempfänger
2 Übertragung einer Immobilie an Angehörige
2.1 Diese Punkte sollten Sie vor einer Übertragung prüfen
2.2 Wenn durch die Übertragung das Kindeseinkommen steigt
3 Immobilienkauf und Weitergabe zwischen Angehörigen
3.1 So können Sie die Abschreibungen nutzen
3.1.1 Abschreibung bei unentgeltlichem Erwerb
3.1.2 Abschreibung bei vollentgeltlichem Erwerb
3.1.3 Abschreibung bei teilentgeltlichem Erwerb
3.2 Das sind Ihre Werbungskosten
3.2.1 Wann Sie Schuldzinsen als Werbungskosten absetzen können
3.2.2 Renovierungskosten: nicht immer voll abziehbar
3.2.3 Die Kosten der Vermögensübernahme sind Anschaffungskosten
3.2.4 Erhaltungsaufwendungen können verteilt werden
3.3 Sonderfragen
3.3.1 Wann das Finanzamt Ihnen die Anschaffungskosten kürzt
3.3.2 Aufgepasst beim Verkauf des Grundbesitzes
3.3.3 Gewerblicher Grundstückshandel
3.3.4 Wenn der erworbene Grundbesitz mit einem Nutzungsrecht belastet ist
4 Nießbrauchs- und Wohnrechtsverträge richtig abschließen
4.1 Nießbrauch und Wohnrecht: Was bedeutet das?
4.1.1 Was ist ein Nießbrauch?
4.1.2 Was ist ein Wohnrecht?
4.1.3 Lohnen sich Nießbrauchs- und Wohnrechtsverträge?
4.2 Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung
4.3 So vereinbaren Sie einen Nießbrauch
4.3.1 Erster Schritt: Sie müssen einen Vertrag abschließen
4.3.2 Zweiter Schritt: Der Nießbrauch muss ins Grundbuch eingetragen werden
4.3.3 Der Nießbrauch wird nicht ins Grundbuch eingetragen – was passiert dann?
4.3.4 Wann endet der Nießbrauch?
4.3.5 Der Nießbrauch bei minderjährigen Kindern
4.4 Vorbehaltsnießbrauch: steuerliche Folgen
4.4.1 Der Vorbehaltsnießbrauch ist meist unentgeltlich
4.4.2 Steuerliche Folgen beim Nießbraucher
4.4.3 Steuerliche Folgen beim Eigentümer
4.4.4 Wenn nur ein Teil des Grundbesitzes mit dem Nießbrauch belastet ist
4.4.5 Wenn nur ein Teil des Grundbesitzes mit dem Wohnrecht belastet ist
4.4.6 Ablösung des Vorbehaltsnießbrauchs: Was ist zu beachten?
4.4.7 Was passiert nach dem Erlöschen des Nießbrauchs?
4.4.8 Was wird aus dem Vorbehaltsnießbrauch beim Tod eines Ehepartners?
4.4.9 Wenn die Eltern sich am Hausbau der Kinder beteiligen
4.4.10 Statt Vorbehaltsnießbrauch: Welche Alternativen gibt es?
4.5 Zuwendungsnießbrauch: steuerliche Folgen
4.5.1 Der Zuwendungsnießbrauch kann entgeltlich, teilentgeltlich oder unentgeltlich sein
4.5.2 Steuerliche Folgen beim Eigentümer
4.5.3 Steuerliche Folgen beim Nießbraucher
4.5.4 Ablösung des Zuwendungsnießbrauchs: Was ist zu beachten?
4.5.5 Wann lohnt sich der Zuwendungsnießbrauch?
4.5.6 Sonderfall Vermächtnisnießbrauch
5 Immobilienübertragung gegen Versorgungsleistungen
5.1 Rente
5.2 Dauernde Last
5.3 Steuerliche Einordnung
5.4 Entgeltliche Übertragung
5.5 Teilentgeltliche Übertragung
5.6 Die Steuer beim bisherigen Eigentümer
5.6.1 Bei Übertragung des Eigenheims
5.6.2 Bei Übertragung von Mietimmobilien
5.7 Die Steuer beim neuen Eigentümer
5.7.1 Bei entgeltlicher Übertragung
5.7.2 bei teilentgeltlicher Übertragung
Immobilienverkauf und Vermietung zwischen Angehörigen
Einführung
Bei der Planung von Steuergestaltungsstrategien werden in allen Lebensbereichen die engsten Angehörigen einbezogen. Besonders wenn es wie bei Immobilien um sehr teure Vermögensteile geht, ist das Vertrauen in die eigene Familie besonders wichtig. So ist es nicht verwunderlich, dass auch im Immobilienbereich einige Strategien zur Reduzierung der Steuerlast durch Einbindung der eigenen Familie möglich sind.
Doch bevor Sie sich an die Arbeit machen, mit der Familie gemeinsam ein Konzept zur Steuerreduzierung zu entwickeln, sollten Sie einen Grundsatz für die Anerkennung jeglicher Gestaltung mit Familienangehörigen verinnerlichen: Der Grundsatz, nach dem die Finanzverwaltung prüft, ob Verträge zwischen nahen Angehörigen steuerlich anerkannt werden, ist der sogenannte Drittvergleich (Fremdvergleich).
Das bedeutet: Das Finanzamt muss einen Vertrag mit Angehörigen dann anerkennen, wenn er mit den gleichen Vereinbarungen auch mit Fremden geschlossen worden wäre. Hierzu wird als Vergleichsgrundlage z.B. ein üblicher Mietvertrag zwischen Fremden herangezogen. Beugen Sie möglichen Auseinandersetzungen vor, indem Sie alle Vereinbarungen schriftlich festhalten.
Wichtig: Es genügt nicht, Verträge nur so zu dokumentieren, dass sie einem Drittvergleich standhalten. In der Praxis kommt es auch darauf an, dass der geschlossene Vertrag später auch genau so durchgeführt wird.
1 Vermietung an Angehörige
Besitzen Sie eine vermietete Immobilie, erzielen Sie daraus Mieteinnahmen. Davon können Sie bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Vermietungseinkünfte die Aufwendungen für die Immobilie abziehen. Das sind zum Beispiel Darlehenszinsen, Hausmeister- und Verwalterkosten, Grundsteuer, Instandhaltungsaufwendungen und Abschreibungen.
Vermieten Sie eine Immobilie zu einer reduzierten Miete an einen Angehörigen, reduziert sich dadurch das steuerliche Ergebnis aus der Vermietung. Je höher Ihr persönlicher Steuersatz ist, desto größer sind die möglichen Steuervorteile. Dennoch verzichten Sie bei der verbilligten Überlassung an Angehörige natürlich zunächst auf Einnahmen. Nur einen Teil dieser Einnahmeausfälle gleicht die geringere Steuerbelastung wieder aus.
Meist entsteht bei der Vermietung einer Immobilie ein steuerlicher Verlust – jedenfalls solange das Objekt noch mit Darlehen belastet ist, deren Zinsen steuerlich geltend gemacht werden können. Dieser Verlust verringert Ihre Steuerbelastung.
Die Finanzbehörden erkennen Verluste jedoch immer nur dann an, wenn Sie mit einer Immobilie auf Dauer einen Überschuss erzielen werden. Bei dauerhaft zu Marktpreisen vermieteten Immobilien geht das Finanzamt zunächst einmal von einem sogenannten Totalüberschuss aus. Sie können eine Immobilie aber nicht nur an fremde Dritte, sondern auch mit einem Mietabschlag an einen Angehörigen vermieten. Vorteil: Durch die geringere Miete entsteht ein größerer steuerlicher Verlust, der einen Teil der Mieteinbußen wieder ausgleicht.
Das kann aber steuerliche Konsequenzen haben. Denn während bei der Vermietung an einen Fremden die Finanzämter selten nachfragen, werden Mietverhältnisse mit Angehörigen häufig überprüft. Die Beamten gehen oft davon aus, dass ein Mietverhältnis in Wirklichkeit nicht vorliegt und dieser Gestaltungsweg nur aus steuerlichen Gründen gewählt wurde.
1.1 So wird das Mietverhältnis anerkannt
Halten Sie alle Kriterien, nach denen die Finanzverwaltung ein Mietverhältnis prüfen kann, genau ein und dokumentieren Sie das. In jedem Fall sollten Sie einen schriftlichen Mietvertrag abschließen, wie Sie es mit jedem anderen Mieter auch tun würden. Der Mietvertrag sollte die allgemein üblichen Bestimmungen enthalten wie eine Mietkaution, Instandhaltungspflichten und Ähnliches.
!
Tipp: Verwenden Sie einen Mietvertrag, den Sie auch bei Vermietung an einen Fremden nutzen würden (Formularmietverträge). Sind Sie Mitglied im Haus- und Grundbesitzerverein, erhalten Sie hier ebenfalls geprüfte und rechtssichere Vertragsmuster.
Doch mit dem Abschluss eines Mietvertrages allein ist es nicht getan. Der Vertrag muss auch genau so eingehalten werden. Das heißt, die Mietzahlungen müssen nachweisbar fließen. Am leichtesten fällt Ihnen dieser Nachweis, wenn der Mieter monatlich die vereinbarte Miete inklusive Nebenkostenabschlägen auf ein separates Konto einzahlt. Das erleichtert Ihnen nicht nur die Buchführung im Zusammenhang mit den Mieteinnahmen. Sie können auch jederzeit belegen, dass die Mieten wie vereinbart gezahlt wurden.
Aber nicht nur die Miete muss gezahlt werden. Damit ein Mietverhältnis wie mit einem fremden Dritten durchgeführt ist, müssen auch die Nebenkosten erfasst und abgerechnet werden. Da jeder Mieter Anspruch auf eine korrekte Nebenkostenabrechnung hat, dürfen Sie bei der Vermietung an Familienangehörige davon keine Ausnahme machen.
Fremdvergleich
Das Finanzamt kann einen Mietvertrag mit Angehörigen nicht anzweifeln, wenn er genauso durchgeführt wird, wie es mit einem Fremden der Fall wäre. Diese Prüfung der Finanzverwaltung nennt man Fremdvergleich.
!
Tipp: Miete und Nebenkosten sollten genauso gezahlt werden wie bei jeder anderen Vermietung auch. Sorgen Sie dafür, dass diese Umstände jederzeit belegbar sind, und verzichten Sie nach Möglichkeit auf Barzahlung oder Aufrechnung mit anderen Geldflüssen zwischen den Angehörigen.
Und das sind die Einzelheiten:
Der BFH lässt es auch zu, dass Sie die Unterhaltszahlungen mit der Miete verrechnen und dem Kind nur die Differenz als Barunterhalt überweisen (BFH-Urteil vom 19.10.1999, IX R 30/98, BStBl. 2000 II S. 223). Das Gleiche gilt, wenn Ihr Kind die Miete aus einer einmaligen Geldschenkung von Ihnen bestreitet (BFH-Urteil vom 28.3.1995, IX R 47/93, BStBl. 1996 II S. 59).
Wir empfehlen Ihnen aber, die Unterhaltszahlungen nicht mit der Miete zu verrechnen. Wenn Sie dem Kind lediglich den um die Miete gekürzten Barunterhalt überweisen, besteht die Gefahr, dass das Mietverhältnis »in Vergessenheit« gerät und dann nicht mehr wie vereinbart durchgeführt wird. Sobald Sie beispielsweise die verringerten Unterhaltszahlungen nicht regelmäßig monatlich überweisen, ist damit gleichzeitig die Miete nicht regelmäßig gezahlt, was wiederum unter Fremden unüblich wäre.
Ein Verfahren vor dem BFH hatte sich mit einer besonders weiten Auslegung der Verrechnung zu befassen: Die Eltern hatten der Tochter eine Wohnung überlassen und Verluste aus Vermietung und Verpachtung geltend gemacht. Anstelle einer Mietzahlung gaben Sie an, der Tochter weniger Barunterhalt gezahlt zu haben. Einen Beleg hierfür konnten sie nicht beibringen, da die Zahlungen unregelmäßig und bar erfolgt seien. Dieser großzügigen Interpretation folgten Finanzgericht und BFH nicht und versagten die Anerkennung von Vermietungsverlusten. Denn ein Mietverhältnis konnten die Richter hier nicht erkennen (BFH-Urteil vom 16.2.2016, IX R 28/15, BFH/NV 2016 S. 1006).
Ergibt sich aus der Nebenkostenabrechnung eine Nachzahlung des Mieters, dann dürfen Sie Ihrem Kind diese Nachzahlung auf keinen Fall erlassen. Eine solche Schenkung wäre unter Fremden nicht üblich.
Denken Sie später daran, dass das Mietverhältnis mit dem Kind beispielsweise zum Ende des Studiums ordnungsgemäß beendet wird. Das Kind sollte entweder entsprechend den Kündigungsfristen im Mietvertrag rechtzeitig kündigen oder Sie sollten mit dem Kind einen Mietaufhebungsvertrag abschließen (»Die Vertragsparteien erklären übereinstimmend, dass das Mietverhältnis zum ... endet.«).
Vermietung über Kreuz
Ein Mietvertrag wird grundsätzlich steuerlich nicht anerkannt, wenn sich Angehörige eine Immobilie wechselseitig vermieten (BFH-Urteil vom 25.1.1994, IX R 97-98/90, BStBl. 1994 II S. 738). Diese Konstruktion dient nur dazu, den Beteiligten den Werbungskostenabzug zu verschaffen und ist damit ein Gestaltungsmissbrauch. Möchten Sie in diesen Fällen eine Anerkennung der Mietverträge erreichen, müssen Sie gute Argumente für diese Konstellation anführen.
Das könnte der Fall sein, wenn die Eltern ihr Einfamilienhaus nicht mehr bewirtschaften können, der jungen Familie dagegen die Eigentumswohnung in der Nachbarschaft zu klein wird. Ziehen die Eltern in diesem Fall in die kleinere und seniorengerechtere Eigentumswohnung, während die Familie des Kindes in das für sie deutlich besser geeignete Einfamilienhaus mit großem Garten umzieht, ist das ein nachvollziehbarer Grund für die wechselseitige Vermietung.
Ausnahme: Ein Kind vermietet den Eltern eine Wohnung und wohnt gleichzeitig unentgeltlich im Haus der Eltern. Der Unterschied: Das ist nur eine »halbe« Überkreuzvermietung, weil ohnehin nur der Sohn Werbungskosten abziehen kann, die Eltern aber nicht. Den Eltern wiederum steht es frei, ihr Haus unentgeltlich zu überlassen. Damit liegt kein Gestaltungsmissbrauch vor (BFH-Urteil vom 14.1.2003, IX R 5/00, BStBl. 2003 II S. 509).
Außerdem wird eine Überkreuzvermietung in Kombination mit einer vorweggenommenen Erbfolge in folgendem Fall anerkannt: Ein Zweifamilienhaus wird in zwei Eigentumswohnungen aufgeteilt, von denen Mutter und Sohn jeweils eine bewohnen. Gleichzeitig überträgt die Mutter dem Sohn die von ihr selbst genutzte Wohnung. Anschließend vermieten sich Mutter und Sohn die Wohnungen gegenseitig (BFH-Urteil vom 12.9.1995, IX R 54/93, BStBl. 1996 II S. 158). Anders als bei der »normalen« Überkreuzvermietung liegt darin kein Gestaltungsmissbrauch. Denn die Mutter konnte frei über ihr Eigentum verfügen und unter wirtschaftlichen Aspekten durchaus auch die von ihr selbst genutzte Immobilie übertragen.
Dagegen wird ein Mietvertrag steuerlich nicht anerkannt, wenn Eltern und Kinder ihre Eigentumswohnungen untereinander tauschen und sich die Wohnungen anschließend gegenseitig vermieten (FG Münster vom 20.1.2010, 10 K 5155/05, DStRE 2011 S. 213). In dem konkreten Fall hatten sowohl der klagende Sohn als auch seine Eltern für jeweils eine selbst genutzte Eigentumswohnung Förderung nach § 10e EStG erhalten. Nach dem Ende der Förderung tauschten sie notariell das Eigentumsrecht an den Wohnungen und vermieteten sie sich gegenseitig. Ziel war es, die Schuldzinsen für die beiden Objekte als Werbungskosten abzusetzen.
Das ließen die Finanzrichter nicht zu. Für diese ungewöhnliche Gestaltung gebe es keine wirtschaftlichen oder sonstigen außersteuerlichen Gründe, vielmehr sollten nur Steuern gespart werden. Der Kläger war Zeitsoldat und hielt sich nur gelegentlich in der Wohnung auf. Ein »verständiger« Eigentümer hätte aber nicht seine Eigentumswohnung vermietet und zugleich von seinem Mieter dessen Wohnung angemietet, um sich dort nur selten aufzuhalten, so die Richter. Den Hinweis des Klägers, nach seinem Ausscheiden aus der Bundeswehr am Wohnort eine neue Berufstätigkeit aufnehmen und eine Familie gründen zu wollen, ließ das Finanzgericht nicht gelten.
Die Miete darf nicht über Umwege zum Mieter zurückfließen
Auch wenn es sich beim Mieter um einen nahen Angehörigen handelt, dürfen Sie nicht über Umwege die gezahlten Mieten zurückerstatten.
In einem vor dem Finanzgericht Düsseldorf verhandelten Fall hatte der Ehemann einen von ihm bezahlten Anbau auf dem gemeinsamen Grundstück an die Ehefrau zum Betrieb einer Psychotherapiepraxis vermietet. Der Mietvertrag wies einige Lücken auf: Es fehlten Angaben zur Fläche, Anzahl und Ausstattung der vermieteten Räume, zu Nebenräumen sowie die Anschrift der Mieträume. Die Mieten wurden monatlich vom Praxiskonto der Ehefrau auf ein Konto des Ehemannes gezahlt. Von dort flossen alle drei Monate Beträge, die ungefähr der dreifachen Monatsmiete entsprachen, auf ein anderes Konto der Ehefrau.
Die zeitnahe Rückzahlung der geleisteten Mietzahlungen an die Ehefrau wurde nicht nur vom Finanzamt moniert. Auch das Finanzgericht schloss sich dem an und versagte die Anerkennung des Mietvertrages. Ausschlaggebend waren hierbei nicht die formalen Fehler im Mietvertrag, sondern, dass das Mietverhältnis nicht wie vereinbart und unter fremden Dritten üblich durchgeführt wurde (FG Düsseldorf vom 25.6.2010, 1 K 292/09 E, EFG 2010 S. 1415).
Mietvertrag und Schenkung in Kombination
Der BFH hatte über eine Kombination aus Mietverhältnis und Schenkungsvereinbarung zwischen Angehörigen zu entscheiden: Der Sohn hatte eine Doppelhaushälfte an seine Mutter vermietet. Diese hatte ihm zuvor einen größeren Geldbetrag geschenkt, sich aber das Recht vorbehalten, jährlich einen Betrag von bis zu 10.000,– € zurückzufordern. Diese Rückforderung erhob die Mutter nun jedes Jahr und verrechnete ihren Anspruch dann mit der jährlich nachträglich fälligen Jahresmiete für ihre Doppelhaushälfte.
Nachdem das Finanzgericht die Gestaltung bereits ablehnte, weil sie einem üblichen Mietvertrag mit Fremden bei Weitem nicht entspricht, ging der Fall noch zum Bundesfinanzhof. Die höchsten Finanzrichter sahen nicht nur die Gestaltung des Mietvertrages, sondern auch eine Schenkung mit Rückforderungsvorbehalt als unüblich und damit als nicht anzuerkennen an (BFH-Urteil vom 4.10.2016, IX R 8/16, BStBl 2017 II S. 273).
Vieles am Mietvertrag war ungewöhnlich: Mietzahlungen wurden nur einmal jährlich im Nachhinein geleistet; die Nebenkosten wurden ohne Vorauszahlungen ebenfalls nur einmal pro Jahr abgerechnet und auch erst nach mehreren Monaten bezahlt. Außerdem war eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten vereinbart und eine Mietsicherheit fehlte.
Vermietung in häuslicher Lebensgemeinschaft
Nicht akzeptiert wird es, wenn Sie Teile Ihrer Wohnung an den Partner vermieten. Bei Ehepartnern ist die gemeinsame Nutzung der Wohnung aus privaten Zwecken in der Regel sofort ersichtlich. Aber auch bei unverheirateten Paaren überwiegt die private Veranlassung des Zusammenlebens und ein Miet- oder Untermietverhältnis kommt nicht infrage (FG Baden-Württemberg vom 6.6.2019, 1 K 699/19).
1.2 So werden alle Werbungskosten akzeptiert





























