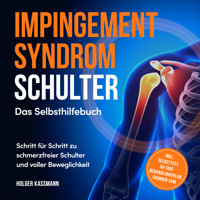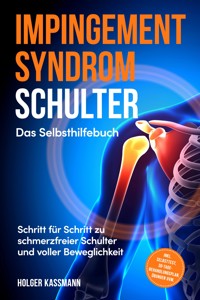
Impingement Syndrom Schulter - Das Selbsthilfebuch: Schritt für Schritt zu schmerzfreier Schulter und voller Beweglichkeit - inkl. Selbsttest, 30-Tage-Behandlungsplan, Übungen uvm. E-Book
Holger Kassmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONIX Media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Impingement-Syndrom: Mit Expertenwissen das Impingement-Syndrom verstehen und durch alltagstaugliche Praxismaßnahmen effektiv bekämpfen Ihre Schulter macht schon länger Probleme, und Sie vermuten das Impingement-Syndrom? Oder Sie haben bereits eine entsprechende ärztliche Diagnose erhalten? Und nun wollen Sie selbst aktiv werden, um ohne Tabletten und OP wieder uneingeschränkte Bewegungsfreiheit zu genießen? Dann ist dieser Ratgeber Ihr perfekter Therapie-Begleiter! Mit der Enge in der Schulter sind Sie nicht allein: Etwa jeder Zehnte in Deutschland leidet einmal in seinem Leben unter dem Impingement-Syndrom, das mit starken Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und erheblicher Minderung der Lebensqualität einhergehen kann. Die gute Nachricht: Die meisten Beschwerdebilder lassen sich innerhalb kurzer Zeit, ohne OP und in Eigenregie, gut behandeln, und dieses Buch zeigt Ihnen, wie. Machen Sie sich zunächst mit den wichtigsten anatomischen Grundlagen der Schulter sowie den Merkmalen des Impingement-Syndroms vertraut und ermitteln Sie mit wissenschaftlich etablierten Tests, ob Ihre Beschwerden darauf zurückzuführen sind. Anschließend sagen Sie den Schmerzen aktiv den Kampf an: mit einer großen Auswahl an kinderleichten, sofort durchführbaren und hochwirksamen Maßnahmen aus Bereichen wie akuter Schmerzbekämpfung, Mobilisierung, Kräftigung, Triggerpunktarbeit, Ernährung, Prävention und Regeneration. Ohne ärztliche Hilfe? Keine Sorge! Auch die mögliche Notwendigkeit medizinischer Behandlung kommt nicht zu kurz, doch in erster Linie ist dieser Praxisratgeber darauf ausgerichtet, Ihnen dank detaillierter Anleitungen effektive Maßnahmen zur Selbsthilfe an die Hand zu geben. Unter der Lupe: Aufbau der Schulter, Anatomie und Symptome des Impingement-Syndroms, Abstufungen der Erkrankung sowie medizinische Interventionsmöglichkeiten – werden Sie in kürzester Zeit zum Schulter-Experten. Schmerzen behandeln: Lernen Sie Methoden wie Klopftechnik, Kneten und Reiben sowie Entlastungslagerung für akute Phasen kennen und gezielte Mobilisierungs-, Kräftigungs- und Dehnübungen für chronische Schmerzphasen. Machen Sie sich mit Triggerpunkt- und Faszienmassage vertraut. Ganzheitlicher Ansatz: Finden Sie heraus, wie Sie mit antientzündlicher Ernährung, optimaler Mikronährstoffversorgung, gezielter Erholung sowie korrekter Alltagshaltung den Grundstein für umfassende Schulter-Gesundheit legen. Starke Schultern: Dieses Buch zeigt Ihnen einen alltagstauglichen und langfristigen Weg aus der Schmerzfalle und gibt Ihnen Bewegungsfreiheit und Kraft zurück. Mit dem zusätzlichen "30-Tage-Selbstbehandlungsplan" im Bonusteil können Sie zudem sofort durchstarten und in kürzester Zeit gezielt erste Erfolge verwirklichen. Also worauf warten Sie noch? Klicken Sie nun auf "Jetzt kaufen mit 1-Click" und freuen Sie sich darauf, sich schon bald wieder auf starke Schultern zum Bäumeausreißen verlassen zu können!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2025 www.edition-lunerion.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2025
Inhalt
Vorwort
Kurzcheck: Leide ich möglicherweise am Impingement-Syndrom?
Typische Symptome des Schulter-Impingement
Unter der Lupe: Aufbau & Funktion der Schulter
Aufbau des Schultergelenks
Impingement-Syndrom der Schulter – wenn es in der Schulterzu eng wird
Risikofaktoren: Wie es zum Impingement-Syndrom kommt
Typische Impingement-Beschwerden in der Schulter
Ähnliche Beschwerden der Schulter
Schmerzkompass: Stufen des Impingement-Syndroms
Das Impingement-Syndrom der Schulter im Anfangsstadium
Umgang mit der Krankheit im fortgeschrittenen Stadium und nach einer Operation
Leben mit dem Impingement-Syndrom der Schulter
Schulterschmerzen effektiv selbst behandeln
Akute Schmerzphasen
Chronische Phasen
Mobilisieren
Kräftigen
Dehnen
Dehnung des Schultergürtels
Triggerpunkte finden & lösen
Was sind Triggerpunkte?
Praktisches Vorgehen
Regeneration & Lockerung: Die Faszienmassage
Dehnung
In Balance: Den Körper ganzheitlich stärken
Gesundheit fokussieren
Anti-entzündliche Ernährung
Mikronährstoffe für eine umfassende Versorgung
„Auf starken Schultern lastet viel“: Regeneration & Erholung
Prävention & Regeneration: Was starke Schultern brauchen
Mobilisation
Kräftigung
Stabilisation
Weiterführende Tipps
Ärztliche Behandlung
Operation, ja oder nein?
Physiotherapie
Bonus: Schmerzfrei & fit
Der 30 Tage Selbstbehandlungsplan für Gesundheit & Prävention
Quellen
Vorwort
Wenn Sie an dem Impingement-Syndrom der Schulter leiden, sind Sie nicht allein. Etwa jeder zehnte Erwachsene in Deutschland erkrankt einmal im Leben an einem Impingement. Das macht es zum dritthäufigsten Beschwerdebild im orthopädischen Bereich.
Doch auch geteiltes Leid bleibt Leid. So geht das Impingement-Syndrom der Schulter mit zahlreichen Einschränkungen im Alltag und einem hohen Leidendruck einher.
Leiden auch Sie an dem Impingement, gibt es gute Nachrichten für Sie. Die meisten Beschwerdebilder der Schulter lassen sich innerhalb kurzer Zeit ohne einen operativen Eingriff von zuhause aus behandeln und sogar vollständig beseitigen.
In diesem Buch werden Sie an die Hand genommen und bekommen aufgezeigt, wie Sie die Behandlung Ihrer Schulterschmerzen effektiv unterstützen können. Sie lernen alle nötigen Informationen zur Anatomie und Funktion der Schulter, um zu verstehen, was das Impingement überhaupt ist und wie es entsteht. Damit Sie sich in akuten sowie chronischen Schmerzphasen zu helfen wissen, lernen Sie eine Vielzahl an Antischmerz-Techniken kennen.
Starke und bewegliche Schultern geben Ihnen die Lebensqualität zurück, die Ihnen das Impingement genommen hat, deshalb mangelt es in diesem Buch nicht an Übungsbeispielen fürs Schultertraining So haben Anfänger, Fortgeschrittene und Profis immer die passende Übung parat.
Um Schulterbeschwerden zu behandeln, ist neben dem Training der Schulter auch die ganzheitliche Gesundheit Ihres Körpers wichtig. Alles, was Sie zu gesunder Ernährung, einem qualitativen Schlaf sowie mentaler Gesundheit und Stressreduzierung wissen müssen, ist deshalb ebenso in diesem Buch zu finden. Am Ende erwartet Sie noch ein 30-Tage-Plan, der Ihnen den Einstieg in neue gesunde und schulterfreundliche Routinen kinderleicht macht.
Also worauf warten Sie noch? Werden Sie selber zum Experten Ihre Schulter und legen Sie los. Schulterschmerzen adé!
Kurzcheck: Leide ich möglicherweise am Impingement-Syndrom?
Durch einfache Tests können Sie selbst einschätzen, ob es sich bei Ihren Beschwerden um das Impingement-Syndrom handelt. Sein typisches Beschwerdebild lässt das Impingement-Syndrom gut von anderen Erkrankungen der Schulter unterscheiden. Die schmerzhafte Enge im Bereich des Schultergelenks ist dabei das Hauptdiagnosekriterium und leicht mithilfe von Tests herbeizuführen, wenn ein Impingement vorliegt. Wenn bei Ihnen das Impingement der Schulter schon ärztlich festgestellt wurde, können Sie dieses Kapitel überspringen.
Da das Wissen über die typischen Beschwerden einer Erkrankung häufig die Wahrnehmung der eigenen Beschwerden verändert, sollten Sie sich zuallererst einen Moment Zeit nehmen, um sich zu fragen, was genau Ihre Beschwerden sind. Vielleicht hilft es Ihnen auch, einige Notizen zu machen. Überlegen Sie sich, bei welchen Bewegungen Sie Schmerzen haben und wann diese Sie im Alltag einschränken. Wo genau sind die Schmerzen? Wie fühlt sich der Schmerz an? Wie intensiv ist der Schmerz? Was hilft, den Schmerz zu lindern? Ist Ihnen noch etwas aufgefallen? Auch ein Schmerztagebuch ist eine gute Möglichkeit, einen Überblick über Ihre Schmerzen zu gewinnen und erleichtert nebenbei auch den nächsten Arztbesuch, da Sie genau dokumentiert haben, welche Beschwerden Sie haben.
Beispiel für ein Schmerztagebuch
Datum
29.10.24
Uhrzeit
09:02 Uhr
Schmerzintensität (0-10)
6
Art des Schmerzes
Ziehend
Lokalisation
Seitlich, vorne
Dauer
10 Minuten
Auslöser
Haare föhnen
Linderung
Kälte, Schonung
Bemerkung
Leichte Taubheit
Typische Symptome des Schulter-Impingement
Durch das Einklemmen von Weichteilen in der Schulter kommt es beim Impingement-Syndrom zu Schmerzen. Diese beschreiben die meisten Patienten als tief im Gelenk liegend. Sie treten am stärksten beim Anheben der Arme auf Höhe der Schulter auf, was zu einer eingeschränkten Bewegungsfreiheit führt. Patienten können nicht mehr über dem Kopf arbeiten oder ihre Arme zur Seite heben. Auch meiden Patienten das Liegen auf der betroffenen Seite aufgrund der Schmerzen. Eventuell können Geräusche wie Knacken oder Reiben beim Heben der Arme entstehen. Erkennen Sie sich in diesem Absatz wieder? Dann leiden Sie wahrscheinlich an einem Impingement-Syndrom der Schulter.
Tests zum Impingement
Das Prinzip von Impingement-Tests ist, die krankhafte Enge im Schultergelenk durch bestimmte Bewegungen hervorzurufen. Lösen diese Bewegungen einen Schmerz aus, ist der Test positiv und ein Impingement-Syndrom wahrscheinlich. Es ist wichtig, die Bewegungen langsam und vorsichtig auszuführen, um zu starke Schmerzen zu vermeiden.
Painful Arc
Der Painful Arc, englisch für schmerzhafter Bogen, ist der bekannteste Test, um ein Impingement festzustellen. Heben Sie Ihre zu den Seiten ausgestreckten Arme langsam nach oben, als würden Sie, wie bei einem Hampelmann, Ihre Hände oben zusammenführen wollen. Ein einsetzender Schmerz, der kurz vor der Schulterhöhe (60°) einsetzt und weiter oben (120°) wieder aufhört, spricht für einen positiven Test und ein Impingement-Syndrom.
Anmerkung
Wenn die Schmerzen bei einer Abduktion von über 120 Grad auftreten, deutet dies eher auf eine Erkrankung im AC-Gelenk (Schultereckgelenk) hin, das sich zwischen Acromion (ein Knochenvorsprung, der den höchsten Punkt des Schulterblattes (Scapula) darstellt) und Schlüsselbein befindet. Dies könnte beispielsweise auf eine Arthrose hindeuten.
Neer-Test
Für den Neer-Test, auch Neer-Zeichen genannt, brauchen Sie eine weitere Person, da dieser Test in einer passiven Bewegung ausgeführt wird. Die Person fixiert zunächst das Schulterblatt, indem sie Druck von oben auf die Schulter ausübt. Danach positioniert sie den Arm in einer Innenrotation, das heißt, dass der Daumen nach unten zeigt. Nun führt sie den ausgestreckten Arm langsam vorne nach oben. Treten ähnlich wie beim Painful Arc wieder Schmerzen auf Höhe der Schulter und höher (90-120°) auf, ist dies ein Zeichen für ein Impingement-Syndrom. Zusätzlich sollte eine verstärkte Außenrotation des Arms zu einer Schmerzlinderung führen, da in dieser Position das Risiko einer Einklemmung unter dem Schulterdach verringert wird.
Schürzengriff
Der Schürzengriff ist ein schneller Test, um Ihre Beweglichkeit und die Muskeln Ihrer Schulter zu testen. Führen Sie Ihre Hände hinter Ihrem Rücken auf Gürtelhöhe zusammen, als würden Sie sich eine Schürze umbinden wollen. Diese Bewegung sollte im Normalfall für keine Beschwerden sorgen. Tut sie es doch, weist dies auf ein Problem Ihrer Schultermuskulatur hin. Allerdings nicht zwingend auf ein Impingement-Syndrom.
Jobe-Test
Mit dem Jobe-Test können Sie Defekte Ihrer Schulter feststellen, insbesondere solche, die die Sehne des Muskels Supraspinatus involvieren. Auch für diesen Test brauchen Sie eine zweite Person. Um den Test durchzuführen, bringen Sie zunächst Ihre ausgestreckten Arme schräg nach vorne auf Schulterhöhe, so als würden Sie einen riesigen Gymnastikball umarmen. Rotieren Sie Ihre Arme nach innen, das heißt, die Daumen schauen nach unten. Jetzt übt die helfende Person Druck von oben auf Ihre ausgestreckten Arme aus. Wenn das Halten der Arme gegen diesen Widerstand bei Ihnen Schmerzen verursacht, ist der Test positiv.
Eine weitere mögliche Ursache für Ihre Schmerzen könnte eine Kalkschulter sein, bei der es zu Kalkablagerungen in den Sehnen kommt. Eine Kalkschulter sorgt im Gegensatz zum Impingement-Syndrom schon bei Druck auf die Schulter für Schmerzen und lässt sich so vom Impingement-Syndrom unterscheiden. Der Behandlungsansatz der Kalkschulter ähnelt mit Physiotherapie, Schmerzmitteln und Kältetherapie dem des Impingement-Syndroms. Die in diesem Buch beschriebenen Übungen können teilweise auch Beschwerden einer Kalkschulter lindern, fokussieren sich aber hauptsächlich auf das Impingement-Syndrom.
Definition: Kalkschulter
Durch Alterungsprozesse, Überlastungen oder Verletzungen kann es in den Sehnen der Schulter zu Kalkablagerungen kommen. Diese führen zu ähnlichen Symptomen wie das Impingement-Syndrom mit dem Unterschied, dass schon allein Druck auf der Schulter Schmerzen verursacht, was beim Impingement meist nicht der Fall ist.
Ob Sie sich nun sicher sind, dass Sie am Impingement-Syndrom leiden oder nicht: Sie sollten Ihre Beschwerden auf jeden Fall ärztlich abklären lassen.
Unter der Lupe: Aufbau & Funktion der Schulter
Nichts ist so komplex und faszinierend wie unsere Schulter. Sie hat den größten anatomischen Bewegungsspielraum aller Gelenke, aber gleichzeitig die geringste knöcherne Stabilität. Dadurch ist sie besonders anfällig für Verletzungen. Um diese Schwäche auszugleichen, wird die Stabilität des Schultergelenks durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Muskelgruppen und Sehnen gewährleistet. Schon kleinste Ungleichgewichte in diesem komplexen Gefüge können entzündliche Prozesse auslösen, die oft zu den typischen Schulterschmerzen führen. Damit Sie nun verstehen, wie es überhaupt zu einem Impingement-Syndrom kommt und wie Ihnen Übungen helfen können, Ihre Beschwerden zu lindern, ist es wichtig, den anatomischen Aufbau der Schulter zu kennen. Jeder weiß, wo die Schulter ist, aber wissen Sie auch, wo genau Ihr Schultergelenk sitzt und welche Teile Ihres Skeletts es verbindet?
Vielleicht kommt Ihnen dieser Abschnitt an der ein oder anderen Stelle etwas trocken vor. Sie werden jedoch schnell merken: Ihren eigenen Körper sowie die medizinische Theorie hinter diesem zu kennen, hilft Ihnen, selbstbestimmter und eigenverantwortlicher mit Ihren Beschwerden umzugehen. Sie können verstehen, wie bestimmte physiotherapeutische Übungen wirken, aber auch im Gespräch mit medizinischem Personal, welches leider oft komplexe medizinische Sprache benutzt, treten Sie selbstbewusster auf.
Aufbau des Schultergelenks
Das Schultergelenk, auch Articulatio humeri oder Articulatio glenohumeralis genannt, verbindet den Oberarmknochen mit dem Schulterblatt. Um genau zu sein, den oberen Teil des Oberarms, auch Oberarmkopf (Caput humeri) genannt, und den äußersten Teil des Schulterblatts, an dem die Gelenkpfanne (Cavitas glenoidalis) sitzt. Der Oberarmkopf besitzt unter der Gelenkfläche eine kleinere (Tuberculum minus) und eine größere Erhebung (Tuberculum majus). Die Gelenkpfanne ist eine rundliche Vertiefung am seitlichen Ende des Schulterblatts, die durch ihr Aussehen schon erahnen lässt, dass sie das Gegenstück zum kugelförmigen Oberarmkopf bildet.
Über der Gelenkpfanne befindet sich das Schulterdach (Acromion), ein spitzer Knochenvorsprung, der durch das Acromioclaviculargelenk, kurz AC-Gelenk, mit dem Schlüsselbein verbunden ist. Der Raum zwischen dem Oberarmkopf und dem Acromion nennt sich subacromialer Raum. Neben dem Acromion besitzt das Schulterblatt noch einen weiteren zackigen Vorsprung, der aufgrund seiner Form Rabenschnabelfortsatz (Processus coracoideus) genannt wird.
Probieren Sie doch einmal aus, ob Sie die knöchernen Strukturen des Schulterblatts selbst fühlen können. Insbesondere das Schulterblatt mit dem Acromion sowie das Schlüsselbein können Sie gut bei sich selbst ertasten. Legen Sie dafür eine Hand auf Ihre hintere Schulter und ertasten Sie durch leichten Druck zunächst das Schulterblatt. Sobald Sie dies gefunden haben, folgen Sie diesem härteren Widerstand nach außen in Richtung Ihres Oberarmes. Wenn Sie die Seite Ihres Oberarms erreicht haben und eine knöcherne Kante spüren können, halten Sie wahrscheinlich Ihr Acromion zwischen den Fingern. Wenn Sie nun mit Ihren Fingern weiter auf dem Acromion nach vorne wandern, landen Sie automatisch auf Ihrem Schlüsselbein.
Verursacht das Tasten bei Ihnen jedoch Schmerzen, sollten Sie lieber auf diese kleine Erkundungstour verzichten.
Natürlich reichen ein paar knöcherne Strukturen noch nicht aus, um ein funktionsfähiges Gelenk zu bilden. Ohne Kapsel, Bänder und Muskeln würden die Knochen einfach auseinander gleiten. Uns fehlen also noch solche Strukturen, die das Gelenk stabilisieren.
So befinden sich die beiden Gelenkflächen des Oberarms und des Schulterblatts in einer Gelenkkapsel. Diese besteht aus Bindegewebe und umgibt das Gelenk vollständig. In der Gelenkkapsel sorgt die dickflüssige Synovialflüssigkeit für Geschmeidigkeit und für die Versorgung des Gelenks mit Nährstoffen.
Hinweis:
Synovialflüssigkeit versorgt den Knorpel in den Gelenken mit Nährstoffen, und dieser Prozess ist tatsächlich stark von Bewegung abhängig. Bei Bewegung des Gelenks wird der Knorpel abwechselnd komprimiert und entlastet. Diese Druckwechsel wirken wie eine Pumpe, denn sie drücken alte Flüssigkeit aus dem Knorpel heraus und ziehen frische, nährstoffreiche Synovialflüssigkeit hinein. Ohne Bewegung bleibt die Synovialflüssigkeit weitgehend statisch. Dadurch gelangen weniger Nährstoffe in den Knorpel, und Abfallprodukte können sich ansammeln, was langfristig die Gesundheit des Gelenks beeinträchtigen kann. Gerade im Fall Arthrose ist daher eine Schonung weniger wirkungsvoll als moderate tägliche Bewegung.
Neben der Gelenkskapsel sorgen verschiedene Bänder (Ligamenta) für weitere Stabilität. Bänder sind faserreiche Bindegewebsstränge. Sie sind bis zu einem gewissen Maß dehnbar, aber dennoch sehr robust, das Klebeband unseres Körpers sozusagen.
Ihre Namen verdanken die Bänder meist den Strukturen, die sie miteinander verbinden. So heißen die wichtigsten Bänder in der Schulter:
Ligamentum coracoacromiale (Rabenschnabelfortsatz-Schulterdach-Band),
Ligamentum coracohumerale (Rabenschnabelfortsatz-Oberarm-Band) und
Ligamenta glenohumeralia (Schultergelenkbänder).
Im Gegensatz zu anderen Gelenken unseres Körpers wie dem Knie oder der Hüfte spielen die Bänder im Schultergelenk eine untergeordnete Rolle, wenn es um die Stabilität geht. Denn das Schultergelenk wird hauptsächlich von Muskeln und deren Ansätzen (Sehnen) stabilisiert. Vier Muskeln sind daran hauptsächlich beteiligt und ergeben zusammen die sogenannte Rotatorenmanschette. Die Sehnen der Muskeln der Rotatorenmanschette umgeben das Schultergelenk wie eine Kappe oder eben wie eine Manschette und sorgen dafür, dass der Oberarmkopf auch bei Bewegung immer mittig in der Gelenkpfanne liegen bleibt.
Funktion des Schultergelenks
Ohne Schultergelenke wäre der Alltag hart. Im Supermarkt in das höchste Fach greifen, Fahrrad fahren, Dinge hochheben, essen und trinken. Vielleicht mussten Sie aufgrund Ihrer Beschwerden in letzter Zeit auch schon schmerzhaft feststellen, an welchen Bewegungen das Schultergelenk beteiligt ist. Denn das Schultergelenk ermöglicht es uns, über 1000 unterschiedliche Positionen einzunehmen. Das Schultergelenk ermöglicht uns eine Vielzahl an Bewegungen: das Heben der Arme zur Seite (Abduktion) oder das Zusammenführen hinter dem Rücken, wie beim Schürzengriff (Adduktion), ebenso wie das Heben der Arme nach vorne (Anteversion) oder nach hinten (Retroversion). Auch Drehbewegungen des Oberarms um die eigene Achse (Innen- und Außenrotation) sowie Kombinationen all dieser Bewegungen sind möglich, da das Schultergelenk fast mühelos alle drei Raumachsen abdeckt.
Das Schultergelenk ist ein Kugelgelenk. Die Gelenkpfanne umfasst die Gelenkfläche des Gelenkkopfes, dem Oberarmkopf, nur zu 30 Prozent, das sorgt für mehr Bewegungsfreiheit und macht das Schultergelenk zu dem beweglichsten Gelenk unseres Körpers. Dies sorgt aber auch für eine höhere Luxationsgefahr, also ein Rausrutschen des Gelenkskopfs aus der Gelenkpfanne. Um dies zu verhindern, sorgen die Sehnen der Muskeln der Rotatorenmanschette – der Untergrätenmuskel (Infraspinatus), der Obergrätenmuskel (Supraspinatus), der kleine Rundmuskel (Teres minor) und der Unterschulterblattmuskel (Subscapularis) – dafür, dass der Oberarmkopf stabil in der Gelenkpfanne bleibt. Diese Muskeln dienen aber nicht nur der Stabilität, sondern sind auch für die Bewegung des Schultergelenks verantwortlich. Je nach Lage und Verlauf der Muskeln sind die verschiedenen Muskeln jeweils für bestimmte Bewegungen zuständig.
Die Muskeln Musculus supraspinatus, Musculus infraspinatus und Musculus teres minor sitzen auf der Rückseite des Schulterblatts. Der Musculus supraspinatus sorgt für das Anheben der Arme (Abduktion) und insbesondere für den Start dieser Bewegung. Musculus infraspinatus und Musculus teres minor veranlassen hauptsächlich die Außenrotation.
Der Musculus subscapularis befindet sich als einziger Muskel der Rotatorenmanschette auf der Vorderseite des Schulterblattes und ermöglicht eine Innenrotation im Schultergelenk.
Zwei andere wichtige Muskeln, die zwar nicht Teil der Rotatorenmanschette sind, aber dennoch für wichtige Bewegungen verantwortlich sind, sind der Musculus deltoideus (Deltamuskel) für die Abduktion und der Musculus latissimus dorsi (breiter Rückenmuskel) für die Innenrotation. Der Musculus deltoideus ist der Muskel, der der Schulter oberflächlich aufliegt. Wenn Sie eine Hand auf Ihre Schulter legen, können Sie eventuell fühlen, wie sich der Musculus deltoideus anspannt, sobald Sie Ihren Arm anheben. Der Musculus latissimus dorsi zieht mit seinen Fasern über Ihren gesamten Rücken und ist weniger gut tastbar.
Neben den Muskeln sorgen auch die Gelenklippen und die Schleimbeutel wortwörtlich für eine reibungslose Funktion des Schultergelenks. Als Gelenklippe (Labrum) wird der erhabene Rand der Gelenkpfanne bezeichnet, der ein Rausrutschen des Gelenkkopfes verhindern soll. Außerdem setzt die Sehne des Bizepsmuskels an ihr an. Die zwei wichtigsten Schleimbeutel im Schultergelenk sind die Bursa subacromialis zwischen der Sehne des Supraspinatus und dem Acromion und die Bursa subdeltoidea, die sich zwischen der Gelenkkapsel und dem Musculus deltoideus befindet. Die Schleimbeutel puffern das Gelenk und vermindern Reibung bei Bewegung.
Die Bursa subacromialis befindet sich in dem Raum zwischen der Gelenkkapsel und dem Acromion, der auch als subacromialer Raum bezeichnet wird.
Die Schleimbeutelentzündung (Bursitis)
Schleimbeutel sind das, was ihr Name schon suggeriert. Sie sind Beutel, gefüllt mit Schleim, deren Funktion es ist, Bewegungen in Gelenken zu puffern. Durch Überlastung, Verletzungen oder Infektionen kann es zu einer Entzündung der Schleimbeutel kommen (Bursitis). Diese äußert sich meist mit Schmerzen, einer Schwellung und Erwärmung des Beutels sowie Bewegungseinschränkungen des betroffenen Gelenks.
Wie Sie sehen, ist unser Körper ein wirkliches Kunstwerk, in dem jede noch so kleine Struktur ihren Platz hat und so einen reibungslosen Ablauf ermöglicht. Doch es kann passieren, dass sich die Strukturen verändern, anschwellen oder einfach nicht mehr genau an der Stelle sitzen, wo sie eigentlich hingehören. So bringen sie das komplexe Gleichgewicht durcheinander, und das ist auch der Fall beim Impingement-Syndrom.
Durch Veränderungen im Schultergelenk reicht dann der Platz nicht mehr aus, um alle Sehnen, Muskeln, Nerven und Schleimbeutel zwischen dem Gelenk und dem Schulterdach unterzubringen. Dies betrifft vor allem den subacromialen Raum, da durch diesen viele wichtige Strukturen wie die Sehnen der Rotatorenmanschettenmuskeln verlaufen. Durch die Enge werden verschiedene Strukturen zusammengequetscht, und dies verursacht Schmerzen. Wie es genau zum Impingement-Syndrom kommt, erfahren Sie im nächsten Kapitel.
Impingement-Syndrom der Schulter – wenn es in der Schulter zu eng wird
Nachdem Sie nun einen Überblick über den anatomischen Aufbau und die physiologische Funktion des Schultergelenks bekommen haben, widmen wir uns jetzt den Problemen, die entstehen, wenn nicht alles im Schultergelenk so funktioniert, wie es soll. Wie kommt es beim Impingement-Syndrom zu den typischen Schmerzen, und wie entsteht überhaupt die Engstelle? Vielleicht haben Sie über das Impingement-Syndrom schon einiges gehört und gelesen. Hier bekommen Sie noch einmal einen detaillierteren Überblick über das Impingement-Syndrom, damit Sie sicher wissen, was genau in Ihrer Schulter vorgeht.
Im letzten Abschnitt haben Sie gelernt, dass das Schultergelenk eine große Bewegungsfreiheit besitzt und deshalb besonders durch die Muskeln der Rotatorenmanschette stabilisiert werden muss, um Luxationen (Ausrenkungen) zu vermeiden. Über der Gelenkpfanne des Schulterblattes befindet sich das Schulterdach. Der Bereich zwischen Gelenkkapsel und Schulterdach heißt subacromialer Raum und ist auch der Ort, an dem es am häufigsten zum Impingement kommt. Das Impingement-Syndrom wird auch Schulterengpass-Syndrom genannt und beschreibt eigentlich schon, was passiert: Es kommt zu einer Engstelle im Bereich des Schultergelenks, meist im subacromialen Raum. Bei bestimmten Bewegungen der Arme drücken Humeruskopf und Acromion die zwischen ihnen liegenden Strukturen zusammen. Darunter befinden sich unter anderem auch Nerven, die bei einer Reizung dem Gehirn die Information geben, dass im Schultergelenk etwas nicht stimmt, und dies tun sie mithilfe von Schmerzen.
Exkurs: Was passiert genau im Körper?
Die Schmerzempfindung beim Impingement entsteht durch einen komplexen Prozess, der mit der Reizung von Schmerzrezeptoren, sogenannten Nozizeptoren, beginnt. Diese befinden sich in den entzündeten oder geschädigten Strukturen, wie der Supraspinatussehne, der Bursa (Schleimbeutel) oder anderen Weichteilen der Schulter.
Wenn Sie beispielsweise Ihren Arm anheben, kommt es zu einer Einengung zwischen dem Schulterdach (Acromion) und dem Oberarmkopf. Dadurch entsteht eine mechanische Reibung, die das Gewebe reizt und eine lokale Freisetzung von entzündungsfördernden Substanzen wie Prostaglandinen oder Histamin auslöst. Diese Stoffe aktivieren die Nozizeptoren, die den Schmerzreiz in Form elektrischer Signale an das Rückenmark weiterleiten. Von dort wird der Reiz über spezialisierte Nervenbahnen an das Gehirn gesendet, wo er schließlich verarbeitet wird.