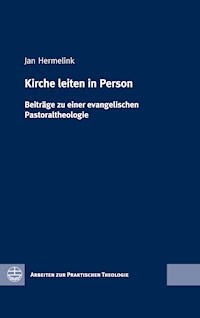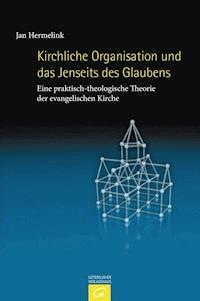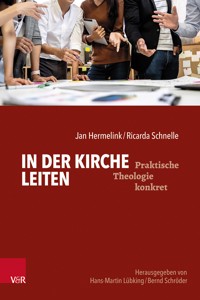
20,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Praktische Theologie konkret
- Sprache: Deutsch
In der Kirche wird auf allen Ebenen Leitung praktiziert, von der Ortsgemeinde bis zum Landeskirchenamt, von der Kindertagesstätte bis zum diakonischen Unternehmen. Diese Praxis ist für die Kirche ebenso wichtig wie ihre Gottesdienste, ihre Seelsorge, ihr bildendes und diakonisches Handeln. Denn eine Kirche, die durch Strukturverluste, Mangelerfahrungen sowie Gender- und Diversitätskonflikte herausgefordert ist, muss ihre Aktivitäten aufeinander abstimmen, interne Spannungen bearbeiten, gemeinsame Ziele formulieren und dabei möglichst Viele an der Leitungsaufgabe beteiligen. Jede:r Pfarrer:in vor Ort, dazu Kirchenvorsteher:innen und andere Ehrenamtliche, leitende Verwaltungskräfte und diakonische Führungskräfte sind an dieser Aufgabe beteiligt. Das Buch bietet allen, die in der Kirche leiten, grundlegende Perspektiven und konkrete methodische Hinweise. Dabei werden die sozial- und organisationswissenschaftlichen Einsichten genutzt, die in den letzten Jahrzehnten auch in der Kirche angewandt werden, und durchgehend mit christlich-religiösen Perspektiven, kirchenrechtlichen Regelungen und theologischen Aspekten vermittelt. Leitung wird in diesem Buch als eine soziale Praxis verstanden, die spezifische Kommunikationsformen, materiale Artefakte und räumliche Konstellationen nutzt. Sie geschieht durch Einzelne, vor allem aber in zahlreichen Gremien und Kollegien, deren Arbeitsweise genauer zu betrachten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Jan Hermelink / Ricarda Schnelle
In der Kirche leiten
VANDENHOECK & RUPRECHT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2025 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: In der Kirche leiten_AdobeStock_303724131_© saksit
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
E-Mail: [email protected]
ISSN: 2700–1059
ISBN 978-3-647-99320-1
Inhalt
Vorwort der Herausgeber
Geleitwort von Beate Hofmann
Vorwort des Autors und der Autorin
Einleitung
1Situation
1.1Vielfach verflochten: Kirche und gesellschaftliche Verhältnisse
1.2Verschärfte Krisenlagen: Transformation als Leitungsaufgabe
1.3Zwischen Aversion und Vertrauen: mit der Fülle des kirchlichen Rechts umgehen
1.4Hydra und Öl im Getriebe: Verwaltung in der Kirche
1.5Zwischen Zwang und Autonomiegewinn: Kooperationen und Fusionen
1.6Direkt und indirekt gestalten: zur evangelischen Leitungskultur
1.7Das Geschlecht spielt keine Rolle? Genderperspektiven
1.8Wer wird (noch) leiten? Ein Blick auf kommende Generationen
2Praktisch-theologisches Update
2.1Theologie für die Gestaltung des Ganzen: Leiten in der Kirche als Thema der Praktischen Theologie
2.2Gemeinsam leiten: Charakteristika synodaler und kollegialer Gremien
2.3Kirchliche Muster beweglicher machen: systemische Perspektiven
2.4Kirche als Unternehmen verstehen und leiten: betriebswirtschaftliche Perspektiven
2.5Leiten im Geist Christi: Formen und Risiken »Geistlicher Leitung«
2.6Angst, Macht und Scham: tiefenpsychologische Perspektiven
2.7Das Kreuz an der Wand, das Tablet in der Hand: Praktiken und Artefakte in der Leitungspraxis
2.8Theatral leiten: Leiten als Inszenierung in der Krise
3Essentials: religiöse und politische Dimensionen des Leitens
3.1Leiten durch das religiöse Wort und durch verbindliche Ordnung: historisch-theologische Grundlagen
3.2Dynamischer Rahmen für eigenes Entscheiden: Leiten mit dem Kirchenrecht
3.3Orientierung an Zielen und Wirkungen: Management in der Kirche
3.4Chefin und zugleich Pastorin? Personalführung und Seelsorge
3.5In Vielfalt führen: kirchliches Diversity Management
3.6Aufmerksamkeit erlangen und begrenzen: Leiten als öffentliche Praxis
3.7Bleibt alles unsicher: in der kirchlichen Transformation leiten
4Anregungen für die Praxis
4.1Selbstleitung: Was leitet mich?
4.2Begleiten, beraten, entwickeln: beruflich Mitarbeitende leiten
4.3Ermutigen, strukturieren, orientieren: Freiwilligenmanagement
4.4Leiten auf der Schwelle: Ehrenamtliche in Leitungsverantwortung
4.5Auf dem Flur: in Zwischenräumen und Übergängen leiten
4.6Leiten in und mit Räumen: eine Ressource für die Leitungspraxis
4.7Du hast nichts zu verlieren: Experimentierfeld Leitung
5Goldene Regeln
6Besondere Aufgaben
6.1Gewissheit kommunizieren in Unsicherheit: Zukunftsprozesse leiten
6.2Alles steht infrage: Leiten angesichts von sexualisiertem Missbrauch
6.3Auf dem Weg zu neuen Berufsrollen: berufsübergreifende Kooperationsformen als Leitungsaufgabe
6.4Du hast den Ton noch aus: Leiten in wachsender Distanz
Literatur
Vorwort der Herausgeber
Die Reihe »Praktische Theologie konkret« will Pfarrer:innen sowie Mitarbeitende in Kirche und Gemeinde mit interessanten und innovativen Ansätzen in kirchlich-gemeindlichen Handlungsfeldern bekannt machen und konkrete Anregungen zu guter Alltagspraxis geben.
Die Bedingungen kirchlicher Arbeit haben sich in den letzten Jahren zum Teil erheblich verändert. Auf viele heutige Herausforderungen ist man in Studium und Vikariat nicht vorbereitet worden und in einer oft belastenden Arbeitssituation fehlt meist die Zeit zum Studium neuerer Veröffentlichungen. So sind interessante neuere Ansätze und Diskussionen in der Praktischen Theologie in der kirchlichen Praxis oft kaum bekannt.
Der Schwerpunkt der Reihe liegt nicht auf der Reflexion und Diskussion von Grundlagen und Konzepten, sondern auf konkreten Impulsen zur Gestaltung pastoraler Praxis:
–praktisch-theologisch auf dem neuesten Stand,
–mit Informationen zu wichtigen neueren Fragestellungen,
–Vergewisserung über bewährte »Basics«
–und einem deutlichen Akzent auf der Praxisorientierung.
Die einzelnen Bände sind von Fachleuten geschrieben, die praktischtheologische Expertise mit gegenwärtiger Erfahrung von konkreter kirchlicher Praxis verbinden. Wir erhoffen uns von der Reihe einen hilfreichen Beitrag zu einem wirksamen Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis kirchlicher Arbeit.
Dortmund/Göttingen
Hans-Martin Lübking und Bernd Schröder
Geleitwort von Beate Hofmann
Leitung in der Kirche steht vor einer paradoxen Aufgabe: Sie soll ganz anders mit Macht umgehen als der Rest der Welt, aber sie soll mindestens genauso effektiv und erfolgreich sein und der Erfüllung des gemeinsamen Auftrags dienen.
Woher kommt das? Schon in Mt 20 heißt es: »Jesus Christus spricht: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener« (Mt 20, 25–26).
Daraus hat die Barmer Theologische Erklärung 1934 angesichts der NS-Diktatur gefolgert: »Die verschiedenen Ämter in der Kirche begründen keine Herrschaft der einen über die anderen, sondern die Ausübung des der ganzen Gemeinde anvertrauten und befohlenen Dienstes.
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und dürfe sich die Kirche abseits von diesem Dienst besondere, mit Herrschaftsbefugnissen ausgestattete Führer geben und geben lassen.«
Das setzt den Maßstab für alle kirchliche Leitung. Darum sprechen wir in der Kirche von »Leiten« und nicht von »Führen«. Darum gibt es in der Kirche eigentlich keine einsamen Entscheidungen einzelner Führungskräfte, die andere dann einfach umsetzen sollen, sondern im Gespräch miteinander errungene und gemeinsam getragene Entscheidungen.
Das wirkt oft mühsam und macht uns manchmal sehr langsam. In den ersten Wochen der Coronapandemie zum Beispiel waren die Gremienwege zu langsam angesichts der rasanten Entwicklung, da mussten anfangs Krisenstäbe ad hoc entscheiden, wie mit der Seuche im kirchlichen Raum umzugehen ist.
Das Spannende an unseren kirchlichen Leitungsformen ist: Sie sind eigentlich sehr modern. Denn aktuelle Managementtheorien betonen: Um in unserer komplexen Welt zu klugen Entscheidungen zu kommen, braucht es die Beteiligung unterschiedlicher Perspektiven. Das gelingt nicht durch einsame Entscheidungen einzelner, sondern in moderierten Entscheidungsprozessen, an denen möglichst unterschiedliche Menschen beteiligt sind.
Dafür bieten kirchliche Gremien und Entscheidungswege eine gute Basis. Frauen und Männer möglichst paritätisch und junge Menschen gesichert auf allen kirchlichen Ebenen zu beteiligen, hat die Debatten vielfältiger und unsere Entscheidungen klüger gemacht.
Freilich hat der Anspruch, mit Führung und Macht in der Kirche ganz anders umzugehen, auch Schattenseiten. Wie die ForuM-Studie zu sexualisierter Gewalt in der Kirche uns eindringlich vor Augen führt, hat die Tabuisierung von Macht in der evangelischen Kirche zur Verschleierung von Abhängigkeitsverhältnissen und zur Vertuschung von grenzüberschreitender oder gewaltvoller Machtausübung geführt. Patriarchale Verhaltensmuster finden sich auch im Raum der Kirche immer noch.
Darum gehört es zu guter Leitungsausübung im Raum der Kirche essenziell dazu, das eigene Leitungsverhalten kritisch zu reflektieren. Supervision oder Coaching sind aus meiner Sicht für Leitungspersonen kein Luxus, sondern ein Qualitätserfordernis.
Auch dieses Buch leistet zu dieser kritischen Reflexion einen wichtigen Beitrag, den wir dringend brauchen. Denn die Strukturen von Kirche sind in Veränderung begriffen. Das stellt Leitende auf allen Ebenen vor neue Herausforderungen, die zum Beispiel in den kirchlichen Verfassungen unterkomplex beschrieben und oft nicht klar genug benannt sind.
Zugleich verschieben sich vielerorts durch Fusionen und Umstrukturierungen Entscheidungsorte. Kirchenleitungserprobungsgesetze ermöglichen es, die unterschiedlichen Aufgaben von Kirchenleitung vor Ort und in der Region neu zu sortieren. Ob sich diese Entflechtung von Verwaltung und Gestaltung bewährt, wird sich zeigen. Es ist ein Versuch, weiterhin viele Menschen am kirchlichen Leben zu beteiligen, ohne allzu viele mit den Detailanforderungen von Gebäude-, Friedhofs-, Personaloder Haushaltsverwaltung zu beschäftigen.
All diese Entwicklungen zeigen, warum es notwendig ist, sich die Rahmenbedingungen von Leitung in der Kirche klar zu machen und immer wieder darüber nachzudenken, wie in diesen Rahmenbedingungen Leitung gut wahrgenommen werden kann.
Dazu bietet das vorliegende Buch eine gute Basis durch seine Fülle an aktuellen Einsichten und Anregungen.
Ich bedanke mich bei Ricarda Schnelle und Jan Hermelink, dass sie sich die Mühe gemacht haben, diesen Überblick über die Diskurse um Leitung in der Kirche zusammenzubinden und gut lesbar und nachvollziehbar zugänglich zu machen. Möge das Buch viele Leser*innen finden und dazu beitragen, dass wir unserer paradoxen Aufgabe gerecht werden: Ganz anders, aber trotzdem gut zu leiten, in der Kraft des Heiligen Geistes und im Dienst an unserem Auftrag.
Dr. Beate Hofmann
Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
Vorwort des Autors und der Autorin
In der Kirche leiten: Die Bedingungen, unter denen sich die kirchliche Leitungspraxis vollzieht, haben sich radikal gewandelt. Und in den zurückliegenden Jahren hat das Tempo der kirchlichen Transformation noch einmal angezogen. Führungskräfte erleben diese Veränderungen in allen Arbeitsbereichen und wissen, dass sich dieser Prozess in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen wird.
Vor diesem Hintergrund stehen die Beobachtungen in diesem Band. Es sind die Einsichten zweier ordinierter Pastor:innen1, die sich der Kirche und ihrer fortwährenden Reform verbunden fühlen. Und die – wie viele Menschen in Leitungsverantwortung – mit Sorge auf manche Entwicklung schauen und gleichzeitig Lust und Mut verspüren, inmitten dieser Gemengelage Neues zu erproben. Hier schreiben zwei Praktische Theolog:innen, ein Mann und eine Frau, die zwei unterschiedlichen Generationen angehören und in der akademischen Theologie zu Hause sind. Der eine, Jan Hermelink, lehrt und erforscht Praktische Theologie im universitären Kontext, war Mitglied einer Landessynode und ist geprägt durch den ständigen Kontakt mit Theologiestudent:innen. Die andere, Ricarda Schnelle, hat Erfahrungen in der Leitung von Kirchengemeinden und ist nun an der Akademie für Kirche und Diakonie in der Fort- und Weiterbildung unterschiedlicher Berufsgruppen unterwegs, die Führungsverantwortung tragen. Beide stammen wir nicht direkt aus dem Bereich der Diakonie, bemühen uns jedoch, dieses wesentliche Handlungsfeld im Blick zu behalten.
Wir danken den Herausgebern der Reihe Praktische Theologie konkret, Hans-Martin Lübking und Bernd Schröder, für die Initiierung dieses Buches, den Göttinger Hilfskräften Anna Lotte Martensen und Aylin Sayin für eine sorgsame Korrektur sowie Jana Harle und Carlotta Koch für die geduldige Betreuung seitens des Verlages Vandenhoeck & Ruprecht.
In der Kirche leiten. Das Tempo der Veränderung wird immer schneller. Mit diesem Buch ermutigen wir die Leser:innen, immer wieder mit reflexivem Abstand auf das eigene Tun zu schauen. In dieser punktuellen Verlangsamung liegt – davon sind wir als Wissenschaftler:innen überzeugt – eine wichtige Ressource für kirchliches Leitungshandeln.
Göttingen und Berlin im Oktober 2024
Jan Hermelink und Ricarda Schnelle
1Die Repräsentation der unterschiedlichen Geschlechter, gerade im nonbinären Bereich, kann sprachlich nur unzureichend geschehen. Um die reale Vielfalt der Verhältnisse wenigstens anzuzeigen und den Text zugleich gut lesbar zu gestalten, verwenden wir den Doppelpunkt, wie hier gebraucht, dazu Partizipialkonstruktionen – »Leitende« – und gelegentlich abwechselnde oder doppelte Nennung von weiblichen/männlichen Formen.
Einleitung
»In der Kirche leiten« – zu dieser Aufgabe kann man auf unterschiedlichen Wegen gelangen. Die einen haben sich die Leitungsaufgabe gezielt gesucht, etwa als Mitglied eines Kirchenvorstands, als Leiterin eines kirchlichen Verwaltungsamtes oder als Vorsitzende des Jugendkonvents. Andere haben zunächst wenig mit Leitung im Sinn gehabt; sie haben sich im Besuchsdienst oder in der Konfirmandenarbeit engagiert und sind erst allmählich in Leitungsrollen berufen worden oder hineingewachsen. Auch viele Pfarrer:innen sehen sich zunächst als Seelsorger oder als Predigerinnen und merken erst später, wie umfassend der Pfarrberuf zu einem Leitungsberuf geworden ist (vgl. Hermelink 2014b).
»In der Kirche leiten« – das ist eine sehr zwiespältige Erfahrung. Zur Leitung gehört die Freude daran, einen größeren Zusammenhang zu gestalten und voranzubringen – und dazu gehört der Widerstand, der den Leitungsimpulsen offen oder ganz indirekt begegnet. In der Kirche steht die Gestaltungsmacht, die zum Leiten dazugehört, zudem noch einmal besonders im Zwielicht: »Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener«, sagt Jesus zu den Jüngern, die einen Platz in seiner Nähe beanspruchen (Mt 20,26). Und zugleich erfordert die gegenwärtige Situation der Kirche besonders engagierte Leitung: deutliche Impulse der Erneuerung sowie verständnisvolle, tröstende Worte angesichts vieler Abbrüche. Die Frage nach Macht und Ohnmacht, gerade in der Kirche, wird uns in diesem Buch immer wieder beschäftigen, nicht zuletzt im Blick auf sexualisierten Machtmissbrauch (siehe 6.2).
Die aktuell schwierige Situation der christlichen Kirchen in Deutschland beschäftigt die meisten Menschen, die sich beruflich oder freiwillig engagieren. Mit der gesellschaftlichen Skepsis gegenüber organisierter Religion und ihren Vertreter:innen umzugehen und dazu den Mangel an Menschen, Finanzen und Gestaltungsspielräumen in der Kirche selbst zu bewältigen, das gehört für Leitende in der Kirche auf allen Ebenen zu den täglichen Herausforderungen. So verwundert es nicht, dass die Aufgabe, Kirche in den aktuellen Umbrüchen zu leiten, immer häufiger zum Thema von umfangreichen Handbüchern (vgl. Dieckmann u. a. 2023) und vielen Fortbildungsangeboten wird.
Das vorliegende Buch thematisiert die Praxis des Leitens in der Kirche, und zwar gerade in ihren tiefgreifenden Transformationen, aus einer dezidiert praktisch-theologischen Perspektive. Das bedeutet dreierlei: Wir weiten den Blick; wir schauen genauer hin; und wir fragen durchgehend nach spezifisch theologischen Dimensionen des Leitens in der Kirche.
Leiten geschieht in der evangelischen Kirche nicht nur dort, wo traditionell von »Kirchenleitung« gesprochen wird, also in den Organen oder Instanzen einer Landeskirche: Synode, Bischöf:in, Kirchenamt etc. In der Kirche wird vielmehr auf allen Ebenen geleitet, angefangen bei einer Jugendgruppe, deren Aktivitäten zu planen, deren Räume zu gestalten und deren Mitglieder persönlich anzusprechen sind. Solche und andere Leitungsaufgaben stehen auch in einem kreiskirchlichen Verwaltungsamt oder in einer diakonischen Einrichtung an. Überall dort, wo ein sozialer Zusammenhang absichtsvoll und systematisch gestaltet wird, vollzieht sich leitendes Handeln.
»In der Kirche leiten« – das ist zudem eine Aufgabe, die nicht nur von einzelnen Menschen, sondern zugleich von Gruppen und Gremien erfüllt wird (siehe 2.2), angefangen beim Kirchenvorstand (Presbyterium, Gemeindekirchenrat etc.), sodann in regionalen Konventen und Synoden, in den Leitungsrunden von Kirchenämtern und diakonischen Einrichtungen.
Leiten und Führen, das gezielte Gestalten eines größeren Ganzen in struktureller und individueller Hinsicht: Das sind also Tätigkeiten, mit denen in Diakonie und Kirche viele Menschen beschäftigt sind. Unser Buch richtet sich darum nicht nur an Theolog:innen, Jurist:innen, Amtsleiter:innen und andere berufsmäßige Leitungskräfte. Als Leser:innen erhoffen wir uns, gerade in einer Reihe »Praktische Theologie konkret«, auch freiwillig Engagierte, die in einer Gemeinde, einer diakonischen Initiative oder einem Vereinsvorstand leitende Aufgaben übernehmen (siehe 4.4). Denn wir meinen: Leiten – das ist in der Kirche nicht allein etwas für wenige »da oben«, sondern Leiten gehört zu (fast) jeder Tätigkeit in der Kirche wesentlich hinzu.
Im Horizont dieses weiten Leitungsverständnisses wird zudem deutlich: In der Kirche wird auf sehr unterschiedliche Weise geleitet. Neben »harten« Entscheidungen über Gelder und Personen, über Gesetze und Geschäftsordnungen stehen »weiche« Formen in der Moderation von Konflikten, in der Bildung von Netzwerken oder in längerfristiger Personalberatung. Dabei sind harte und weiche Leitungsformen kaum zu trennen: Zu jeder bindenden Entscheidung gehören zahlreiche vorbereitende sowie nachgehende Gespräche; und in die meisten Beratungsformate spielen – offen oder unterschwellig – die Status- und Machtunterschiede der Beteiligten hinein.
In praktisch-theologischer Perspektive interessieren wir uns darum für die alltäglichen Erfahrungen, die konkreten Praktiken und die hier jeweils angewandten Methoden – wir versuchen also, genauer, detaillierter hinzuschauen (siehe 2.7). Zugleich sind alle einzelnen Leitungspraktiken aber getragen von allgemeineren Überzeugungen, von persönlichen Haltungen, die die leitenden Akteur:innen lebens- wie berufsgeschichtlich gleichsam verinnerlicht haben und denen sie im täglichen Geschäft folgen, ohne dies immer reflektieren zu können. Wir fragen darum auch nach den Grundsätzen, den fundamentalen Erfahrungen, von denen sich die leitenden Personen und Gremien selbst leiten lassen, die sie motivieren und orientieren (siehe 1.6, 4.1).
Fast alle thematischen Aspekte und konkreten Probleme, die das Leiten in der Kirche ausmachen, finden sich so oder ähnlich auch in anderen sozialen Organisationen. Die Führungsinstrumente und Managementtheorien aus Unternehmen, Bildungs- oder Serviceeinrichtungen werden daher auch in Kirche und Diakonie schon längst und immer professioneller genutzt (siehe 2.4, 3.3). Im Raum der Kirche weiß man jedoch darum, dass zur Praxis des Leitens stets auch eine religiöse Dimension gehört. Denn die beteiligten Personen bringen immer, auch bei scheinbar ganz »sachlichen« Themen, zugleich ihre ureigenen Hoffnungen und Ängste ins Spiel, ihre Ideale eines guten Zusammenlebens und einer besseren Zukunft: Es geht um absolute Werte und letztgültige Überzeugungen. Und in der Kirche sind oft bestimmte Bilder von Gemeinde leitend oder biblische Visionen eines geschwisterlichen und gerechten Miteinanders. Wie solche christlichen Motive sich im kirchlichen Handeln jeweils konkretisieren – das ist die Grundfrage der Praktischen Theologie.
Geistliche Leitung (siehe 2.5) beginnt insofern nicht erst dann, wenn in den kirchlichen Beratungen ausdrücklich auf biblische Texte oder christliche Motive zurückgegriffen wird. Nicht nur dort, wo im Umfeld von Leitungsprozessen gebetet oder gepredigt, wo die Bibel zitiert oder gemeinsam über sie gesprochen wird, geschieht die »Leitung durch das Wort Gottes«, von der in der lutherischen Tradition die Rede ist (siehe 3.1). Sondern in der Kirche gehört die geistliche Dimension zu jeder Leitungspraxis immer schon dazu; und es tut den Gestaltungsvollzügen gut, wenn diese Dimension gelegentlich und jedenfalls im Konfliktfall ausdrücklich gemacht wird.
Dass zwischen »weltlichen«, aus anderen gesellschaftlichen Bereichen bekannten Leitungspraktiken und einer »geistlichen« Leitung keine klare Trennung möglich ist und schon gar nicht ein prinzipieller Gegensatz besteht – diese genuin praktisch-theologische Einsicht soll in unserem Buch daher durchgehend zur Geltung kommen. Denn die häufige Klage, man habe wieder einen ganzen Abend lang nur über organisatorische Fragen diskutiert, statt sich den »eigentlichen« Aufgaben der Kirche zu widmen, diese Klage verkennt, wie sehr jede Strukturdebatte durch genuin religiöse Bilder von Kirche und ihren Aufgaben bestimmt ist. Und umgekehrt ist jeder Gottesdienst, jedes seelsorgliche Gespräch auf verlässliche äußere Strukturen angewiesen, die immer neu zu gestalten sind (siehe 3.2).
Schließlich ein Hinweis zur Terminologie: Wir reden in diesem Buch meistens von »Leiten«, gelegentlich auch von »Führen«. Dieser Begriff bezieht sich im allgemeinen Sprachgebrauch eher auf einzelne Personen und kleine Gruppen; demgegenüber betrifft »Leiten« eher ganze Institutionen, ihre Strukturen und Rahmenbedingungen. Beide Begriffe überschneiden sich jedoch; insbesondere in Gremien – in einem Kirchenvorstand wie in einem diakonischen Vorstand – wird offenbar sowohl geleitet als auch geführt. »Leiten« ist der weitere Begriff, den wir daher meistens verwenden.
1Situation
1.1Vielfach verflochten: Kirche und gesellschaftliche Verhältnisse
Leiten in der Kirche bedeutet, kleinere und größere Bereiche des gemeinsamen christlichen Lebens gezielt zu gestalten. Um diese Aufgabe realistisch anzugehen, ist von vornherein zu bedenken: Das kirchliche Leben ist kein Sonderbereich, in dem ganz eigene Regeln gelten oder ganz besondere Werte verfolgt werden könnten. Denn im europäischen Raum existieren die großen christlichen Kirchen seit Jahrhunderten nicht getrennt vom allgemeinen sozialen Leben; sie sind keine Kontrastgesellschaft und alles andere als ideale Gemeinschaften. Das kirchliche Leben ist vielmehr bis heute, im Ganzen wie im Einzelnen, zutiefst verflochten mit zahlreichen anderen Bereichen der Gesellschaft.
Diese Verflechtung gilt insbesondere für die politischen Verhältnisse: Die Institutionen kirchlicher Leitung – Kirchenkreistage, Gemeindekirchenräte, Pfarrämter – sind bis in ihre Bezeichnungen den Instanzen politischer, vor allem kommunaler Selbstverwaltung in der Moderne nachgebildet. Inhaltlich agiert die Kirche etwa dort genuin politisch, wo sie die Integration von Minderheiten oder die Inklusion von Benachteiligten fördert oder wo sie ausdrücklich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wirbt. Ebenso sind kirchliche Bildungsinstitutionen, vom Religionsunterricht bis zur Erwachsenenbildung, integraler Bestandteil des jeweiligen regionalen Bildungssystems; auch Konfirmand:innen- und Jugendarbeit sind damit inhaltlich wie personell eng verflochten. Und viele Standards des ökonomischen Systems – Arbeitsrecht, Ausbildungs- und Besoldungsordnungen, regionale Kooperation und lokale Konkurrenz von Dienstleistern – gelten mit wenigen Modifikationen auch für den kirchlichen »Betrieb«.
Erst recht entsprechen die kirchlichen Kommunikationsformen stets genau dem jeweiligen Stand der Mediengesellschaft: Das religiöse Buch und die kirchliche Zeitschrift waren ebenso Teil des zeitgenössischen medialen Marktes wie die Radioandacht, das »Wort zum Sonntag« und aktuell die Aktivitäten von Pfarrer:innen und engagierten Laien in den Sozialen Medien. Alle kirchlichen Äußerungen jenseits der unmittelbaren Kommunikation in kleinen Gruppen unterliegen den allgemeinen Gesetzen medialer Kommunikation (siehe 3.6). So sind persönliche Auseinandersetzungen oder Skandale der Organisation für die Öffentlichkeit besonders interessant, auch in der Kirche. Die Regeln massenmedialer Kommunikation steuern ebenso die fiktionale Darstellung etwa von Pfarrpersonen: Wenn die einschlägigen Fernsehserien private Hinterbühnen oder moralische Brüche thematisieren, dann funktionieren sie nicht anders als Krankenhausserien oder Krimireihen.
Zu den Rahmenbedingungen des Leitens in der Kirche gehören in erster Linie die jeweiligen Grundstrukturen gesellschaftlichen Lebens. Einige davon seien hier knapp skizziert. Die moderne Gesellschaft ist zunächst nicht mehr durch die Konkurrenz familiärer Großverbände geordnet und auch nicht mehr zentral-hierarchisch strukturiert, sondern sie erscheint funktional differenziert: Ökonomische und kulturelle, politische und wissenschaftliche Kommunikationssysteme funktionieren in relativer Eigenständigkeit, sie bilden je eigene Werteordnungen und besondere Organisationen aus. So kann man hochreligiös und gleichzeitig Physikerin sein, oder Großaktionär und Mitglied einer linken Partei. Christliche Bindung verbindet sich mit den unterschiedlichsten politischen und kulturellen Optionen – das macht die Gestaltung kirchlichen Zusammenlebens, von der Ortsgemeinde bis zur Landessynode, zunehmend anspruchsvoll.
Die heutige Gesellschaft ist zudem durch eine zunehmende »Singularisierung« geprägt, die Andreas Reckwitz (2017) prägnant beschrieben hat. Die Dominanz des Allgemeinen: von Fließbandproduktion, standardisierten Wohnungen und Massentourismus, auch von selbstverständlicher Kirchlichkeit, wird seit den 1970er-Jahren immer mehr verdrängt durch die Dominanz des Besonderen. Orte, Dinge, Zeiten und Menschen müssen als »singulär«, als ganz und gar einmalig erscheinen, um auf dem (zunehmend digitalen) Markt der Aufmerksamkeit Erfolg zu haben. Damit rückt die besondere Sphäre der Kultur in den Vordergrund; denn hier haben individuelle Kreativität und authentische Selbstdarstellung, Eigensinn und sinnlich-körperliches Erleben ihren ursprünglichen Ort. Diese »Kulturalisierung der Lebenswelt« (Reckwitz 2017, 75 ff.) ist auch in der Kirche zu beobachten: Der agendarische Sonntagsgottesdienst für alle wird randständig; das individuelle religiöse Erlebnis dagegen, emotional dichte Erfahrungen in einem Gospelgottesdienst oder das ganz besondere Projekt gewinnen immer mehr an Interesse.
Die religiöse Singularisierung verbindet sich mit einer wachsenden Pluralisierung der Sinnbezüge und Weltbilder. Einzelne und Gruppen bewegen sich auf einem dynamischen Markt der Weltanschauungen, der traditionelle Bindungen ebenso umfasst wie Yoga, Fastengruppen und buddhistische Meditation. Die radikale Pluralisierung des gesellschaftlichen Lebens erhöht zudem seine Konfliktträchtigkeit: Nicht nur fundamentalistische Gruppen aus Christentum und Islam, sondern auch politisch extreme Bewegungen bedrohen das soziale Zusammenleben auf allen Ebenen. Religiöse Traditionen wirken hier konfliktverschärfend, können aber auch integrieren und befrieden.
In Wechselwirkung mit der zunehmenden sozialen Differenzierung und Pluralisierung stehen die wachsenden Gestaltungsräume der Individuen. Wie von Ulrich Beck (1986) prägnant beschrieben, eröffnet sich seit den 1960er-Jahren für immer mehr Menschen die Chance, wichtige biografische und berufliche Lebensentscheidungen (relativ) unabhängig von der jeweiligen sozialen Herkunft zu treffen. Die Einzelne kann immer mehr selbst entscheiden, welchen kulturellen oder religiösen Gruppen sie sich anschließt, wo und wie sie sich kurz- oder langfristig engagiert und welche sozialen Anliegen sie unterstützt. Es liegt auf der Hand, dass diese Steigerung individueller Freiheit die herkömmlichen Bindungsmuster etwa zu Sportvereinen, politischen Parteien, aber auch zu Kirchen erheblich verändert: Das jeweilige »Angebot« muss zu meiner ganz persönlichen Situation passen.
Was bedeuten diese gesellschaftlichen Strukturtrends für die kirchliche Leitungspraxis? Zunächst verlieren allgemeine Urteile über »die heutige Gesellschaft« oder »den modernen Menschen« immer mehr an Überzeugungskraft. Für jeden kirchlichen Leitungskontext, für jedes Leitungsthema ist sorgfältig und immer neu zu bestimmen, welche besonderen Verhältnisse, welche spezifischen Traditionen und Einstellungen hier jeweils einwirken: Inwiefern sind die kirchlichen Verhältnisse »vor Ort« auch Resultat besonderer regionaler Prägungen oder aktueller politischer Entwicklung? Wie sehr kommen in den Konflikten eines Kirchenvorstands oder einer diakonischen Initiative ganz profane Kontexte zum Ausdruck, und inwiefern haben diese »nicht kirchlichen« Faktoren bei näherem Hinsehen dann doch religiöse Hintergründe?
Sodann sind die Leitungspraktiken in der Kirche, ihre Beratungen und Entscheidungen stets auf ihre gesellschaftlichen Folgen hin zu betrachten. Die Umwidmung von Gebäuden, die Beendigung eines diakonischen Projekts oder die Gründung einer kirchlichen Schule werden von der regionalen Öffentlichkeit sorgfältig beobachtet, weil diese Maßnahmen – weit über ihre religiösen Aspekte hinaus – die kulturellen, vielleicht auch die ökonomischen Verhältnisse vor Ort verändern; sie können die Vereinzelung befördern oder sie stärken den Zusammenhalt. Zum gegenwärtigen Leiten in der Kirche gehört daher stets auch die Dimension seiner öffentlichen Darstellung – durch regionale Medien und kommunale Gesprächszusammenhänge und besonders durch die kirchlichen Leitungsakteur:innen selbst (siehe 3.6).
Seit der Verbreitung des Smartphones, Mitte der 2000er-Jahre, ist der soziale Alltag zutiefst durch die Digitalisierung bestimmt: Analoge und digitale Kommunikationspraktiken, Begegnungen vor Ort und »Fernanwesenheit« (Costanza 2012) verflechten sich immer dichter; Arbeitsund Sozialbeziehungen erscheinen mehr und mehr als dynamische, wenig abgrenzbare Netzwerke. Die Logik der »Singularisierung« wird auf diese Weise noch einmal verstärkt: Die je eigene, je besondere Aktivität der einzelnen »produser« relativiert die Macht der Experten, auch der Theolog:innen. Persönliche, authentische und alltagsnahe Kommunikation erscheint wirkungsvoller als traditionelle Autorität. So erscheint etwa die Erzählung einer verwaisten Mutter, wie ihr ein Bibelvers geholfen hat, viel eindrücklicher als die Sonntagspredigt der Pfarrer:in.