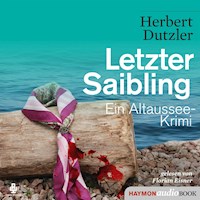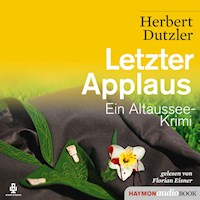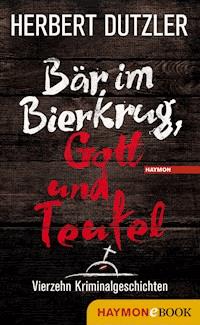Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenn Wut die Kontrolle übernimmt. Von einem, der auszog, um dich das Fürchten zu lehren. Der Weg eines unschuldigen Kindes zum rechtsradikalen Mörder: vorbestimmt oder frei gewählt? Leo ist ein unschuldiges Kindergartenkind – Leo ist ein rechtsradikaler Mörder. Sein Hass hat einen Ursprung: Leos Vater. Denn der weiß ganz genau, wie sein Sohn zu sein hat: als Kind gehorsam und ordentlich, als Erwachsener autoritär und angesehen. Leos Mutter steht daneben und fängt die Schläge ab, bevor sie Leo treffen. Aus ihr macht das eine gebrochene Frau. Und aus Leo? Welche Wahl hat er denn, als selbst gewalttätig zu werden? Sein Weg scheint vorgezeichnet, unausweichlich. Oder hat er vielleicht doch eine Wahl? Könnte er sich gegen seinen Hass entscheiden? Es gibt Hoffnung: Marinca. Vielleicht kann sie zu ihm durchdringen. Es bleibt ihr aber nicht viel Zeit. So nahe dran, dass es wehtut – so nachvollziehbar, dass es unheimlich ist Die Schlinge zieht sich zu, lässt keine Luft zum Atmen. Du kannst nichts daran ändern. Dir bleibt die Luft genauso weg wie Leos Opfern. Und ihm selbst. Du bist mittendrin, die ganze Zeit dabei. In Leos Kopf. In seinem Denken. In seiner zunehmenden Paranoia. Du kannst mit ihm gehen, jeden Schritt von der Unschuld zur Schuld. Und du kannst jeden Gedanken nachvollziehen – auch wenn du das gar nicht willst. Düster und verstörend In seinem neuen Roman gelingt Herbert Dutzler etwas Außergewöhnliches: der verstörende Einblick in den Kopf eines Täters – in einen Weg, der unaufhaltsam in eine Richtung führt. In Richtung der Zerstörung anderer und von sich selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schon als Kind trifft das Leben Leo mit voller Härte: In seiner Familie steht autoritäre Unterdrückung auf der Tagesordnung, er lernt keine Liebe und keine Nähe kennen, stattdessen Disziplin und Gewalt.
Das hinterlässt Wunden, die nur sehr schwer heilen – und mit den Narben kann Leo auch als Erwachsener nicht umgehen. Sie machen ihn wütend. Auf alles Fremde, alles in seinen Augen Andere.
Leos Weg scheint vorgezeichnet, unausweichlich, schicksalhaft – er führt mitten hinein in seinen immer größer werdenden Hass. Wie eine Schlinge legt er sich um Leos Hals, lässt keine Luft zum Atmen. Er kann sich selbst nicht entkommen. Oder hat er doch eine andere Wahl?
Und auch dir bleibt der Atem weg, denn du bist mittendrin. In Leos Kopf. In seinem Denken. In seiner zunehmenden Paranoia. Du gehst mit ihm, jeden Schritt, vom unschuldigen Kind bis zu dem Punkt, an dem Leos Wut ein schreckliches Ventil findet …
Herbert Dutzler
In der Schlinge des Hasses
I
„Komm jetzt endlich! Komm!“ Mama ist ungeduldig. Ich muss aber noch das Hexenhaus holen, das ich heute aus Karton gebastelt habe. Ich will es mit nach Hause nehmen. Dann kann ich mit meinen Playmobil-Männchen spielen. Die passen da hinein. „Jetzt bitte!“ Mama klatscht mit den Händen gegen ihre Oberschenkel. Aber sie muss auf mich warten.
Ich laufe noch einmal zurück in den Gruppenraum. „Das Haus!“, sage ich zu Tante Cornelia. „Wo ist das Haus?“ Sie nimmt es vom Tisch und legt es mir vorsichtig auf die ausgestreckten Arme. „Du könntest es auch hierlassen und morgen noch bemalen!“, meint sie. Ich schüttle den Kopf und gehe wieder in die Garderobe.
„So, jetzt aber!“ Mama fasst mich an den Oberarmen und drückt mich auf die Bank. Ich habe Angst, dass das Hexenhaus kaputtgeht, und halte es krampfhaft fest. „Wir sind schon so spät dran!“, schnauft Mama, während sie mir die Hausschuhe auszieht und meine Füße in die Stiefel hineinzustopfen versucht. „Kannst du nicht ein bisschen mithelfen?“ Ich muss mein Hexenhaus festhalten. Außerdem beginnt es draußen gerade zu schneien. „Kann ich am Nachmittag rausgehen? Einen Schneemann bauen?“ „Verdammt nochmal, jetzt steck endlich deinen Fuß rein!“ Mama ist richtig wütend geworden. Ich sehe den Schneeflocken zu, die immer dichter vom Himmel fallen. „Gibt’s ein Problem?“ Tante Cornelia steckt den Kopf durch die Tür. Meine Mama schüttelt den Kopf. „Schon geschafft!“ Jetzt muss ich mein Haus doch abstellen, denn während ich meine dicke Jacke anziehe, kann ich es nicht halten. „Das lassen wir da! Wir haben zu Hause schon genug von dem Krempel!“, entscheidet Mama.
Das darf nicht sein. Mein Hexenhaus! Ich brauche es doch! Heute Nachmittag schon! Und sie hat es sich nicht einmal genau angesehen. Ich spüre, wie sich meine Augen mit Tränen füllen. Ich halte das Haus mit beiden Händen fest und stampfe mit den Füßen wütend auf den Boden. „Das Dach ist aus Lebkuchen!“, schluchze ich, als sie mich an einer Hand nach draußen zieht. „Und die Fenster aus Marzipan!“ Ich lecke mir mit der Zunge über die Lippen und lasse das Haus nicht los. Die Tränen versiegen wieder. „Schnell jetzt! Ich muss noch das Essen fertig machen, bevor Papa nach Hause kommt!“ Ich klettere ins Auto, stelle das Hexenhaus neben mir ab und setze mich auf meinen Sitzpolster. Mama greift nach dem Sicherheitsgurt, aber vor lauter Hast gelingt es ihr nicht, ihn im richtigen Gurtschloss einrasten zu lassen. „Verdammt!“, flucht sie.
Das nächste Mal beginnt sie zu schimpfen, als wir an der ersten Ampel die Grünphase knapp verpassen. Sie schlägt sogar aufs Lenkrad und fährt ruckartig an, als die Ampel erst gelb zeigt. „Ich habe Durst! Bleib beim Supermarkt stehen!“ Ich will unbedingt etwas trinken! „Du wartest, bis wir zu Hause sind. Da kannst du Wasser trinken!“ „Ich will aber kein Wasser! Du sollst stehen bleiben! Jetzt!“ Ich schreie so laut, dass Mama zusammenzuckt. Schon wieder die Tränen. Sie gibt Gas und schießt über eine Kreuzung, als die Ampel gerade von Gelb auf Rot schaltet. Und sie flucht wieder.
Ich kenne das schon. Bevor Papa nach Hause kommt, ist Mama immer nervös, aufgeregt und furchtbar hektisch. Und ich brauche dann immer etwas, das gerade nicht da ist. Das ist einfach so. Ich brülle noch mehrmals nach Saft, sie soll endlich langsamer machen, sich endlich einmal mit mir beschäftigen. Sie hat nicht einen einzigen Blick auf mein Hexenhaus geworfen!
Daheim habe ich eine Playmobil-Hexe. Sie hat einen spitzen Hut mit einer Feder und einen lila Rock mit Flicken drauf. Außerdem einen Besen, orange Haare und eine orange Brille. Die wird gut in das Hexenhaus passen. Mama hat sie noch nicht gesehen, denn eigentlich ist sie für Mädchen, und ich habe mit Sophie getauscht. Sophie wollte unbedingt einen Astronauten haben, und davon hatte ich zwei. Oder drei. Mama hält nicht viel davon, wenn ich mit Sachen spiele, die eigentlich für Mädchen sind. Oder, genauer gesagt, sie hält nicht viel davon, weil Papa strikt dagegen ist, dass ich mit Mädchensachen spiele. Er kauft mir immer nur Bubenspielzeug. Einmal habe ich mir aus dem Lego-Katalog etwas ausgesucht, das rosa und lila war. Da ist Papa ganz eigenartig geworden, hat die Seite aus dem Katalog gerissen und ist rausgegangen. Gesagt hat er nichts.
Hänsel und Gretel passen auch gut ins Hexenhaus. Als Hänsel nehme ich den … „Aussteigen! Oder bleib da, wie du willst!“ Mama lässt die Heckklappe aufspringen und holt ihren Einkaufskorb heraus. Ich bleibe sitzen und nehme mein Hexenhaus auf den Schoß. Plötzlich ist es still, ich höre die Haustüre ins Schloss fallen. Mama ist hineingegangen und hat mich alleine gelassen. Das Gurtschloss kann ich schon selbst öffnen, aber ich bleibe trotzdem im Auto. Da ist es so angenehm und friedlich. „Es war so finster, und auch so schrecklich kalt …“, singe ich. Hoffentlich kommen meine Eltern nicht auf die Idee, mit mir in den Wald zu gehen und mich dort zurückzulassen. Es ist wohl besser, wenn ich doch aussteige. Vor der Haustür muss ich das Hexenhaus noch einmal abstellen, um die Tür aufzubekommen. Die Türschnalle ist ganz schön hoch oben.
„Spinnst du jetzt komplett?“, schreit Mama, als ich mich mit den Stiefeln an den Füßen auf den Weg in den ersten Stock mache. Vor lauter Schreck lasse ich mein Hexenhaus fallen, es purzelt zwei Stufen hinunter. Schon wieder kommen die Tränen. Ich brülle jetzt auch, aber vor Schreck und vor Zorn. „Was fällt dir denn ein, mit den dreckigen Stiefeln auf die Treppe!“ Ich habe vergessen, dass es eine ganz strenge Regel gibt, dass man nicht mit Schuhen in den ersten Stock darf. Ich habe einfach nur daran gedacht, so schnell wie möglich mein Hexenhaus unter mein Bett zu stellen, wo es sicher ist. Jetzt ist es womöglich kaputt.
„Sieh dir das einmal an!“ Mama deutet auf die schmutzigen Sohlenabdrücke auf den Stufen. „Das kann ich jetzt auch noch wegputzen, bevor Papa kommt!“ Ich brülle noch lauter, als ich entdecke, dass sich das Dach des Hauses an einer Ecke gelöst hat. Es ist sogar verbogen. „Mein Haus! Mein Haus!“, schreie ich, während mir Mama grob die Stiefel von den Füßen zerrt. Ich nehme es wieder auf die Arme und haste auf Socken die Treppe hinauf. Erst, als ich es unter meinem Bett verstaut habe, lässt das Schluchzen nach. Ich glaube, ich kann es wieder reparieren. Die Playmobil-Figuren müssen in einer der Schubladen unter dem Kleiderschrank sein. Ich öffne sie.
Als Erstes finde ich einen Bauarbeiter mit Warnweste, Schutzhelm und Gehörschutz. Ich nehme ihn heraus, denn er kann den Verkehr auf dem Teppich regeln. Vor allem muss er aufpassen, dass keine Autofahrer bei Rot oder Gelb über die Baustellenampel fahren. Eine Ampel muss auch irgendwo im Kasten sein. Ich krame weiter herum. Da ist noch ein Bauarbeiter mit Schubkarre und einer mit Funkgerät. Nein, das ist ein Feuerwehrmann. Ich stelle beide neben den ersten, sie können ihm helfen. Ich muss noch eine Absperrung suchen, damit niemand über die Baustelle fährt. Und ein Auto, das an der Absperrung stehen bleiben muss.
Ich höre, wie unten die Haustür zufällt. Das muss Papa sein. Normalerweise kommt er zu Mittag nicht nach Hause, aber er muss heute Abend noch nach Finnland fliegen. Oder nach Holland, ich habe es mir nicht gemerkt. Da ist jedenfalls morgen eine wichtige Sitzung in der Filiale. In Irland. Ja, in Irland, glaube ich. Jedenfalls irgendwas mit „Land“ am Ende. Ich schaue über das Treppengeländer nach unten. Papa ist gerade dabei, meine Stiefel aufzuheben und ordentlich nebeneinanderzustellen. Prüfend fährt er mit dem Finger über einen der schmutzigen Abdrücke auf den unteren Treppenstufen und betrachtet dann seine Fingerkuppe. „Hier sieht’s ja aus!“, sagt er. „Ist wenigstens das Essen fertig?“
„Es war ein bisschen chaotisch heute!“, höre ich Mamas Stimme aus der Küche. Sie klingt ein wenig zittrig, wie immer, wenn Papa nach Hause kommt. „Und Leo hat wieder einmal entsetzlich getrödelt.“ Papa schüttelt den Kopf und verschwindet in der Küche. „Leopold, meinst du“, höre ich ihn noch sagen. „Du weißt, dass ich es nicht dulde, dass Vornamen verhunzt werden!“ Seine Stimme ist lauter geworden. Ich gehe zurück in mein Zimmer und lasse das Auto gegen die Absperrung krachen. Der Arbeiter, der aufpassen sollte, verliert zur Strafe seinen Kopf. Hätte er eben besser achtgegeben!
„Leopold!“ Papa ruft von unten, und seine Stimme klingt bedrohlich und ungeduldig. „Leopold, komm zum Essen herunter!“ Ich springe auf und haste die Treppe hinunter. Papa mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Wenn er etwas sagt, muss es sofort passieren. Nicht später. Ich bleibe auf der untersten Stufe stehen. Papa lächelt. Er trägt einen grauen Anzug mit Weste und Krawatte darunter. Mit den Fingern der rechten Hand fährt er mir durchs Haar. „Du sollst doch nicht trödeln!“, ermahnt er mich. „Wenn Mama etwas sagt, wird es gleich gemacht! Sie hat ja nicht so viel Zeit wie du!“ Ich habe auch keine Zeit gehabt, denke ich. Zuerst keine Zeit, um Mama das Hexenhaus zu zeigen, und dann keine, um stehen zu bleiben und im Supermarkt Saft zu kaufen. „Ich hab Durst!“, sage ich, denn ich habe vergessen, etwas zu trinken, als wir nach Hause gekommen sind.
„Jetzt setzen wir uns zu Tisch. Da kannst du dann trinken. Ordentlich. Aus einem Glas, wie es sich gehört.“ Papa mag es nicht, wenn ich mir Wasser aus dem Badezimmer im Zahnputzbecher hole. Wasser wird bei Tisch aus einem Glas getrunken. „Wozu haben wir die schönen Gläser?“, fragt er immer.
Ich rutsche auf meinen Stuhl. Papa zieht sein Sakko aus und drapiert es sorgfältig über die Stuhllehne. Er zupft so lange daran herum, bis es nicht mehr schief hängt. Der Tisch ist schön gedeckt, so, als ob es ein Fest zu feiern gilt. Das ist aber bei uns immer so. Es gibt ein sauberes Tischtuch, und Teller und Besteck sind ganz exakt ausgerichtet. Papa sieht auf seinen Platz und rückt Gabel und Messer etwas zurecht, so, als ob sie an der falschen Stelle gelegen wären. Oder nicht genau im rechten Winkel zur Tischkante. „Das kann doch nicht so schwer sein!“, rügt er Mama, wenn das Besteck nicht richtig liegt. „Erkennst du denn nicht, ob etwas im rechten Winkel liegt? Oder weißt du nicht, was das ist?“ Manchmal lacht er dann auch, und Mama erklärt, dass sie nie so gut in Mathematik gewesen ist. Dann nickt Papa zufrieden, weil er denkt, dass Frauen in Mathematik eben gar nicht gut sein können. Heute allerdings sagt er nichts, als Mama die Platte mit dem Rinderbraten auf den Tisch stellt. Er legt nur kurz den Handrücken auf seinen Teller, wobei sein Ring klirrt. „Die Teller sollten vorgewärmt sein“, sagt er. „Der Braten wird sonst zu schnell kalt.“ Mama stöhnt. „Dazu bin ich nicht mehr gekommen!“, entschuldigt sie sich. Papa sagt nichts, schüttelt aber missbilligend den Kopf und schnalzt mit der Zunge.
„Ganz brauchbar!“, meint er nach dem ersten Bissen. „Gut, dass ich dafür gesorgt habe, dass wir ordentliches Rindfleisch bekommen. Das aus dem Supermarkt taugt ja nichts. Es ist doch von dem Galloway-Züchter mit dem Hofladen, den ich dir empfohlen habe, nicht?“ „Deswegen hat es ja auch so lange gedauert!“ Mama klingt verärgert. „Ich habe fast eine Dreiviertelstunde bis zum Hofladen gebraucht. Und dann dauert ja so ein Braten auch seine Zeit!“ „Das ist alles eine Frage der Einteilung!“, erklärt Papa mit erhobener Gabel. „Und jetzt wird nicht diskutiert, sondern gegessen!“
Ich kann das Fleisch nicht selber schneiden, es ist viel zu fest. „Komm, ich schneide dir das!“, sagt Mama und schneidet mein Stück Fleisch kreuz und quer in viele kleine Quadrate. „Leopold sollte langsam lernen, sein Fleisch selbst zu schneiden“, meint Papa. Mama antwortet nicht. Ich stecke ein Stück Fleisch in den Mund und kaue darauf herum. Irgendwie bleibt es im Mund stecken, lässt sich mit den Zähnen nicht zerbeißen, und schlucken kann ich es schon gar nicht. Ich weiß natürlich, dass ich es auf keinen Fall ausspucken darf. Nach langer Zeit gelingt es mir, den Bissen hinunterzuschlucken. Ich esse nur noch Nudeln, die mir Mama auch kleingeschnitten hat. Mit meinem Löffel. Aber auch das passt Papa nicht. „Wann lernt er endlich, ordentlich mit einer Gabel umzugehen?“, fragt Papa, zu Mama aufblickend. „Und das Fleisch wird auch gegessen, das ist erste Qualität, und es war sehr teuer. Man arbeitet ja nicht für den Abfallkübel!“ Ich sage nichts. Papa sieht auf die Uhr. Wenn ich Glück habe, dann muss er weg, bevor er mich zwingen kann, noch mehr Fleisch zu essen.
„Ich muss mich umziehen!“, sagt er schließlich. „Mein Flug geht in eineinhalb Stunden.“ Papa muss sich nicht anstellen wie die anderen, denn er fliegt in der Business Class. Deshalb kann er es sich leisten, erst so kurz vor dem Abflug zum Flughafen zu fahren. „Denkst du daran, Leopold zur musikalischen Früherziehung zu bringen?“, fragt er noch. Mama seufzt. „Natürlich!“, sagt sie. Ich weiß nicht, ob sie wieder wegen dem „Leopold“ geseufzt hat oder wegen der Musikstunde.
Papa heißt Leopold, und sein Vater und sein Großvater haben auch Leopold geheißen. Ich bin also Leopold der Vierte, was Papa niemals vergisst zu betonen. Leopold der Erste hat die Firma gegründet, und Leopold der Zweite hat sie zu einem Großunternehmen gemacht. Leopold der Zweite ist Opa und erst vor kurzem in Pension gegangen. Dennoch taucht er fast jeden Tag in der Firma auf. Das weiß ich, weil Papa fast täglich seinem Ärger über Opa Luft macht. Der mischt sich angeblich überall ein, tut, als ob er noch der Chef wäre, und versteht überhaupt nichts davon, wie man gute Geschäfte macht. Sagt Papa.
Ich finde Opa Leo gemütlich, denn er spielt immer mit mir, wenn ich bei ihm und Oma bin. Opa Leo hat eine Modelleisenbahnanlage, und ich darf sogar die Züge fahren. Obwohl Papa meint, eine Modelleisenbahn sei weder eine sinnvolle Beschäftigung für einen alten Mann noch ein geeignetes Spielzeug für mich.
Mama räumt den Tisch ab, während Papa sich oben im Schlafzimmer fertigmacht. Sie hält den Finger vor den Mund, als sie meine Fleischportion vom Tisch nimmt und in die Küche trägt. Später wird sie sie im Klo hinunterspülen, denn manchmal kontrolliert Papa auch, ob der Müll in der richtigen Mülltonne ist. „Tierische Abfälle gehören nicht in den Biomüll!“, hat er Mama schon mehrmals erklärt, wenn er einen Hühnerknochen oder eine Fischhaut im Biokübel vorgefunden hat.
Bei Oma und Opa ist das auch ganz anders. Oma weiß, was ich gerne mag. Wenn ich bei ihr bin, bekomme ich immer Mohnnudeln oder einen Kaiserschmarren mit Zwetschgenröster. Sie setzt sich auch immer zu mir und hört mir zu, wenn ich ihr was vom Kindergarten erzähle. Und wenn sie mir wirklich zu viele Mohnnudeln auf den Teller gehäuft hat, dann isst sie sie selber auf.
„Leopold!“ Papa beugt sich zu mir herunter, um seinen Kuss zu bekommen. Der ist verpflichtend, wenn er über Nacht wegfährt. Mama ist in der Küche damit beschäftigt, den Geschirrspüler einzuräumen. „Brigitte!“, ruft Papa, denn es gehört zu den festgelegten Ritualen, dass auch sie sich an der Haustür mit einem Kuss von ihm verabschieden muss. Als sich die Haustür hinter Papa schließt, seufzt Mama laut auf und lässt sich auf das Sofa im Wohnzimmer fallen. Der Geschirrspüler bleibt halb eingeräumt zurück. Mama legt die Hände vors Gesicht und zuckt. Ich glaube, sie weint still in sich hinein. Leise gehe ich wieder in mein Zimmer. Vor dem Essen hatte ich ganz vergessen, dass ich eigentlich die Bewohner für mein Hexenhaus zusammensuchen wollte.
1
„Bitte, lass mich nicht allein!“
Er konnte das Gewinsel seiner Mutter nicht mehr länger ertragen. Seit er eine Freundin hatte, war Mama in Panik, dass er ausziehen könnte. Und das, so schwor er sich, würde er auch, sobald sich eine günstige Gelegenheit ergab. „Ich lass dich nicht allein!“, log er zwischen zwei Bissen Marmeladebrot. Mama konnte es einfach nicht lassen, ihm jeden Morgen ein Brot mit ihrer klebrigen Erdbeermarmelade zu schmieren, obwohl er ihr schon tausendmal erklärt hatte, dass er keine Marmeladebrote essen wollte. Vor allem, weil die Marmelade mehrere Jahre alt war und das Erdbeerrot einem rötlichen Grau gewichen war. Nur, damit sie nicht gleich wieder mit ihrem Gezeter anfing, hatte er ein paarmal abgebissen.
„Aber diese Esther, die will mit dir zusammenwohnen! Das ist doch klar! Die will dich ganz für sich allein!“ Mama hatte Esthers Namen mehr ausgespuckt als gesprochen. Tiefe Ringe unter den Augen, raue Stimme, unsichere Schritte. Wie fast jeden Morgen. Es war schlimmer geworden. Als er noch in der Schule gewesen war, hatte sie wenigstens nur am Abend getrunken. Nun hatte sie schon wieder diesen zittrig-weinerlichen Ton angeschlagen, den er gar nicht vertrug. „Ich denke nicht daran, auszuziehen!“, erklärte er nochmals, nur, um sie endlich zum Schweigen zu bringen. „Zumindest nicht jetzt!“ „Aha!“ Mama knallte die Zuckerdose auf den Tisch. „Aber bald, was? Und dann lässt du mich auch im Stich!“ Leo schüttelte den Kopf. Am liebsten hätte er ihr das Marmeladebrot ins Gesicht geschleudert und wäre sofort davongelaufen. „Irgendwann werde ich eine Familie haben, ein eigenes Haus, eine Frau, Kinder! Ein eigenes Leben!“ Mama wischte Tränen aus den Augenwinkeln. „Aber dann könnt ihr doch hier wohnen! Das Haus ist groß genug!“ Leo seufzte. Er konnte seiner Mutter nicht erklären, dass es keine Frau auf der Welt gab, die es aushalten würde, mit ihr zusammen in diesem Haus zu wohnen. Es war hoffnungslos.
„Mama, vielleicht bemühst du dich einmal, nicht schon wieder vormittags besoffen zu sein! Das wäre ein Anfang!“, sagte Leo. Obwohl er sich nicht überlegt hatte, der Anfang wovon das sein konnte. „Du bist ungerecht!“, schnappte Mama zurück. „Ich trinke am Vormittag gar nichts! Höchstens ein Gläschen zur Beruhigung, wenn du wieder einmal vergisst, anzurufen. Ich hab dir tausendmal gesagt, ruf an, wenn du angekommen bist! Da ist es kein Wunder, wenn man … ja, wenn ich was zur Beruhigung brauche!“ „Wie oft musst du dich denn beruhigen?“, höhnte Leo. Es war unerträglich. Nicht einmal ein Funken von Einsicht. „Du könntest ja auch zu Mittag heimkommen. Ich koch dir dann was Schönes …“ Leo stand auf. „Ich kann zu Mittag nicht heimkommen, das geht sich zwischen den Vorlesungen nicht aus! Ich bin auch kein Baby, das dreimal am Tag von der Mama gefüttert werden muss! Und am Abend habe ich Termine!“ Leo stand auf, nahm den Kakaobecher und schüttete ihn in das Spülbecken. Mama schluchzte. „Ja! Deine Termine kenne ich! Diese Esther!“
In der Küche herrschte das übliche Chaos. Es bereitete ihm fast körperliche Schmerzen. Seine Mutter war unfähig, Ordnung zu halten, sie hatte nicht einmal einen Plan, welches Geschirr in welchen Schrank gehörte. Wenn er nach einem sauberen Glas suchte, war das oft vergeblich. Wenn er eines fand, war es jedes Mal in einem anderen Schrank an einem anderen Platz. Schmutziges Geschirr stand schon seit dem Wochenende schlampig übereinandergestapelt in einer Ecke der Anrichte. Leo atmete auf, als er draußen stand und die Haustür hinter ihm ins Schloss fiel.
An der Uni herrschte wenigstens Ordnung. Obwohl die Studentenvertreter alles dafür taten, dass die Gänge mit ihren unüberschaubaren Anschlagtafeln ständig mit unordentlich hingetackerten Zetteln geflutet wurden.
Leo ließ seine Blicke über die Reihen des Hörsaals schweifen. Etwa zu einem Drittel war er besetzt, wie üblich waren alle Plätze hinten am Rand schon vergeben. „Entschuldigung!“ Er musste sich an drei Mädchen in der drittletzten Reihe vorbeiquetschen, um zu einem freien Platz zu kommen. Missmutig klappte er seinen Sitz herunter und holte den Notizblock aus dem Aktenkoffer. Es war unerträglich, dass der alte Hörhager es nicht erlaubte, dass man sich mit dem Notebook Notizen machte. Das Klappern der Tastaturen störe seine Konzentration, das hatte er gleich in der ersten Vorlesung klar gemacht, als einige Laptops auf den Pulten aufgetaucht waren. Leo holte seine Federschachtel aus dem Koffer. Sie war schwarz und enthielt vier Stifte, ebenfalls in Schwarz und gleich lang. Es hatte ihn viel Mühe gekostet, dieses Set zusammenzustellen. Eine Füllfeder, ein Kugelschreiber, ein Faserschreiber und ein Bleistift. Den benützte er so selten wie möglich, denn hätte er ihn gespitzt, wäre er kürzer als die anderen Schreibgeräte gewesen.
Wozu römisches Recht überhaupt gut sein sollte. „Europäische Zivilrechtsdogmatik und ihre römischen Grundlagen“. Was für ein Scheiß. Aber die Vorlesung gehörte nun einmal zum Pflichtprogramm. Was sollte man machen. Professor Hörhager begann, wie immer, seine Vorlesung so leise, dass man ihn kaum verstehen konnte. Erst als sich das Gemurmel und Gekicher im Hörsaal gelegt hatte, erhob er seine Stimme so weit, dass man ihm folgen konnte. Auf ein Mikrophon verzichtete er. Das habe er in vierzig Jahren Uni nie gebraucht, und er werde das auch nicht ändern, erklärte er jedem, der es wissen wollte.
Zwei der Mädchen an seiner rechten Seite fuhren mit ihren Kugelschreibern eifrig über das Papier, die langen Haare hingen unordentlich bis auf die Pulte nieder. Leo hatte zwei Plätze zwischen sich und ihnen freigelassen. Verstohlen beobachtete er die ihm am nächsten Sitzende. Sie kaute gelangweilt an ihrem Stift. Das verabscheute er. Die Stifte wurden dadurch unansehnlich, ekelig. Das Mädchen hatte die Beine übereinandergeschlagen und trug einen kurzen Rock. Sie schien Leos Blicke wahrzunehmen und wandte sich ihm zu. Ihr Blick war spöttisch, fast verächtlich. Waren sie einander schon einmal begegnet? Er senkte die Augen auf seinen Notizblock, der außer ein paar Kritzeleien nichts enthielt. Sie sah nicht aus wie eine Studentin im dritten Semester. Sehr hübsch, das schon, auch jung, aber irgendwie fehlte ihr das Kindliche der anderen Studentinnen im Saal. Irgendwo, dachte er, hatte er dieses Mädchen schon einmal gesehen, aber es war kein angenehmes Aufeinandertreffen gewesen. Hörhagers Geschwafel zog an ihm vorüber, während er angestrengt darüber nachdachte, wo sie ihm aufgefallen war.
Plötzlich sah er das passende Bild vor sich, blond, blaue Daunenjacke, weiße Pudelmütze. Sie stand eingezwängt zwischen ungepflegten, bärtigen Männern, der Kontrast war ihm aufgefallen. Die Menge brüllte: „Nazis raus! Nazis raus!“ Es war bei einem Vortrag an der Uni gewesen, gegen den die Linken wütend demonstriert hatten. Irgendwas hatte denen an dem Vortragenden nicht gepasst, er konnte sich nicht erinnern, was es gewesen war, weder der Vortrag noch der Vortragende hatten ihn interessiert. Er war nur hingegangen, weil die Verbindung geschlossen antreten sollte, so hatte es zumindest geheißen. Natürlich hatten sie Farben getragen, und das allein war dem linken Mob schon so zuwider, dass sie sich ihnen kreischend und brüllend entgegengestellt hatten. Aber das waren sie schon gewohnt. Die Uni hatte die Veranstaltung genehmigt, also hatten die Linken keine Chance, sie zu vertreiben. In der sogenannten Qualitätspresse war zwar noch tagelang darüber diskutiert worden, ob der Vortrag mit den Werten der österreichischen Universität zu vereinbaren war, ein Dekan hatte sich sogar entschuldigen müssen, aber dann hatte sich alles wieder beruhigt. Er versuchte, sich zu erinnern, ob das Mädchen mitgebrüllt oder nur zugesehen hatte, aber es gelang ihm nicht.
Er bemühte sich, sich auf den Vortrag von Professor Hörhager zu konzentrieren, brachte sogar ein paar Notizen zustande, fühlte sich aber von dem Mädchen beobachtet. Hier war er allein, was, wenn sie womöglich mitten im Hörsaal „Nazis raus!“ zu schreien anfangen würde? Wahrscheinlich wäre er einer gegen ein paar Dutzend. Die Linken hatten ja die Universitäten nahezu komplett übernommen, von ein paar Ausnahmen abgesehen. Überall saßen die Roten, sogar auf den Lehrstühlen. Selbst der alte Hörhager hatte Vorbehalte gegenüber den Studentenverbindungen. Sein Vater sei Widerstandskämpfer gewesen, hieß es.
„Ich hätte da eine Frage.“ Er zuckte zusammen. Das Mädchen neben ihm hatte Hörhager mit kräftiger Stimme unterbrochen, als er einmal eine Pause in seinem monotonen Vortrag eingelegt hatte. Er sah sich verwundert nach ihr um. Mit einer Hand strich sie eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. Sie hatte ein Schüttelpennal auf ihrem Platz stehen, in dem kunterbunte Schreibgeräte wie Kraut und Rüben durcheinanderlagen. Abgewetzt war es zudem.
Hörhager blickte verblüfft in den Hörsaal, streckte aber dann auffordernd den Arm aus, als er die erhobene Hand entdeckte. Die Frage plätscherte an Leo vorüber. Wozu stellte man Fragen? Es reichte doch, wenn man das Skriptum der Vorlesung so halbwegs auswendig konnte. Der alte Hörhager jedoch nickte. „Eine sehr gute Frage, Frau Kollegin!“ Leider schloss sich daran eine überlange Antwort an, die den Zeitrahmen der Vorlesung sprengte. Unruhig sah Leo auf die Uhr. Wie kam diese dumme Gurke dazu, hier Fragen zu stellen, die dazu führten, dass überzogen wurde? Was bildete sie sich ein?
Endlich schloss Professor Hörhager seinen Vortrag. Leo blieb sitzen und gab vor, noch in seinen spärlichen Notizen zu lesen. Ohne aufzusehen, markierte er manche Stellen, unterstrich das eine oder andere Zitat, um dem Mädchen nicht beim Verlassen der Sitzreihe zu begegnen. Als er seine Stifte in ihre Schlaufen gesteckt hatte, sorgfältig darauf achtend, dass alle in der gleichen Position lagen, stand sie allerdings noch immer in der Reihe auf dem Platz, auf dem sie zuvor gesessen war. „Na, kleiner Nazi?“, sagte sie. „Ganz allein heute? Ohne deinen Scharführer? Fürchtest du dich da nicht?“ Leo spürte ein Würgen im Hals. Es fiel ihm keine passende Antwort ein, nichts, was lässig und schlagfertig klingen wollte. Das Mädchen grinste unverschämt. „Lass mich in Ruhe!“, presste Leo hervor, wandte sich ab und drückte sich den langen Weg durch die Reihe zur anderen Seite. Vor Wut ballte er seine Hände in den Hosentaschen zu Fäusten. So eine wie die, die sollte einmal ordentlich verprügelt werden, bei einer Demo zum Beispiel. Da sollte die Polizei ruhig einmal ein wenig kräftiger mit dem Schlagstock dreinfahren.
Diese aggressive Provokation versetzte ihn in ohnmächtige Wut, die immer wieder nach „Zuschlagen!“ rief. Nachts, vor dem Einschlafen, da würde ihm einfallen, was er hätte sagen sollen, wie er den Angriff mit Worten parieren hätte können, aber da war es natürlich zu spät. Er atmete tief aus und versuchte, sich auf das Treffen mit Esther zu freuen. Sie hatten sich zu Mittag bei einem Asiaten verabredet. Nur Esthers wegen, er selber bevorzugte einheimische Lokale und Speisen. Wer informiert war, wusste, dass das ganze asiatische Essen von Chinesen in Schwarzarbeit und mehr oder weniger aus Abfällen produziert wurde. Er würde Esther gegenüber noch ein paar klare Worte darüber verlieren müssen, wo man zum Essen hingehen sollte, und welche Lokale man zu meiden hatte.
„Na endlich! Hallo, Schatzi!“ Esther nahm ihn in den Arm und kraulte ihn hinter den Ohren. „Na, hast du den Hörhager überstanden? Oder sind dir während der Vorlesung Spinnweben unter den Armen gewachsen? Warum hat das denn so lange gedauert?“ Sie kicherte und kitzelte ihn unter der Achsel. Anstatt ihre Fragen zu beantworten, drückte Leo ihre Hand weg. „Geht so!“ Bevor sie das Lokal betraten, hielt ihn Esther noch einmal an und zupfte an seinem Kragen herum. „Gut schaust du aus!“, sagte sie und drückte ihm einen Kuss auf die Nasenspitze. „Aber mit einem lässigen Seidenschal wär’s noch ein bisschen …, verstehst du?“ Leo nickte und stieß die Tür auf. Einerseits war es ja schmeichelhaft, dass sie ihn so attraktiv fand, aber ihre Versuche, ihn umzustylen, gingen ihm mehr und mehr auf die Nerven. Manchmal kam ihm der Gedanke, sie sei nur mit ihm zusammen, um ihn von Grund auf zu ändern, als eine Art soziales Projekt. Sie zwängten sich auf zwei Barhocker am Laufband, auf dem die Speisen vorbeiglitten. Esther nahm sich gleich einen Teller mit zwei Frühlingsrollen. „Da, schau, Leo, da kommen noch zwei! Soll ich sie für dich nehmen? Die sind nämlich immer gleich aus!“ Ohne zu antworten, schnaubte er und wischte mit seiner Serviette den Platz vor sich sauber. Wer konnte wissen, ob hier ordentlich geputzt worden war. „Warum denn so missmutig, Schatzi?“ „Sag nicht immer Schatzi zu mir, schon gar nicht in der Öffentlichkeit!“ Natürlich lag ihm der Angriff des Mädchens aus dem Hörsaal noch im Magen, er hätte sich geschickter zur Wehr setzen können, sie in die Schranken weisen müssen. Und jetzt auch noch Esther mit ihrem Geschnatter. Hoffentlich hatte niemand aus seiner Verbindung die Szene beobachtet. Und hoffentlich erzählte das Mädchen sie nicht weiter.
Widerwillig stopfte er ein paar Frühlingsrollen in sich hinein. Obwohl er hungrig war, ekelte er sich vor diesem Zeug. Wenn man daran dachte, wer diese Rollen schon mit seinen schmutzigen Fingern berührt hatte. „Wow!“, jubelte Esther, „Garnelen! Magst du auch welche?“ „Ich nehm mir schon was, wenn’s mir passt!“, brummte er. Dieses Bemuttern war schwer zu ertragen. Manchmal kam ihm Esther vor wie seine eigene Mutter. Konnte sie nicht verstehen, dass er sich sein Essen selbst aussuchen wollte? Wenn er schon hier in diesem Loch mit ihr essen musste? Ach bitte, Schatzi, hatte sie gejammert. Ich geh so gern zum Running Sushi, das macht so Spaß! Und mir schmeckt das so! Und es ist gar nicht teuer!
Eigentlich war diese Esther gar nichts für ihn, sie hatte auch kein Interesse an der Verbindung, aber sie war ihm eben passiert. Er war irgendwie in diese Beziehung gestolpert, bloß, weil er endlich regelmäßig Sex haben wollte. Das wollte Esther auch, aber eben noch einiges darüber hinaus. Gespräche, zum Beispiel. Unter anderem über die gemeinsame Wohnung, die sie sich endlich nehmen sollten. So, als ob sie seine Gedanken lesen konnte, kam sie zwischen zwei Teigtaschen genau auf dieses Thema. „Wann gehen wir jetzt endlich eine Wohnung anschauen? Du kannst doch nicht ewig bei Mutti wohnen! Und ich stell es mir so schön vor, eng an dich gekuschelt einzuschlafen! Und aufzuwachen!“ Leider hatte Esther, wie üblich, viel zu laut gesprochen. Der ältere Mann neben Leo hatte alles mitgehört und kicherte verstohlen in sich hinein. „Nicht hier!“, zischte Leo. „Nachher! Draußen!“
„Nie willst du mit mir reden!“, schmollte Esther. „Ich frage mich, wozu du mich überhaupt brauchst!“ Die Finger seiner linken Hand, die gerade keine Essstäbchen halten mussten, schlossen sich unter dem Tisch zur Faust.
„Ich hab dir doch schon gesagt, es ist auch ein finanzielles Problem!“, versuchte er dann, später, auf dem Weg in die Innenstadt, eine Erklärung. „Meine Mama hat nach Papas Tod alles verloren, sie hat so einen blöden Vertrag unterschrieben, einen Ehevertrag, sie kriegt nichts! Außer eine kleine Witwenrente. Es fällt uns schon schwer genug, das Haus zu halten.“ „Kann sie denn nicht arbeiten gehen? Und du könntest dir auch einen Job suchen!“, konterte Esther. „Das muss ich dir doch wert sein! Ich arbeite ja auch neben dem Studium!“ Leo seufzte. „Lass meine Mutter aus dem Spiel. Sie ist krank, und sie hat nichts gelernt.“ Er wollte und konnte Esther nicht erklären, dass die Verbindung es nicht zuließ, neben dem Studium zu arbeiten. Das Training, die Sitzungen, die Kneipen, all das kostete Zeit. Und es war unehrenhaft, neben dem Studium zu jobben. Vor allem, wenn man dann womöglich in der Gastronomie arbeitete und irgendwelche Leute bedienen musste. Solche, die eigentlich gar nicht hierher gehörten. Geld war leider wirklich knapp. Sogar der Baugrund am Bach, auf dem sich Papa seinen Alterssitz errichten hatte wollen, war schon verkauft, der Erlös verbraucht.
„Gehen wir wenigstens heute Abend ins Kino?“, fragte Esther und legte ihren Kopf auf seine Schulter. Ihre Haare kitzelten im Ohr, und er schüttelte sie unwillig ab. „Ich kann nicht, ich muss noch trainieren!“ Esther funkelte ihn böse an. „Ach ja, trainieren? Für das nächste Saufgelage am Wochenende? Oder eure dämlichen Studentenlieder, was?“ Sie hatte nicht das geringste Verständnis dafür, was ihm die Verbindung abforderte. Das Fechttraining war kein Spaß, und die Mensuren erst recht nicht. „Das ist wie Leistungssport“, versuchte er es. „Das musst du verstehen, das ist … das ist gut für mich, es ist ein hartes Training für Körper und Geist! Das kommt mir dann später auch im Berufsleben zugute!“ Esther lachte hämisch auf. „Ja, dein Narbengesicht, das wird dir dann sicher sehr hilfreich sein, im Berufsleben!“
Er hasste diese Diskussionen. Anfangs war Esther sogar noch auf die Bude mitgegangen, hatte mit ihm Veranstaltungen besucht. Aber in den letzten Wochen war sie immer widerspenstiger geworden. Er hatte den Verdacht, dass sie ihn von der Verbindung wegbringen wollte. Dabei hatte sie keine Ahnung. Die alten Herren der Verbindung sorgten dafür, dass man nach dem Studium schnell eine Anstellung bekam und Karriere machte. Dafür brauchte man als Jurist ein Netzwerk, allein war man niemand. Es gab ein paar alte Herren, die hatten Kontakte bis in die Ministerien hinein. Sein Vater konnte ihm nicht mehr helfen, der hatte sich davongemacht, bevor er für ihn nützlich hätte werden können. Und seine Firma, die war jetzt in der Hand des Onkels. Und sein Erbteil ebenfalls, an den kam er nicht heran.
„Weißt du was, Esther?“, versuchte er es versöhnlich. „Heute gehe ich trainieren, wie ausgemacht, dafür bestimmst du morgen, was wir am Abend tun. Tagsüber bin ich auf der Uni.“ „Wenn du meinst!“, gab sie kühl zurück. Irgendwas stimmte mit dieser Beziehung nicht. Eigentlich sollte er den Ton angeben, entscheiden, was wann getan wurde. Und sie hatte sich damit zu arrangieren. In einer Familie würde auf jeden Fall er das Oberhaupt sein, so wie sein Vater es gewesen war. Und so, wie es immer schon gewesen war. Da konnte nicht einfach jeder mitreden. Da kam nur Chaos dabei heraus. Davon würde er Esther noch überzeugen müssen.
Auf der Bude roch es muffig, wie immer, wenn sie trainierten. „Du bist spät!“, ermahnte ihn Paul. „Dabei hast du ohnehin zu wenig trainiert in letzter Zeit!“ „Kümmer dich um deinen eigenen Dreck!“ Leo hatte jetzt wirklich keine Lust, sich Vorhaltungen machen zu lassen, wo er sich ohnehin nur schwer dazu hatte durchringen können, noch zum Training zu kommen. Paul stellte sich ihm entgegen, als er die Garderobe verlassen wollte. „Das ist nicht der Ton, in dem wir miteinander reden! Hast du schon vergessen? Hier geht es um Kameradschaft! Lebenslange Treue!“ „Ja, ja!“, entgegnete Leo, schloss seine Faust fester um den Säbel und drückte sich an Paul vorbei. Der war zwar der Sohn eines Sektionschefs im Ministerium, aber außer Sprüche klopfen, fand Leo, hatte er nicht viel zu bieten. Und die Sprüche stammten meistens aus irgendeinem alten Schinken mit Verbindungsregeln oder aus einem Liederbuch. Eigene Gedanken schien Paul wenige zu haben, er war einer von denen, die nur redeten und nicht handelten. Das war überhaupt eine Schwäche der Verbindung. Über schlechte Witze lachen, saufen, fechten, das war so ziemlich das ganze Programm. Auf einen Posten warten und sich dann seriös geben. Lauter Arschlöcher.
Er drosch auf den Lederschädel ein, der vor ihm, auf einer Stange montiert, heftig wackelte, wenn er traf. Einmal, zweimal, dreimal. Man brauchte Kraft, um dieses Training durchzuhalten. Kraft und Ausdauer. Keuchend setzte er ab. Seine Schulter schmerzte. „Schon müde?“ Schneidend kam Pauls Stimme von hinten. Leo hob seinen Säbel erneut. Paul würde einer der Ersten sein, die diesen Säbel zu spüren bekommen sollten. Dieses arrogante Arschgesicht. Doch immer wieder tauchte bei den Hieben auf den gesichtslosen Kopf das Mädchen aus dem Hörsaal vor seinem inneren Auge auf. Sie hatte den Säbel ebenfalls verdient. Und schließlich Esther, sogar seine Mutter, sein toter Vater. Immer heftiger drosch er auf den Schädel ein, bis er den Säbel atemlos sinken lassen musste.
Arthur klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. „Lass gut sein für heute. Gehen wir ein Bier trinken.“ Leo nickte. Auf der Bude gab es immer Fassbier, mit Flaschenbier gab man sich nicht ab. Ein lauter Rülpser begrüßte Leo, als er sich an den langen Holztisch setzte, an dem bereits ein ganzes Grüppchen Bundesbrüder saß und sich lautstark unterhielt. „Na, Leo, zu spät heute? Hast du erst die Alte ordentlich durchziehen müssen?“ Leo rang sich ein Lächeln ab. „Dreimal!“ „Oho! Darauf ein Prost!“ Einer hob seinen Krug, alle taten es ihm nach, schlugen ihre Bierkrüge gegeneinander und setzten sie an die Lippen. Den ersten Krug galt es, in einem Zug zu leeren. Sonst war man ein Weichei. Leo verschluckte sich, Bier rann seitlich an seinem Kinn, seinem Hals hinab. Gelächter. „Na, wenn du bei deiner Alten auch so ans Werk gegangen bist …“ Gegröle. Leo grölte mit. Er musste seinen Krug wieder füllen. Auch hier wollte es ihm nicht gelingen, den Sprüchen der Bundesbrüder mit lässig hingeworfenen Scherzen entgegenzutreten. Stattdessen krampfte er seine Faust um den Zapfhahn, während das Bier in seinen Krug rann.
Einer der alten Herren der Verbindung setzte sich zu ihnen. Leo hatte ihn schon gelegentlich gesehen, aber nie sprechen hören. Irgendwie kam ihm der Mann bekannt vor. Unter dem Deckel, der traditionellen Verbindungskappe, fielen die dicke Nase, der graue Schnauzer und die schwabbeligen Backen auf. Das Doppelkinn verbarg seinen Kragen und den Krawattenknoten. „Nun, Kameraden? Was steht an?“ Die Stimme ließ Leo zusammenzucken. Er hatte diesen Mann schon einmal gesehen. Ja, jetzt hatte er es. Es war dieser Herwig, ein ehemaliger Freund seines Vaters. Und außerdem war er Leiter des Sommerlagers gewesen, in das Leo geschickt worden war. Und Leo war aus diesem Lager ausgerissen, weil er es dort nicht einmal einen Tag ausgehalten hatte. Er senkte den Kopf. Hoffentlich erkannte ihn der Herr Ingenieur nicht. „Was steht denn an in nächster Zeit?“, wiederholte der alte Herr. „Einige von uns wollen zur Wartburg“, erklärte ihm Paul. Die Wartburg, das war sozusagen der heilige Gral der Studentenverbindungen. Das Mekka, obwohl diesen Begriff nie jemand gebrauchte. Aber es war trotzdem so. Jeder gute Burschenschafter musste einmal zur Wartburg in Thüringen, die man als den Gründungsort aller Burschenschaften beinahe religiös verehrte. Leo hatte für diese Art Kitsch wenig übrig, ihm konnte die Wartburg gestohlen bleiben.
„Sehr schön!“, erwiderte der alte Herr. Leise summte er den Beginn des Liedes „Wenn alle untreu werden“ und grinste dazu hämisch. Gesungen wurde dieses Lied nicht mehr, es verwies allzu deutlich auf einen Zusammenhang mit der Nazizeit, da war man vorsichtig geworden. Aber summen, so sagten manche, werde man wohl noch dürfen. Den Herrn Ingenieur, so hatte sein Vater den Mann genannt, erinnerte sich Leo. Er war zwar auch damals schon fett gewesen, die rote Nase, die schlaffen Backen und das Mehrfachkinn waren allerdings hinzugekommen, seit Leo ihn zuletzt gesehen hatte. Leo erinnerte sich noch genau daran, wie der Herr Ingenieur nach Papas Tod dessen Mercedes billig hatte kaufen wollen und sich überdies noch an seine Mutter herangemacht hatte. Herwig verlor sich nun in seinen Erinnerungen an die Wartburg, die Leo nur teilweise verstehen konnte, weil die Unterhaltung am Tisch immer lauter und chaotischer wurde und kreuz und quer verlief. Er leerte seinen Krug und stand auf, um ihn nachzufüllen. Als er sich wieder setzte, war das Thema gewechselt worden.
„Die linken Zecken haben uns schon wieder die Hauswand beschmiert!“, erklärte Paul. „Was tun wir?“ Leo hatte die Bescherung bereits gesehen, als er angekommen war. „Nazis raus!“ hatte wieder einmal einer an die Wand gesprüht. Die Bronzetafel der Verbindung neben dem Hauseingang war mit brauner Farbe bekleckert worden. „Gleiches mit Gleichem vergelten!“ Adrian knallte seinen Bierkrug auf die Tischplatte. Seine Aussprache war schon etwas unsicher. Leo stürzte sein drittes Bier hinunter, um endlich etwas zu spüren. Es war immer das Gleiche. Bloß, weil sie Werte hatten, weil sie Werte verteidigten, gingen diese linken Chaoten auf sie los. Keiner wusste, was die außer Randalieren eigentlich wollten. Paul schüttelte den Kopf. „Willst du eine Vorstrafe im Register haben, wenn du mit dem Studium fertig bist? Ich nicht!“ Das war wieder typisch Paul, dachte Leo. Anstatt etwas zu tun, dachte er an seine Karriere. Die kam zuerst, danach die Werte. Nach Leos drittem Bier versank die Diskussion in Gegröle und unverständliches Gemurmel. Irgendwann standen plötzlich alle auf, und bevor er wusste, was passierte, fand er sich auf der Straße. „Jetzt gehen wir’s an!“, schrie Adrian. Leo wusste nicht was, aber irgendetwas zu tun, anstatt faul herumzusitzen, schien ihm verlockend. „Da, nimm!“ Adrian hatte das Absperrgitter einer Baustelle beiseitegeschoben. Da lag ein Haufen Pflastersteine. „Guter, alter Granit!“, flüsterte Adrian. Er drückte Leo einen Stein in die Hand. „Mützen!“, flüsterte Adrian. Leo zog sich, wie alle anderen, eine schwarze, dünne Mütze über, die das ganze Gesicht verbarg und nur für Augen und Mund Schlitze freiließ. So was hatten sie für Einsätze immer dabei. Leo hatte seine auf einer Kartbahn mitgehen lassen. Danach ging alles ganz schnell.
Sie bogen um eine Ecke. „Da drin haben sie ihr Hauptquartier“, brüllte einer, und schon flog der erste Pflasterstein. „Los, wirf!“, ermutigte ihn Adrian, und Leo zielte auf ein Fenster im ersten Stock, das erleuchtet und noch nicht zerschlagen war. Der Stein verfehlte das Fenster, prallte von der Hausmauer ab und plumpste vor seine Füße. Er sah um sich. Niemand schien seinen Fehlwurf bemerkt zu haben.
Die Fenster oben öffneten sich, Geschrei drang daraus hervor. „Ihr Schweine!“, hörte er eine Frau schreien. „Ihr verdammten Schweine!“ Ein Pflasterstein flog aus einem der Fenster, Adrian heulte auf. „Ihr habt was verloren!“, schrie eine weibliche Stimme. „Ihr könnt es gern wieder zurückhaben!“ Adrian hielt sich die Schulter und stöhnte. Leo zog ihn am anderen Arm auf die andere Straßenseite. „Ah!“, stieß Adrian hervor. „Die Schweine haben mich erwischt!“ „Lass mal sehen!“ Leo streifte Adrian die Lederjacke ab. „Aua! Vorsicht!“, jammerte der. Hinter sich hörte Leo es erneut klirren. Die Schlacht schien in vollem Gange zu sein. Wahrscheinlich würde bald die Polizei auftauchen, irgendjemand aus der Nachbarschaft hatte sie sicher schon gerufen. Er besah sich Adrians Schulter. „Blut ist jedenfalls keines zu sehen“, sagte er. „Sei nicht so wehleidig!“ „Das zahlen wir ihnen heim!“, zischte Adrian plötzlich. Leo sah nach dem Stein, der Adrian getroffen hatte. „Warte!“, sagte er, hob den Stein auf und strengte sich diesmal mehr an. Es klirrte. Doch da kam von oben wieder etwas geflogen. Er zog den Kopf ein. Oben lachte jemand. „Wir haben noch ein wenig Müll für euch aufgehoben. Müll für Müll!“ Wieder diese Frauenstimme. Irgendwas klebte in seinen Haaren. Braunes Zeug? War das etwa …? Er roch daran. Kaffeesatz. Die hatten den Biokübel auf sie geleert. Aber immerhin, ihre Fensterscheiben waren hin.
Adrian war wieder neben ihm aufgetaucht. Seine Schulter schien nicht schwer verletzt zu sein, denn er schaffte es, seinen Hosenschlitz zu öffnen, und er begann gegen das Gebäude zu urinieren. Leo wollte nicht zurückstehen, stellte sich neben Adrian und tat es ihm gleich. Die vielen Biere hatten ohnehin schon auf seine Blase gedrückt.
Plötzlich strömte Wasser auf ihn herab. „Wenn ihr schon kein Klo findet, hier habt ihr das Wasser aus unserem!“ Adrian fluchte, wandte sich ab, alle rannten. Leo blickte zum Fenster hoch, während er krampfhaft versuchte, seinen Hosenschlitz zu schließen. Die Gesichter waren im Dunkeln. War jenes dabei, das er heute Vormittag im Hörsaal gesehen hatte? Ein Lichtstrahl fiel auf blondes, langes Haar. War seine Bekanntschaft von heute Morgen da oben oder sah er Gespenster?
Plötzlich ertönten Polizeisirenen. „Weg!“, schrie einer. „Schnell!“ Und Leo rannte. Die anderen waren schneller gewesen als er, er sah niemanden mehr. Blaues Licht zuckte an der nächsten Straßenecke. Leo drückte sich in einen Hauseingang, in dem es nach Hundepisse stank. Dafür war es dunkel. Ein Einsatzwagen brauste an ihm vorüber, bog um die nächste Ecke, hielt dort an. Leo blieb im Hauseingang, das Herz schlug ihm bis zum Hals. Erst jetzt merkte er, wie eiskalt seine nassen Haare am Kopf klebten. Ob noch ein Wagen kam? Ob die Polizisten nach ihnen suchten? Dann konnte jederzeit einer um die Ecke kommen. Doch alles blieb still. War es tatsächlich das Mädchen aus dem Hörsaal gewesen, das von oben herab geschrien hatte? Den Mistkübel auf ihn ausgeleert hatte? Es war schwer, sich vorzustellen, wie ihre Stimme klang, wenn sie schrie. Außerdem hatte sie im Hörsaal nicht mehr als zwei Sätze zu ihm gesagt. Warum bloß sah er immer wieder ihr Gesicht mit diesem spöttischen Lächeln vor seinen Augen? Hatte sie ihn dort im Hörsaal schon ausgelacht? Und jetzt Mist auf ihn geleert? Die würde was erleben, wenn er sie noch einmal zwischen seine Finger bekam.
Leo wagte sich aus seinem Versteck, rannte los. Wo waren die anderen? „He!“, hörte er plötzlich. War es Adrians Stimme? Er sah sich um. Gegenüber hatten sich Adrian und die anderen neben einem Lokal mit hell erleuchteter Fassade an die Hauswand gedrückt. „Denen haben wir es aber gegeben!“, grinste Adrian. Seine Haare hingen ihm klatschnass ins Gesicht. „Verdammt!“, schrie Leo. „Die haben uns Wasser aus ihrem Klo über den Kopf geschüttet!“ Gelächter. „Das glaubst du doch selbst nicht!“ Adrian schüttelte den Kopf. „So schnell kriegst du doch Wasser aus der Klomuschel gar nicht raus. Die haben einfach ihre Trinkflaschen ausgeleert. Aber wir haben es ihnen gezeigt! Ein für alle Mal!“
„Kommt!“ Adrian ging voraus in das Lokal. Trotz seiner nassen Haare, dem nassen T-Shirt ließ sich Leo von der euphorischen Stimmung der anderen anstecken. Noch ein Bier. Immerhin hatten sie heute etwas getan. Etwas, das mehr Sinn machte, als auf den Lederschädel einzuprügeln. Der hatte ihnen nämlich nichts getan. Die Linken, das war etwas ganz anderes. Die galt es, in die Schranken zu verweisen. Adrian hob den gestreckten Zeigefinger. „Und deswegen“, lallte er, „gilt es gerade jetzt!“ Sein Ellenbogen rutschte von der Tischkante, sodass er aus dem Gleichgewicht geriet. Leo kicherte meckernd vor sich hin. Adrian fing sich wieder. „Gerade jetzt!“, wiederholte er. „Zusammenzustehen! Und gegen dieses ganze Gesindel anzutreten! Der deutsche Mann muss sich wieder, muss sich die Herrschaft über sein eigenes Land, sein eigenes Gesindel …“ Er verlor sich in seinem Satz. Leo blickte um sich. Von anderen Tischen wurden sie skeptisch gemessen. Das Thema ihrer Unterhaltung kam anscheinend bei den anderen Gästen nicht besonders gut an. Man musste sich in Acht nehmen. Aber die, so überlegte Leo, würden sich alle noch wundern. Sehr wundern!
Irgendwann fand sich Leo allein auf der Straße. Kalt war es geworden, und er hatte keine Ahnung, wie er in die Nähe der Wohnung von Esther gekommen war. Aber, so dachte er, wo er nun schon einmal da war, konnte er doch ebenso gut auf einen Sprung vorbeischauen. Schließlich war Esther seine Freundin. Sie musste ihn in ihr Bett lassen. Auch wenn Mama dann morgen Früh toben würde, wenn sie sein Zimmer leer vorfand.
Die Tafel mit den Klingelknöpfen verschwamm vor seinen Augen, und er musste die Lider fest zusammenkneifen und sich konzentrieren, um den richtigen zu finden. Zwei Namen standen da, der untere war der Esthers. Er klingelte. Noch einmal, weil sich nichts rührte. Noch einmal. Lang. Schließlich knackte der Lautsprecher der Gegensprachanlage. „Ja? Wer ist da? Es ist mitten in der Nacht!“ Es war nicht Esthers Stimme. Esther hatte keinen Akzent. Die da aber schon. Das musste diese Spanierin sein, die seit ein paar Wochen Mitbewohnerin in der WG war. Was hatte eine Spanierin hier zu suchen? Die sollten zu Hause studieren, wie er auch. „Ich will zu Esther! Mach auf!“, lallte er. „Madre de Dios!“, fluchte die Spanierin. Wenig später summte der Türöffner.
Esther empfing ihn an der Wohnungstür. Rasch zog sie ihn in die Wohnung, schloss die Tür und legte einen Finger vor den Mund. „Leise! Weißt du, wie spät es ist?“ Sie schob ihn in ihr Zimmer und schloss die Tür. Das Licht blendete, sodass Leo blinzeln musste. „Ich will zu dir ins Bett!“ Er zog den Reißverschluss seiner Jacke auf. „Du bist ja besoffen! Und du stinkst! Glaub ja nicht, dass du in diesem Zustand hierbleiben kannst!“, zischte Esther. Leo ließ die Arme sinken. Was bildete sich dieser Trampel denn ein? Sie war seine Freundin! Er hatte jedes Recht, hier zu bleiben und mir ihr zu schlafen, wenn er das wollte. Er griff nach Esthers Unterarmen, umklammerte sie, versuchte, sie in Richtung Bett zu drängen. Esther riss sich los, und plötzlich knallte es. Seine Wange brannte. „Untersteh dich!“, flüsterte Esther. „Verschwinde sofort, oder ich schreie. Du weißt, wir sind zu viert. Mit dir werden wir leicht fertig. Und dann hole ich die Polizei!“ Die letzten Worte hatte sie ganz nahe an seinem Ohr fast unhörbar gehaucht. Leos Hände zuckten automatisch nach oben. Am liebsten hätte er sie jetzt gewürgt, bis sie still war. Ganz still. Doch ein Blick in ihre Augen genügte, und seine Hände sanken herab. Esther schob ihn aus ihrem Zimmer, aus der Wohnung, ohne dass er imstande gewesen wäre, Widerstand zu leisten.
Fast hätte ich sie erwürgt, dachte er, als er wieder auf der Straße stand. Weil ihm wieder einmal nichts eingefallen war, was er sagen hätte können, um sie umzustimmen. Fast hätte er seine Hände an ihren Hals gelegt, und wer weiß, was dann passiert wäre. Und es wäre allein ihre Schuld gewesen. Er hatte nichts anderes als sein Recht verlangt.
Als er zu Hause ankam, dauerte es eine Zeitlang, bis es ihm gelang, den Schlüssel im Schlüsselloch zu platzieren. Er musste sich mit dem Kopf und dem linken Arm abstützen, um mit dem rechten sein Ziel zu finden. Bevor er Licht im Vorzimmer machen konnte, stolperte er über den Schirmständer, der mit einem lauten Krachen zu Boden stürzte. „Verdammter Mist!“, murmelte er. Seine Mutter würde aber wohl trotz des Krachs nicht aufwachen. Seit sie trank, reagierte sie kaum mehr auf Lärm in der Nacht. Im Wohnzimmer stand die Weinbrandflasche noch auf dem Tisch. Er hob sie auf und hielt sie gegen das Licht. Vielleicht zwei Zentimeter der goldbraunen Flüssigkeit schwappten noch darin herum. Ob sie den ganzen Rest getrunken hatte? Leo trug die Flasche zur Spüle und schüttete sie aus. Mama kümmerte sich um nichts mehr, um gar nichts mehr. Die Anrichte in der Küche war noch unordentlicher als heute Morgen, schmutziges Geschirr, Einwickelpapier, Verpackungsfolien, Brotbrösel, ein einziges Durcheinander. Leo fegte alles mit seinem Unterarm zu Boden. Er konnte diese Unordnung nicht ertragen. Morgen würde sie wenigstens bemerken, dass ihm das Chaos aufgefallen war. Und es blieb ihr gar nichts anderes übrig, als es vom Boden wieder aufzuheben.
Schwer ließ sich Leo auf das Sofa im Wohnzimmer fallen. Es musste etwas geschehen, es musste wirklich etwas geschehen, und zwar schnell. Die Situation mit Esther, die Lage hier zu Hause – das war nicht so, wie er sich sein Leben vorstellte. Es sollte geordnet, sauber, strukturiert sein. Und dazu war es nötig, dass jeder seine Aufgabe an dem Platz erfüllte, an dem er nun einmal stand. Auf dem Couchtisch vor ihm lagen Zeitschriften und Werbeprospekte wild durcheinander, aufgeschlagen, zerknittert. Er trat mit dem Fuß danach, das meiste flatterte zu Boden. Das war offenbar alles, was Frauen interessierte. Schuhe, Kosmetik und neue Kleider. Und da wollten sie in Wirtschaft und Politik mitreden. Lachhaft. Man konnte es ja an seiner Mutter sehen. Und auch an Esther.
Leo zog seine Schuhe aus und schlich wankend in den ersten Stock, öffnete die Tür zum Schlafzimmer seiner Mutter. Das Licht einer Straßenlaterne leuchtete durch die nur zum Teil geschlossenen Läden, auch hier ein Durcheinander. Kleider lagen auf dem Boden, Unterwäsche, Strumpfhosen. Ihn ekelte. Dennoch schlich er zum Bett seiner Mutter, taumelte, fiel beinahe, machte Lärm. Doch Mama schnarchte gleichmäßig weiter. Leo beugte sich über sie. Es wäre ein Leichtes, sie mit dem Kopfpolster, der immer noch unbenutzt auf Papas Seite lag, zu ersticken. Er stellte sich vor, wie er den Polster nahm, auf ihr Gesicht legte, fest drückte, mit beiden Händen, vielleicht sogar mit einem Knie. Sie würde kurz zucken, versuchen, sich aufzubäumen. Es würde ihr nicht gelingen, weil sie besoffen war, nur halb bei Bewusstsein, und ihr würde auch schnell die Luft ausgehen. Wenn sie versuchte, tief einzuatmen, würde sie den Stoff des Polsters im Mund haben. Ganz schnell würden ihre Bewegungen erschlaffen, und am Morgen würde Leo dem Arzt die leeren Weinbrandflaschen zeigen und ihm erklären, dass seine Mutter sich jede Nacht schwer betrunken zu Bett gelegt hatte. Ihre Leber musste in einem fürchterlichen Zustand sein. Da war es kein Wunder, wenn auch die anderen Organe versagten. Der Arzt würde einen Totenschein ausstellen und keine Fragen mehr stellen.
Leo würde einen Container bestellen, der LKW würde ihn im Garten vom Haken lassen, und Leo würde alles wegwerfen, ihre Kleider, ihre dämlichen Zeitschriften, ihre Bücher, ihre Schnapsflaschen und ihre verdammten Schuhe und Handtaschen. Dann würde es endlich sauber sein in seinem Haus, sauber und ordentlich.
Außer er erwischte einen übereifrigen Arzt, der eine Obduktion durchführen lassen würde. Dann würde man schnell die Fasern in Mamas Lunge entdecken, möglicherweise auch Hämatome im Gesicht oder am Hals. Und auf das Gefängnis hatte Leo keine Lust. Gar keine. Er drehte sich auf Zehenspitzen um und verließ das Zimmer seiner Mutter. Wenn sie in diesem Tempo weitersoff, war sie auch ohne seine Mithilfe in ein paar Monaten tot. Oder erst in ein paar Jahren? Er hätte den Rest des Weinbrands doch nicht wegschütten sollen.
II
„Morgen“, verkündet Papa, „gehen wir Skifahren. Ich habe mir extra einen Tag freigehalten, obwohl …, na, das brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Wir fahren um halb acht los, damit wir einen Parkplatz nahe an der Seilbahn bekommen.“
Ich habe keine Lust, Ski zu fahren. Es ist nicht so, dass ich den Winter nicht mag, aber ich würde lieber den Schneeflocken beim Fallen zuschauen und an den Bäumen rütteln, um zu sehen, wie sie ihre Schneelast abwerfen. Und tiefe Schuhabdrücke im Schnee hinterlassen und dann zurückblicken, um zu sehen, wie tief sie sind und wo ich gegangen bin.
Das alles kann man nicht, wenn man mit Papa Skifahren geht. Da geht es darum, möglichst oft mit dem Lift hinauf- und auf der Piste herunterzufahren. Papa hat eine Uhr, die anzeigt, wie viele Höhenmeter man zurückgelegt hat. „Heute haben wir schon fünftausend geschafft!“, erklärt er dann stolz Mama. „Beim nächsten Mal gehen wir die sechstausend an!“ Ich würde morgen Früh lieber ausschlafen und dann mit meiner Lego-Eisenbahn spielen. In meinem Zimmer ist es warm und gemütlich, draußen aber, so stelle ich es mir zumindest vor, windig und kalt.
„Aufstehen, aufstehen!“ Papa rüttelt mich an der Schulter. Er hat schon seine Skiunterwäsche angezogen. Ich schaue durchs Fenster. Es ist stockdunkel, und ein Ast des Baumes, der vor meinem Fenster steht, wird vom Wind gegen das Fensterglas gepeitscht. „Ich mag nicht!“, sage ich. „Ich mag im Bett bleiben!“ Lachend reißt mir Papa die Decke weg. „Ich mag nicht, das gibt’s nicht! Heute müssen wir raus! Bewegung an der frischen Luft! Das ist gesund! Da wirst du ein ganzer Kerl!“
Es ist Papa sehr wichtig, dass ich ein ganzer Kerl werde, das sagt er immer wieder. Obwohl ich nicht weiß, was das genau ist. Auf jeden Fall hat es viel damit zu tun, dass ich Kälte aushalten muss. Im Sommer muss ich ins eiskalte Wasser und im Winter auf die Berge. Auf die Berge allerdings auch im Sommer. Da geht es darum, dass wir möglichst viele Höhenmeter bergauf zurücklegen. „In deinem Alter“, sagt Papa dann, „da habe ich mit Opa schon mehr als tausend Höhenmeter am Tag gemacht! Und das jedes Wochenende! Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht!“
„Ich mag nicht aufstehen! Skifahren ist blöd!“ Ich fange an zu schluchzen, und das macht Papa wütend. „Du stehst jetzt sofort auf!“, zischt er. „Ich muss mir meine Zeit genau einteilen! Sei froh, dass ich mit dir etwas unternehme! Andere Kinder würden sich glücklich schätzen, wenn …“ Mama steht in der Tür. „Das Wetter ist … möchtest du es dir nicht noch einmal überlegen?“ Sie sieht zu mir her, und ich erkenne das Mitleid in ihrem Blick. Nur, meistens hilft mir das nicht.
„Ich warte unten. Beim Frühstück. Und wenn er nicht spurt, dann fahren wir eben ohne Frühstück! Wo gibt es denn sowas!“ Papa stürmt aus dem Zimmer. Ich schlucke und würge. „Kannst du nicht mitkommen?“, frage ich Mama. „Ich muss ja, ich muss …“ Auch sie kämpft mit den Tränen. „Du weißt ja, dass ich das Skifahren schon lange aufgegeben habe. Wegen meinem Knie!“ Sie dreht sich um und geht ebenfalls nach unten. Ich stehe auf und gehe aufs Klo. Mamas Knie ist nur eine Ausrede, ihr macht das Skifahren genauso wenig Spaß wie mir. Aber mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich anzuziehen.
Während des Frühstücks sieht Papa dauernd auf die Uhr, aber mir bleibt mein Marmeladebrot fast im Hals stecken. Der Kakao ist auch noch zu heiß. „So!“ Papa steht auf. „Wir fahren jetzt. Du kannst ihm ja ein Jausenbrot herrichten, das kann er dann während der Fahrt essen. Die Trödelei ständig, das kann ich nicht ertragen!“ Papa wischt sich den Mund und wirft seine Serviette auf den Teller. Dann höre ich ihn im Vorzimmer rumoren. Er packt die Skischuhe ins Auto. Mama steht in der Küche und schmiert ein Brot. „Käse oder Wurst?“, fragt sie. Ich habe auf beides keine Lust und sage nur deswegen „Käse“, weil sie den zuerst genannt hat. „Schnell jetzt!“ Sie drückt mir das in Alufolie gewickelte Jausenbrot in die Hand. „Sonst wird er noch zorniger!“
Es ist immer noch dunkel, als wir unsere Straße hinunterfahren. Ich halte mein Jausenbrot in der Hand, habe aber überhaupt keine Lust, es zu essen. Vielleicht bei der Fahrt nach Hause. Wenn doch nur dieser Tag schon vorüber wäre. Morgen muss Papa wieder in die Firma und kommt wahrscheinlich erst zurück, wenn ich schon im Bett liege. Das wird ein besserer Tag werden. Noch dazu hat er klassische Musik eingeschaltet. Die macht mich ohnehin immer traurig, auch, wenn ich zuvor gut aufgelegt war. Vor den Scheinwerfern treiben Schneeflocken in alle Richtungen, und auch die Fahrbahn ist strahlend weiß. Ich habe noch die winzige Hoffnung, dass die Bergstraße zum Skigebiet gesperrt ist und wir wieder umdrehen müssen. Voriges Jahr ist das nämlich einmal passiert, aber heute scheint die Straße gut geräumt zu sein.
Zu meinem Pech hört der Schneefall auf, und als wir oben ankommen, blinzelt sogar die Sonne durch die Wolken. „Wunderbar! Da siehst du, dass es sich auszahlt, früh aufzustehen! Fast alle Parkplätze noch frei!“ Es steht also fest: Ich muss heute auf die Piste. Dabei habe ich Angst vor den steilen Hängen. Voriges Jahr, ich erinnere mich genau, konnte ich einmal nicht mehr weiter. Der Hang war so steil, und ich wusste einfach nicht, wie ich den nächsten Bogen hinkriegen sollte. Papa stand viel weiter unten, ich hörte ihn kaum rufen. Und noch viel weiter unten der Waldrand mit den Bäumen. Dagegen würde ich gleich krachen, das hatte ich klar vor Augen. „So komm doch! So fahr doch schon! Stell dich nicht so an!“, rief Papa die ganze Zeit. Aber ich hatte meine Stöcke fest in den Schnee vor mir gepflanzt und konnte sie einfach nicht herausziehen. Es ging nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es damals geschafft habe, doch noch den Berg hinunterzukommen.