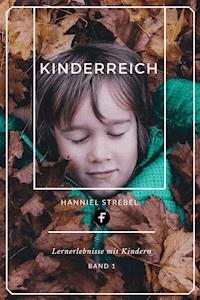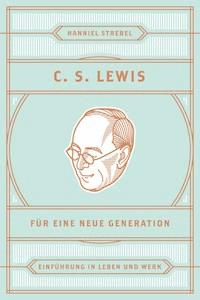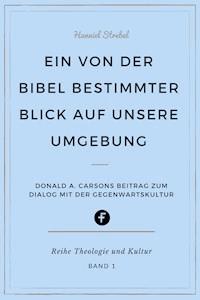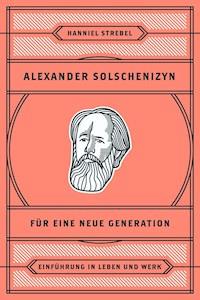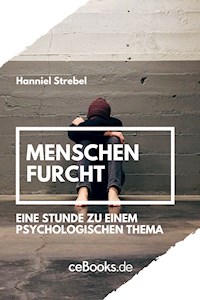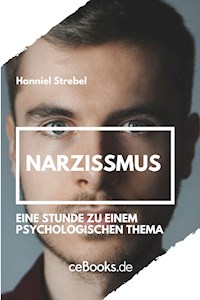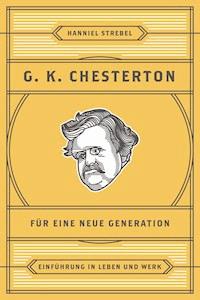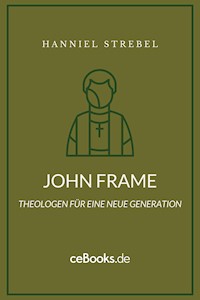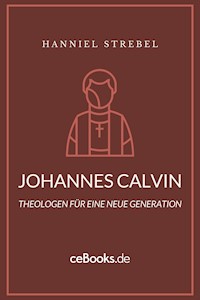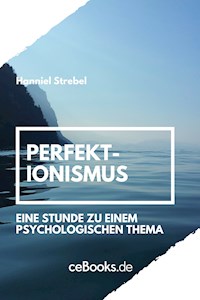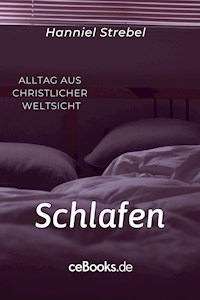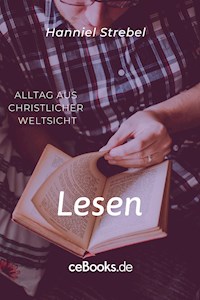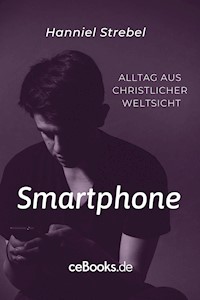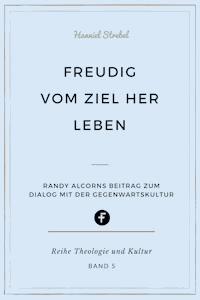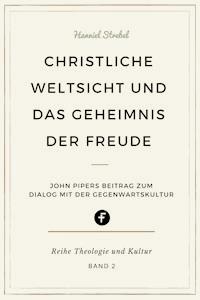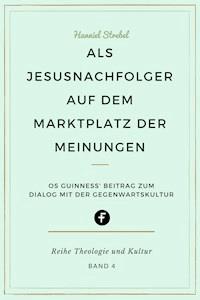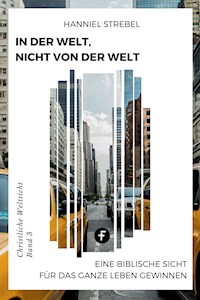
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Christliche Weltsicht
- Sprache: Deutsch
Das Leben als Christ steht in einer dreifachen Spannung (siehe Johannes 17,14-17). Wir sind »nicht von der Welt«, das heisst unsere Identität sollte nicht von den Überlegungen und Strömungen dieser Welt ohne Gott geprägt werden. Gleichzeitig sind wir »in der Welt«. Dies ist unser göttlich verordneter Aufenthaltsort. Dazu kommt der Auftrag unseres Schöpfers und Erlösers: Wir sind »in diese Welt« hineingesandt. Wir dürfen etwas von seinen Vorzüglichkeiten widerspiegeln. Um meinem Auftrag nachzukommen, studierte ich nebenberuflich Theologie. Ich verstehe dies nicht als weltfremde Studierstuben-Disziplin, sondern als Anwendung von Gottes Wort in alle Lebensbereiche. So ringe ich täglich um angemessene Fragen und ehrliche Antworten. Diese Fragen stellen sich in meinen vier wichtigsten Bezügen »in dieser Welt«: Der Familie, der Gemeinde, dem Beruf und innerhalb des Staates. Eine Auswirkung meiner Forschungen ist die Umsetzung eines Intensiv-Familien-Lebensstils. Wir haben das Bildungsmanagement unserer Söhne selber an die Hand genommen, was in unserem Heimatland, der Schweiz, gesetzlich zugelassen ist. Unser Zuhause ist Dreh- und Angelpunkt unseres gemeinsamen Lernens. Die 50 Beiträge sind allesamt durch das Aufwerfen von Fragestellungen entstanden. Oftmals gab es einen aktuellen Anlass: Erlebnisse in der Familie und der christlichen Gemeinde, politische Ereignisse oder Berichte aus den Medien. Die Beiträge, die über mehrere Jahre entstanden sind, verfolgen das Ziel, eine biblische Sicht für das gesamte Leben (zurück) zu gewinnen. Lassen Sie sich durch das Lesen der einzelnen Beiträge zum Nachdenken und mutigen Handeln anregen. Ihr Hanniel Strebel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In der Welt, nicht von der Welt
Eine biblische Sicht für das gesamte Leben gewinnen
Christliche Weltsicht Band 3
Hanniel Strebel
Meinem Cousin Pascal.Danke für die Freundschaft.
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Hanniel Strebel
Cover: Eduard Rempel, Düren
ISBN: 978-3-95893-090-2
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Autorenvorstellung
Hanniel Strebel, 1975, verheiratet, Vater von fünf Söhnen, wohnhaft in Zürich. Betriebsökonom FH und Theologe (MTh / USA), arbeitet seit 14 Jahren in der Erwachsenenbildung. Er schloss sein Theologiestudium mit einer Arbeit über Home Education ab, die 2011 im Verlag für Kultur und Wissenschaft erschien. 2013 promovierte er an der Olivet University (PhD / USA) in Systematischer Theologie mit einer Studie über den niederländischen Denker Herman Bavinck und dessen »Theologie des Lernens«. Er bloggt täglich zu den Themen Bildung, Familie und Theologie unter www.hanniel.ch.
Inhalt
Autorenvorstellung
Vorwort
Familie und Erziehung
1. Kinderwunsch, Kleinfamilienideal und ein Plädoyer für mehr Kinder
2. 13 integrative Hinweise für frisch gebackene Eltern
3. Brief an einen frisch gebackenen Vater: Wie werden Jungs zu Männern?
4. Wenn wir nochmals frisch Eltern würden
5. Die dümmste Frage, die man der Mutter einer Großfamilie stellen kann
6. Ich muss meine Kinder nicht glücklich machen
7. Froh zu sein bedarf es weniger
8. Die Wahl der Qual
9. Willige Gefährten unserer eigenen Begehrlichkeiten
10. Wer den Spaß sammelt, wird davon nicht satt
11. Bedürfnisaufschub: Haupttrainingsfeld jeder Erziehung
12. Die Asymmetrie der Bedürfnisbefriedigung
13. Eingeübte Selbstverliebtheit
14. Wenn Heranwachsende ihre Zeit vergeuden
15. Gegen das Diktat der Mittelmäßigkeit
16. 103-mal Nein!
17. Papa, du bist der beste Bohrer der Welt
18. Ich bin auch ein Tierfreund
19. Ein Christus-freier Urlaub
20. Die Macht bewegter Bilder
21. Die Kinder vom Ferienhort
22. Was die Flüchtlingswelle mit unseren Kindern zu tun hat
23. Jahresrückblick: Buben in die Selbständigkeit begleiten
24. Meine Rolle als Vater von heranwachsenden Söhnen
Gesellschaft und Ethik
25. Ich darf mich nicht einmischen
26. Warum ich keine Gratiszeitungen lese
27. Höfliches Desinteresse
28. Weihnachten in der zivilreligiösen Gesellschaft
29. Gott ist auch Herr des Fußballs
30. Das Klärwerk und die Allmacht Gottes
31. Auf der Strasse für das Leben
32. Aus Paris: Von den Alltagssorgen einer vierköpfigen Familie
33. Nationalfeiertag: Zeit zum Danken
34. Stell dir vor, du öffnest morgen deine Türe für Flüchtlinge
35. Unsere Seele haben wir schon verloren
36. Die Rückkehr des antiken Arbeitsideals
37. Ein ganz normaler Seminartag: Zugehört, erlitten, vergessen
38. Ersatzgottesdienst
Gemeinde
39. Alle wollten nur ihre eigene Haut retten
40. Die 4Punkte: Die wichtigste Botschaft der Welt
41. Hilfe, meine Gemeinde ist funktional liberal!
42. Zwei Schamkulturen und der Mechanismus der Selbsterlösung
43. Wenn die Form den Inhalt determiniert
44. Ich sei ein Kopfmensch
45. Das Schreckgespenst des lieblosen Dogmatismus
46. Ein Plädoyer für Katechese
47. Die vier Fragen jeder Weltanschauung
48. Wie viele Bücher gehören in die Bibliothek eines Theologen?
49. Unsere Liturgie auf Zielsetzung und Gehalt überprüfen
50. Wenn Gottes Wort aus den Gottesdiensten verbannt wird
Unsere Empfehlungen
Vorwort
Mein Leben als Christ steht in einer dreifachen Spannung (siehe Johannes 17,14-17). Ich bin »nicht von der Welt«, das heisst meine Identität sollte nicht von den Überlegungen und Strömungen dieser Welt ohne Gott geprägt werden. Gleichzeitig bin ich »in der Welt«. Dies ist mein göttlich verordneter Aufenthaltsort. Dazu kommt der Auftrag meines Schöpfers und Erlösers: Ich bin »in diese Welt« hineingesandt. Ich darf etwas von seinen Vorzüglichkeiten widerspiegeln.
Um meinem Auftrag nachzukommen, studierte ich nebenberuflich Theologie. Ich verstehe dies nicht als weltfremde Studierstuben-Disziplin, sondern als Anwendung von Gottes Wort in alle Lebensbereiche. So ringe ich täglich um angemessene Fragen und ehrliche Antworten. Diese Fragen stellen sich in meinen vier wichtigsten Bezügen »in dieser Welt«: Der Familie, der Gemeinde, dem Beruf und innerhalb des Staates.
Eine Auswirkung meiner Forschungen ist die Umsetzung eines Intensiv-Familien-Lebensstils. Wir haben das Bildungsmanagement unserer Söhne selber an die Hand genommen, was in unserem Heimatland, der Schweiz, gesetzlich zugelassen ist. Unser Zuhause ist Dreh- und Angelpunkt unseres gemeinsamen Lernens. 2013 habe ich mit einer Studie über die Theologie des Lernens bei Herman Bavinck in Theologie promoviert.
Die 50 Beiträge sind allesamt durch das Aufwerfen von Fragestellungen entstanden. Oftmals gab es einen aktuellen Anlass: Erlebnisse in der Familie und der christlichen Gemeinde, politische Ereignisse oder Berichte aus den Medien. Die Beiträge, die zwischen 2013 und 2015 entstanden sind, verfolgen das Ziel, eine biblische Sicht für das gesamte Leben (zurück) zu gewinnen.
Lassen Sie sich durch das Lesen der einzelnen Beiträge zum Nachdenken und mutigen Handeln anregen.
Herzlich, Ihr
Hanniel Strebel
Familie und Erziehung
1. Kinderwunsch, Kleinfamilienideal und ein Plädoyer für mehr Kinder
Ergebnisse Familie und Generationen in der Schweiz
Die ersten Ergebnisse zur Erhebung »Familien und Generationen« (2013; 17‘000 Befragte) liegen vor. Das Bundesamt für Statistik überschrieb seine Medienmitteilung mit »Kinderwunsch bleibt hoch im Kurs« (BFS-Mitteilung). 9 von 10 Frauen wünschen sich ein Kind. Zwei Drittel wünschen sich zwei Kinder, ein knappes Drittel drei und mehr Kinder. Nur 6 Prozent der Frauen möchten kein Kind. Lediglich 3 Prozent wünschen sich ein Kind. Die Realität weicht davon ab: 30 % der Akademikerinnenbekommen kein Kind, bei der Gesamtbevölkerung sind es 20 %. 16 % haben ein Kind. Interessant sind auch die Ergebnisse zur Kinderbetreuung. Die Skepsis zur Berufstätigkeit von Müttern mit Kleinkindern nimmt ab; Männer sind skeptischer als Frauen eingestellt. Insgesamt nutzen in der Schweiz rund sieben von zehn Haushalten mit Kindern unter 13 Jahren ein familienergänzendes Kinderbetreuungsangebot. Die Mehrheit der Eltern greift auf unbezahlte Betreuung durch Verwandte – insbesondere Großeltern – oder Bekannte zurück.
Warum bleibt der Kinderwunsch so hoch?
In den Sozialwissenschaften gilt es als schick, Einstellungen und Werthaltungen mit der sozialen Konstruktion zu begründen. Das würde bedeuten, dass der Kinderwunsch eine momentane kollektive Konstruktion darstellt. Wer von einem persönlichen Schöpfer ausgeht, der nicht nur jedes Leben schafft, sondern sämtliche Bedingungen verantwortet und überdiesen wacht, geht von einer anderen Prämisse aus. Die Familie ist Gottes Plan, der Wunsch nach Fortpflanzung entspricht der göttlichen Schöpfungsordnung. Wenn Gott die Institution der Familie geschaffen hat, wird er auch über ihrer Erhaltung wachen. Natürlich sind die Bedingungen nicht mehr so, wie sie Gott ursprünglich geschaffen hatte. Sowohl Vorstellungwie Realität vom Familienleben sind durch die Sünde gekennzeichnet. Es gibt Streit, Entfremdung, Gewalt, Missbrauch. Es gibt Bemühungen, das von Gott vorgesehene Modell zu sabotieren.
Fünf Hypothesen, warum das Kleinfamilienideal anhält
Zur Zeit unserer Großeltern ging mit der höheren Geburtenzahl eine hohe Kindersterblichkeit einher. Dieses Argument lässt sich jedoch nicht auf die letzten Jahrzehnte anwenden. Die Geburtenrate ist kontinuierlich zurückgegangen und verharrt in Westeuropa bei knapp 1,5 Kindern. Ich stelle fünf Behauptungen auf, warum auf der Ebene der einzelnen Familie das Ideal der Kleinfamilie (ein bis zwei Kinder) favorisiert wird:
1. Jeder Mensch hat zwei Hände.
Zwei Kinder sind in unserer Vorstellung die Anzahl, die ein Mensch überblicken und »greifen« kann (ein Kind pro Hand). Dies wurde mir bewusst, als unser drittes Kind auf die Welt kam. Es fehlte über Monate eine Hand.
2. Ein Kind für einen Partner.
Ein ungeschriebene Regel scheint zu lauten: Ein Kind für einen Partner. Ein Kind sollte möglichst die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Elternteils erhalten.
3. Die Rollenumkehr lässt nicht mehr als zwei Kinder zu.
Das gelebte Erziehungsideal geht davon aus, dass sich ein Kind von klein auf selbst im Leben zurecht findet. Die Eltern stehen in der Pflicht, ihm eine angenehme und glückliche Kindheit zu bescheren. Das Kind bestimmt mit seinen Wünschen den Kurs der Familie.
4. Die Ansprüche den Lebensstil lassen nicht mehr als zwei Kinder zu.
Ein Familienauto, für jedes Kind ein eigenes Zimmer, zwei- bis dreimal Urlaub pro Jahr, regelmäßige Besuche in Freizeitpärken, außerschulische Förderungsmaßnahmen: Wer sich an einem solchen Lebensstandard ausrichtet, ist durch seine finanziellen Möglichkeiten (auch als Doppelverdiener) limitiert.
5. Die Unterbrechung des Lebens durch die Kinder darf nicht zu lange andauern.
Die Kinderpause muss möglichst kurz gehalten werden. Sonst wird der Anschluss an das (gesellschaftliche) Leben verpasst. Die Berufswelt verändert sich. Die bedingungslose Verwirklichung der eigenen Lebenspläne lassen eine zu lange »Warteschlaufe« nicht zu.
Fünf Gründe, warum Paare mehr als zwei Kinder haben sollen
1. Verbesserte Sozialisierung der Kinder
Sich streiten (ohne sich ständig ins eigene Zimmer und die eigene Welt zu verkriechen), Nähe aushalten, mit Verschmutzung und Unordnung umgehen lernen (und einen notwendigerweise einen eigenen Beitrag zur Beseitigung leisten), zurückstecken, teilen, mitleiden: Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Drei und mehr Kinder lernen in der Familie (fast) alles, was sie im späteren Leben benötigen.
2. Selbstkontrolle als Basis für das Bestehen als Erwachsener
Studien zeigen, dass Selbstkontrolle das A und O für späteren beruflichen und familiären Erfolg darstellt. Wer seine Wünsche ohne Verzögerung durchsetzen kann und kaum Hindernisse in Kauf musste, wird in der Tendenz lebensuntüchtig gemacht.
3. Erleichternder Verlust des Perfektionsideals
Kleinfamilien leiden unter perfektionistischen Ansprüchen. Dies kann verschiedene Lebensbereiche betreffen: Essen, Unterhaltung, Sauberkeit und Ordnung, Ruhe, Umsetzung von Wünschen. Größere Familien bringen in dieser Hinsicht Entkrampfung.
4. Verlassen der Komfortzone
Die Komfortzone besteht aus der Summe der eigenen Gewohnheiten. Wer mehr Kinder hat, muss sich viele Dinge neu überlegen. Das fängt beim Reisen an (Viererabteile), geht weiter bei der Freizeitplanung. Wer seine Komfortzone verlässt, eignet sich neue Fähigkeiten an und erweitert dadurch seinen Einflussbereich.
5. An morgen denken
Die gegenseitige Fürsorge innerhalb der Familie ist auch Generationen übergreifend zu berücksichtigen. Wer als Einzelkind Eltern oder Elternteile im Alter unterstützt, für den kann dies eine große Last werden. Es ist von Vorteil, diese Aufgabe auf mehrere Schultern zu verteilen. Zudem beobachte ich in Kleinfamilien immer wieder ungesunde Verbindungen zwischen Generationen, Überbehütende Eltern verhindern, dass ihre Kinder erwachsen werden (indem sie diese z. B. in finanzieller Abhängigkeit halten).
2. 13 integrative Hinweise für frisch gebackene Eltern
Nach über 10 Jahren Vaterschaft kann ich verraten, welche hilfreichen Hinweise mir für die Akzeptanz im Kollegenkreis schon nahe gelegt wurden. (Das ist kein Scherz.)
Reserviere vorgeburtlich einen Krippenplatz, um das Kind möglich schnell abgeben zu können. Es braucht professionell ausgebildete Betreuer, die sie ins Leben begleiten.
Decke dich mit allem Baby- und Kleinkind-Material ein, das du je bei Kolleg(innen) entdeckst hast. Mit einem Berg Accessoires bist du dabei. Bitte Marken beachten!
Auf jeden Fall anschaffen: Einen hellblauen oder rosaroten Gehörschutz, damit du mit der Babytasche weiterhin lauten Anlässen beiwohnen kannst.
Unbedingt in den ersten drei Lebensjahren eine Weltreise planen, sonst kannst du nicht mehr mitreden.
Belege mit dem Baby Frühschwimm-, Frühmusik-, Frühtanz-, Frühsprach- und sonstige Kurse.
Übertriff deinen Kollegenkreis mit einer aufwändigen, auf das Kind ausgerichteten Geburtstagsparty.
Decke deinen Nachwuchs möglichst ab erstem Jahr mit Elektrogeräten ein. Je früher, desto besser. Blinken und tuten erfreut das Kind.
Schicke dein Kind möglichst früh in Spielgruppen. Es muss sich verteidigen lernen; falls es zu den Scheuen gehört, soll es Schutz bei den Betreuungspersonen suchen und finden.
Kindsein muss Spaß machen: Schicke deinen Nachwuchs, sobald er trocken ist, ins Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Eishockeyspielen, in den Ballett-, Tanz- und Turnunterricht.
Im Urlaub sorge dafür, dass du die Kinder ausnahmsweise Animationseinrichtungen überlassen kannst.
Vergiss den regelmäßigen Warenhausbesuch nicht. Sorge für eine störungsfreie Bummelzeit und gib deine Kleinen in der wohligen Umgebung von Spielburgen ab.
Weil die Kinderzeit so schnell vergeht, reserviere dir alljährlich einen Termin beim Fotografen. Ansonsten nimm jede Vorführung (und mag sie noch so kümmerlich sein), auf Video oder zumindest mit dem Handy auf.
Lass dir regelmäßige Restaurant- und Kinobesuche nicht entgehen. Ohne sie verlierst du den Anschluss an das Tages- und Nachtgeschehen.
So. Jetzt weißt du’s.
P. S. Ich erlebe fast alle Peer-sozialisierten Kinder als Ja-Sager gegen außen(man passt sich der Kollektivmeinung an) und als Nein-Sager nach innen in der Kleinfamilie (man setzt seinen Willen durch). Ich denke aber, dass genau das Umgekehrte wichtig ist: Menschenfurcht zu überwinden in der Öffentlichkeit, Nein sagen und zu einer anderen Meinung stehen können; Unterordnung und Demut nach innen gegenüber den engsten Angehörigen.
3. Brief an einen frisch gebackenen Vater: Wie werden Jungs zu Männern?
Jonas Erne, frischgebackener Vater, stellt sich eine wichtige Frage:
Ich habe in letzter Zeit mehrere Männer gefragt, wann sie vom Jungen zum Mann geworden sind, und meist sehr unbefriedigende Antworten bekommen. Vermutlich wissen es tatsächlich die meisten von uns nicht. Weißt Du es? Wie ist es bei Dir geschehen? Ich freue mich auf Deine Gedanken dazu.
Hier sind einige Überlegungen.
Lieber Jonas, Dein Sohn kann sich glücklich schätzen, dass Gott ihm einen solchen Vater zugewiesen hat! Gleichermaßen ist es außergewöhnlich, dass du schon in den ersten Wochen über den Moment hinausdenkst und die lange Frist ins Blickfeld nimmst. Ich kann mich gut erinnern, wie ich vor 12 Jahren ganz ähnliche Fragen wälzte. Die Fragen haben sich inzwischen nicht aufgelöst, sondern sind im Gegenteil noch zahlreicher geworden.
Ich meine zunächst, dass in den drei von dir genannten Aspekten eine Teilantwort steckt.
Dass du bei der
Christusähnlichkeit
beginnst, kann ich nur doppelt unterstreichen. In dem Maß, wie ich Christus ähnlicher werde, wird für unsere Söhne Mannsein real. Einen Punkt stelle ich besonders heraus: Vertieftes Sündenbewusstsein. Im Lauf der Jahre kommen bei mir immer mehr Schattenseiten meines Charakters zum Vorschein. Es heißt zu ihnen zu stehen, sie zu benennen und Sünden zu bekennen. Zum Teil sind es generationsübergreifende Muster, die erst über die Jahre ins Blickfeld kommen. Könnte es sein, dass gerade hier sich Männlichkeit zeigt:
Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit
?
Ebenfalls unterstreiche ich die Notwendigkeit, andere
Männervorbilder
zu suchen. Ich halte ständig Ausschau und trete wo immer möglich mit ihnen in Kontakt. Dazu gehört die Gewohnheit, unterwegs Männer zu interviewen, die ihren Beruf mit Leidenschaft tun. Das mögen Bauern, Müllmänner, Klempner, Polizisten, Zugfahrer, Ingenieure, Pastoren oder Lehrer sein. Männer, die ihren
Beruf mit Freude ausüben
, sind für meine Jungs anziehend. Sie widerspiegeln also Männlichkeit.
Der
Übergangsritus
ist ebenfalls Teil meiner Überlegungen. Ich peile einen großen Übergang mit 13 Jahren an. Dann beginnt ein Junge, ins Erwachsenenalter einzutreten. Doch es gibt
viele kleine Übergänge
. Ich kann mich gut erinnern, wie mein Ältester mit acht Monaten immer zu den CDs robbte, was ich untersagt hatte. Er blickte zurück, um dann möglichst schnell dorthin zu gelangen. Ich nahm ihn zu mir und hielt ihn fest. Dadurch gab ich ihm zu verstehen, dass ich in diesem Punkt fest bleibe. Weitere Übergänge sind das Trockenwerden oder später das Lesen (ich kaufe jedem Sohn seine erste eigene Bibel). Zudem bietet auch der Jahresablauf mit wiederkehrenden Ereignissen natürliche Aufhänger um Fortschritt festzustellen und sich darüber zu freuen.
Ich füge drei weitere Aspekte hinzu, die es aus gesellschaftlicher Sicht erschweren, dass Buben zu Männern werden.
Ich betrachte die Kindheit als eine schöne, besondere Phase des menschlichen Lebens. Ich habe jedoch Mühe damit, das Kind sein zu vergöttern. Damit einher geht eine Unterforderung der Kinder. Man klatscht überall Beifall, auch dann, wenn es nichts zu klatschen gibt. Klar kann man Kinder überfordern. Man kann sie durch Überbehütung ebenso entmündigen. Wie oft war ich erstaunt, dass mein Bub gewisse Dinge schon verstand oder auch bewerkstelligen konnte, von denen ich dachte, es sei noch zu früh! Trauen wir unseren Söhnen etwas zu?
Einige Väter betonen die Körperlichkeit der Söhne. Das ist sehr wichtig. Sich zu bewegen und Unangenehmes ertragen zu lernen gehört zur Männlichkeit. (Das kann gerade im leibfeindlichen Zeitalter der sozialen Medien nicht genug betont werden.) Genauso gehört jedoch auch die geistige bzw. geistliche Fitness dazu. Hier wird das Eis oft dünn. Wie kann ich meinen Sohn auch auf dieser Ebene stärken?
Soziologen haben wiederholt auf das Phänomen der verzögerten Adoleszenz aufmerksam gemacht. Kinderpsychiater wie z. B. Wolfgang Bergmann führen das wesentlich auf die Überbehütung durch die Mutter zurück. In der Kleinfamilie nimmt die Mutter den Söhnen im Alltag zu vieles ab, was ihnen später an der Lebenstüchtigkeit abgeht. Es empfiehlt sich, dass Buben möglichst schnell für sich selbst und für einen Teil des Haushaltes die Verantwortung übernehmen müssen. Einige Beispiele: Das eigene Zimmer in Ordnung zu halten, ist Selbstsorge; regelmäßig das Badezimmer zu reinigen, ist Sorge für die Familie. Für einen Besuch den Tisch zu decken ist das eine, doch in die Gastgeberrolle zu wachsen, etwas anderes. Ein Buch zu lesen ist Basisfertigkeit; ein Theaterstück zu schreiben und mit anderen einzustudieren, verlangt ganz andere Fähigkeiten ab. Ein Fahrrad mit einer Preisobergrenze selbst zu suchen ist das eine, es zu unterhalten eine Erweiterung dieser Fähigkeit.
Du fragst, wie ich selber zum Mann geworden bin. Also:
Ich habe früh eine Leidenschaft fürs Lesen der Bibel entwickelt. Dazu baute ich schon als Kind eine kleine Bibliothek auf. Ich begann, Notizen anzufertigen. Später übernahm ich Aufgaben in Sonntagschule und Männerbibelkreis. Ich konnte also eigenständig ein Gebiet aufbauen.