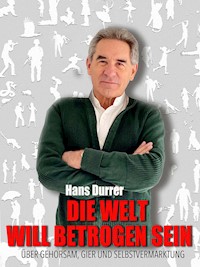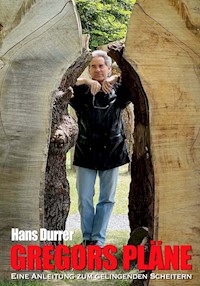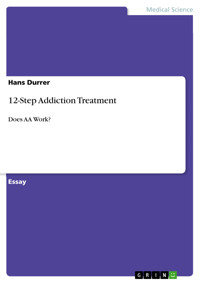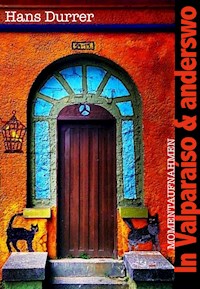
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Fremder in einem fremden Land hat man das Privileg, sich daneben zu benehmen, aus dem Rahmen zu fallen, Dinge zu wagen, die man sich zuhause niemals trauen würde. Auch nimmt man in der Fremde Sachen wahr, die einem in vertrauter Umgebung selten auffallen. Und lernt dabei wieder zu staunen – über eine Autofahrt in der dünnen bolivianischen Luft, die sich anfühlte, als sitze man auf einer Wolke; über eine Kleinstadt in der südkalifornischen Wüste, von der die Bewohner sagen, das sei nicht das Ende der Welt, doch von hier aus könne man es sehen; über die Stille in Westfinnland, die nicht alle ertragen. Von einem begabten Schnorrer in London ist die Rede, von pünktlichen Italienern in Amsterdam, von in der Mittagshitze zerplatzenden Coca Cola Flaschen im brasilianischen Maceío wie auch von der Lebensweisheit einer Thailänderin, die einem deutschen Ehepaar in Phuket erklärte: 'When men finish love, they go". Davon und noch von vielem Anderen – von Charakterfragen über die allmähliche Zerstörung des Vertrauens bis zu der eigenartigen Tatsache, dass der Mensch die Wahrheit nicht erträgt und sich deshalb ständig selbst belügt – handeln diese Kolumnen, die Alltägliches zum Anlass nehmen, um über Grundsätzliches nachzudenken. Über Meinungsäusserungsfreiheit und Selbstzensur, Radikalisierungen und Integrationsgeschwafel sowie über Geneviève aus Lausanne, die für ein Wochenende nach Paris fuhr, um dort ihrem ultimativen Luxus zu fröhnen: Im Hotelzimmer Bücher zu lesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Durrer
In Valparaíso und anderswo
Momentaufnahmen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Als Fremder in einem fremden Land
Thailand und die Thais
Tuk Tuks, Taxis & Boutique Resort Hotels
In Phuket Town
In Chiang Mai
In London
Amsterdam Schiphol
Im Westen Finnlands
Glück im Unglück in Maceío
In Mendoza oder So was Ähnliches wie Lederhosen
In San Juan
In und um La Paz
In Barranquilla
Momente in Valparaíso
In 29 Palms
Anderswo ist es immer anders
Egypt-Air-Flug 990 & The Falling Man
Als Illegaler auf dem Weg nach Europa
Integrationsgeschwafel
Radikalisierungen
Was der Mensch nicht alles glaubt …
Bruder Klaus
Feige, nicht weise
Woran wir uns erinnern sollten
Die allmähliche Zerstörung des Vertrauens
Buchvernissage
Das grosse Welttheater
Die sogenannten Nebensächlichkeiten
Über den Charakter
Mundus vult decipi
Worüber ich mich zunehmend wundere …
Bis das Handy alleine zum Wandern aufbricht
Genug
Der Aufbruch
Impressum neobooks
Als Fremder in einem fremden Land
Als Fremder in einem fremden Land hat man das Privileg, sich daneben zu benehmen, aus dem Rahmen zu fallen, Dinge zu wagen, die man sich zuhause niemals trauen würde. All das wird einem nachgesehen. Weil man nicht zählt. Jedenfalls nicht richtig. Als Mensch. Als wandelnder Geldbeutel schon. Wer länger (viele Jahre also) in einem fremden Land (die USA, wo fast alle eingewandert sind, ist da wohl eine Ausnahme) lebt, bringt es im besten Fall zum Status eines Eingeheirateten. Und dass ein solcher (Frauen sind mitgemeint) nichts zu sagen hat, nie richtig Ernst genommen wird, das weiss ja nun wirklich jeder.
Als ich im Jahre 2002 an einer privaten chinesischen Universität Englisch unterrichtete, gab es da Minibusse, die zwischen der Universität und der knapp eine Stunde entfernten Stadt verkehrten. Die Buschauffeure fuhren derart halsbrecherisch, dass ich jeweils um mein Leben fürchtete. Ich fragte die Studenten, ob sie denn bei diesen Busfahrten keine Angst hätten? Doch, doch, alle hatten sie Angst, doch da könne man eben nichts machen …
Ich schon, ich bin Ausländer. Ich lasse mir auf ein Blatt Papier auf Chinesisch schreiben „Bitte langsam fahren“ und halte den Zettel dem Busfahrer beim nächsten Mal vor die Nase. Dieser grinst, nickt und siehe da, die Fahrt geht in ganz zivilisiertem Tempo vonstatten. Bei der Rückfahrt mache ich es genauso. Und siehe da, auch dieser Fahrer fährt (mir zuliebe, wie ich mir vorstelle) mit mässigem Tempo (das geht gar nicht anders in der Stadt). Doch kaum ist er aus der Stadt raus, drückt er wie gewohnt aufs Gaspedal. Ich sitze zuhinterst im Bus und brülle sehr laut auf Englisch „Hey, spinnst Du eigentlich?“ Alle Fahrgäste drehen sich um und fragen sich wohl, was für ein Heini da solchen Lärm macht. Ich hätte auch auf Schweizerdeutsch brüllen können, meine Worte verstand eh keiner, meine Botschaft hingegen schon, jedenfalls der Fahrer. Ab da verlief die Fahrt wieder gemächlicher. Als ich an meinem Zielort aussteige, lacht der Fahrer und schüttelt mir die Hand.
In China ist man als Ausländer ein Exot. Schon weil man nicht chinesisch ausschaut. Noch exotischer ist der Ausländer, der Chinesisch spricht (um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: ich gehöre nicht dazu). Da freuen sich die Chinesen drüber, aber sie wundern sich auch und einige sind misstrauisch, fragen sich, ob man vielleicht ein Spion sein könnte. Übrigens: einige des Chinesischen mächtige Westler sind christliche Missionare (und christliches Missionieren ist in China verboten) und manchmal auch Spione. Am exotischsten aber ist der Chinese, der kein (oder nur wenig) Chinesisch kann. Chris zum Beispiel ist als Kind chinesischer Eltern in Kanada aufgewachsen, spricht nur gerade ein paar Brocken Chinesisch und wird deshalb von den Chinesen mit grosser Reserviertheit behandelt: Was bildet der sich eigentlich ein? Glaubt der eigentlich, er sei was Besseres?
Als ausländischer Lehrer kann ich mir Fragen erlauben, die sich ein chinesischer (oder mit China gut vertrauter) Lehrer wohl kaum trauen würde. Und ich tue es auch: Wie es komme, dass sie die gelbe Rasse genannt werden? – ich sähe hier nämlich niemanden mit gelber Hautfarbe. Sicher, einige hätten dunklere, andere hellere Haut. Aber gelb? Niemand will sich äussern, einige grinsen, andere tuscheln. Ich hätte gehört, in China würden Hunde gegessen – wer von Ihnen hat schon einmal Hund gegessen? Einer. Ihm ist schlecht geworden. Ich könne vom Aussehen her nicht zwischen einem Koreaner und einem Chinesen unterscheiden – ob sie es könnten? Sie können es, zu meinem nicht geringen Erstaunen, offenbar auch nicht.
Auch wenn man sich in fremden Ländern mehr Freiheiten zugesteht als in heimischen Gefilden, überreizen sollte man die Dinge nicht.
Einmal bin ich von einem Studenten (dem Klassensprecher, also einem linientreuen Kommunisten) zum Essen eingeladen worden. Ich werde mein Essen selber bezahlen, und er seines, habe ich gleich zu Beginn klar gestellt. Der Student hat etwas gezwungen gegrinst, doch akzeptiert.Das ist nicht sehr höflich? Ja, stimmt. Wieso hab ich es also gemacht? An dieser Schule war es gang und gäbe, dass Studenten ihre Lehrer einluden, sei es zum Essen, sei es zu einem Besuch bei den Eltern. Das wurde gemacht, um sich die Lehrer gewogen zu machen. Nahm der Lehrer die Einladung an, so stand er künftig in der Schuld des Studenten (das chinesische System basiert darauf, sich einander gegenseitig zu verpflichten) und von ihm wurde erwartet, dass er den Schüler beim Examen nicht durchfallen lassen würde. Ich selber bin mal ganz offen gefragt worden, was ein bestandenes Examen koste.
Während des Essens spuckte der Student Knochenstückchen, die er ja, zugegeben, schlecht hinunter schlucken konnte, neben sich auf den Teller. Ich fand das grauenhaft. Doch was tun? Es ihm, da das hier offenbar gängiges Benehmen war, nachmachen? Ging nicht, auch weil ich keine einschlägige Übung hatte und womöglich was weiss ich wohin spuckte. Doch ich wollte auch nicht. Was ich auch nicht wollte: Ihm zuzuschauen, wie er (zugegeben, gekonnt) neben den Teller spuckte. Und so guckte ich halt einfach weg. Und manchmal – angewidert und fasziniert zugleich – auch wieder hin.
Thailand und die Thais
Die Thais hatten etwas, was ich nicht hatte – zumindest in meiner Vorstellung.
Mir schien, sie akzeptierten das Leben wie es war. Gelassen und ohne Aufhebens taten sie, was zu tun war. Natürlich: Ich wollte sie auch so.
Dass nicht wenige das mit der Hilfe von Beruhigungsmitteln tun, erfuhr ich erst Jahre später von einem Freund, der in Asien in der Pharma-Branche tätig ist.
Dazu kam: sie waren höflich, freundlich, nett und lächelten viel. Das ist angenehm – ob es nun, wie nicht wenige Westler wähnen, aufgesetzt und scheinheilig ist. Als wir in unserem Thai-Kurs gefragt wurden, was uns an Thailand gefalle, waren wir uns (von Japan bis zur Schweiz) alle einig: Die Thais. Und das Essen.
In der Schweiz hört man von Fremden auf diese Frage jeweils: Die Landschaft.
Hauptsache, es sieht gut aus, denn es ist der Schein, worum es geht. Dahinter ist nichts weiter, denn die Dinge sind, wie sie scheinen und wie sie scheinen, so sind sie. Deswegen konstatieren die Thais auch immer das Offensichtliche. Mache ich einen Thai auf einen wunderschönen Vogel aufmerksam, guckt der hin und sagt: Vogel.
Mich hat diese Sicht der Dinge, die mir, der ich dauernd nach Bedeutungsvollem suche, so recht eigentlich fremder nicht hätte sein können, fasziniert und befreit. „The Buddhist materialist analysis of phenomena is … not meant to attack the surface of things, but to destroy their depth“, schreibt Mont Redmond in seinem Wondering into Thai Culture. Die Dinge, auf der spirituellen Ebene, waren einfach und banal und offensichtlich. A rose is a rose is a rose. Nimmt man sich fürs Betrachten der Rose die nötige Musse, begreift man, dass die Rose auch gar nicht mehr zu sein braucht.
Mein Freund Sukit ist Arzt in Trang, einer Stadt im Süden des Landes. Eines Abends fragt er, ob ich zu einer Totenwache mitkommen wolle. Ich wisse nicht, ob ich als Fremder dahin gehöre, wehre ich ab. Aber es ist der Vater meines Schwagers, und den kennst du. Ich gehe mit.
Bei der Aufbahrungshalle angekommen, stellt Sukit mich den Anwesenden vor. Die meisten sind beim Essen – in Thailand begrüsst man sich nicht mit „Hallo, wie geht’s?“ sondern mit „Hast du schon gegessen?“ Einer, der sich als der Sarghersteller entpuppt und schon ziemlich betrunken ist, will unbedingt den Sarg aufmachen, um mir sein Werk auch von innen zu zeigen, und kann nur schwer davon abgebracht werden.
Als wir die Halle verlassen, bemerke ich vor der Tür ein grosses Schild auf dem der Name und das Alter des Verstorbenen angegeben ist. Achtzig ist er geworden. Ein hohes Alter, bemerke ich. Na ja, sagt Sukit, eigentlich ist er ja achtundsiebzig gewesen, doch es hätte ihm sicher gefallen, wenn er achtzig geworden wäre.
Sind die Thais wirklich anders als Schweizer? Genauer: Sind die Thais, die ich gesehen, getroffen und beobachtet, mit denen ich geredet, gegessen und getrunken habe, wirklich so viel anders als ich, der Schweizer?
Selbstverständlich – schliesslich sehen sie anders aus, sind sie in einer anderen Landschaft, in einem andern Klima herangewachsen. „Was macht ihr am liebsten?“ wurden thailändische Studenten gefragt. Sich hinlegen, Musik hören, essen – lauteten die Antworten, in dieser Reihenfolge. Und überhaupt: Wären sie nicht anders, hätte ich ja gleich in der Schweiz bleiben können.
Als The Nation einmal Thailänderinnen, die mit Amerikanern verheiratet waren, fragte, was sie denn ihren thailändischen Schwestern, die sich mit der Absicht trügen, einen Ami zu heiraten, mit auf den Weg geben würden: Den Amis sei wichtiger, so die Antwort, „to get the job done than to look good at work.“
Tuk Tuks, Taxis & Boutique Resort Hotels
Kabin Buri, 30 Grad Celsius, meine Tuk Tuk Fahrerin ist um die fünfzig, trägt einen Wintermantel sowie eine Fellmütze, hat keine Ahnung, wo mein Hotel ist, macht sich kundig und verfährt sich dann total … Schlussendlich landen wir irgendwo auf der grünen Wiese, wo zwei einsame neue Häuser stehen und wo ich sicher bin, das kann es nicht sein … doch natürlich liege ich falsch, denn genau das habe ich gebucht …
De donde eres? fragt der Thai, Mitte fünfzig, als ich beim Fruchtverkäufer vor dem 7-Eleven auf meine Ananas warte. Das ist eine Premiere, noch nie zuvor bin ich in Thailand auf Spanisch angesprochen worden. Gelernt habe er es vor zwanzig Jahren, im Irak, als er dort zwei Jahre für eine spanische Firma im Einsatz gewesen sei. Heute, er zeigt mir seinen Ausweis, arbeite er für Thai International. Ich bezahle meine Ananas und wir verabschieden uns voneinander. Wie sagte doch mein Freund Holger vor vielen Jahren: An Ansprache mangelt es wahrlich nicht in Thailand!
Lat Krabang, Bahnhof. Dem Taxifahrer ist das Hotel, in dem ich ein Zimmer gebucht habe, gänzlich unbekannt. Also zeigte ich ihm den Papierausdruck meiner Reservierung mit der Adresse. Er tut so, als ob er verstanden hätte, wirkt aber nicht so, doch er gibt schon mal Vollgas. Nach ungefähr zehn (und gefühlten zwanzig) Minuten verlangsamt er und schaut nun in alle möglichen Richtungen. Schliesslich reicht er mir sein Handy. Er will, dass ich den Namen des Hotels in die Such-Funktion eingebe. Ich tue wie mir gesagt, seine Miene hellt sich auf und er drückt erneut aufs Gas – das Hotel befindet sich gerade mal ein paar wenige Meter vom Bahnhof.
Heutzutage genügt es nicht, als Hotel zu firmieren. In Thailand, zum Beispiel, heisst mittlerweile jedes zweite Boutique Hotel oder Resort. Mein gerade aktuelles – ein einfaches, sauberes, gewöhnliches Gebäude, das seinem Zweck (meine Unterbringung) bestens gerecht wird, nennt sich Boutique Resort Hotel. Wer nun annimmt, „Resort“ sei ein Hinweis auf einen ruhigen Ort, täuscht sich. Als ganz unvermutet ein ohrenbetäubender Lärm mein Zimmer erfüllt, denke ich automatisch, ein Flugzeug habe den nahen Flughafen vepasst und steuere jetzt geradewegs auf mein Boutique Resort Hotel zu … doch es war nur ein Zug, der durch mein Zimmer donnerte (die Eisenbahnschienen lagen direkt hinter dem Hotel) …
Mein rechtes Auge ist entzündet. Ich frage die Bedienung im Hotel Restaurant in Chachoengsao, ob sie mir bitte einen Schwarztee bringen könne – ich will mir den im heissen Wasser aufgeweichten Teebeutel aufs entzündete Auge drücken. Am nächsten Morgen erkundigt sich die Bedienung nach meinem Befinden. Besser, sage ich, und deute auf mein Auge. Sie examiniert es, lächelt und bringt mir – als ich mit dem Frühstück fertig bin – zwei aufgeweichte Teebeutel …
Welche Fluggesellschaft?, fragt der Fahrer des Airport Shuttle Bus. Cathay Pacific, antworte ich, worauf er da anhält, wo er sowieso hat anhalten wollen …