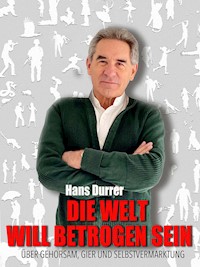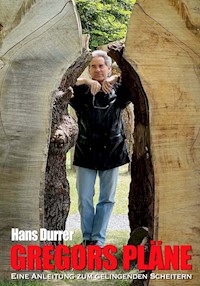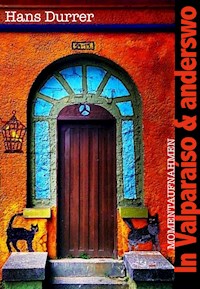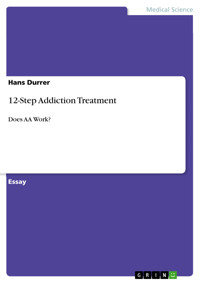Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wir leben in süchtigen Zeiten, halten es für normal, dass wir von allem und jedem immer mehr wollen und dass nichts genügt. Mehr-Mehr-Mehr ist uns selbstverständlich, den Hals nicht vollzukriegen sowieso, Gier als Leitprinzip unserer auf Wachstum fixierten Gesellschaft so recht eigentlich unabdingbar. Für die, welche mit dem herrschenden Konsumwahnsinn nicht klarkommen und sich in Süchte und andere seelische Krankheiten retten, stellt die Gesellschaft Hilfsangebote zur Verfügung – vom Psychiater über die Psychologin zum Sozialarbeiter – , die diese aus dem System Gefallenen wieder funktionstüchtig machen sollen. Bei denen, die das wollen und an die von den Krankenkassen finanzierten Hilfen glauben, besteht durchaus die Möglichkeit, dass dies gelingen kann. Denn es ist vor allem der Glaube, auf den es ankommt. Denjenigen hingegen, die weder an staatlich diplomierte Seelenhelfer glauben, noch zu einem gut funktionierenden Rädchen im kapitalistisch-kannibalistischen Raubtierkapitalismus werden wollen, hat die Gesellschaft wenig anzubieten. An diese wendet sich dieses Buch. "Wie geht das eigentlich, das Leben?" erzählt Geschichten, nicht nur von der Sucht, sondern vor allem davon, wie destruktiv angelegte Menschen lebensbejahend auf und in der Welt sein können. Ganz unterschiedliche Frauen und Männer kommen zu Wort und zu sehr verschiedenen Themen, einzig die Richtung ist vorgegeben: Das Ziel ist, bei sich zu sein, Meister seiner selbst zu werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Durrer
Wie geht das eigentlich, das Leben?
Anregungen zur Selbst- und Welterkundung
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Zum Geleit
Vom Nicht-Wahrhaben-Wollen
Ob Therapien nützen, lässt sich nicht beweisen
Brücken bauen
Diplomierte Experten für die Seele?
Ohne Business-Plan
Gier ist gut: Die kapitalistische-kannibalistische Weltordnung
Ein Ego-Problem
Die Angst vor dem Leben
Suchtverlagerung
Eine Sucht, die meinen Horizont erweitert
Von Plänen und 'falschen Hoffnungen'
Akzeptanz als Schlüssel
Eine neue Brille
Counselling in der Praxis
Selber denken
Schreiben als Therapie
Eine Frage der Haltung
Was seelisch Leidende verbindet
Schlusswort
Literaturverzeichnis
Impressum neobooks
Zum Geleit
Der Siebzigjährige sehnte den Augenblick herbei,
da er leben könne, wie es ihm behagte.
Honoré de Balzac: Verlorene Illusionen
Die hier vorliegenden Aufzeichnungen richten sich an diejenigen, deren Angst vor dem Leben und dem Tod so gross ist, dass sie sich in betäubende Süchte retten. Und die „so sick and tired of being so sick and tired“ sind, dass sie wirklich etwas ändern und ihrem Dasein eine neue Richtung geben wollen, jedoch mit den von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Hilfsangeboten – Psychiatern, Psychologen, Sozialarbeitern (weiblich wie männlich) – wenig bis gar nichts anfangen können. Menschen also, die ähnlich ticken wie ich.
Ich schreibe hier von Dingen, die ich kenne, die ich erfahren und erlebt, durch die ich hindurch bin, die ich erlitten habe. Und die mir geholfen haben.
Sucht und andere psychische Störungen sind im Grunde nichts anderes als destruktive Antworten auf die Frage: Wie geht das eigentlich, das Leben? Dass Lebensverweigerung keine angemessene Antwort ist, das weiss ich. Und das weiss auch jeder Süchtige.
Um möglichen Missverständnissen gleich vorzubeugen: Das ist kein Buch über Sucht, das ist auch kein Buch über psychische Störungen, denn süchtig und krank sind wir so recht eigentlich alle, nur nicht im selben Ausmass. Und das meint: Hilfe brauchen wir alle. Treffend hat es der Psychiater Mark Vonnegut, der als Jugendlicher mit Schizophrenie diagnostiziert worden war, in einem Brief an seinen Vater, den Schriftsteller Kurt Vonnegut, das war 1985, auf den Punkt gebracht: „We are here to help each other get through this thing, whatever it is.“
Viele Süchte und andere seelische Leiden erledigen sich von selbst, denn das Grundprinzip allen Lebens ist das Streben nach Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts. Geist und Seele werden ihr Gleichgewicht finden, wenn sich unser Ego ihnen nicht in den Weg stellt.
In Sachen Therapie meint das: der Süchtige steht sich meist selbst im Wege. Und er hat Mühe, sich helfen zu lassen. Gegen diesen Widerstand, sich helfen zu lassen, hat ein Therapeut ohne eigene Suchterfahrung kaum eine Chance, da viele Süchtige Nicht-Süchtige als Helfer ablehnen, denn, so sagen sie, die wissen ja eh nicht, wovon sie reden. Ob diese Süchtigen damit recht haben oder nicht, spielt keine Rolle, es reicht, dass sie es glauben. Denn was sie glauben, bestimmt ihr Tun. Und auch ihr Nicht-Tun.
Das ist ein Buch darüber, dass Therapien oft eher Teil des Problems, als Teil der Lösung sind. Das heisst nicht, dass Therapien nichts nützen. Einerseits bringen sie den Therapeuten Arbeit und Verdienst und machen die Pharmaindustrie reich, andrerseits stabilisieren sie die Gesellschaft, indem sie es gelegentlich schaffen, Patienten wieder funktionstüchtig zu machen und dazu sehen, dass die, bei denen das nicht gelingt, in speziellen Einrichtungen betreut werden.
Wer in einem System, das der seelischen Gesundheit wenig zuträglich ist, nicht funktioniert, ist möglicherweise gesünder, als jemand, der darin floriert. Das meint nicht, dass die Insassen psychiatrischer Kliniken alle gesund sind, das meint, dass es mehr als eigenartig ist, diejenigen als gesund gelten zu lassen, die mithelfen, ein System aufrechtzuerhalten, das viele krank macht. „Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein“, schreibt Flore Vasseur in „Kriminelle Bande“. Und:„Absurder könnte es nicht sein: Die Zukunft ganzer Länder wird Leuten anvertraut, die auf den Begriff des Gemeinwohls am allergischsten reagieren.“
***
Nicht die Droge, der Mensch ist das Problem. Der Mensch, der nicht mit sich selber und seiner Umwelt, also mit der Natur und seinen Mitmenschen, verbunden ist. Um eine solche Verbindung erleben zu können, muss er die Erfahrung machen, dass er nicht alleine auf der Welt ist, dass er nicht der einzige ist, der leidet, dass es auch für sogenannt hoffnungslose Fälle Hoffnung und die Möglichkeit zur Veränderung gibt.
Es sei eine ganz alte Vorstellung, dass Geschichten Leben retten können, habe ich den Krimiautor Friedrich Ani in einer Fernsehsendung sagen hören. Und genau davon handelt dieses Buch: von Geschichten, die mir durchs Leben geholfen haben. Da ich mich nicht (mehr) für eine Ausnahme halte, kann es gut sein, dass einige dieser Geschichten auch anderen helfen können. Um es mit Joan Didion zu sagen: „Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben.“
Im Alter von 17 las ich einige Bücher über Zen-Buddhismus. Daisetz Teitaro Suzukis „Die grosse Befreiung“, Eugen Herrigels „Zen und die Kunst des Bogenschiessens“, „Zen-Buddhismus und Psychoanalyse“ von Fromm, Suzuki und de Martino. Später dann die Bücher von Alan Watts und andere mehr; über Janwillem van de Weterings eineinhalb Jahre in einem Zen-Kloster in Kioto habe ich, als ich noch glaubte, Ethnologie zu studieren sei spannender als sich mit juristischen Fragen zu plagen, eine Seminararbeit geschrieben.
Inwiefern diese Lektüre ganz einfach Ausdruck pubertären Suchens war, geprägt vom Zeitgeist, vermag ich nicht zu sagen, doch Zen-Buddhistisches hat mich mein ganzes Leben begleitet. Als ich letzthin auf Bernard Glassmans „Anweisungen für den Koch. Lebensentwurf eines Zen-Meisters“ stiess, glaubte ich zu spüren, dass mir diese Gedanken wohl immer deswegen zu-fallen konnten, weil ich offen für sie war.
Wenn ich mich im Nachfolgenden gelegentlich auf Zen beziehe, aus der Weltliteratur, Krimis oder aus psychologischen und philosophischen Werken zitiere, tue ich das nach Lust und Laune und ohne Rücksicht auf Lehrmeinungen in den jeweiligen Gebieten. Dass ich dabei ausgiebig andere Autoren anführe, ist vorwiegend meiner Suchtpersönlichkeit und speziell meiner Büchersucht geschuldet, soll aber auch offenlegen, woher ich meine Ideen habe.
Ich zitiere, wie es mir gefällt. Zusammenhänge, die andere mir vorgeben, respektiere ich oft nicht, und manchmal doch. Ich ziehe es vor, mir meine eigenen zu schaffen. So wie es mir gerade passt. Bestärkt hat mich dabei Antonio Machados „No hay camino, se hace camino al andar“ („Es gibt keinen Weg. Der Weg entsteht beim Gehen.“)
Natürlich ist dies auch ein Buch über den Weg, den ich gegangen bin und gehe. Er ist alles andere als gradlinig und voller Widersprüche. Mein Denken ebenso. Und mein Fühlen sowieso. Genau wie das richtige Leben. Was den nachfolgenden Aufzeichnungen zugrunde liegt, so bilde ich mir ein, ist das ernsthafte Bemühen um Aufrichtigkeit. Das meint nicht etwa schrankenlose Offenheit, das meint vielmehr, dass ich hier die Version meiner Lebenseinsichten vorlege, mit der ich selber am besten leben kann.
Sich auf die Realität, auf das Hier und Jetzt, einzulassen, nur darum geht es. „Warte nicht, bis du erleuchtet bist“, postuliert Zen-Meister Glassman. Denn „the present is a present“.
Vom Nicht-Wahrhaben-Wollen
Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig
zu hoffen, dass sich etwas ändert
Albert Einstein
Die fünfundvierzigjährige Frau hatte einen Nervenzusammenbruch gehabt, war auf der Intensivstation einer Klinik gelandet, wollte jetzt kürzer treten und, wie sie mir sagte, ihr stressiges Leben ändern. Ob sie sicher sei?, fragte ich. Ja, ganz sicher. Was sie dieses Wochenende geplant habe? Da komme eine Freundin aus Paris. Ob es nicht besser wäre, sich Zeit für sich zu nehmen anstatt sich ständig mit Leuten zu umgeben? Ich verstünde nicht, sagte sie, dieser Besuch bedeute keinen Stress, im Gegenteil, er werde ihr gut tun.
Ich machte noch weitere Vorschläge, die alle darauf abzielten, weniger unter Leuten und mehr für sich zu sein – sie lehnte alle ab. Ihre Gründe waren nachvollziehbar und einleuchtend, nur lief ihr Argumentieren darauf hinaus, dass sie nichts, aber wirklich gar nichts ändern konnte. Doch hatte sie nicht gesagt, sie wolle was ändern?
Wenn Menschen sagen, sie wollten und brauchten eine Veränderung, ja, sie sehnten sich geradezu danach, meinen sie damit meist nicht, dass sie sich ändern wollen, sondern dass sich die Umstände ändern sollen. Der Job, der Chef, die Freunde, eigentlich alles, nur nicht sie selber.
Niemand ändert sich freiwillig, denn das würde bedeuten, ein anderer Mensch zu werden. Und niemand will ein anderer Mensch werden, es sei denn, er muss.
***
Dass ich jahrelang nicht wahrhaben wollte, dass ich ein Alkoholproblem hatte, ist mir besonders deutlich aufgegangen, als ich in alten Tagebüchern las. Ich litt, weil ich so sensibel war, weil ich so speziell war, weil mich niemand verstand, weil ich meine Bestimmung noch nicht gefunden hatte.
Um Hilfe bitten, kam nicht in Frage. Das tun nur Schwächlinge. Der Einzige, der sein Leiden lindern konnte, war ich selber. Ob ich das damals wirklich so geglaubt habe, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen – das Gedächtnis ist bekanntlich kreativ und selektiv. Für meine Weigerung mir helfen zu lassen habe ich keine bessere Erklärung.
Meine Suche führte mich zu Philosophischem, Psychologischem, Ethnologischem, Soziologischem, zu fast allem, was zwischen zwei Buchdeckel passte – nur Mainstream durfte es nicht sein. Wurde etwas an der Uni gelehrt, konnte man es vergessen. Meine damaligen „Helden“ schätze ich auch heute noch (soviel zu meiner persönlichen Entwicklung!): Robert M. Pirsig, Alan Watts, Eugène Ionesco, Charles Bukowski.
Mein erstes Bukowski-Buch, „Aufzeichnungen eines Aussenseiters“, habe ich vor vielen Jahren während wenig inspirierender juristischer Vorlesungen gelesen – das war kein schöngeistiges Getue, das war nicht artifiziell-kompliziert, das war schnörkellos, direkt und klar. Und es spielte in Los Angeles, wo in meiner damaligen Vorstellung das richtige Leben stattfand. Als ich dann Jahre später während einiger Wochen dort lebte, fühlte es sich allerdings nach kurzer Zeit auch nicht wesentlich anders an als anderswo.
Charles Bukowski beschreibt ein anderes Amerika, als das uns aus den Massenmedien vertraute, schildert es als das einsamste Land der Welt, in dem nichts passiert und alle immer etwas müssen, vor allem arbeiten, denn ohne Job zu sein, ist das Allerschlimmste, das einem passieren kann. „Hunderttausende einsame und frustrierte Männer und Frauen leben weitgehend ohne Sex und mit Sicherheit ohne Liebe, arbeiten in verhassten Jobs, überfahren rote Ampeln, rasen in Feuerhydranten und Schaufenster, zocken, saufen, nehmen Drogen, rauchen 2 Päckchen am Tag, masturbieren, werden verrückt, verrückter und noch verrückter, werden gläubig, kaufen sich Goldfische, Katzen, Affen ...“. So recht eigentlich klingt das auch sehr nach dem Europa oder dem Asien von heute.
Eine meiner liebsten Geschichten aus „Noch mehr Aufzeichnungen eines Dirty Old Man“handelt davon, wie Bukowski mit Patricia zum Boxen geht, die beiden auf der Heimfahrt in Streit geraten („Worüber weiss ich nicht mehr, aber ich glaube, es ging darum, ob der Fahrstuhl oder die Rolltreppe die grössere Erfindung war.“) und dieser dann eskaliert: „Patricia war zwar im Irrenhaus gewesen, aber Nina auch. Fast alle Frauen, die ich kannte, waren im Irrenhaus gewesen. Es bewies gar nichts. Mir war, als hörte ich ein Geräusch. Ich drehte mich um. Patricia war auf den Gehsteig gefahren und kam mit dem Wagen auf mich zu. Ich machte einen Satz an die Hauswand, und der rechte Kotflügel schrappte mir übers Bein ...“.
Schildern, was man denkt, beschreiben, was passiert. Ohne Sinngebungsversuche. Das ist die Art Schreiben, die ich liebe. Auch natürlich, weil ich selber ständig auf der Suche nach Sinn und Bedeutungsvollem (gewesen?) bin. Unter anderem bei den Zahlen.
So hat etwa die 9 für mich immer schon eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Ich führe das darauf zurück, dass ich im September, dem neunten Monat, geboren wurde. Als mir dann jedoch eine brasilianische Masseurin, die ich wegen Rückenschmerzen aufgesucht hatte, sagte, dass Angst und Depressionen charakteristisch seien für meine Zahl, die 9, war ich dermassen verblüfft (Angst und depressive Anwandlungen – wirkliche Depressionen habe ich bislang nicht erfahren – waren mir in der Tat nicht fremd), dass ich ganz vergass, sie zu fragen, wie sie darauf komme, dass die 9 meine Zahl sei.
Obwohl ich so recht eigentlich keinerlei Zweifel habe, dass die 9 meine Zahl ist, so ist mir doch auch die 11 immer teuer gewesen. Trotz intensiven Nachdenkens ist mir jedoch nie richtig klar geworden, weshalb dem so ist; die einzig mir einleuchtende Erklärung hat mit frühen Erfahrungen zu tun (und dass die prägend sind, weiss ja nun wirklich jeder).Seit ich als Bub in Zürich in den Ferien weilte, ist die Trambahn Nummer 11, die Verbindung vom Hauptbahnhof zur Wohnung meiner Grossmutter, mir von allen Trambahnen die liebste, auch heute noch.
Dass ich mir diese Zahlen vielleicht auch ganz einfach aus einer Laune heraus zu eigen gemacht haben könnte, ziehe ich zwar durchaus in Betracht, doch, so sage ich mir, auch wenn dem sogewesen sein könnte, so musste es ja einen Grund gehabt haben, dass es gerade die 9 und die 11 und nicht etwa die 2 oder gar die 0 waren, die mir eingefallen und für die ich mich entschieden hatte.
Überhaupt, die 0, also die kam auf gar keinen Fall in Frage, denn ich erinnere mich bei dieser Zahl immer an ein ehemaliges Mitglied der Schweizer Regierung, dessen Name mit einem O (und damit der Zahl 0 zum Verwechseln ähnlich) beginnt – und diese Zahl beschreibt die Fähigkeiten dieses Mannes derart überzeugend, dass eine solche Koinzidenz schlicht nicht zufällig sein konnte.
Von Zeit zu Zeit streift mich der Gedanke, dass mein Lebensschicksal möglicherweise nicht so sehr von einer einzelnen Zahl, sondern von einer Zahlenkombination abhängig sein könnte. Wäre es vielleicht möglich, dass in meinem Falle die 9 und die 11 zusammengehörten? Dafür spräche, dass ich am 9.11., dem Tag, als die Berliner Mauer fiel, mich in Berlin aufhielt, obwohl, das war 1989 und da stört dann eben die 8. Und überhaupt denkt man ja bei der Kombination von 9 und 11 schnell einmal an 9/11, wie die Amerikaner den 11. September 2001 nennen. Dass die immer eine Extrawurst haben müssen! Es ist doch weltweit gängig, dass zuerst der Tag, dann der Monat und dann das Jahr kommt. Nur bei den Amis nicht, bei denen kommt der Monat zuerst. Man kann sich schon fragen, ob man Leuten, die so willkürlich mit Daten umgehen, eigentlich trauen kann.
Ich bin nicht der einzige, dem es Zahlenkombinationen angetan haben. So schrieb etwa Eva Gabrielsson, die Frau, die 32 Jahre mit Stieg Larsson zusammen war, dass dieser sein Leben lang der Kristallnacht vom 9. November 1938 gedachte … und dann am 9. November 2004 starb. Wieder ein 9.11! Ob es da vielleicht eine Verbindung zwischen mir und Larsson …? Ich habe doch auch selber einmal angefangen, einen Krimi zu schreiben …
Übrigens: Ich bin kein Esoteriker, der in allem und jedem Bedeutungsvolles zu sehen imstande ist. Überhaupt nicht. Und Zahlenrätsel sind schon gar nicht mein Ding. Zahlen gibt es in der Natur ja gar nicht, sie sind erfunden worden. Wenn wir ihnen also spezielle Bedeutung zumessen, so ist dies vor allem Ausdruck unseres Bedürfnisses nach Orientierung und Sinn. Und daran ist ja nichts verwerflich, auch wenn dieses Bedürfnis manchmal etwas gar eigenartige Blüten treibt.
Im Grunde, und davon bin ich überzeugt, finden wir nur, was wir selbst versteckt haben. Oder etwa doch nicht? Gott, ist das schwierig!
Als ich vor vielen Jahren für eine Hilfsorganisation (die Hilfe bestand hauptsächlich darin, Leuten wie mir, die keine vernünftige Anstellung finden konnten, ein Auskommen zu sichern) im südlichen Afrika arbeitete, sah ich mich eines Tages, grosser Überschwemmungen wegen, zur Verteilung von Hilfsgütern abkommandiert. Zusammen mit meinem „Field Officer“, einem Zulu, der den Vorteil hatte, die Einheimischen zu verstehen, sass ich in einem Lagerraum an einem Tisch und liess mir übersetzen, weshalb die vielen geduldig wartenden Menschen glaubten, sie seien der humanitären Hilfe bedürftig, für die es meine Organisation immer mal wieder in die Medien schaffte. Eine uralte Frau, mit gebücktem Gang, unzähligen Runzeln und von einer Zähheit, von der ich selber gerne etwas gehabt hätte, antwortete auf die Frage nach ihrem Geburtsdatum mit „Uuhhii, das war zur Zeit des grossen Durchfalls“. Da weder mein Field Officer noch ich wussten, wie man mit dieser Information das vor uns liegende Formular ausfüllen sollte, entschlossen wir uns, ein fiktives Datum einzutragen. Der Frau war es egal, Hauptsache sie bekam ihren Sack Reis und ein paar Decken.
Das Datum, das ich eingetragen hatte, war der 28. September 1935 und alles andere als beliebig ausgewählt. Ganz im Gegenteil, es war mit Bedeutung gerade zu aufgeladen. Zum einen war ich an einem 28. September geboren (wie übrigens auch Brigitte Bardot), zum anderen hatte ich die letzten beiden Ziffern meines Geburtsjahres – 53 – ganz intuitiv (und darauf legte ich Wert, da mir damals alles Intuitive irgendwie bedeutungsvoll vorkam) umgedreht und so hatte sich mir das Geburtsjahr 1935 für die alte Frau offenbart. Seither fühle ich mich ihr ganz speziell verbunden. Und irgendwie, denkt es manchmal in mir, muss es der alten Frau doch bestimmt auch so ergehen. Irgendwie.
Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen: dieses Zahlen-Dingsbums überkommt mich zwar manchmal, aber nicht wirklich oft.
Länger angehalten hat eine ganz andere Manie. Während vieler Jahre war ich felsenfest davon überzeugt, mein Saufen sei ein Symptom für einen tieferliegenden Konflikt, dessen Ursache auszumachen und dann anzugehen sei. Es dauerte unfassbar lange, bis ich begriff, dass das völliger Quatsch ist. Ich soff nicht, weil ich ein Problem hatte (Probleme haben wir alle, aber nicht alle versuchen, sie wegzusaufen), ich soff, weil ich Alkoholiker war (und bin).
Doch natürlich hatte ich nicht einfach ein Alkoholproblem, ich hatte ein Lebensproblem.
***
Viele, die mit dem Saufen aufhören, erleben sich in den ersten Monaten wie auf einer rosaroten Wolke. Alles, wirklich alles, ist plötzlich ganz wunderbar. Nichts, absolut gar nichts, was ich anders hätte haben wollen.
Bedauerlicherweise hielt diese rosarote Wolke nicht an, war sie nach ein paar Monaten wieder weg. Und die Probleme, die ich früher weggesoffen hatte, waren immer noch da. Nur war ich jetzt bereit, mich ihnen zu stellen. Zumindest glaubte ich das.
„The first principle is not to fool yourself. And you are the easiest person to fool“, hat Richard Feynman, Nobelpreisträger für Physik, einmal über das wissenschaftliche Arbeiten gesagt. Das gilt, wie ich finde, so recht eigentlich für alle unsere Auseinandersetzungen mit dem Leben.
Jahrelang bin ich mit dieser Feynman-Erkenntnis hausieren gegangen, habe kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um mit ihr aufzutrumpfen. Ich war überzeugt, dass ich sie mir nicht nur zu eigen gemacht hatte, sondern mich nach ihr ausrichtete. Allerdings nur bei theoretischen Fragen: in meinem praktischen Handeln bin ich ihr tunlichst aus dem Weg gegangen.
So ist mir etwa eine Retter-Mentalität eigen, die mir die meiste Zeit meines Lebens gar nicht bewusst war. Und wenn sie mir gelegentlich zu Bewusstsein kam, fand ich sie eigentlich auch ganz okay. Ja mehr: ich war der Meinung, sie zeichne mich aus. Denn schliesslich wollte ich ja das Gute und bildete mir zudem ein, auch zu wissen, was das Gute war. Und manchmal wusste ich es ja auch.
Dass ich es geschafft hatte, mit dem Saufen aufzuhören, machte mich froh und auch etwas stolz – mir gefiel, mich Leuten zugehörig zu fühlen, denen gelungen war, woran allzu viele scheitern. Die ganze Welt wollte ich von meinem Erfolg wissen lassen; ganze Strassen hätte ich in den ersten Monaten meines alkoholfreien Lebens trocken legen können.
Mein Ego sei mir im Weg gestanden, trompetete ich in die Gegend hinaus. Und war überzeugt davon, dass ich meines nun im Griff hatte – es war ein fataler Irrtum. Nach wie vor war ich rechthaberisch und besserwisserisch. Nach wie vor glaubte ich, dass die 12-Schritte der beste Weg seien, um von einer Sucht wegzukommen, um ein gutes Leben zu leben. Nach wie vor war ich sicher, dass das, was mir geholfen hatte, auch das Beste für alle anderen sei. Natürlich hätte ich das niemals zugegeben. Und natürlich hielt ich Leute, die so etwas offen sagten, für Volltrottel. Dass ich selber auch so war, begriff ich erst, als meine aufrichtigen und engagierten Versuche, andere retten zu wollen, mich selber fast zerstörten.
***
Obwohl verschiedene Abhängigkeiten (addictions) als ganz unterschiedliche Probleme erscheinen mögen, handle es sich dabei tatsächlich nur um verschiedene äussere Ausprägungen desselben Mechanismus, meint Lance Dodes in „The Sober Truth“. Meines Erachtens trifft das nicht nur auf Abhängigkeiten, sondern auf alle Lebensschwierigkeiten zu.
Wenn ich im Nachfolgenden Alkohol- und Heroinsucht, Depression und Panikattacken, Neurosen und Borderline und vieles mehr wild durcheinanderwerfe, tue ich das nicht, weil ich zwischen Äpfeln und Birnen nicht zu unterscheiden wüsste (es sei ausdrücklich erwähnt: über medizinisches Fachwissen verfüge ich nicht, doch ich weiss auch, dass die Medizin keine Wissenschaft in dem Sinne ist wie die Physik eine ist), sondern weil ich mich darauf konzentriere, was diesen Befindlichkeiten gemeinsam ist: die Lebensverweigerung.
Diese Lebensverweigerung zeigt sich auch in der sogenannten Co-Abhängigkeit, die nichts anderes ist als Abhängigkeit. Konkreter: Selbst-destruktive Abhängigkeit, Sucht. Denn nicht die Abhängigkeit ist das Problem, sie gehört ja zum Leben – so ist das Kleinkind von Mutter und Vater abhängig, die Gemeinschaft von ihren Mitgliedern, der Staat von seinen Mitbürgern – , sondern die zwanghafte, selbst-zerstörerische, lebensverneinende.
Süchtige sind Langweiler, selbstmitleidige Langweiler. Und überdies feige. Ihr Beitrag zum Leben besteht darin, dass sie sich diesem verweigern. Und ihre Nächsten, die sich um sie sorgen, terrorisieren. Doch das ist ihnen egal. Sie sind ausschliesslich mit sich selber beschäftigt. Ich weiss, wovon ich rede, ich war auch einmal so.
Dass Süchtige auch Leidende sind, versteht sich. Dass sie Hilfe brauchen genauso. Tragisch ist, dass allzu viele glauben, dem sei nicht so, sie schafften es, wenn überhaupt, alleine. So wie ich das während gut zehn Jahren geglaubt habe. Und sie geben sich nicht nur Mühe, sie strengen sich wirklich an, sehr sogar. Und immer wieder von Neuem, doch selten mit anhaltendem Erfolg.
Einige versuchen es auch mit Therapie, und ja, die kann gelingen. Doch oft ist sie nicht viel mehr als ein Machtkampf zwischen Therapeut und Patient. Während der Therapeut die Schwachstelle des Patienten zu eruieren versucht, tut der Patient alles, um genau das zu verhindern.
Manch seelisch Leidenden ist nicht zu helfen, ihr Widerstand zu gross und zu heftig. Die Psychiatrieprofessorin Kay Redfield Jamison, die selber an einer bipolaren Störung leidet, berichtet in „Eine ruhelose Seele“von einem solch herzzerreissenden Fall: „Nichts, was in der Macht der Medizin oder der Psychologie stand, konnte ihn dazu bringen, seine Medikamente lange genug zu nehmen, dass es ihm auf die Dauer gut ging. Lithium half ihm, aber er nahm es nicht.“
Doch Einstellungs- und Verhaltensänderungen sind möglich. Manchmal. Ich habe es erfahren. Und andere auch. Auf ganz unterschiedlichen Wegen, einige davon finden sich auf den folgenden Seiten.
Ob Therapien nützen, lässt sich nicht beweisen
„We are all mad, Inspector, for the simple reason
that we don’t know why we exist and this …”
he waved his hand at the tissue of existence before him,
“this life is how we distract ourselves so that we don’t
have to think about things too difficult for us to comprehend.”
Robert Wilson: A Small Death in Lisbon
„Nützt eh nix" sagen viele, die Familienangehörige in Suchtkliniken oder beim Therapeuten wissen. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und da es Süchtige gibt, die nach einem Aufenthalt in einer Suchtklinik oder der Behandlung bei einer Therapeutin (es kann auch ein Mann sein) einige Zeit suchtfrei sind, nützt Therapie vielleicht ja eben doch.
Nur eben: wer weiss denn schon, ob Alkoholsüchtige nicht auch ohne Hilfe trocken geworden wären? So hören doch viele mit dem Saufen auf, weil sie in einen neuen Lebensabschnitt eintreten und/oder weil in einem bestimmten Moment die Sonne scheint oder es regnet oder weil der kleine Sohn (oder die kleine Tochter) fragte: „Papi/Mami, besäufst du dich wieder?“
Wir wissen nicht, was eine Sucht auslöst, wir wissen auch nicht, was eine Sucht beendet, doch wir wissen, dass einige es schaffen, von der Sucht loszukommen.
Gängige Therapieangebote verstehen Sucht als medizinisches, psychologisches und soziales Problem. Sie leiden nicht unter dem, was Sie sich vorstellen, sagt die Psychologin, der Psychiater oder die Sozialhelferin zum Alkoholiker, Sie leiden unter dem, was ich studiert habe.
Das heisst nicht, dass Therapien von Psychologen, Psychotherapeutinnen oder Psychiatern gar nichts bringen – sie können gut tun, sie können helfen. Nur eben: Psychologen, Psychotherapeutinnen oder Psychiater, die etwas von Sucht verstehen, tun dies nicht ihrer staatlich anerkannten Diplome wegen, sondern trotz dieser.
Suchtbehandlung von bei der Krankenkasse zugelassenen Therapeuten ist jedoch auch deswegen häufig nicht von Erfolg gekrönt, weil Süchtige (ob Alkoholiker oder Drogenabhängige) die gesellschaftlichen Werte, die die Therapeuten repräsentieren, ablehnen. Dazu kommt, dass ein Nicht-Alkoholiker in der Regel keinen Schimmer hat, wie ein Alkoholiker wirklich tickt, weil man das nicht studieren kann, sondern selber erlebt haben muss.
Aber Hallo! Die Forderung, man könne nur behandeln, was man auch selber durchgemacht hat, ist doch absurd, Veterinäre wären ja sonst alle arbeitslos und viele Tiere tot. Einverstanden, doch es gilt eben auch dies: „1976 streikten die Ärzte aller öffentlichen Krankenhäuser im Los Angeles County; die tägliche Sterberate sank um zwanzig Prozent.“ (James Frey in „Strahlend schöner Morgen“).
***
Unter Therapie versteht man ein Heilverfahren, von dem verlangt wird, dass es mess- und beweisbar ist und methodisch vorgeht. Als ob es für seelische Leiden Rezepte geben würde; Listen, die man abarbeiten könnte.
Doch Therapien können funktionieren. Für die, die an sie glauben. Und da es ganz unterschiedliche Ansätze und Vorgehensweisen gibt, hat der Patient die Auswahl. Und der Therapeut ebenso. So hält etwa der Psychiater Hans-Joachim Maaz nichts „von einer vorgeblichen Neutralität des Therapeuten“, sondern betrachtet es „als seine Pflicht, die eigene Position gegenüber den Belangen des Patienten zu reflektieren“, wie er in „Hilfe! Psychotherapie. Wie sie funktioniert und was sie leistet“schreibt. Kein Therapeut kann seine Erfahrungen, seine Lebenseinstellung, aus der Therapie heraushalten.
Doch was macht eigentlich ein Therapeut? Er exploriert, stellt Fragen, trifft mit dem Patienten Vereinbarungen, bestätigt, was bestätigt gehört, verbalisiert emotionale Erlebnisinhalte, konfrontiert, deutet, doch raten soll er nicht oder nur selten, meint Maaz, da es darauf ankomme, dass der Patient lerne, sich besser zu verstehen, und aus Erkenntnis und Einsicht zu seinen Entscheidungen finde. „Psychotherapie ist Lehre zur Selbstberatung.“ Das Problem dabei ist, dass wir alle nicht sehr gut darin sind, auf unseren eigenen Rat zu hören.
Psychotherapie wirke, sei wissenschaftlich gesichert, behauptet Maaz, doch bleibe ihre individuelle Anwendung eine Kunst und sei von ganz subjektiven Faktoren abhängig. Nun ja, es galt lange Zeit auch als wissenschaftlich gesichert, dass Homosexualität eine Krankheit sei – aus der International Classification of Diseases (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde sie erst 1993 entfernt. Fakt ist: Für viele der seelischen Krankheiten, die Aufnahme in die DSM, das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen, der Bibel der Psychiatrie, finden, gibt es keine wissenschaftliche Grundlage.
Wissenschaft zeichnet sich durch Gesetze aus. Dabei handelt es sich, wie Siddhartha Mukherjee in „Gesetze der Medizin“ ausführt, um „Aussagen, deren Wahrheitsgehalt auf wiederholten experimentellen Beobachtungen einiger universeller oder verallgemeinerbarer Naturattribute gründet.“ Das ist in grossem Ausmass in der Physik der Fall, in kleinerem in der Chemie und in einem wesentlich kleinerem in der Biologie.
Laut Karl Heinz Brisch, dem Herausgeber von „Bindung und Sucht“, geht es in der Therapie um den Aufbau einer sicheren therapeutischen Bindung, die es ermöglichen soll, dem Klienten neue Möglichkeiten der Stressregulation zu vermitteln. Erst wenn in der Therapie neue, intensive, sichere Bindungserfahrungen zur Verfügung gestellt werden können (das kann dauern!), sei es möglich, das Suchtmittel zu entziehen. Ob der an Sofort-Lösungen gewöhnte Süchtige sich wirklich so lange gedulden kann?
Der Kunst der Gesprächsführung und dem erfolgreichen Umgang mit kleineren Fehlern oder Schnitzern, die eine Beziehung belasten können, werde nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt, schreibt Arnold A. Lazarus im Vorwort zu „Was Therapeuten falsch machen“. Das erstaunt nicht wirklich, denn das Ziel akademischer Ausbildungen ist die Erlangung eines offiziell anerkannten Diploms und nicht die Befähigung zur Hilfeleistung bei realen Problemen.
Bernard Schwartz und John V. Flowers, die Autoren von „Was Therapeuten falsch machen“,betonen, dass Behandlungsentscheidungen auf den besten verfügbaren Forschungsergebnissen basieren sollten. Wer würde dem auch widersprechen wollen? Nur eben: Das die Wissenschaft prägende Kausalitätsprinzip ist auf das Unbewusste nicht anwendbar ist. Unbewusst heisst ja, dass wir nichts Sicheres darüber wissen. Im besten Fall können wir informiert und intelligent raten (was, zugegeben, zu ganz guten Ergebnissen führen kann), was sich da abspielen könnte. Doch dieses Unbewusste in ein System von Ursache und Wirkung zwingen zu wollen, sagt mehr über unsere Gewohnheit zu denken aus („Das Problem ist, dass wir allzu gern eine Lösung wünschen, die dem Ursache-Wirkung-Prinzip gefährlich gefällig ist …“, schreibt Kathrin Wessling in „Drüberleben“), als darüber, was in dieser terra incognita wirklich passiert.
„Was Therapeuten falsch machen“listet mehr als fünfzig Fehler auf. Das beginnt mit „Sie ignorieren die Stärken, Fähigkeiten und Ressourcen des Klienten“ und endet mit „Die Kraft menschlicher Resilienz unterschätzen.“ Bei nicht wenigen der aufgeführten Fehler staunt man über die offenbar geringe Selbstreflexion einiger Therapeuten. Und auch darüber, dass die Autoren es nötig finden, für vollkommen Selbstverständliches Studien anzuführen. „Daraus lässt sich schliessen, dass wir Therapeuten genauso talentiert in Sachen Verleugnung, Selbsttäuschung und Rationalisierung (je nach Denkschule) sind wie unsere Klienten.“ Ausser den Therapeuten hat sich darüber vermutlich niemand gewundert.
Nun gut, wir leben in Zeiten der Spezialisierung. Gesunder Menschenverstand ist da wenig gefragt, denn darauf lässt sich kein Fachgebiet aufbauen. Ausser natürlich, man versieht ihn mit einem möglichst gefragten Label wie zum Beispiel Therapie, denn so was lässt sich verkaufen. Am Ende ist alles eine Frage des Marketings, sagte mir einmal ein Finanzspezialist aus New York.Das ist nicht nur in der Finanzwelt so, das ist heutzutage so recht eigentlich überall so.
***
Ob eine Alkoholtherapie nützt oder nicht, lässt sich nicht beweisen. Schon deswegen nicht, weil es keinen allgemeinen Konsens über die Natur, die Ursachen und die Behandlung des Alkoholismus gibt. Und was versteht man eigentlich unter Genesung? Ein Jahr Abstinenz, oder fünf Jahre, oder gar kontrolliertes Trinken?
Und überhaupt: Wie will man wissen, ob jemand aufgrund einer Therapie mit dem Saufen aufgehört hat? Die meisten Kliniken/Therapeuten verlangen von den Süchtigen Abstinenz, bevor sie mit der Behandlung beginnen.
Eine Therapie ist also erst dann möglich, wenn jemand mit dem Trinken aufgehört hat. Doch braucht so jemand überhaupt noch eine Therapie? Falls Abstinenz nicht das Ziel, sondern die Voraussetzung für ein selbstverantwortliches Leben ist, dann ist Hilfe nötig, irgendeine Hilfe.
Mit dem Trinken aufzuhören, gelingt wenigen. Und die, denen es gelungen ist, können selber nicht sagen, wie es gelungen ist. Mein eigenes Aufhören erkläre ich mir heute so: Ich hatte einen Moment der Klarheit und aus Gründen, die ich nicht kenne, hatte ich den ergriffen, mich daran festgekrallt. Ob das wirklich so gewesen ist, weiss ich nicht.
Ich hatte zudem Glück: Das Bedürfnis zu saufen war weg. Und kehrte bis heute nicht zurück. Für mich ist das ein Wunder. Auch weil ich weiss, dass es anderen ganz anders geht. Und einige, auch nach Jahren der Abstinenz mehrmals pro Tag versucht sind, zur Flasche zu greifen.
Alkoholiker brauchen kein Expertenwissen, sie sind selber Experten; sie brauchen eine grundsätzlich neue Sichtweise. Walther H. Lechler schreibt in „Nicht die Droge ist's, sondern der Mensch“: „Die Metapher 'Alkohol' heisst übersetzt nicht allein C2H5OH oder Äthylalkohol, oder aqua vitae, sondern ist ganz schlicht Synonym von Lebenslüge, Selbstbetrug und Selbsttäuschung. Sie bezeichnet alles, was dazu dienen kann, unseren Blick vor der Wirklichkeit zu verstellen.“
Süchtige sind Lebensverweigerer.
***
„Lassen Sie mich es so sagen: Man kann nicht auf der Welt sein, ohne in Schmerzen zu leben, seelischen und körperlichen Schmerzen. Wir haben Mechanismen entwickelt, um mit diesen Schmerzen umzugehen, sie irgendwie zu überwinden. Therapie, Religion und Spiritualität, Beziehungen, materiellen Erfolg. All das kann funktionieren, aber auch selbst zum Problem werden“, notierte David Foster Wallacein „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“.
Wer realisiert und akzeptiert, dass er unter einem Alkoholproblem leidet, hat Glück, denn Alkohol ist konkret, eine chemische Substanz. Eine Neurose oder eine Depression ist wesentlich schwerer zu fassen. Beim Alkoholiker ist klar, was er zu tun hat: Keinen Alkohol trinken. Und wie macht man das? Indem man das erste Glas stehen lässt. Das ist die erste Voraussetzung, ohne diese geht es nicht. Das ist schwierig? Ist es nicht, die Alkis sind schwierig.
Gemeinsam ist psychischen Störungen, von der Depression bis zu Borderline, von der Sucht bis zur Neurose, dass die darunter leidenden Menschen ständig mit den Bedingungen des menschlichen Lebens hadern, dass sie die Realität (und damit auch sich selber) nicht akzeptieren können.
Ist Burn-out eine Krankheit, ist ADHS eine Krankheit?
Kommt ganz drauf an, wen man fragt, denn es gibt keinen biologischen Test, der Normalität nachweisen könnte. Das heisst, dass es nur subjektive Diagnosen gibt und diese sind naturgemäss fehlerhaft. Und häufig von Profitinteressen motiviert. Da wären zum Beispiel die Pharmafirmen: Die Pathologisierung oder Krankheitserfindung sei die hohe Kunst, psychiatrische Krankheiten zu verkaufen, weil sie der effizienteste Absatzmarkt für lukrative Psychopharmaka sind, schreibt der Psychiater Allen Frances in „Normal. Gegen die Inflation psychiatrischer Diagnosen“. Und da wären dann ja auch noch die vielen Therapeuten, die sich Arbeit beschaffen müssen.
Eine zutreffende Diagnose, so Frances, könne ein Leben retten, eine falsche eines ruinieren. Nur eben: Auch wenn die Diagnose einer seelischen Störung zutreffend ist, heisst das noch lange nicht, dass deswegen die Krankheit geheilt werden kann, denn aus ganz vielen Diagnosen lassen sich nicht notwendigerweise konkrete, erfolgsversprechende Handlungsanleitungen ableiten.
Dazu kommt, dass, was als psychische Störung gilt, auch dem Zeitgeist unterliegt. So war etwa Schizophrenie die Modediagnose der Sechzigerjahre. Heute ist es, gemäss Frances, der Autismus, die bipolare Störung, ADHS sowie die schizoaffektive Störung.