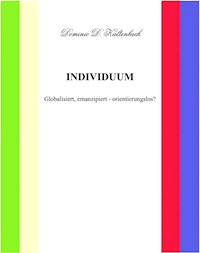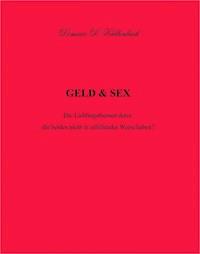Dominic D. Kaltenbach
INDIVIDUUM
Impressum
INDIVIDUUM. Globalisiert, emanzipiert - orientierungslos?
Dominic D. Kaltenbach
Copyright: © 2019 Dr. Dominic D. Kaltenbach
Verlag: Dr. Dominic D. Kaltenbach
Richard-Schirrmann-Straße 18
79822 Titisee-Neustadt
Deutschland
Inhaltsverzeichnis
Zwei entscheidende Prozesse
Weltvergesellschaftung
Warten auf den Untergang
Der Verfall der Familie
Der Verfall der Arbeit
Der Verfall der Religion
Der Verfall des Verfalls oder Vom Schein zum Sein
Bei Tisch im Restaurant
Der gesellschaftliche Nachlass eines Freiherrn
Der Restaurantgast von Knigges Gnaden
Das Servicepersonal von Knigges Gnaden
Der Baron ist tot, es lebe der Baron!
Geld & Sex
Vorsicht, Eindringlinge
Geld im Spiegel Dritter
Sex im Spiegel Dritter
Sie haben das Recht, zu schweigen
Schnell, erbarmungslos, relativ: die Zeit
Wie spät ist es?
Es wird Zeit!
Verschwindet die Zeit wieder?
Exkurs: Zeitreisen
Alles Zeitliche hängt vom Souverän ab!
Ende?
Schluss!
Vertrauen ist nicht alles
Zwei entscheidende Prozesse
Die wirtschaftliche Skrupellosigkeit reißt im Zuge der Globalisierung ungehindert die Weltherrschaft an sich, vernichtet die identitätsstiftenden kulturellen Besonderheiten und schert sich einen Dreck um die Bedürfnisse der einfachen Menschen.
Durch die Individualisierung zudem bestialisch auseinandergetrieben, bleibt den vereinzelten Gesellschaftsmitgliedern, in ihrer obligatorischen Traditionsarmut, nur der rücksichtslos befriedigte Konsumrausch.
Den hier versammelten Essays liegt entsprechend die Erkenntnis zugrunde, dass sich der Weg, hin zu einem fruchtbaren Miteinander in der Weltgesellschaft der Individuen, aus der Verbindung dieser beiden zerstörerischen Prozesse ergibt.
Diese auf den ersten Blick ebenso unplausible wie unkonventionelle Sichtweise ergibt sich aus einem Analysekonzept, das im Rahmen der Arbeit „Globalisierung - bleibt das Individuum auf der Strecke?“ entwickelt worden ist. Es orientiert sich schlicht an den hier einleitend prägnant zugespitzten Befürchtungen. So simpel die resultierende Gliederung ist, vermag sie dennoch, der allseits bemängelten zunehmenden Unübersichtlichkeit ein gutes Stück entgegenzuwirken.
Unter der Leitfrage, womit der Einzelne durch die Globalisierung genau konfrontiert ist, beginnt die Betrachtung mit der Suche nach den gestaltenden Akteuren. Da deren Handeln typischerweise jenseits alter Raumvorstellungen angesiedelt ist, muss der Detektor anschließend auf vereinheitlichende Eingriffe in die kulturelle Unabhängigkeit eingestellt werden. Ergänzend ist im Fortgang nach Anhaltspunkten für eine Weltgesellschaft Ausschau zu halten. Während ein Teil der Sozialwissenschaften diese zum letztverbliebenen Handlungsrahmen erklärt, bestreitet ein anderer alleine schon die Möglichkeit einer solchen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die weiterführende Frage, woran sich der individualisierte Mensch eigentlich orientiert. Bei der Suche nach Einbindungsformen drängt sich zunächst eine strikte Abgrenzung zwischen einem unreflektierten Nachahmen von Individualitätsmustern und der eigentlichen Individualisierung auf. Dieser Spur folgend, erscheint selbst der kränkelnde Umgang mit Überlieferungen in einem aufschlussreichen Licht. Letztlich wirken sich die Eigenschaften des individualisierten Kompasses auch auf das ewige Spannungsverhältnis von gesellschaftlichen Belangen und persönlicher Selbstverwirklichung aus.
Für das Gesamtbild können die Ergebnisse der für beide Prozesse jeweils dreigliedrigen Vorgehensweise zu einem, hier exemplarisch skizzierten, Zopf verflochten werden. Ausgehend von den betrachteten Akteuren, bricht die Globalisierung mit den zuvor als unumstößlich geltenden Ordnungsstrukturen und Gestaltungsmonopolen. Auf der Weltbühne ringen bei Weitem nicht mehr nur juristische und natürliche Personen mit Rang und Namen um ihre jeweiligen Interessen.
Die sortierende Auseinandersetzung mit der einhergehenden Vielfalt ist ein wesentlicher Bestandteil der im Rahmen der Individualisierung an Umfang zugelegten Eigenverantwortlichkeit. Während frühere Einbindungsformen ein desinteressiertes, passives Mitschwimmen ermöglichten, sind mit diesem Verhalten bei der heutigen Strömungslage heftige Turbulenzen zu erwarten. Der Verlust von Selbstverständlichkeiten mutet jedem Einzelnen zu, sich seinen Lebensthemen und Beziehungen bewusst zuzuwenden und diese aktiv zu pflegen.
Der globalisierte Einheitsbrei bleibt nicht zuletzt deshalb aus, weil sich die Attraktivität des lokal Bekannten nicht in der einst konstruierten Alternativlosigkeit erschöpft. Zudem fördert ein wechselseitiger Lern- und Austauschprozess zutage, dass die Kerninteressen der Menschheit in etlichen Bereichen gar nicht derart weit auseinander liegen. Der gegenteilige Eindruck wurde im Rahmen der Nationenbildung abgrenzend bewusst herbeigeführt und findet sich bis heute im Dienst einer örtlich begrenzten Solidaritätserzeugung.
Das Ideal eines passiven Untertans liegt denn auch der Diagnose einer vermeintlich individualisierungsbedingten Verachtung von Traditionen zugrunde. Hier findet sich jedoch vielmehr ein ebenso fundierter wie kritischer Umgang mit dem kulturellen Erbe, der sich durch eine räumliche Offenheit auszeichnet und der von einem individuellen Verantwortungsbewusstsein getragen ist.
Dieses globale Verantwortungsgefühl zeigt sich gerade bei der zivilgesellschaftlichen Beteiligung. Beginnend beispielsweise beim individuellen Verzicht auf klimabelastende Annehmlichkeiten, ist den Unternehmen alleine schon aus rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus an der Verbreitung rechtsstaatlicher Prinzipien gelegen. Und selbst bei der Fortentwicklung des Völkerrechts sind die Beamten des auswärtigen Dienstes nicht mehr unter sich. Mit der veränderten inter-nationalen Kooperation wird auch die Staatsangehörigkeit zur Ausgangsbasis für die weltgesellschaftliche Mehrebeneneinbindung jedes Einzelnen - als Gemeinde-, Landes-, Bundes-, Unions- und Weltbürger.
Seine persönliche Entfaltung in der Auseinandersetzung mit den Belangen und dem Facettenreichtum der ganzen Menschheit suchend, kann sich der selbstverwirklichte Mensch offensichtlich nicht passiv fordernd hinter einer Teilgruppierung verstecken. Die zugrunde liegende Haltung lässt sich durch den Unterschied zwischen Nationalgefühl und Verfassungspatriotismus dahingehend konkretisieren, dass auch „fremde“ Weltdeutungen nicht seelenlosen Kollektiven, sondern Mitmenschen zugeschrieben werden. Wenn eigene Beschwernisse entsprechend als wertvoller Beitrag für das globale Miteinander und nicht als Niederlage gewertet werden, erklärt sich daraus die vermeintlich widersprüchliche Verbindung aus aktivem Einsatz für die Weltgesellschaft und individuellem Genuss.
In der Gesamtschau erweist sich die Globalisierung als Prozess, der das Korsett aus „Selbstverständlichkeiten“ aufbricht und jeden Einzelnen mit einer überwältigenden Vielfalt konfrontiert. Selbige eigenverantwortlich zu durchdringen, sich dabei der Besonderheiten des Eigenen bewusst zu werden und diese im fruchtbaren Austausch lebendig zu halten, stellt den Kern der Individualisierung dar und qualifiziert diese als Gegenstück zur Globalisierung.
Bedauerlicherweise steht jeder noch so schönen Theorie die Praxis entgegen. Ein theoriekonformes positives Meinungsbild zu den beiden Prozessen lässt sich nur dann präsentieren, so die überdeutlichen Hinweise aus der breiten Bevölkerung, wenn sich die Stichprobenziehung auf die Villenviertel dieser Welt beschränkt. Damit werden jedoch nicht nur die gestalterischen Möglichkeiten, sondern auch die unzähligen tatsächlichen Aktivitäten derjenigen unterschätzt, die nicht zu den Spitzenverdienern gehören.
Jedem Vorhaben, ob mit oder ohne erkennbarem Globalisierungsbezug, sind bereits unzählige standardisierte Hindernisse gratis beigegeben. Diese reichen von den schwerwiegenden Folgen der grundsätzlich nicht optimalen Kindheit, über die generell vorliegende unsichere Finanzausstattung bis zur ständig ungünstigen politischen Weltlage. Die allgemeinen Vorzeichen deuten überwiegend darauf hin, den individuellen Vorstoß besser gleich bleiben zu lassen. Verfestigt sich der Eindruck zermürbender Machtlosigkeit, tendieren die Bewältigungsstrategien erwiesenermaßen zum Selbstschutz. Die Belange der Mitmenschen werden unter diesen Bedingungen weitestgehend ausgeblendet. In penetranten Fällen wird die Gefahr jeglicher Empathie einfach durch die Abwertung betroffener Personenkreise vermieden. Die eigene Opferrolle lässt jedenfalls eine Selbstsicht als verantwortlicher Teil der Weltgesellschaft nicht zu.
Auf der konstruktiven Seite müssen dagegen alle noch so kleinen Mosaiksteinchen mühsam selbst zusammengetragen werden. Um die jeweiligen Umstände betrachtend in deren Wesensbestandteile zerlegen zu können, muss zunächst das entsprechende Wissen vorliegen. Mit dem Bildungselement kann auf der Seite der allgemeinen „Verwirklichungschancen“ zwar bereits ein Plus verbucht werden, als nächstes tritt jedoch ein störanfälliges Wechselspiel mit psychischen Puzzleteilen in den Vordergrund. So lassen sich konkrete Veränderungsmöglichkeiten nur dann deutlich erkennen, wenn der Betrachter zugleich davon überzeugt ist, mit seinen Fähigkeiten die angestrebten Effekte auch erfolgreich herbeiführen zu können. In Anlehnung an den kanadischen Psychologen Albert Bandura nährt sich diese entscheidende Kombination aus objektivem Können und subjektiver „Selbstwirksamkeitserwartung“ nicht nur aus dem eigenen Erleben, sondern auch aus der inspirierenden Beobachtung anderer oder aus mitmenschlichem Zuspruch. Bei einer stichprobenartigen Gepäckkontrolle wurde motivierenderweise entdeckt, dass der erspähte eigene Einfluss prinzipiell ein gesteigertes Selbstvertrauen und eine widrigkeitentrotzende Tapferkeit mit sich führt.
Derart vorteilhafte Persönlichkeitsmerkmale beschränken sich folglich nicht auf einen prädestinierten Personenkreis. Wenn sich diese Eigenschaften nach empirischen Befunden stärkend beeinflussen lassen, ist allerdings auch die Kehrseite dieser Medaille zu berücksichtigen. Über zeitliche Belastungsgrenzen der psychischen Puffer ist noch wenig bekannt. Andauernde Angriffe auf Beteiligungsformen und Lebensqualität einer Person werden aufgrund ihrer früher oder später auftretenden zermürbenden Wirkung jedoch nicht umsonst als Psychoterror bezeichnet. Die subtilere Schwarzmalerei wird verkannterweise dagegen dem Realismus zugerechnet.
Zugegebenermaßen liegt es auf der Hand, dass Individualisierungsbefürworter mit dem prognostizierten Verfall von Familie, Arbeit und Religion nicht aus der Ruhe zu bringen sind. Aber weshalb stoßen die Untergangspropheten in diesen Halt und Orientierung bietenden Lebensbereichen nicht allgemein auf mehr Widerspruch?
Wer eine paradoxe Vielfalt mag, wird die lagergeprägten Bestandsaufnahmen aus der Familienforschung lieben. In ihnen spiegeln sich die unterschiedlichsten Vorstellungen zum Aussehen und Funktionieren des familialen Zusammenlebens wider. Die entsprechende Bandbreite an gesellschaftlichen Erwartungen stellt Frauen, Männer und Kinder buchstäblich auf eine Zerreißprobe. Der makellose Grundaufbau der naturbelassenen Normalfamilie aus Vater, Mutter und leiblichem Nachwuchs lässt bis heute jede andere Form im Lichte mehr oder weniger problemgenerierenden Versagens erscheinen. Der partnerschaftliche und erzieherische Bruch wird selbst bei den verständnisvollen Varianten zum bezeichnenden Merkmal der ausgebesserten Familienform. Wie können ausgerechnet diese schmuddeligen Boten der sozialen Abwärtsspirale zu Leuchttürmen für das weltgesellschaftliche Miteinander werden?
In der international umkämpften Arbeitswelt sind tatsächlich nur noch die Ruinen einstiger Stabilität zu erkennen. Ohne das stützende Bild des flankierenden Heimchens, der stupide kopierenden Asiaten und der faulen Drittweltler lässt sich nicht einmal mehr auf Anhieb beantworten, was richtige Arbeit eigentlich ausmacht. Ist mit dem Verlust der Strukturen, die am männlichen Leistungsträger orientiert waren, der Irrweg im Erwerbsleben vorprogrammiert? Hätte man auch ohne die Consultants bemerken müssen, dass auf dem Arbeitsmarkt wirklich alle außer der erworbenen Fähigkeiten gefragt sind?
Noch weit Schlimmeres lässt der Blick auf die Welt der Barmherzigkeit erwarten. Von Rationalisierung und Säkularisierung anscheinend unbeeindruckt, treffen hier die Vorstellungen zum richtigen Weg bekanntermaßen mit voller Grausamkeit aufeinander. Ist zwischenzeitlich wenigstens einwandfrei geklärt, welche Interpretation der göttlichen Nächstenliebe mit demokratischen Grundwerten vereinbar ist? Wieso landet die Suche nach der Weltauffassung, die den respektlosesten Bekehrungseifer an den Tag legt, ausgerechnet bei den traditionell friedlichen Zusammenkünften der Verwandtschaft?
Genau besehen muss am Ende tatsächlich der Verfall der letzten verbliebenen Sicherheit verkündet werden. Der gesellschaftliche Untergang rückt mit dem Verschwinden der alten Normalität bedrohlich weit aus dem Blickfeld. Fraglich bleibt, ob die Schnappatmung bei den Schwarzsehern eher durch den Abschied von der liebgewonnenen Katastrophe oder aufgrund ihrer eigentümlichen Vorstellung vom Wohnen im Globalen ausgelöst wird. Ist Letzteres tatsächlich möglich, ohne dass die Konfrontation mit einer Unmenge verworrenster Sachverhalte den Schädel irgendwann zum Bersten bringt? Und was hat das eigene Zutrauen in die selbständige Urteilsfähigkeit mit der großen Weltgesellschaft zu tun?
Das Leben wäre bereits wesentlich einfacher, wenn die Mitmenschen höflicher wären und sich zu benehmen wüssten. Eigentlich müsste das breite, umsatzstarke Interesse an geschliffenen Umgangsformen und am gekonnten Auftritt bei Tisch das Zwischenmenschliche deutlich entlasten. Bevor die Freunde der Finsternis hier neuerliche Beweise für den gesellschaftlichen Niedergang wittern, sei umgehend auf den Zivilisationsprozess verwiesen. Die Tischsitten dienten auf dem Weg zum friedlichen Miteinander nicht unbedingt und nicht in erster Linie dem wechselseitigen Respekt. Die altehrwürdige Philosophie distanziert sich, angewidert vom unappetitlichen Ende der Geschichte, gleich komplett von allem, was auch nur im Entferntesten mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. Wer naiverweise annimmt, die Wahl des Leibgerichts gehe ausschließlich auf sinnliche Erfahrungen zurück oder hinter der intensiven Beschäftigung mit Speisenfolge und Tafelmanieren stecke vornehmlich die Begeisterung am Formvollendeten, übersieht die unritterlichen Motive der speziellen Parteigänger des Freiherrn Knigge. Jedes kleine Detail lässt sich vorzüglich auch in einem selbstherrlichen Gemetzel um den höheren kulturellen Status einsetzen. Stünde es den Jüngern der Ikone der Umgangsformen nicht besser zu Gesicht, den im Hauptwerk enthaltenen Hinweisen auf die abstoßende Wirkung eines derart unedlen Gebarens die gebotene Aufmerksamkeit zu verschaffen?
Auf der öffentlichen Bühne des Restaurants lassen sich die pointiert zur Geltung kommenden Gesinnungsunterschiede lehrreich beobachten. Der Gast von Knigges Gnaden zeigt sich in seinem Rollenspiel als Gebieter der zivilisierten Welt. Die taktvoll auf ihn ausgerichtete, bemerkenswert harmonische Choreographie kann seinen Ansprüchen ohnehin nicht genügen. Für die Lakaienrolle des Gegenübers nicht vorgesehen, kann auch Fachwissen und handwerkliches Geschick das vernichtende Urteil nicht abwenden. Unbesehen zielt die Machtdemonstration direkt auf die Hinrichtung der ihrer Rolle öffentlich entkleideten Privatperson. Hat diese verstaubte Trennung von öffentlichem und privatem Lebensbereich nicht sowieso längst ausgedient? Werden die hochherrschaftlichen Kreise nicht seit jeher für ihre rücksichtslose Selbstdarstellung bewundert? Ist ein Genuss, der die Kontrolle weitestgehend auf die Zeremonienmeister überträgt, ohne die Neigung zur Unterwürfigkeit überhaupt möglich?
Auf der Seite des gastronomischen Partners lässt sich bisweilen ebenfalls eine taktlose Rollengestaltung beobachten. Was einst selbst Majestäten zu erfüllen vermochte, ist einer Servicekraft von Knigges Gnaden absolut unwürdig. Mit dienstbereitem Sachverstand und zuvorkommender Höflichkeit ist dem Gast nicht zu vermitteln, dass er den zukünftigen Manager des Hauses vor sich hat. Ein verächtlicher Auftritt lässt dagegen, trotz unwürdiger Durchgangsstation, diesbezüglich keinerlei Zweifel aufkommen. Zeigt sich Persönlichkeitsstärke wirklich durch schamlose Dreistigkeit im Rahmen einer ungezügelt aufdringlichen Selbstdarstellung? Weshalb finden sich unbestreitbare Merkmale charakterlicher Größe dann gerade in Verbindung mit einem Serviceverständnis, dem unauffällig vorausschauend kein Wunsch entgeht? Werden diese sogenannten weichen Fähigkeiten heutzutage nicht ohnehin von jedermann gefordert? Was könnte das heutige Heer ziviler Diplomaten schon von den hintergründigen Feinheiten eines imperialistisch klingenden amerikanischen, englischen, französischen oder russischen Service lernen?
Die gebotene Erwiderung von Höflichkeiten scheint vor allem dann auszubleiben, wenn sich das Gegenüber durch die gezeigte Ehrerbietung in einer herausragend gesellschaftlichen Position wähnt. Klärt sich diese Merkwürdigkeit mit dem Sachverhalt, dass selbst ausgewiesene Experten die Umgangsformen zu schmückendem Beiwerk degradieren und deren moralischen Hintergrund übersehen? Wäre die entsprechende innere Motivation nicht sogar geeignet, in der Weltgesellschaft der Individuen das Konfliktpotential aus den unterschiedlichsten Vorstellungen zum gebotenen Umgang zu minimieren? Münden die Empfehlungen des Freiherrn Knigge etwa deshalb bereits in den Auftrag, sich eine ehrbare, gefestigte Persönlichkeit zuzulegen, weil sich die Unwägbarkeiten des Miteinanders gar nicht wesentlich verändert haben?
Die außerordentliche Hilfsbereitschaft bei den heiklen Fragen des Lebens ist dagegen eindeutig neueren Datums. Als brüskierend distanziert und zugeknöpft gilt, wer weder in Geldangelegenheiten noch zum Sexualleben einen offenherzig bereichernden Erfahrungsaustausch mit jedermann zu pflegen wünscht. Dabei ist es unbestreitbar ein Gebot der Nächstenliebe, der um sich greifenden Orientierungslosigkeit entgegenzuwirken. Die bedauernswertesten Fälle erkennen in geistiger Isolation nicht einmal mehr die gravierenden Mängel, die jegliche Zufriedenheit als unbegründet entlarven.
Das Geldwesen, durch psychopathische Egomanen im Ruf beschädigt, gehört zum Sozialsten, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Dessen gesamte sinnstiftende Existenz steht und fällt mit dem umfänglich geteilten Wertverständnis und der wechselseitigen Bezogenheit des jeweiligen Handelns. Verliert auch nur ein verirrtes Glied das Interesse am universellen Tauschobjekt oder lässt gar die Gemeinschaft durch Konsumverweigerung über den möglichen Einsatz seines gefährlichen Arsenals im Dunkeln, bedroht diese Ignoranz den gesamten Weltfrieden. Ein erfülltes Dasein ist motivierende Zielsetzung und gemeinschaftliches Horrorszenario in einem. Geht es den Freunden bedingungsloser Transparenz etwa doch nicht darum, die Mitmenschen zu verstehen? Kann das Mitgefühl die Konfrontation mit selbstsicherer Glückseligkeit nicht ertragen? Gibt es im Umgang mit Geld nur zwei sich ausschließende Alternativen: gesellig oder vernünftig?
Entspannterweise schließt Intimität per Definition schon einmal alle unvertrauten Personen aus. Jede weitere Konkretisierung bleibt, sofern selbige entscheidungsfähig und freiwillig anwesend sind, den Beteiligten überlassen. Nach drei sexuellen Revolutionen lassen tiefenpsychologisch fundierte, politisch begründete oder praxiserprobte Handreichungen keine noch so ausgefallene Frage unbeantwortet. Umso erstaunlicher ist der Zweifel, der etliche Menschen aus ihrem romantischen Liebesnest an die Öffentlichkeit treibt. Mit der beinahe panischen Sorge, ob das praktizierte Verständnis der Normalität entspricht, gewähren sie bereitwillig Einblick in die Intimsphäre und liefern sich damit nicht selten der Beschlechtachtung zwielichtiger Moralapostel aus. Hat die Angst, etwas zu verpassen, das Verborgene um seinen Reiz gebracht? Verspricht die Abarbeitung externer Checklisten tatsächlich mehr Erfüllung als eine aufeinander konzentrierte Vertrautheit im Wechselspiel von Respekt und Eroberung? Und wie kommt es zu den überraschenderweise unerfüllten Sehnsüchten, die Forscher im vermeintlich sexuellen Eldorado entdeckten?
Selbständigkeit und Geheimniskrämerei gelten nicht zuletzt deshalb als gemeinschaftsschädigend, weil sie die Mitmenschen um die Möglichkeit bringen, einander zu helfen und aufeinander aufzupassen. Wenn mit Wohlstand und Fortpflanzung grundlegende Gemeinschaftsinteressen auf dem Spiel stehen, geht nichts über die akribischen Ermittlungen und den unkomplizierten Sachverstand der besorgten Nachbarschaft. Festgeschriebene Verfahren und umfangreiche Regelungen, die sachfremde Einflüsse, unfaire Vorgehensweisen, übergebührliche Beeinträchtigungen und Fehleinschätzungen bei der Wahrheitsfindung verhindern sollen, riechen dagegen förmlich nach hoheitlicher Bevormundung. Ist es dem friedlichen Miteinander nicht zuträglicher, diese herzlosen Bürokratiemonster beiseite zu lassen und sich stattdessen untereinander lückenlos bis ins letzte Detail zu kennen?
Auch ohne tiefschürfende Spionage ist allseits bekannt, dass sich nahezu jeder mehr Zeit wünscht. Kaum ein anzustrebendes Ziel wird derart einhellig geteilt, wie ein stressfreies Leben in harmonischem Einklang mit dem Kosmos. Die Hinterhältigkeit der Zeit beginnt jedoch bereits damit, jedem Grundansatz zum diesbezüglich richtigen Weg recht zu geben. Ob vorwärts oder rückwärts gerichtete Kreisläufe, vorbestimmte oder beeinflussbare Stränge, konstante oder variable Geschwindigkeit, Einbahnstraße oder Wendemöglichkeit, begrenzt oder offen, Tatsache oder Illusion - jede Vorstellung erfährt ihre offensichtliche Bestätigung.
Immerhin nimmt die Krone der Schöpfung mit ihrem scharfsinnig-detailreichen Wortschatz die einzigartige Position ein, sprachgewaltig über die Gegenwart hinaus in die phantastischen Sphären des Unbegreiflichen vordringen zu können. Die Zeit zeigt sich von dieser herausragenden Leistung allerdings wenig beeindruckt und gewährt demütigenderweise auch wortkargen Lebewesen planende Einblicke in die Zukunft. Selbst die seit Jahrtausenden betriebene Anstrengung, die Geheimnisse des Universums zu lüften und daraus den Kraftstoff für die urmenschliche Ausdauer zu gewinnen, wird mit zeitlichem Hohn vergütet. Je ambitionierter die Nutzbarmachung, desto widersprüchlicher sind die zutage tretenden Eigenschaften des ausbruchssicheren Kerkers. Am Ende geschieht vorher, was später verursacht wird und die simple Einigung zur „Gleichzeitigkeit“ ist ohne Mediator unmöglich.
Auf kurz oder lang gibt es sicherlich nichts, was die Menschheit nicht zu beherrschen weiß. Die mit vereinten Kräften entwickelte zeitliche Koordination mündet allerdings auffallend häufig darin, sich wechselseitig mit unglaublichen Geschichten, beängstigenden Vorhersagen, widernatürlichen Taktungen und niederschmetternden Beurteilungen zu drangsalieren. Schaukeln sich hier die disziplinierenden Maßnahmen aufgrund der „gegenwärtigen“ Eigentumsverhältnisse auf? Offensichtlich ist mit individualistischer Aufdringlichkeit, trotz angeberischer Beschämung der Zeitgenossen und selbstzentrierter Rücksichtsforderungen, ebenfalls kein stressfreies Dasein möglich. Liegt des Rätsels Lösung um die Zeit etwa in der unbescheidenen Kombination aus selbstbewusst wahrgenommener Eigenverantwortlichkeit und selbstloser Bewertung des entsprechenden Eingriffs in das universelle Geschehen?
Weltvergesellschaftung
Leben mit der Untergangsprophezeiung - Wie steht es um Familie, Arbeit und Religion?
Warten auf den Untergang
Es ist schlecht bestellt um unser Dasein: Familie, Arbeit, sogar die religiöse Orientierung und die Hoffnung auf das Jenseits - die großen Propheten unserer Zeit beklagen lautstark den Untergang all dieser Institutionen.
Schuld daran ist - natürlich die Globalisierung. Sie ermöglicht vor allem den wirtschaftlichen Akteuren, sich jeglicher Regulierung zu entziehen. Der gnadenlose Weltmarkt spielt Staaten gegeneinander aus und macht kulturelle Besonderheiten dem Erdboden gleich. Als Deutscher hätte man im Überlebenskampf sicherlich noch eine Chance gehabt. Kulturelle und nationale Errungenschaften verschwinden jedoch achtlos im Einheitsbrei der Weltgesellschaft. Es bedarf keiner separaten Erwähnung, dass sich auf der Weltbühne absolut niemand für den schlichten Menschen und dessen Bedürfnisse interessiert.
Wer gegenteilige Beispiele zu kennen glaubt - alles vermarktungsorientierte Taktik. Hier tritt mit der Individualisierung die Komplizin der Globalisierung auf den Platz. Sie löst die Menschen aus ihren Schutz gewährenden Einheiten heraus. Die Familie hatte von Anfang an keine Chance. Es ist offensichtlich, dass Erziehung und die Weitergabe von Überlieferungen nicht mehr stattfinden. Tradition muss unweigerlich durch Konsum ersetzt werden. Bedauernswert, wer aus Armut heraus nicht konsumieren kann. Erleichternderweise fällt die belastende Orientierung an den Mitmenschen ohnehin der resultierenden Ellenbogen-Mentalität zum Opfer. Gesellschaftliche Belange und die Zukunft nachfolgender Generationen spielen für das Handeln keine entscheidende Rolle mehr.
Die Diagnose ist gestellt. Die Propheten sind sichtlich zufrieden. Mit den beiden Prozessen als Schuldige lässt sich kein persönlicher Adressat ausmachen. Eine weitere Auseinandersetzung wäre bei der vorliegenden Plausibilität sowieso zwecklos. Es wird kommen, wie es kommen muss. Hilfe ist daher nicht zu erwarten. Bleibt zumindest, so lange als möglich durchzuhalten und den Besitzstand zu wahren. Als letzte verbliebene Sicherheit im Leben muss wenigstens die zweifelsfreie Tatsache des kommenden Untergangs erhalten bleiben. Dafür müssen die letzten unverbesserlichen Visionäre zum Arzt geschickt und Optimismus sicherheitshalber als Mangel an Informiertheit klassifiziert werden.
Der Untergang kommt! Es bleiben nur noch zwei wesentliche Fragen offen: Wie viel Zeit bleibt uns noch und was fängt man mit der verbleibenden Zeit an?
Für die augenscheinlich älteste Vorbereitungsmethode braucht es nur ein Boot. Die Größe bestimmt sich je nach Rettungsanspruch und reicht vom Einpersonen-Paddelboot Typ „Ego“ bis zum artenerhaltenden Stallboot Typ „Arche“. Früher eher selbst gebaut, vertraut man heutzutage auch gerne mal auf bereits vorgefertigte Modelle, die in Eigenleistung immerhin noch selbst auf einen Berg geschafft werden müssen. Allerdings empfiehlt sich diese Vorbereitungsart nur dann, wenn mit einem baldigen Auftreten großer Wassermassen gerechnet wird.
Eine andere, erstaunlich häufig vorfindbare Methode deckt nicht nur ein breiteres Szenario ab, sie eignet sich zudem auch für einen mittel- bis langfristigen Erwartungshorizont. Technisch auf der Höhe der Zeit, gestaltet sich das Abwarten mit einem hauseigenen Bunker natürlich weit weniger einschränkend als die klassische Variante auf dem Berg. Allerdings bleibt ungeklärt, ob man den Bunker jemals wieder wird verlassen können.
Beide Ansätze gehen irrtümlich von einem Danach aus. Dabei legt der verbreitete Fatalismus eigentlich eher eine schnelle, stoische und damit zumindest selbstbestimmte Beendigung nahe. Trotz offensichtlicher Sinnlosigkeit, ordnet der Pflichtbewusste zunächst noch seinen Nachlass. Möglicherweise ist das traurige Schicksal auch leichter zu ertragen, wenn der Abschlussbericht offenbart, an welcher Stelle die fatale, die falsche Entscheidung gefällt wurde. Schließlich, und das wird niemand wirklich bezweifeln, war früher einmal alles eindeutig und damit selbstverständlich auch besser:
„Familie“ stand für eine uneingeschränkte Harmonie. Niemand kam auf die Idee, die familiale Ordnung, die jedem seinen Platz und seine Aufgabe zuwies, in Frage zu stellen. Die Kinder konnten wohlbehütet aufwachsen. Gewährleistet wurde dies durch die liebevolle, aufopfernde Mutter und durch den, selbstverständlich biologisch dazugehörenden, Vater. Dieser übernahm uneigennützig die wirtschaftliche Versorgung der ganzen Familie. Die daraus begründete Stellung als Familienoberhaupt, mit uneingeschränkter Entscheidungsbefugnis, war in Anbetracht der Schwere dieser Aufgabe nur ein kleiner Dank.
„Unternehmer“ stand für Verantwortung und Anstand. Der Gewinn spielte für den Großteil der Menschen nur bei der Lotterie eine Rolle. Heuschrecken fand man ausschließlich auf der Wiese und erfreute sich an deren musikalischem Zirpen. Das Arbeitsleben war wohlgeordnet. Jeder wusste genau, wann im Leben eine entscheidende Veränderung anstand. Zuerst kommt die Schule, danach der Beruf und schließlich der wohlverdiente Ruhestand. Der Chef gab die Richtung vor und garantierte im Rahmen eines väterlichen Verhältnisses ein geordnetes Dasein auf Lebenszeit. Damit war dieser in jeglicher Hinsicht auch Vorbild für die Organisation innerhalb der Familie.
„Glaube“ war weder das Gegenteil von Wissen noch ein Diskussionsangebot. Jeder wusste sofort nach der Geburt, was er glaubte und kam diesem unmissverständlichen, göttlichen Willen in Demut und Reue auch zeitlebens nach. Es gab nur die eine, die wahre Religion. Diese gab Halt und Orientierung. Selbstverständlich kümmerte sich die Kirche auch um den privaten und intimen Bereich im Leben. Wer sonst hätte hier als Vorbild im Umgang mit den sündhaften Versuchungen fungieren können. Das Böse war damit ebenfalls zweifelsfrei eingegrenzt. Alle diejenigen, die den eindeutigen Aufforderungen Gottes, vertreten durch die Kirche, nicht Folge leisteten, waren für jeden offensichtlich vom Teufel besessen. Die Härten des Alltags ermöglichten in besonderer Weise ein gottgefälliges Leben und garantierten die alles entscheidende Belohnung im Himmel.
Der Verfall der Familie
Was ist aus der Familie nur geworden? Die Entwicklung war so vielversprechend. Dabei kam der Begriff „Familie“ in unseren Breiten erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf.
Vorher hatten die Menschen offensichtlich wenig bzw. einen eigenwilligen Sinn für Ordnung. Ab dem 14. Jahrhundert war zumindest so etwas wie ein „Haushalt“ vorherrschend. In der Regel zählten zu einem Haushalt meist ein Vater, eine Mutter, viele Kinder, Knechte, Mägde, Verwandte und Untermieter. Man schien sich allgemein auch recht gut zu verstehen. Das Zusammenleben dieser Haushaltsmitglieder spielte sich nämlich meist in nur einem Raum ab. In diesem wurde gearbeitet, gegessen und geschlafen. Nichts davon hätte selbst den Blicken der dörflichen bzw. städtischen Gemeinschaft entzogen werden müssen. Der Haushalt war mehr oder weniger ausschließlich für die Ernährung der in ihm lebenden Menschen verantwortlich. Er war eine Produktionseinheit. Unabhängig dessen, ob die Tätigkeit im bäuerlichen, handwerklichen oder protoindustriellen Bereich angesiedelt war. Verständlich, dass dabei materielle Motive und zusammenpassende Arbeitskompetenzen die Grundlage der Ehe waren. Wo die Härte der Zeit eine emotionale Beziehung zuließ, war diese immerhin durch eine patriarchale Struktur geprägt. Die Frau soll arbeitsfähig und gehorsam sein. Durch die fehlende Zeit für die Kinder kam es auf die mütterlichen Fähigkeiten sowieso nicht unbedingt an. Die Umsorgung der Kinder war ab dem 3. bzw. 5. Lebensjahr durch die Einbindung in den Arbeitsprozess gewährleistet. Um das Versorgungspotential des Haushalts nicht Übergebühr zu beanspruchen, war es nicht unüblich, dass die Kinder relativ früh die Eltern verlassen mussten. Sie wurden weggeschickt, um bei Verwandten oder auch Fremden in Dienst zugehen. Das Wohlbefinden der Kinder gehörte dabei nicht unbedingt zu den vordringlich zu berücksichtigenden Aspekten. Teilweise sahen diese Kinder ihre Eltern nie wieder.
Die gehobeneren Ständen lebten sicherlich nicht unbedingt in dieser räumlichen Enge. Für den Umgang mit den Nachkommen dürfte auch weniger ein materieller Hintergrund ausschlaggebend gewesen sein. Vielmehr stand dort eine öffentlich repräsentative Lebensweise der Kinderbetreuung entgegen. Die Kinder wurden entsprechend von Kindermädchen und/oder dem Dienstpersonal versorgt. Im Vergleich zu jenen aus ärmeren Schichten dürfte diesen zumindest die schwere körperliche Arbeit erspart geblieben sein.
Es wird allgemein angenommen, dass die damals nicht unübliche mehr als verhaltene emotionale Beziehung zu den Kindern möglicherweise auf die große Anzahl derer und die allgemein ohnehin hohe Kindersterblichkeit zurückging. Es wird zwischenzeitlich ebenfalls angenommen, dass auch die Mehrgenerationenfamilie in Westeuropa aufgrund der geringen Lebenserwartung zwischen 35 und 40 Jahren nicht unbedingt vorherrschend war. Dieses idyllische Bild der Großfamilie war wohl doch eher eine auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts zu datierende Erfindung der Sozialwissenschaftler.
Die Idylle kommt aber spätestens mit der traditionellen bürgerlichen Kleinfamilie. Diese besteht aus einem verheirateten, auf jeden Fall und unbedingt verschiedengeschlechtlichen Paar, das mindestens mit einem Kind zusammenlebt. Zum erweiterten Kreis der Familie gehören fortan nur noch Blutsverwandte. Geheiratet wird nun nicht mehr aus materiellen Gründen, sondern selbstverständlich aus Liebe und Zuneigung. Eine Unterscheidung zwischen Ehe und Familie ist eigentlich überflüssig. Die Partnerschaft ist auf das gesamte Leben ausgelegt und verlangt das absolute Bekenntnis zur ewigen, monogamen Treue. Das Kinderbekommen gibt dem Rückzug in die Privatsphäre ihren Sinn. Das Private ist fortan der einzige Platz für emotionales Wohlbefinden und verbindet sich mit Wärme, Nähe, Sicherheit und Ruhe.
Die Schaffung dieser Oase ist der bürgerlichen Trennung von Erwerbsarbeit und Familie sowie der dazugehörenden geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung zu verdanken. Der Mann verlässt tagsüber das Haus, um schwer arbeitend seiner Rolle als Alleinverdiener gerecht zu werden. Die Frau darf selbstverständlich den ganzen Tag im Wohlfühlbereich des Privaten bleiben. Im Gegenzug hat sie sich mit bedingungsloser Liebe um das Wohl des Mannes und der Kinder zu kümmern. Die Sorge des Mannes um die Frau ist bei genauer Betrachtung aber nicht weniger tiefgründig. Sie darf sich nun voll und ganz auf die familieninternen Aufgaben konzentrieren, die früher nebenbei erledigt werden konnten und auch mussten.
Eine Scheidung aus diesem Idyll kann niemand wirklich wollen. Entsprechend ist diese nur für absolute Ausnahmefälle vorgesehen und stark sanktioniert. Der meist einhergehende gesellschaftliche Ausschluss und die materielle Verarmung mussten sich die Frauen schon selbst zuschreiben. Immerhin setzt die Schaffung der privaten Oase eine nicht gerade geringe Anstrengung des Mannes voraus. Zwar lässt die Bescheidenheit vieler Männer dies nicht unbedingt erkennen, aber vor allem in unteren Schichten ist diese geschlechtsspezifische Rollenverteilung aus materiellen Gründen eher selten praktikabel.
Für den informierten Beobachter ist es wohl wenig überraschend, dass diese Anstrengungen, gerade seit den 1960er-Jahren, enorm an Stellenwert verloren zu haben scheinen. Zunächst begann die Anzahl der Scheidungen zu steigen. Seit den 1970er-Jahren überschlagen sich dann die familienbezogenen Ereignisse. So sinkt seither die Zahl der Eheschließungen, dafür steigt das durchschnittliche Alter bei der Heirat. Das gleiche ist bei den Geburten zu beobachten. Die Statistik verzeichnet einen stetigen Geburtenrückgang bei deutlich steigendem Alter der Erstgebärenden. Und wenn von einer steigenden Zahl berichtet werden kann, dann sind das die Geburten unehelicher Kinder und nichtfamilialer Haushalte. Was läuft hier nur schief? Was treiben die Menschen innerhalb der Familien?
Mit einem Satz beantwortet: Vorgaben von außen raus und vieles, aus ursprünglich familienfremden Bereichen, rein. Als erstes werden alte Zusammenhänge auseinander gebrochen: Liebe und Ehe, Ehe und Elternschaft, biologische und soziale Elternschaft gehören nicht mehr selbstverständlich zusammen. Was unter Familie jeweils verstanden werden soll, muss nun von den Paaren in Abstimmung mit ihren jeweiligen Lebensbedingungen selbst ausgehandelt werden. Es wird geunkt, diese Entwicklung sei einzig und alleine auf die veränderten Möglichkeiten der Frau zurückzuführen. Das scheint bei den neuen Begrifflichkeiten auch durchaus naheliegend. Welcher Mann käme auf die Idee einer „pragmatischen Verhandlungspartnerschaft“ oder einer „Konsensualpartnerschaft“. Auch der völlige Rückzug aus der Öffentlichkeit in das Private und die einhergehende Bedeutungsaufladung der Partnerschaft scheint eindeutigen Ursprungs zu sein. Bereits heute muss man drei „Privatheitstypen“ mit ihrer jeweils charakteristischen Orientierung unterscheiden. Von der „Normalfamilie“ wird nur noch gesprochen, wenn die Orientierung auf die Kinder gerichtet ist. Daneben findet sich noch ein partnerschaftsorientierter und ein individualistischer Typus. Die ideale Partnerschaft vor Augen wird die ehemalige Oase der Ruhe mit riesigen Erwartungen und Ansprüchen beladen. Mit der unweigerlich zunehmenden Diskrepanz zwischen Lebensentwürfen und Umsetzungsmöglichkeiten sind Konflikt und Disharmonie gesät und damit das Ende der Verhandlungspartnerschaft besiegelt.
Hier schnappt nach herrschender Meinung die sogenannte Modernisierungsfalle zu. In Zeiten unbegrenzter Möglichkeiten sind die finanziellen Hindernisse eine unerträgliche Demütigung. Dass die „Verwirklichungschancen“ in erster Linie mit der Aneignung notwendiger Fähigkeiten und der bisweilen frustrierenden Arbeit am gesetzten Ziel in Verbindung stehen, scheint bei dieser Diagnose unbeachtlich zu sein. Scheitern die Familien tatsächlich schlicht und einfach am Geld?
Der Blick auf die familiale Arbeitsteilung innerhalb der neuen Lebensentwürfe offenbart eine andere Problemlage. Zwar gibt es unter den Männern eine zunehmende Zahl an Vorreitern, die Partnerschaft nicht grundsätzlich nach Geschlechterrollen gestaltet sehen wollen. Insgesamt wird das Thema aber lieber besprochen als an dessen Umsetzung gearbeitet. Materielle Hintergründe dürften hierbei nicht unbedingt eine Rolle spielen. Zwischenzeitlich werden die unter Umständen einhergehenden finanziellen Einbußen zumindest teilweise durch den Staat abgefedert. Man spricht von einer verbalen Aufgeschlossenheit bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Junge Männer können sich noch am ehesten vorstellen, Erziehungsurlaub zu nehmen. Allerdings wird die Kindererziehung dann nicht, wie bei den Frauen, als Hausarbeit, sondern als Form der Selbstverwirklichung charakterisiert. Dass die praktizierte Unterschiedslosigkeit der entsprechenden Einsicht hinterherhinkt, scheint allerdings nicht alleine am Rollenverhalten der Männer zu liegen. Bei der Hausarbeit wird sogar von einer Re-Traditionalisierung gesprochen. Die übernommenen Tätigkeiten lassen sich angeblich immer noch geschlechtsspezifisch nach drinnen-draußen, leicht-schwer, fein-grob und trocken-nass trennen. Viele Frauen bleiben also trotz zunehmender Erwerbstätigkeit hauptsächlich und meistens alleine für den Haushalt zuständig.
Einige Erklärungsansätze hierfür erinnern stark an eine Unternehmensberatung. So werden Investitionen in die Beziehung zur Nutzenmaximierung herausgearbeitet. Auch die Kinder werden in diese Kosten-Nutzen-Kalkulation einbezogen. Der Kinderwunsch sei das Ergebnis der Abwägung des Konsum-, Einkommens und Versicherungsnutzens eines Kindes. Stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wann die ersten Familien an der Börse notiert werden. Bemerkenswert und von den Männern tunlichst zu beachten ist auch der „Gender-Display-Ansatz“: Wenn die Frauen in der Beziehung schon die Hauptverdienerinnen sind, wollen sie wenigstens zu Hause durch die Übernahme der Hausarbeit ihre weibliche Rolle betonen.
Der Untergang der „Familie“ kann also eher nicht den Frauen in die Schuhe geschoben werden. Ist diese Redewendung überhaupt noch zeitgemäß? Vielleicht lässt sich der Untergang der Familie den Frauen zumindest in die High Heels schieben? Schließlich sind sie durch das umfänglichere Erwerbsengagement aus der alten Versorgungsnotwendigkeit durch die Männer herausgelöst. Das schöne Druckmittel der Verarmung bei einer Scheidung zieht in diesen Fällen nicht mehr. Entsetzt sind vor allem jene Männer, die primär die Konformität und weniger die Individualität ihrer Angetrauten besonders lieben. Der Anteil an Vollzeit erwerbstätigen Müttern ist relativierend allerdings kontinuierlich gesunken. So arbeiten Frauen mit Kindern vor allem in Teilzeit und geringfügiger Beschäftigung. Auch wenn sich im Osten Deutschlands noch stärker das Doppelversorgermodell findet, sind die Frauen primär Zuverdiener, so dass das Ernährermodell fortan lediglich als „modifiziert“ bezeichnet werden muss. In Anlehnung an den Soziologen Rüdiger Peuckert (1944 bis 2018) könnte die von Müttern überwiegend eingegangene Zerreißprobe zwischen Familie und Beruf damit in Zusammenhang stehen, dass weder die absolute Konzentration auf Mann und Nachwuchs noch die Unterordnung derselben zugunsten der Karriere mit vergleichbaren Zufriedenheitswerten einhergeht.
Das Auftreten der letzten Kategorie, die reine Berufsorientierung, wird immer wieder als Folge der Individualisierung bezeichnet. Entsprechend ausgeschmückt als Karrierefrau, die über Leichen geht - vor allem die der nicht geborenen Babys. Selbst wenn ein Alibi-Kind existiert, könnten es unter anderen Umständen schließlich mehrere Kinder sein. Ein anderes Phänomen ist allerdings für die Individualisierung wesentlich charakteristischer. Zumal sich dieses Phänomen in allen drei Orientierungskategorien findet. So hat sich das Deutungsmuster verändert. Unabhängig welche Orientierung vorliegt, sie wird als eigene Entscheidung und nicht mehr als Entsprechung der normativen Vorgabe gewertet. Die Gewissheit der einen und unumstößlich richtigen Lebensform gibt es nicht mehr. Die Konfrontation mit unterschiedlichsten Alternativen führe entsprechend zur völligen Orientierungslosigkeit. Dabei fällt immer wieder auf, wie wenig den Menschen bei ihrer Lebensgestaltung zugetraut wird. Die aktive Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten als Kern der Individualisierung birgt zwar Risiken eigener Natur, denn getroffene Entscheidungen können sich durchaus auch als falsch erweisen. Doch führt sie bestenfalls zu einem ehrlicheren Umgang mit sich und seinen Mitmenschen. Im Zweifel mussten die Rollenmuster der bürgerlichen Kleinfamilie ein Leben lang ertragen und durchlitten werden. Der Familie als solcher würde jedoch ein zweifelhaftes Zeugnis ausgestellt, wenn diese alleine aufgrund von Alternativen dem Untergang geweiht wäre. Anders sieht die Bewertung aus, wenn zwar die Akzeptanz institutionell vorgegebener Rollenmuster abnimmt, die ausgehandelte Praxis aber durchaus Parallelen zur traditionellen Familie aufweist.
In der äußeren Erscheinung dominiert statistisch immer noch das traditionelle Familienmodell. Die Ehe ist allerdings nicht mehr die erste Wahl. Geheiratet wird meist erst nach der Geburt eines Kindes. Früher legitimierte die Ehe das Kind, heute legitimiert eben das Kind die Ehe. Zur Bestimmung von „Familie“ wird das Primat der Ehe sogar völlig aufgegeben. Verheiratet oder nicht-verheiratet ist nicht länger relevant. Die Elternschaft begründet jetzt Familie. Das bisher Undenkbare braucht nun einen Namen. Im Angebot sind u.a. „uneheliche Familie“, „Fortsetzungsfamilie“, „Patchworkfamilie“, „Einelternfamilie“, „Ein-Elternteil-Familie“.
Wie soll man sich bei diesem Durcheinander allerdings von außen noch ein Bild machen können, wer wie zusammengehört? Glücklicherweise findet sich bei den Soziologen Johannes Huinink und Dirk Konietzka eine hilfreiche, fünfstufige Einordnungsschablone für die Lebensform einer Person:
1. Existenz einer Paarbeziehung
Paarbeziehungen werden weiterhin als sehr bedeutsam eingestuft. Partnerwechsel müssen hier allerdings bezüglich der Dauer geprüft werden. Neben der „Traditions- bzw. Kontinuitätsbiographie“, charakterisiert durch langfristige feste Beziehung, hat sich nämlich die „Kettenbiographie“ etabliert. Dabei handelt es sich um mehrere feste Beziehungen in Folge. Vorsicht, die augenscheinliche Einstufung als alleinstehender Single kann erst nach Überprüfung des zweiten Punktes sicher vorgenommen werden.
2. Existenz einer Lebensgemeinschaft
Es könnte sein, dass zwar eine Paarbeziehung vorliegt, diese aber nicht in einem gemeinsamen Haushalt praktiziert wird. Das „Getrennt Zusammenleben“ bzw. „Living Apart Together“ findet sich wie die uneheliche Lebensgemeinschaft häufig bei Jüngeren. Aber auch Ältere wählen nach Beendigung einer festen Beziehung häufig diese Haushaltsform.
3. Institutionalisierungsgrad der Paarbeziehung
Die Heiratsneigung ist insgesamt zwar gesunken. Sie ist aber immer noch relativ hoch. Der Institutionalisierungsgrad sollte deshalb nicht vorschnell aus den Augen verloren werden. Immerhin wird die nichteheliche Lebensgemeinschaft selbst von vielen Anwendern nicht generell als andauernde Alternative angesehen. Hoffnung für Traditionalisten schüren hier Bezeichnungen wie „voreheliche Lebensgemeinschaft“ und „Ehe auf Probe“. Primär im großstädtisch-alternativen Milieu ist der Würfel allerdings gegen die Ehe gefallen.
4. Vorherrschendes Erwerbsarbeitsmodell
Früher war die Einstufung, wer wie die Familie ernährt, noch relativ einfach. Man musste lediglich beobachten, wer zwischen 7.00 und 8.00 Uhr das Haus verließ und zwischen 16.00 und 17.00 Uhr wieder zurückkehrte. Durch die neuen Möglichkeiten und Arbeitsformen, beispielsweise das „Homeoffice“, ist diese Einstufung von außen heute besonders schwierig. An- und Abwesenheitszeiten können hier nicht unbedingt als Indikator herangezogen werden. Auch das Antreffen der betreffenden Person zu den üblichen Arbeitszeiten in der Öffentlichkeit, spricht nicht generell für eine vorliegende Arbeitslosigkeit oder eine Arbeitsverweigerung.
5. Kinder
Diese Einstufung ist wieder einfacher. Macht sich durch Lärm oder sonstige Zumutungen ein Kind bemerkbar, handelt es sich um eine „familiale Lebensform“. Zu unterscheiden ist dann lediglich noch, wer wie zusammengehört. Ob die Elternschaft also biologisch oder sozial begründet ist. Ohne Kind liegt eine „nicht-familiale Lebensform“ vor. Wenn Kinder im Spiel sind, hört der Spaß sowieso auf. Die gesellschaftlichen Forderungen beschränken sich hier jedoch nicht nur auf die einzuhaltenden Ruhezeiten. Während die Labilität von Partnerschaften allgemein noch eher akzeptiert wird, wird für die Elternschaft Bindung gefordert. Entsprechend hat zwar der Verbindlichkeits- und Verpflichtungscharakter der Ehe, nicht aber der Familie abgenommen. Innerhalb der Familien kommt es zu einer Bedeutungszunahme der Kinder. Diese sind nicht mehr nur selbstverständlicher Bestandteil der Beziehung. Kinder sind heute ein Ergebnis bewusster Entscheidung. Vereinzelt wird sogar bemängelt, dass die resultierende Zentrierung auf das Kind zu einer Vernachlässigung der Paarbeziehung führe. Insgesamt wird die Familie von allen Bevölkerungsgruppen, verstärkt auch von Jugendlichen, immer noch als sehr wichtig und für die eigene Zufriedenheit als sehr bedeutend eingestuft.
Spätestens jetzt stellt sich allerdings die Frage, weshalb dann überhaupt im Generellen gewährleistet sein muss, dass man sich von außen ein Bild über das Innen der Familien machen kann. Die Antwort ist so brisant wie einfach. Die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, dass die Familie durch Reproduktion und Sozialisation die quantitative und qualitative Nachwuchssicherung gewährleistet.
Nicht mehr und nicht weniger.
Die besten Kontrolleure sind - wie im Baurecht - nun einmal die Nachbarn. Diese Beobachter stufen die Nachwuchssicherung, wahrscheinlich in Ermangelung der eben dargestellten Einordnungsschablone, als eindeutig gefährdet ein. Es drängt sich hier allerdings der Verdacht auf, dass bei der Vielfältigkeit der Lebensformen vor allem die Kontrollierbarkeit und nicht die „Familie“ gefährdet ist.
Die quantitative Nachwuchssicherung scheint jedenfalls nicht per se mit den Veränderungen verbunden zu sein. In Schweden findet sich beispielsweise eine der stärksten Pluralisierungen der Lebensformen. Gleichzeitig hat Schweden allerdings auch eine der höchsten Geburtenraten Europas. In Italien wiederum kennt man kaum Formen außerehelichen Zusammenlebens. Die Fortpflanzungstätigkeit ist dennoch, zumindest bezüglich des erhofften Ergebnisses, eher niedrig. Die resultierende Empfehlung läge auf der Hand, gliche beispielsweise Irland bei den Beziehungsformen nicht Italien und überträfe bei der Geburtenrate dabei sogar noch Schweden. Es erscheint insgesamt wenig erfolgsversprechend, die Geburtenrate über staatliche Lenkungsmechanismen beeinflussen zu wollen. So wird davon ausgegangen, dass staatliche Maßnahmen, wenn sie überhaupt einen Effekt zeigen, dazu führen, dass eine ohnehin geplante Geburt lediglich zeitlich vorverlagert wird.
Bei der qualitativen Nachwuchssicherung scheint der Verfall allerdings schon offensichtlicher. Wenn die allgemein akzeptierten normativen Verbindlichkeiten keine uneingeschränkte Anwendung mehr finden, muss die Kindererziehung scheitern. Aber von was ist hier eigentlich die Rede - Erziehung? Scheitert diese in der heutigen Zeit, weil die körperliche Züchtigung nicht mehr Bestandteil sein darf? Haben die Vertreter der 68er-Bewegung die Pädagogik kaputt gemacht? Wie konnte dann deren eigene, an Tradition orientierte Erziehung zu einer derartigen Entgleisung führen? Fragen über Fragen.
Erziehung ist ganz allgemein zunächst ein Bestandteil der Sozialisation. Sie bezeichnet abgrenzend dabei die bewussten und gezielten Einflussnahmen auf die Persönlichkeitsentwicklung. Die Bedeutung dieser Entwicklung kann kaum zu hoch eingeschätzt werden. Ein Autor spricht sogar von der „zweiten Geburt“. Die erste Geburt bringt entsprechend lediglich den physischen Menschen hervor. Erst durch die zweite Geburt hat man es mit einer soziokulturellen Person zu tun. Ob diese zweite Niederkunft weniger Schmerzen verursacht als die erste, ist nicht untersucht. Jedenfalls dauert sie wesentlich länger. Schließlich beinhaltet sie nicht nur die erste emotionale Fundierung, sondern auch erste rudimentäre Kategorien des Weltverstehens und des Weltvertrauens. Auf diese erste soziale Positionierung kann dann die Vermittlung der Kultur, die sogenannte Enkulturation erfolgen. Dabei führt die Interaktion mit den Erziehungspersonen zu einer spezifischen individuellen bzw. sozio-kulturellen Prägung. Die Kinder werden im Zuge dessen also auf die spätere Übernahme ihrer sozialen Rollen in der Gesellschaft vorbereitet. Weshalb später das schon früh erworbene Weltvertrauen augenscheinlich mit zunehmendem Kenntnisstand wieder abnimmt, bleibt ein Rätsel, an dem auch die Untergangspropheten scheitern. Sie weisen jedenfalls jegliche Unterstellung der Mittäterschaft zurück. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle jedoch, dass die Sozialisation nicht alleine in der Verantwortung der Familien liegt. Es werden insgesamt drei Sozialisationsinstanzen unterschieden. Die primäre Instanz ist die Familie. Als sekundäre Instanz kommen dann die Schule und allgemeine Bildungseinrichtungen hinzu. Die tertiäre Instanz fasst den verbleibenden Rest zusammen. Darunter fallen Freizeitorganisationen und die Gleichaltrigen ebenso wie die Medien. Wenn es allerdings keine allgemeingültigen Verbindlichkeiten mehr gibt, wo soll diese institutionelle Erziehung dann anknüpfen? Alleine innerhalb der Familien komme es bereits zu einem enorm hohen Kommunikationsaufwand und unweigerlich zu einhergehenden Konflikten und Partnerschaftsproblemen. Ganz zu schweigen von den entsprechenden Bedingungen für die geforderte Erziehungspartnerschaft. Hier sollen alle an der Erziehung eines Kindes Beteiligten - Eltern, Großeltern, Verwandte, Lehrer, Vereinsbetreuer etc. - dafür Sorge tragen, dass das Kind in seiner Erziehung eine einheitliche Linie erfährt. Rüdiger Peuckert stellt diesbezüglich vier Kategorien zur Wahl: Der „reife Erziehungsstil“ beinhaltet deutliche Forderungen in Verbindung mit emotionalem Rückhalt. Der sogenannte „naive Erziehungsstil“ setzt voll und ganz auf die familiale Wärme. Mit Leistungsansprüchen wird das Kind nicht behelligt. Umso kälter erscheint vor diesem Hintergrund der „gleichgültige Erziehungsstil“. Hier wird, außer Selbständigkeit, nichts gefordert, aber auch nicht gekuschelt. Vor der 68er-Bewegung gang und gäbe, wird die selten gewordene Kombination aus überzogenen Erwartungen und bemerkenswerter Gefühlsarmut nunmehr sogar als „paradox“ bezeichnet.
Vorreiter sehen bezüglich der anzuwendenden Erziehungsmethode auch die Kinder selbst in der Verantwortung. Diese müssten schließlich selbst am Besten wissen, welcher Stil für sie individuell der passendste ist. Warum sollen sie also nicht ihre Bedürfnisse und Erwartungen in den entsprechenden Verhandlungen mit einfließen lassen? Nicht völlig unbegründet erscheint zumindest die Feststellung, dass gerade aus dem entsprechenden Aushandlungsprozess auch eine bemerkenswerte Interaktionskompetenz erwachsen könnte. Ein vorbildliches Beispiel stellt immerhin Felix dar, der mit 13 Jahren bereits seine erste Rede vor den Vereinten Nationen in New York gehalten hat. Eine allgemeine Empfehlung wäre allerdings noch verfrüht. Mit Blick auf die Langzeitwirkung sollte zuvor erst noch das Experimentierstadium abgeschlossen werden. So berichtete beispielsweise auch Freiherr zu Guttenberg davon, dass er bereits als Kind redegewandt vor Publikum auftreten musste. Es kann nun nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass das im Zuge seiner Dissertation gezeigte Leistungsverständnis ursächlich auf diese Erziehungsmethode zurückzuführen ist.
Gesicherte Erkenntnisse liegen allerdings bereits zum Zusammenhang von Interaktionskompetenz und Familienform vor. Der Erwerb der Interaktionskompetenz hängt erwiesenermaßen nicht von der Familienform selbst, sondern von der Beziehungsqualität ab. Die Beziehungsqualität wiederum zeigte keinen eindeutigen Zusammenhang zu finanziellen und zeitlichen Belastungen, wie sie für verschiedene Familienformen grundsätzlich angenommen werden. Vielmehr zeigte sich überraschenderweise hier eine negative Wechselwirkung mit den Kontrolleuren. Bei allen gegebenen Schwierigkeiten beeinträchtigen im Ergebnis nicht die alternativen Lebensformen selbst, sondern vor allem deren Stigmatisierung die Entwicklung der betroffenen Kinder.
Zugegeben, „Chinesisch für Fortgeschrittene im Alter von 3 bis 5 Jahren“ und „Voltigieren für Krabbelkinder“ wird meist von einer anderen Klientel besucht. Aber ist es vielleicht sogar denkbar, dass sich die sogenannten problembehafteten Familienformen letztlich als Kompetenzzentren für die zunehmend ebenfalls an Bedeutung gewinnenden „soft skills“ erweisen?
Als „problembehaftet“ werden Familien in erster Linie eingestuft, wenn eine Scheidung vorliegt. Die Scheidungserfahrung ist bekanntermaßen für alle Beteiligten dauerhaft beeinträchtigend. Dabei haben Frauen eher Probleme mit der Situation vor der Trennung, bei Männern ergeben sich die Probleme eher hinterher. Vor allem aber für Kinder kann die Scheidung zu einer traumatischen Erfahrung werden. Nach amtlichen Daten war im Jahr 2016 bei gut der Hälfte aller Fälle Nachwuchs im Spiel. Man geht zwischenzeitlich allerdings davon aus, dass die Scheidung als solche nicht alleine bewertet werden kann. Als problemgenerierend erwies sich nämlich weniger die Trennung, als vielmehr der wechselseitige Umgang vor und nach der Scheidung. Ungezügelte Streitigkeiten vor dem Kind und die Instrumentalisierung dessen für Einzelinteressen sind der effektivste Weg, das Kindeswohl zu beeinträchtigen. Diese Situation vor Augen, plädiert die klinisch orientierte Scheidungsliteratur für eine radikale und vollkommene Trennung. In der Praxis zeigt sich allerdings, dass für die Kinder die Beziehungspflege zu beiden Elternteilen elementar wichtig ist.
Bei der Scheidung wird entsprechend also nur das Ehesystem, nicht aber das Eltern-Kind-System gelöst. Man spricht fortan von der Fortsetzungsfamilie. Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von möglichen Familienkonstellationen. Die prominenteste Vertreterin ist die Patchworkfamilie. Bei diesen Familien ist die Situation meist noch relativ einfach zu erfassen. Väter und Mütter aus vorangegangenen Beziehungen bekommen in einer neuen Ehe weitere, gemeinsame Kinder. Die sicherlich älteste Variante ist die Stieffamilie. Zwar wird der Begriff „Stieffamilie“ teilweise auch als Synonym für Fortsetzungsfamilie verwendet, primär wird damit jedoch entweder eine Familie bezeichnet, bei der nach dem Tod eines Partners eine Wiederverheiratung erfolgt oder wenn zu den eigenen Kindern bzw. anstatt eigener Kinder fremde Kinder aufgenommen werden. Neben diesen noch relativ überschaubaren gibt es auch Familienkonstellationen, in denen die Mitglieder nur Ausschnitte einer gemeinsamen Familie teilen. Im Extremfall lebt jede beteiligte Person eine andere Familie. Mittelpunkt, Umfang und Ränder sind dann für jedes Familienmitglied unterschiedlich definiert. Dieser Hintergrund verdeutlicht besonders anschaulich, was bereits der französische Soziologe Emile Durkheim (1858 bis 1917) sinngemäß feststellte: Verwandtschaft begünstigt zwar die Zusammengehörigkeit, diese muss jedoch durch ein aktives Näherrücken erst entstehen. Bei den Formen der Fortsetzungsfamilien muss Familie erst recht durch jeden aktiv hergestellt und organisiert werden. Sie kann dabei durchaus eine Aufwertung erfahren. Die entsprechenden Beziehungen sind frei gewählt und damit auch bewusst gewollt. Das ist mehr als man in mancher Normalfamilie vorfindet. Die zugrunde liegende Aufgabe hört sich zwar anstrengend an, scheint aber ein sehr fruchtbarer Prozess zu sein. Die soziale Eltern- und Verwandtschaft gewinnt gegenüber der biologischen enorm an Bedeutung. Es wird davon ausgegangen, dass ungefähr jedes vierte minderjährige Kind mit den sozialen Eltern nur teilweise oder gar nicht verwandt ist. Die meisten Kinder erleben im Zuge dieser aktiven Familienherstellung jedoch nicht den Verlust eines Elternteils, sondern werden zu „elternreichen“ Kindern. Hierfür kommt es vor allem darauf an, dass die Fortsetzungsfamilien Grenzen finden, die den neuen sozialen Elternteil einschließen und den nunmehr abwesenden biologischen Elternteil nicht ausschließen. Nach Rüdiger Peuckert ist ein kindorientierter Umgang zwischen den Expartnern gar nicht so selten. Selbst wenn die biologischen Eltern ihren Konflikt nach der Scheidung nicht lösen können, organisieren manche eine Art „parallele Elternschaft“, die den Nachwuchs vom Kampfgeschehen fernhält. Was die soziale Elternschaft anbelangt, so dauert es in der Regel 5 Jahre, bis zwischen den Kindern und dem neuen Elternteil eine tragfähige Beziehung entstanden ist. Insgesamt bewältigen die meisten Trennungskinder ihre Situation mittel- bis langfristig jedoch problemlos.
Es gibt bei genauer Betrachtung also weder einen Grund, die unterschiedlichen Formen der Fortsetzungsfamilien und deren Mitglieder herabwürdigend zu beäugen, noch deren Erziehungsqualität in Frage zu stellen. Diese Familienformen bieten augenscheinlich vielmehr tatsächlich ein enormes Erfahrungspotential für das Leben in der Weltgesellschaft. Die hierfür entscheidende „Weltbewusstheit“ setzt, in Anlehnung an den Soziologe Rudolf Stichweh, keinesfalls teure Exkursionen in die entlegensten Winkel der Erde voraus. Zum einen ändert die Anzahl bereister Orte nichts an der Grundhaltung, ob andere Lebensauffassungen bestenfalls toleriert oder aber tatsächlich mit Respekt akzeptiert werden. Zum anderen konfrontiert der Weltvergesellschaftungsprozess jeden Einzelnen auch zu Hause damit, dass seine Lebensweise weder die einzige noch die vortrefflichste Möglichkeit ist. Ein Sachverhalt, der den Mitgliedern einer „Nicht-Normal-Familie“ sicherlich mehr als vertraut erscheint. Die entsprechenden Erfahrungen und die Bewältigungsformen, die Kinder im Rahmen einer gelungenen Fortsetzungsfamilie erwerben können, sind für ein Leben mit der Vielfalt der Weltgesellschaft jedenfalls alles andere als hinderlich.
Die Umgangsformen innerhalb der Familie und damit auch das Eltern-Kind-Verhältnis haben sich in den letzten Jahren allgemein gewandelt. Vor allem die Machtbalance zwischen Eltern und Kind ist durch eine Emanzipation der Kinder geprägt. Der Befehlshaushalt, mit seinem autoritären, strengen und strafenden Erziehungsstil, ist überwiegend durch den Verhandlungshaushalt abgelöst worden. Problematischerweise ist unter diesen Umständen allerdings selbst für erfahrene Beobachter nicht immer klar zu unterscheiden, ob sie eine Erziehung hin zur Selbstständigkeit oder eine resignierte Gleichgültigkeit vor Augen haben. Von einer Erziehungsverweigerung dürften die ahnungslosen Nörgler jedoch spätestens dann nicht mehr sprechen, wenn wissenschaftlich belegt ist, dass Kleinkinder, noch bevor sie sich motorisch aufrichten, Wortgefechte durchstehen können. Nicht anders wird es sich mit der törichten Forderung verhalten, dass „verhandlungssichere“ Fremdsprachenkenntnisse erst dann erworben werden sollten, wenn der Zögling gelernt hat, was Verhandeln und Entscheiden eigentlich bedeuten. Derart sozialromantische Sichtweisen berücksichtigen in keinster Weise, dass viele Kinder die Zeit wieder aufzuholen haben, die bis zu ihrer Geburt bereits vergangen ist.
Die längeren Ausbildungszeiten der Eltern verzögern die Familiengründung erheblich. Während die Entscheidungsphase vor einer Generation mit 10 Jahren angegeben wird, sei heute die „Rushhour“ des Lebens auf 5 Jahre geschrumpft. Diese Entwicklung gilt allerdings nur dann, wenn das sogenannte sequenzielle Prinzip nach der Ausbildung noch die berufliche Etablierung verlangt. Väter und Mütter, die bei der Familiengründung entsprechend auf ein gefestigtes ökonomisches Fundament bauen, sehen im Nachwuchs nicht zuletzt eine Bedrohung ihres materiellen und beruflichen Status. Wenn die Voraussetzungen allerdings erst einmal als gegeben eingestuft werden, bleibt es unter diesem Verständnis meist nicht bei einem Kind. Verbindet sich Arbeit und Familie nach dem parallelen Modell, richtet sich der Kinderwunsch nicht nach wirtschaftlichen Sicherheiten. Diese Unbeschwertheit tendiert allerdings auch stark zur Ein-Kind-Familie.
Dabei weiß doch jeder, dass Einzelkinder verzogen sind. Entweder, weil man mindestens eines dieser „Gören“ kennt oder weil man selbst eines ist. Umso bedrückender erscheint die Tatsache, dass die Kinder ihre ersten Lebensjahre zunehmend nur in enger Beziehung zu Erwachsenen verbringen. Die wahrgenommenen Kompensationsmöglichkeiten sind allerdings vielfältig. So dient die Einbindung in zweckrationale Gruppen als Geschwisterersatz. Die sozialen, sportlichen, künstlerischen und fremdsprachlichen Schwerpunkte bieten dem Kind unterschiedlichste Rollenkontexte, in denen es sich lernend zu bewähren hat. Freizeit ist Lernzeit. Die entsprechend zunehmende Pädagogisierung, Institutionalisierung und Verinselung der Kindheit ist allerdings schon wieder Anlass zur Kritik. Die Rede ist dann von der „Termin-“ und „Vereinskindheit“. Durch eine derart umfängliche Betreuung verlören die Kinder jegliche Fähigkeit zur Selbstbeschäftigung und zu spontanen Aktivitäten. Wesentlich flexibler sind dann nur noch die Eltern, deren Beziehung zum Kind zu einer sogenannten „Schulbeziehung“ mutiert ist. Zuneigung ist nichts Naturgegebenes, sondern will verdient sein. Welcher Maßstab ist hierfür also geeigneter als die Schulnoten?
Wie beruhigend ist an dieser Stelle wieder einmal die statistische Wirklichkeit. Die Kinderzahl pro Familie hat sich insgesamt zwar verringert, die Mehrzahl der Kinder wächst jedoch draußenspielend mit Geschwistern auf. Der unter Umständen daraus resultierende psychische Schaden ist zumindest gesellschaftlich salonfähig.
Erziehung ist wirklich keine einfache Sache. Pädagogik und Psychologie geben den Eltern in unzähligen Publikationen zumindest das beruhigende Wissen an die Hand, dass Begabungen und schulische Leistungen kein naturgegebenes Schicksal sind. Dass ihre Bemühungen und ihr elterliches Verhalten den Ausschlag für die kindliche Entwicklung geben, führt bei vielen Eltern erstaunlicherweise allerdings zu einer zunehmenden Überforderung.
Nichtsdestotrotz bleibt die Intuition nach 2006 auch bei der TNS Emnid Mütter-Umfrage 2016 mit 89% die am häufigsten genannte Orientierungshilfe für die Mutterrolle. In Verbindung mit den Erziehungszielen präsentieren sich die Eltern hier bestens gerüstet, um den Nachwuchs auf die Weltgesellschaft vorzubereiten. Die wissenschaftlichen Verfechter der Wertehierarchie scheinen sich dagegen selbst im Weg zu stehen: Wenn die Werte der Selbstverwirklichung hoch eingestuft werden, müssen die der gesellschaftlichen Konformität unweigerlich niedrig eingestuft werden und umgekehrt. Alles andere spräche für eine pathologische Orientierungslosigkeit. Im Einklang mit den Erziehungsberechtigten gehen die Vertreter der Wertesynthese jedoch davon aus, dass sich beide Orientierungen nicht wechselseitig ausschließen. Es erfolge vielmehr eine situationsspezifische Abwägung, bei der einmal das eine, ein anderes mal das andere stärker gewichtet werde. Statistisch konnte bereits nachgewiesen werden, dass Menschen mit einer wertesynthetischen Orientierung wesentlich besser mit unübersichtlichen Ausgangslagen, wie sie sich in der heutigen Zeit zunehmend finden, zurechtkommen. In den letzten Jahrzehnten hat die traditionelle Erziehung zu „Gehorsam und Unterordnung“ gegenüber der Förderung von „Selbstständigkeit und Persönlichkeit“ zwar kräftig Federn gelassen. Im Ergebnis werden die Ideale des Zusammenlebens nunmehr jedoch, ganz im Sinne der Wertesynthese, als ebenso wichtig angesehen wie die der Selbstverwirklichung. Bei der Vorbereitung auf unsichere Zeiten setzen die Eltern also nicht, wie vielleicht zu erwarten gewesen wäre, primär auf Durchsetzungsvermögen, vielmehr behaupten auch Höflichkeit, Benehmen und Gewissenhaftigkeit ihren Platz. Gewichtungsunterschiede ergeben sich zum Teil durch die erwartete Berufsneigung. Sehen Eltern ihren Sprössling zukünftig eher in abhängiger Beschäftigung, spielen Umgangsformen und Respekt in der Erziehung eine etwas größere Rolle. Wird sich dieser aller Wahrscheinlichkeit nach später dagegen durch Selbständigkeit bewähren müssen, so wird er bereits früh in die Verhandlungen über die angewandte Erziehungsmethode mit einbezogen.
Ergänzend nochmals auf die Vorbilder für die Mutterrolle zurückkommend, offenbart die Innenansicht eine Überraschung. Die Möglichkeit der Mehrfachnennungen ergab auch 2016 auf Platz 2, statt vormals 66% nun mit 79%, den Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern. Auf dem erstaunlichen 3. Platz landete bei beiden Erhebungen, von 53% auf 65% gewachsen, das Abschauen bei der eigenen Mutter. Angeblich ist doch das Generationenverhältnis nur noch als Generationenkonflikt bekannt. Bei genauer Betrachtung erweist sich dieser jedoch, wenn überhaupt, dann als außerfamiliäres, gesellschaftliches Phänomen. Mögliche Ursachen werden darin gesehen, dass beispielsweise die Alterssicherungskosten wesentlich stärker kollektiviert seien als die eher individualisierten Versorgungskosten für Kinder. Innerhalb der Familie befindet sich das Generationenverhältnis vielmehr sogar auf einem historischen Höhepunkt. Die Mehrgenerationenfamilie ist alles andere als vom Verfall bedroht. Durch die geringere Kinderzahl umfasst diese zwar weniger Mitglieder innerhalb der gleichen Generation. Durch die höhere Lebensdauer umfasst die Mehrgenerationenfamilie allerdings so viele Generationen wie noch nie zuvor. Das Zusammenleben findet allerdings meist nicht in einem gemeinsamen Haushalt statt. Deshalb wird von der multilokalen Mehrgenerationenfamilie gesprochen, deren Ortsbezug vom gleichen Haus bis hin zu anderen Kontinenten reicht. Die technisch erleichterte Überwindung von Distanzen ermöglicht es, den Kontakt zu den Kindern und Enkelkindern auch nach deren Auszug beizubehalten. In der Migrationsforschung finden sich hier beeindruckende Familiennetzwerke, die das Familienleben und die familiale Unterstützung über mehrere Länder hinweg organisieren. Allgemein findet sich eine große familiale Solidarität und Unterstützungsbereitschaft zwischen den Generationen. Dabei erfährt nicht zuletzt die Großelternrolle eine enorme Aufwertung, was besonders den Berufstätigen und Alleinerziehenden zugutekommt. Letztere leben zwar überwiegend unter der Armutsgrenze, nach Rüdiger Peuckert werden jedoch fast alle Alleinerziehenden in irgendeiner Form durch ihr soziales Umfeld unterstützt.
Staatliche Leistungen standen seit jeher im Verdacht, den familialen Zusammenhalt zu ersetzen. Im Alltag ermöglichen diese jedoch vielfach erst die vorfindbare Hilfe zwischen den Generationen.
Bleibt abschließend die alles entscheidende Frage, wer sich denn nun nicht nach wessen Familienbild richtet.
Alleine die Sorge um unseren Staat treibt diesbezüglich schon wundersame Blüten. Mal sind es die Alten, die partout nicht einsehen wollen, dass einer Rentnerschwemme nur durch ein sozialverträgliches Frühableben beizukommen ist. Ein anderes Mal sind es die Frauen, die sich weigern, ihrer gesellschaftlichen Gebärfunktion nachzukommen. Seit Jahrzehnten sind es jedoch auf jeden Fall die Migranten, die sich mit ihren Großfamilien, im Wohnzimmer verbarrikadiert, dem öffentlichen Leben entziehen und damit auf die Abschaffung unseres Landes hinwirken. Oder sind es am Ende vielleicht doch die Zahlenschieber, die nicht einsehen wollen, dass Statistik nur mit Verstand angewendet werden sollte?
Solange unsere verfassungsrechtlich verankerte freiheitliche demokratische Grundordnung besteht, wird sich jedenfalls niemand unter Androhung der Exkommunikation öffentlich für sein Familienverständnis rechtfertigen müssen. Bezüglich der familieninternen Straftaten sollte sich auch der Angestammte nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Von dem merklichen Schwund des Staatsvolkes ganz zu schweigen, würde der Integrationstest zur allgemeinen Bürgerpflicht. Auch staatliche Eingriffe in die Schlafzimmer der Bürger bleiben auf die zweifelhafte Möglichkeit finanzieller Anreize beschränkt. Zu einer vorstellungskonformen Fortpflanzungshäufigkeit führen diese erfahrungsgemäß jedenfalls nicht.
Gott sei Dank - aber er hat sich ein eigenes Kapitel verdient.
Bis hierher lässt sich also nicht ausmachen, wer oder was auf den Untergang der Familie hinwirkt. Einer der deutlichsten Hinweise darauf, dass alles seinen (individuell) geordneten Gang nimmt, findet sich in der Gesamtschau der wissenschaftlichen Interpretationen. Während die eine Seite eine Pluralisierung und Vervielfältigung der familialen Lebensformen zu erkennen glaubt, wird von anderer Seite betont, dass es schon immer verschiedenste Formen gegeben habe. Fraglich bleibe lediglich, ob es diesbezüglich zu einer Dominanzverschiebung komme. Alles quatsch, es könne vielmehr von einer Strukturstarre ausgegangen werden. Die Versorgerehe sei und bleibe das dominante Familienmodell.
Während sich die wissenschaftlichen Disziplinen also mit sich selbst beschäftigen, scheinen die Familien zeitgleich ihren eigenen Weg zu finden. Selbst für Traditionalisten lässt sich festhalten, dass die überlieferten gesellschaftlichen Vorgaben nach Prüfung ihrer jeweiligen und individuellen Sinnhaftigkeit weiterhin Anwendung finden. Der Umgang innerhalb der Familien scheint dabei, entgegen der früheren Gepflogenheiten, jedoch wesentlich mehr an den beteiligten Individuen und nicht mehr an anonymisierten Rollenträgern orientiert zu sein. Mit dem Bedeutungsverlust der biologisch begründeten, obligatorischen Solidarität dürften die Familien in historischem Ausmaß von einer neuen Beziehungsqualität geprägt sein.
Das damit bestenfalls einhergehende zwischenmenschliche Verständnis ist nichts Geringeres als die Voraussetzung für das weltgesellschaftliche Miteinander. Das beeindruckendste Beispiel hierfür sind der Palästinenser Ismail Khatib und seine Frau. Deren Sohn war 2005 von israelischen Soldaten erschossen worden. Es wäre sicherlich mehr als verständlich gewesen, hätte dieses unermessliche Leid die Wahrnehmung auf den eigenen Schmerz beschränkt. Zum Vorbild für die gesamte Menschheit wurde Familie Khatib nicht nur durch die Freigabe der Organe ihres Sohnes, sondern ebenfalls durch die dabei gezeigte Grundhaltung, die Grenzen und Kulturen zu überwindenden vermag. So retteten sie - Nahost-Konflikt hin oder her - auf eigenen Wunsch auch sechs israelischen Kindern das Leben. Sie demonstrierten damit der ganzen Welt, dass es spätestens bei der elterlichen Sorge um die Kinder weder um Staats- noch um Kulturangehörigkeit gehen darf.
Der Verfall der Arbeit
Was ist aus der Arbeit nur geworden? Die Entwicklung war so ... - Was ist Arbeit im Generellen eigentlich? Die Sache scheint so lange klar zu sein, bis man beginnt, sich ein genaueres Bild zu machen.
Vielleicht kann die Philosophie hier weiterhelfen. Arbeit gehört nach philosophischem Verständnis zum menschlichen Handeln und beinhaltet ein zweckvolles Tun und Wirken. Schön und gut, aber das gilt gleichermaßen auch für den Toilettengang. Kommt daher vielleicht die Redewendung 'ein Geschäft verrichten'? Damit haben wir zwar ein Bild vor Augen, aber eher zu einem anderen Thema. Bei den Ayizo, einer bäuerlichen Gesellschaft im Süden der Republik Benin, werden selbstbezogene körperliche Handlungen, wie beispielsweise auch die Körperreinigung, jedenfalls ausdrücklich nicht zur Arbeit gezählt.
Ein Kriterium, das uns von diesem Irrweg wieder herunterbringen könnte, ist die Festlegung, dass die Tätigkeit als gesellschaftlich wertvoll anerkannt sein muss, damit man sie als Arbeit bezeichnen darf. Damit fällt schon mal einiges weg. Gesellschaftlich wertvoll! Die philosophischen Disziplinen schreiben sich allerdings schon seit der Entstehung des Privaten die Finger wund, um der bisher fälschlicherweise so bezeichneten Haus-„Arbeit“ diese gesellschaftliche Adelung zukommen zu lassen. Bleibt diese unermüdliche „Arbeit“ der Philosophen vielleicht deshalb unfruchtbar, weil sich vielen Menschen auch der gesellschaftliche Wert der Philosophie selbst nicht so recht erschließt?
Vielleicht lässt sich der gemeinnützige Beitrag über das Einkommen bestimmen? Die Sicherung des Lebensunterhalts findet sich ohnehin in mehreren Definitionsversuchen. Damit kann die Hausfrau endgültig zu Hause bleiben. Der Philosophie-Professor ist eindeutig und zweifelsfrei gesellschaftlich wertvoll. Und dies mindestens in gleicher Weise wie - der Zuhälter?
Hausfrauen, Professoren, Zuhälter! Kein Wunder, dass man hier nicht so recht weiterkommt. Arbeit muss anstrengend und mühevoll sein. Dieser Aspekt findet sich über mehrere Jahrhunderte in unterschiedlichen Kulturkreisen. Als Gegenstücke dienen entsprechend das Spiel oder allgemeiner die Muße. Wer hat nicht das klare Bild der schwer arbeitenden Menschen vor Augen - der Bauarbeiter, der sich völlig erschöpft von der Verrichtung der kräftezehrenden Arbeit, die Zigarette mehr hängend als fest im Mundwinkel, der gnadenlos sengenden Hitze der Sonne trotzend, mit letzter Kraft auf seine Schaufel stützt. Das ist Arbeit!
Zu Missverständnissen scheint es zu kommen, seit die akademischen Aufklärer, hinterher weder entkräftet noch erschöpft, die Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ins Spiel brachten. Nebenbei bemerkt würden die Ayizo, im Unterschied zu manch bäuerlichem Arbeitsverständnis im Hochschwarzwald, nie an der notwendigen Anstrengung hinter dieser intellektuellen Leistung zweifeln. Jedenfalls verschwanden ab dem 18. Jahrhundert zunehmend nicht nur der Selbstzweck der Arbeit, sondern auch die aufopfernd zu erarbeitenden Früchte des Jenseits aus dem Blickfeld. Sehen wir hier vorgreifend bereits die allgemeinen Wurzeln des Untergangs der Religion und damit der Gesellschaft? Der Islam - sofern nicht verachtet - belehrt uns hier eines Besseren. Dessen Gesetze klassifizieren die selbstkasteiende Zerstörung der von Gott geschenkten Arbeitskraft seit jeher als lästerlich und nicht als Fahrschein ins Paradies.
SELBSTbestimmung und SELBSTverwirklichung durch Arbeit - wer kann unter diesem Vorzeichen noch an andere denken? Wen erdrückt es nicht, den Titel „Krone der Schöpfung“ durch individuelle Leistung überbieten zu müssen? Ganz zu schweigen von den Anstrengungen, die eine tatsächliche Ergründung und Auseinandersetzung mit sich selbst und seinem Umfeld erfordern würden.
Der Mensch wäre nicht Mensch (Europäer), hätte er hierfür nicht eine effizientere Methode gefunden. Wer sagt denn, dass die eigene Leistung gesteigert werden muss? Die Herabwürdigung der Leistung anderer führt zum gleichen Effekt. Diese glänzende Idee war anfangs relativ einfach umzusetzen. Auf den Besichtigungstouren durch die Welt fanden sich mit freundlicher Unterstützung etwa der Völker Indonesiens, Malaysias oder der Philippinen hinreichend viele Beispiele. Deren Faulheit war aber auch zu offensichtlich.