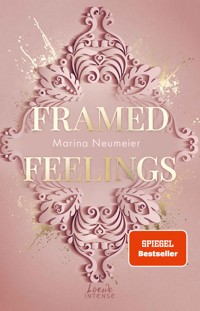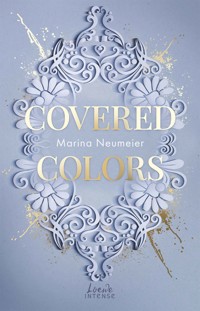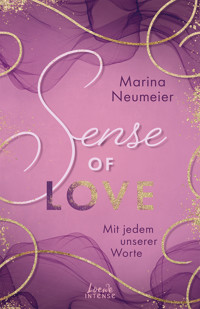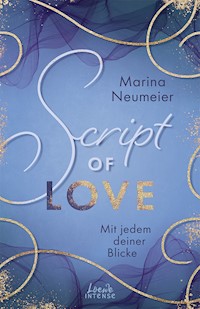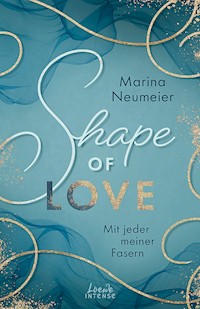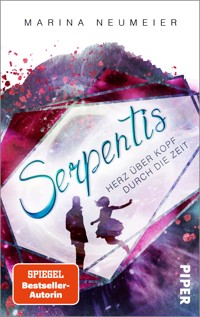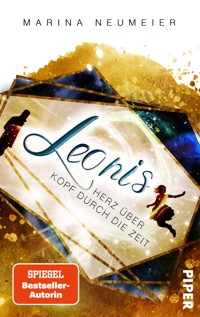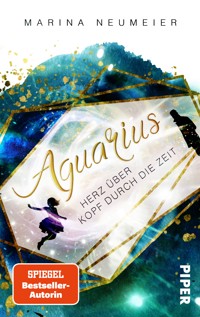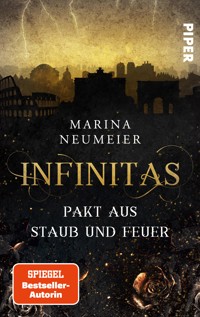
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Wundervoll
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fürchtet den Zorn der Götter! Der atemberaubende zweite Teil der Infinitas-Dilogie »Die Götter mögen diese Welt verlassen haben, aber so lange es uns gibt, bestehen sie fort. Weil sie in uns weiterleben.« Nach den Ereignissen auf dem Vesuv findet sich Aliqua in der Gefangenschaft der Immortali wieder. Hier entdeckt sie das wahre Ausmaß ihrer Gabe, das sie zum Schlüssel im Kampf gegen den Fluch der Unsterblichkeit machen könnte. Währenddessen suchen Santo, Orela und die anderen verzweifelt nach ihr und schlagen dabei einen gefährlichen Weg ein, denn die gefürchteten römischen Götter sind näher, als sie denken ... Und dann sind da immer noch Santos Geheimnisse, die zwischen ihm und Aliqua stehen und eine Liebe in Gefahr bringen, die die Jahrhunderte überdauert hat. Nach der »Aquarius«-Trilogie folgt eine weitere spannende Fantasy-Liebesgeschichte von der Gewinnerin des Newpipertalent-Awards 2019! »Es ist wieder spannend und kreativ - ich liebe die Infinitas-Dilogie!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Infinitas – Pakt aus Staub und Feuer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Sprachredaktion: Uwe Raum-Deinzer
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Giessel Design
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Kapitel Eins
Santo
Aliqua
Kapitel Zwei
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Drei
Aliqua
Kapitel Vier
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Fünf
Aliqua
Kapitel Sechs
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Sieben
Aliqua
Kapitel Acht
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Neun
Aliqua
Kapitel Zehn
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Elf
Aliqua
Kapitel Zwölf
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Dreizehn
Aliqua
Kapitel Vierzehn
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Santo
Kapitel Fünfzehn
Aliqua
Kapitel Sechzehn
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Siebzehn
Santo
Kapitel Achtzehn
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Neunzehn
Rom, 79 n. Chr.
Aliqua
Kapitel Zwanzig
Aliqua
Kapitel Einundzwanzig
Rom, 79 n. Chr.
Santo
Kapitel Zweiundzwanzig
Aliqua
Kapitel Dreiundzwanzig
Rom, 79 n. Chr.
Kapitel Vierundzwanzig
Aliqua
Kapitel Fünfundzwanzig
Herculaneum, 79 n. Chr.
Kapitel Sechsundzwanzig
Aliqua
Santo
Kapitel Siebenundzwanzig
Santo
Kapitel Achtundzwanzig
Aliqua
Kapitel Neunundzwanzig
Santo
Kapitel Dreißig
Aliqua
Epilog
Aliqua
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Aequat omnis cinis. Inpares nascimur, pares morimur.
Die Asche macht alle gleich. Ungleich werden wir geboren, gleich sterben wir.
Seneca, Briefe an Lucilius (Epistulae morales ad Lucilium), 62 n. Chr, 91. Brief
Kapitel Eins
Santo
Von allen Göttern verfluchte, beschissene Hölle.
Meine Kehle liegt in Fetzen, während ich dem Helikopter nachstarre, der immer höher hinaufsteigt und bald zu einem winzigen Punkt zwischen den wabernden Rauch- und Aschewolken zusammenschrumpft. Ich schreie weiter ihren Namen. Immer und immer wieder, weil ich einfach nicht begreifen kann, was gerade passiert ist. Ascheflocken tanzen durch die Luft wie grauer Schnee und legen sich auf mein Gesicht. Mit jedem Atemzug inhaliere ich die ätzende Mischung aus Gasen und Schwefel, die der erwachte Vesuv ausspuckt.
Wo kam dieser Helikopter so plötzlich her? Warum habe ich wider besseres Wissen alle Ratschläge in den Wind geschlagen und zugestimmt, mich den Immortali mit Aliqua allein entgegenzustellen? Ich hätte sie mir über die Schulter werfen und weglaufen sollen, solange es noch ging.
Und jetzt ist sie fort, während um uns herum der Vulkan brodelt wie ein überkochender Teekessel. Hier fliegt uns jeden Moment alles um die Ohren, aber ich kann mich nicht bewegen. Nicht, solange ich den kleinen dunklen Punkt am Himmel noch sehen kann, der kaum mehr als Helikopter zu erkennen ist. Aliqua ist dort drinnen, zusammen mit Marcellus, und er hat unmissverständlich klargemacht, was er von ihr will. Er beansprucht sie als sein Eigentum und wird ihre besondere Gabe dazu nutzen, um die Welt ins Chaos zu stürzen. Meine Augen tränen in den Vulkandämpfen, während ich den Weg des Hubschraubers in der Ferne zu verfolgen versuche. Wohin bringen sie sie?
Ich weiß, dass es irgendwann zwecklos ist, ein Flugobjekt mit den bloßen Augen verfolgen zu wollen. Aber wenn ich es nicht versuche, dann gebe ich auf. Dann muss ich aufgeben und mir eingestehen, dass die Immortali gerade den Sieg davongetragen haben. In doppelter Sicht.
Gerade ist es ihnen gelungen, Marcellus zu befreien, nachdem er, wie Aliqua, seit dem Jahr Neunundsiebzig unter den erkalteten Vulkanmassen geruht hat. Er, der damals in der Antike die Idee hatte, die Götter um Hilfe zu bitten, als eine Seuche alles und jeden in Rom dahingerafft hat. Überraschenderweise gingen die Götter, die gemeinhin nicht für ihre gütige Natur bekannt waren, auf die Hilfegesuche unserer beiden Familien ein und boten uns etwas noch viel Besseres an als ein bloßes Heilmittel für die grassierende Krankheit: einen Trank, der Unsterblichkeit verleiht. Das erschien uns allen fast zu gut, um wahr zu sein (Spoiler: das war es auch), aber wir griffen natürlich trotzdem zu. Doch seitdem wir die Götter nachhaltig verärgert haben, sind sie von der Erde verschwunden und haben uns mit einem Leben in Unsterblichkeit allein gelassen.
An Marcellus hat seitdem kaum jemand einen Gedanken verschwendet, denn er galt seit dem Weggang der Götter als verschollen, und ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen, dass sie ihn vernichtet hätten. Aber damit komme ich zurück zur wahren Natur der Götter: Sie wären niemals so gnädig gewesen, ein Aas wie Marcellus mit dem Tod zu belohnen.
Stattdessen hat er die Jahrhunderte quicklebendig unter der Erde überdauert, bereit, mir einen weiteren, vernichtenden Stoß zu versetzen, sobald er aus dem Dreck gekrochen war.
Gelblich graue Nebelschwaden bedecken inzwischen den Himmel, zu dem ich noch immer hinaufstarre, aber ich habe den dunklen Punkt am Horizont endgültig aus den Augen verloren. Marcellus könnte Aliqua überall hinbringen. Die Möglichkeiten sind schier endlos.
Am Rande nehme ich wahr, dass rund um mich herum das Chaos ausgebrochen ist. Immortali und Damnati haben aufgehört, einander an die Kehle zu gehen, seit der Helikopter abgehoben ist und der Vulkan immer deutlicher signalisiert, dass er jeden Moment ausbrechen wird. Gestalten rasen an mir vorbei, verschwimmen zu Schatten in meinem Augenwinkel, während sie panisch versuchen, ihre Haut zu retten. Was witzlos ist, denn wir sind alle unsterblich und würden sogar ein Bad in frischer Lava überstehen. Wir Damnati genauso wie die abtrünnigen Immortali.
Eine Hand, die mit voller Wucht auf meine Schulter kracht, reißt mich aus meinen Gedanken. Mein Cousin Adone ist hinter mich getreten. Seine Statur würde Herkules Konkurrenz machen, und eine schwächere Person als ich wäre unter dem Schlag seiner Pranke in die Knie gebrochen. Nur jahrhundertelanges Training verhindert, dass er mich in den Boden rammt wie einen stumpfen Pflock.
»Beweg dich hier schleunigst weg, oder du erlebst am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, pochiert zu werden«, grunzt er. Sein Gesicht ist gerötet, und Schweiß läuft ihm über die Stirn.
Ich reagiere nicht. Der Gedanke, einfach hier zu bleiben und mich dem Vesuv auszuliefern, fühlt sich genau nach der richtigen Art von Buße an. Fast kommt es mir vor wie ein Zeichen des Schicksals. Aliqua wurde im Jahr Neunundsiebzig während des großen Ausbruchs unter den Vulkanmassen begraben. Sie hat sich in Herculaneum aufgehalten, einer der Städte, die damals zerstört wurden, und das war zum größten Teil meine Schuld. Und auch knapp zweitausend Jahre später bin ich nun wieder daran beteiligt, dass ihr Gewalt angetan wurde. Ich konnte sie nicht beschützen – nicht vor den Immortali und nicht vor sich selbst. Aber am allerwenigsten vor mir.
»Santo!« Adones Gebrüll dröhnt in meinen Ohren. »Beweg jetzt endlich deinen Arsch zu den Autos, oder ich werfe dich über meine Schulter wie ein Kleinkind. Such es dir aus.«
Ich blinzle durch die ätzenden Dämpfe, die jeden einzelnen Atemzug zur Qual machen. Ein Erdstoß lässt die Knochen in meinem Leib erzittern, und brodelnde Hitze steigt aus dem Untergrund auf. Die Hölle, die in mir tobt, bricht auch um mich herum aus. Ich heiße sie willkommen.
Jeden Moment … jeden Moment.
Adone flucht laut, dann – schneller, als ich reagieren kann – geht er in die Knie und hebt mich hoch. Er schnauft vor Anstrengung, als er mich wie angedroht über seine Schulter wirft und mit seiner Beute in Richtung der Autos stapft, die mit laufendem Motor auf uns warten. Seine massige Schulter gräbt sich in meinen Magen, und mein komplettes Blut scheint mir in den Kopf zu schießen, als ich rücklings über seinem breiten Rücken hänge.
Das ist … aber ich bin viel zu apathisch, um zu registrieren, wie entwürdigend das gerade ist.
»Lass mich hierbleiben«, verlange ich gepresst.
Er kichert nur böse. »Träum weiter, Kleiner. Meinst du ernsthaft, wir lassen dich hier seelenruhig verschmoren und ersparen es dir, mit uns die Karre aus dem Dreck zu ziehen?«
Stimmen werden um uns laut, und im nächsten Moment lande ich unsanft auf der Rückbank eines Wagens. Alles dreht sich, mein Magen zieht sich zuckend zusammen. Trotzdem rapple ich mich auf, Adone springt neben mich auf den Sitz und schlägt die Tür hinter sich zu.
»Wir sind da. Gib Gas!«
Meine Augen sind noch immer gereizt und tränen, doch ich kann Giulia hinter dem Steuer des Jeeps erkennen. Ihre dunkelrote Lockenmähne ist unverwechselbar. Auf dem Platz neben mir sitzt Scuro, mein anderer Cousin, der sich wie so oft in Schweigen hüllt, und ich habe keine Ahnung, wer sich vorne auf dem Beifahrersitz befindet.
Kalte, klimatisierte Luft wirbelt durch den Innenraum des Jeeps, und allmählich klärt sich meine Wahrnehmung. Was dazu führt, dass ich registriere, wie viele Stellen meines Körpers schmerzen. Vorhin, beim Kampf gegen Marcellus’ Entourage, habe ich einiges abbekommen und eine Reihe heftiger Schläge einstecken müssen. Besonders mein Kopf dröhnt, Blut verstopft meine Nase und füllt noch immer meinen Mund. Wahrscheinlich versaue ich die Ledersitze, bis wir in Rom sind.
Der Wagen rast zusammen mit zwei anderen den steilen Weg zum Fuß des Vulkans hinunter, so schnell wie möglich über klaffende Risse und bebenden Untergrund hinweg. Die Stoßdämpfer leisten Höchstarbeit, trotzdem fühlt sich jeder Ruck so an, als würde jemand in aller Ruhe meinen Schädel mit einer Axt spalten. Mit zusammengebissenen Zähnen starre ich durch die mit Ruß und Aschestaub bedeckte Frontscheibe.
Verdammt, mir ist kotzübel.
Auf halbem Weg den Abhang hinunter fällt mir etwas ein, und ich ramme die Füße in die Mittelkonsole vor mir, als würde ich versuchen, auf die Bremse zu treten.
»Meine Moto Guzzi!«, krächze ich. »Wir mussten sie kurz vor dem Parkplatz stehen lassen. Giulia, halt an!«
Der Motor heult auf, als sie genau das Gegenteil tut. In halsbrecherischem Tempo schlittert der Jeep um eine Kurve, was Geröll und Äste gegen die Karosserie prasseln lässt.
»Dein Motorrad ist das Letzte, worum du dir gerade Gedanken machen solltest, Mann«, rügt eine Stimme vom Beifahrersitz. Jetzt erkenne ich auch, wer da vorne sitzt.
Massimo Pomponio. Barbesitzer, ebenfalls ein Damnatos und einer der Spitzenkandidaten auf meiner persönlichen Abschussliste. Ich kann den Kerl einfach nicht ausstehen.
»Was, du bist hier und nicht direkt zu deinem alten Kumpel Marcellus zurückgekrochen?«, höhne ich.
Er dreht sich nicht zu mir um, was mir den Anblick seiner arroganten Visage erspart. Allerdings genügt seine gedehnte Stimme allein vollkommen, um mich zur Weißglut zu bringen.
»Stell dir vor, ich habe noch immer nicht beschlossen, die Abtrünnigen zu unterstützen, die die Welt ins Chaos stürzen wollen. Schockiert dich das wirklich so sehr?«
»War das eine ernst gemeinte Frage?«
Massimo seufzt, als hätte er es mit einem Kleinkind zu tun. »Ich an deiner Stelle wäre etwas freundlicher zu mir.« Ich kann sehen, wie er eine seiner sauber manikürten Hände inspiziert.
»Ach ja?«
»Wie du richtig festgestellt hast, war Marcellus einmal mein Freund. Wenn du mich lieb bittest, könnte ich versuchen, Kontakt zu ihm herzustellen, um der alten Zeiten willen. Du weißt, dass ich von dieser festgefahrenen Feindschaft zwischen den Damnati und den Immortali nicht viel halte.«
Ich brumme, damit er weiter spricht.
»Wenn Marcellus mir wieder vertraut, kann ich vielleicht herausfinden, wo er deine Perle hingebracht hat.«
Ein großer Teil von mir will genau wie das Kleinkind reagieren, das offenbar gerade alle in mir sehen, und ihn einfach aus dem fahrenden Auto schleudern. Sein anzüglicher Tonfall, als er Aliqua erwähnt, erinnert mich an den Abend in seiner Bar, als die beiden getanzt haben. Und ich wie ein eifersüchtiger Idiot die Tanzfläche gestürmt habe, um Aliqua von ihm wegzureißen.
»Das klingt doch super!«, zwitschert Giulia und lässt den Jeep über einen dicken Ast springen, der quer über der Fahrbahn liegt. Meine Schädeldecke platzt gleich auf!
»Ja, klasse Idee«, brumme ich. Ich kann die Selbstzufriedenheit geradezu schmecken, die Massimo vom Beifahrersitz ausdünstet.
Es dauert eine Ewigkeit, bis wir die Autobahn in Richtung Rom erreichen. Inzwischen wimmelt es rund um den Vesuv von Einsatzkräften und Regierungsleuten, die hektisch auf den erwachten Vulkan reagieren. Sirenengeheul dringt durch die Scheiben aus Panzerglas. Als einer der potenziell gefährlichsten Vulkane wird der Vesuv rund um die Uhr überwacht, um mögliche Ausbrüche frühzeitig zu erkennen, aber kein Messinstrument der Welt kann die Einmischung von Ewiglichen voraussehen. Da gibt es keine Vorboten oder Warnungen.
Seit uns die Götter vor einer halben Ewigkeit zum unsterblichen Leben verflucht haben, tragen wir alle noch einen Rest göttlicher Macht in uns, die aber normalerweise keinen großen Schaden anrichtet. Ein so epochales Ereignis wie Marcellus’ Befreiung direkt am Vulkan war aber wohl gewaltig genug, um dem Vesuv eine spontane Reaktion zu entlocken, auf die sich kein Sterblicher vorbereiten konnte. Ich bete, dass sie es irgendwie schaffen, so viele Menschen wie möglich aus der Gefahrenzone zu bekommen, bevor es zu spät ist. Die verstopften Autobahnen sprechen zumindest dafür, dass sich alle bemühen, schnell das Weite zu suchen.
Während wir uns quälend langsam durch den Verkehr kämpfen, wünsche ich mir verzweifelt meine Moto Guzzi. Mit meinem Motorrad könnte ich mich spielend durch den Stau schlängeln und Rom in der Hälfte der Zeit erreichen. Allerdings sehe ich inzwischen ein, dass es Wahnsinn gewesen wäre, wegen der Maschine noch einmal umzudrehen.
Irgendwann schaltet Giulia das Radio ein und durchsucht das Programm, bis sie einen Lokalsender aus dem Großraum Neapel findet. Die aufgeregten Stimmen zweier Moderatoren schallen aus den Lautsprechern, und wir lauschen angespannt auf Neuigkeiten. Zuerst gibt es nur Hinweise für die Bevölkerung, Informationen zu Evakuierungen und Staumeldungen (haha!). Es werden weder Werbe-Jingles noch Schlager gesendet, was den Ernst der Lage unterstreicht.
Dann sprechen die Moderatoren im Studio endlich mit einer Außenreporterin, die in unmittelbarer Nähe des Vulkans positioniert ist.
»Gerade konnte ich mit dem Generaldirektor des Vesuv-Observatoriums reden, und er hat uns bestätigt, dass trotz dieser Beben kein Ausbruch unmittelbar bevorsteht. Die Experten vor Ort sind noch dabei, alle Daten auszuwerten, aber sämtliche Sensoren bestätigen einen Druckabfall in den Magmakammern Nach der Rauchentwicklung aus dem Krater und dem Aufbrechen der Caldera deuten alle Zeichen auf eine massive Eruption hin, aber dabei scheint es zu bleiben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es jedoch noch keine Erklärung für dieses Phänomen.«
Einer der Moderatoren schnappt aufgeregt nach Luft. »Das bedeutet, wir können bereits Entwarnung geben?«
»Dafür ist es noch zu früh. Denn das vollkommen untypische Verhalten des Vulkans lässt momentan keine definitiven Aussagen und Prognosen zu.«
Es geht noch eine Weile weiter hin und her, aber das Gespräch beginnt sich im Kreis zu drehen, und Massimo stellt die Lautstärke runter.
Im Wagen herrscht verblüfftes Schweigen.
»Hab ich das gerade richtig verstanden?«, sagt Adone irgendwann. »Der Vulkan wird nicht ausbrechen?«
»Scheint so.« Giulia wirft einen Blick in den Rückspiegel, und ich sehe, wie sie die Stirn runzelt. Auch ich drehe mich um und spähe aus dem Heckfenster. Wir haben schon einen ordentlichen Abstand zwischen uns und den Vulkan gebracht, aber in der Ferne sehe ich noch immer eine schmale Rauchsäule in den dunstigen Himmel aufsteigen.
»Meint ihr, Vulcanus hat …«, setzt Giulia an, wird aber sofort von energischen Protestrufen zum Verstummen gebracht.
»Ganz sicher nicht«, zischt Massimo, der so angefressen klingt, als hätte sie gerade seine Mutter beleidigt. »Als hätte dieser feuerspuckende Bastard jemals einen Vulkan zurückgepfiffen. Außerdem haben die Götter die Erde verlassen, schon vergessen?«
Giulia zieht die Schultern hoch. »Aber ihr stimmt mir zu, dass es nicht normal ist, dass der Vesuv plötzlich beschlossen hat, doch nicht auszubrechen. Wir alle haben es gespürt, er stand ganz kurz davor.«
Ja, das haben wir alle gespürt. Und es ist ein Rätsel. Aber eines, um das wir uns später kümmern können.
Ich bin froh, dass Neapel wahrscheinlich vor einem Ausbruch verschont bleibt, aber das war zu keinem Zeitpunkt meine größte Sorge. Ja, womöglich macht mich das zum größten Arschloch überhaupt, aber mein komplettes Sein ist gerade auf einen einzigen Gedanken ausgerichtet: Aliqua von Marcellus zurückzuholen.
Koste es, was es wolle.
Aliqua
Glühende Hitze umgibt mich von allen Seiten.
Mein Atem verbrüht mit jedem hastigen Zug meine Lippen, und Feuerzungen perlen anstatt Schweiß aus allen Poren. Ich kann mich nicht bewegen, sosehr ich es auch versuche. Eine Schwere, die sich nicht abschütteln lässt, lähmt meine Glieder, und ich muss ausharren, während sich Schicht um Schicht von flüssiger Hitze über mir auftürmt. Sie kriecht meine Beine hinauf, erreicht meine Hüften und den Bauch, bis sie Sekunden später meine Brust bedeckt.
Jeder Atemzug ist eine Qual, und mir wird bewusst, dass ich es nicht mehr lange schaffen werde, meinen Brustkorb zu heben, um ein weiteres Mal Luft zu holen. Meine Sekunden sind gezählt, denn mein Atmen wird immer schwächer, und Panik bricht in mir aus, als ich begreife, dass es mir nicht mehr oft gelingen wird, Luft in mich zu saugen.
Ein, aus.
Ein, aus.
Ein, aus.
Asche klebt an meinem Rachen, aber ich schließe meinen Mund nicht. Stattdessen reiße ich ihn so weit wie möglich auf, um das Unabwendbare aufzuhalten. Nur noch einmal. Nur noch ein weiterer Zug …
Im hintersten Winkel meiner Gedanken ist mir bewusst, dass ich das hier verdient habe, es sogar freiwillig auf mich genommen habe, aber eine Strafe zu akzeptieren und sie dann tatsächlich anzunehmen, sind zwei unterschiedliche Dinge. So entschlossen ich auch war, jetzt regiert in mir nur noch nackte Angst, und ich drehe beinahe durch, weil ich flüchten will, aber nicht kann.
Tränen lösen sich aus meinen Augenwinkeln, und sie sind so heiß wie pures Feuer, als sie sich einen Weg über meine Wangen bahnen. Die brennenden Spuren auf meiner Haut fühlen sich nach Bedauern und Trauer an. Aber so ist es mit den schweren Entscheidungen im Leben. Auch wenn man weiß, dass man gerade das Richtige tut, schmerzt es deshalb nicht weniger.
Als ich aufwache, dauert es einige Minuten, bis ich die Bilder des Traums abschütteln kann. Sie fühlen sich zu real an, zu sehr nach etwas, das nicht nur ein Produkt meiner Fantasie ist, sondern das ich schon einmal erlebt habe. Aber mein Kopf ist zu benommen, um herauszufinden, was Wahrheit und was Einbildung ist. Am liebsten will ich die Augen fester zusammenkneifen und wieder in den Schlaf abdriften. Die Dunkelheit lockt mich mit dem Versprechen von Vergessen und Frieden. Doch in meinem Hinterkopf lauern Erinnerungen, die mich mahnen, dem Sog nicht nachzugeben, sondern jetzt endlich aufzuwachen und mich der Realität zu stellen.
Mit einem Kraftakt bäume ich mich auf und werfe die Benommenheit von mir ab. Noch immer greift der Schlaf mit lockenden Fingern nach mir, will mich zurück in die friedvolle Dunkelheit ziehen, aber ich widerstehe ihm mit aller Kraft.
Allmählich beginne ich meinen Körper wieder zu spüren. Die Schwere meines eigenen Gewichts, das mich in eine weiche Unterlage niederdrückt. Das dumpfe Pochen hinter meinen Schläfen.
O ihr Götter, habe ich gestern mit Adone einen über den Durst getrunken? Ich fühle mich ganz danach. Schwer und träge, als hätte ich den Kater meines Lebens. Wenn ich die Augen öffne, überrollt es mich bestimmt mit voller Wucht.
Also taste ich zuerst mit geschlossenen Augen meine Umgebung ab und stelle fest, dass ich wohl auf einem Bett liege. Meine Fingerspitzen gleiten über Laken, deren Stoff leicht kratzt, als wäre er schon zu oft gewaschen worden. Die Matratze unter mir ist etwas hart, aber komfortabel. Definitiv nicht vergleichbar mit dem Bett, dass ich in der Wohnung der Omodeos in Rom hatte.
Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hierhergekommen bin.
Es vergehen noch einige weitere Minuten, ehe mein Gedächtnis wieder die Arbeit aufnimmt. Mir wird allmählich klar, dass ich in der vergangenen Nacht nicht ausgegangen bin. Weder mit Adone noch mit irgendjemand sonst. Etwas anderes ist dafür verantwortlich, dass ich mich so miserabel fühle. Eine Mischung aus unbegreiflichen Erinnerungen und einer Hand, die so lange meinen Nacken umklammert hielt, bis mir schwarz vor Augen wurde.
Mit einem Keuchen, das von den Zimmerwänden hallt, schnelle ich hoch und erwarte fast, mich gefesselt vorzufinden. Aber meine Gliedmaßen sind frei, als ich mir die zerzausten Haare aus dem Gesicht wische und mich umschaue. Der Raum, in dem ich mich befinde, ist schlicht und nur spärlich möbliert, aber keinesfalls die Art von Gefängniszelle, die ich im ersten Moment erwartet habe. Hohe, weiß getünchte Wände, zwei Fenster, die allerdings mit Läden verschlossen sind und keinen Blick nach draußen erlauben. Schmale Lichtstreifen dringen durch die Lamellen und verraten mir, dass es Tag sein muss. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie spät es ist oder wie viel Zeit vergangen ist, seit der Helikopter mich vom Vesuv weggebracht hat.
Die Bilder stehen mir jetzt wieder gestochen scharf vor Augen. Alles, was sich von dem Moment an ereignet hat, als Santo im Morgengrauen vor der Villa in Tivoli aufgetaucht ist und den Anruf bekam, dass Marcellus aus dem Vesuv befreit werden sollte.
Die Augen weit aufgerissen starre ich die Wand an, ohne irgendetwas wahrzunehmen.
Santo und ich. Der Zorn darüber, dass er gelogen und mir so viel verheimlicht hat. Unsere halsbrecherische Fahrt nach Neapel, um den Vulkan zu erreichen, bevor die Immortali ihr Vorhaben umsetzen und Marcellus befreien konnten.
Wir haben es nicht rechtzeitig geschafft.
Und mir ist es auch nicht gelungen, den Vulkan zu stoppen, der nur Augenblicke vor einem gewaltigen Ausbruch stand. Mittlerweile muss es passiert sein, und alles in mir zieht sich vor Schmerz zusammen, wenn ich mir vorstelle, was das für die Großstadt Neapel und die umliegende Umgebung bedeutet. All die Menschen, die nicht mehr rechtzeitig fliehen konnten. Tausende müssen unter den Vulkanmassen begraben worden sein, tot in der Sekunde, als die Mischung aus unbegreiflich heißer vulkanischer Asche und giftigen Gasen die Hänge hinunterraste und sie einhüllte. Ein solcher Strom zerstört alles auf seinem Weg, und es gibt keine Chance, ihm zu entkommen.
Blinzelnd zwinge ich mich dazu, dieses Horrorszenario beiseitezuschieben und mich stattdessen wieder auf meine direkte Umgebung zu konzentrieren. Marcellus hat mich verschleppt, und irgendwie muss ich herausfinden, wo ich bin.
In meinem Zimmer befinden sich neben dem Bett, auf dem ich sitze, nur ein Kleiderschrank und ein altertümlicher Waschtisch mit Porzellangeschirr und einem Stuhl davor.
Meine Glieder sind noch immer schwer, aber ich steige aus dem Bett, um mich genauer umzuschauen. Meine Beine zittern, und die Jeans ist an mehreren Stellen aufgerissen und voller Staub. Ein Blick zurück aufs Bett verrät mir, dass auch die weißen Laken und Kissen von einem grauen Schleier bedeckt sind, den ich darauf hinterlassen habe. Immerhin scheint mich während meiner Bewusstlosigkeit niemand angerührt zu haben, um mich auszuziehen.
Zuerst tappe ich zur Tür und drücke probehalber die Klinke nach unten. Abgeschlossen, keine große Überraschung. Wenn ich bisher noch Zweifel hatte, dann ist mir spätestens jetzt klar, dass ich eine Gefangene bin. Ich habe es nicht geträumt, dass Marcellus mich verschleppt hat.
Der Kleiderschrank ist leer, es hängen nicht einmal Bügel auf der Kleiderstange – wahrscheinlich war es ihnen zu riskant, mich mit Gegenständen aus Metall alleine zu lassen, mit denen ich mich selbst verletzen oder sie als Waffe benutzen könnte. Das Geschirr auf dem Waschtisch stellt sich auf den zweiten Blick als Emaille heraus, was mich ebenfalls enttäuscht. Porzellan hätte ich zerbrechen und die Scherben als Klingen benutzen können.
Ich entdecke eine weitere Tür neben dem Schrank, die in ein angrenzendes Badezimmer führt. Es ist winzig, ohne Fenster und wie das Zimmer äußerst spartanisch eingerichtet. Aber gut, ich sollte wohl froh darüber sein, ein WC zu haben und keinen Nachttopf benutzen zu müssen.
Als Nächstes untersuche ich die Fenster. Meine Mundwinkel sinken nach unten, als ich entdecke, dass ich auch diese nicht öffnen kann. Neben den Griffen befinden sich winzige Schlüssellöcher, und sie sind gewissenhaft abgeschlossen. Frustriert schlage ich mit der geschlossenen Faust gegen den Rahmen, aber nichts tut sich.
Ein Laut bildet sich in meiner Kehle, mehr ein animalisches Knurren als ein menschliches Seufzen, und ich lasse es bewusst in mir aufsteigen. Die Erkundung des Zimmers hat mir ein wenig Zeit gegeben, um mich von den Gedanken und Gefühlen abzulenken, die sich wie ein Scheiterhaufen in mir auftürmen, der jeden Moment in Flammen aufgehen kann. Aber sie drohen mich noch immer zu überwältigen. Meine Kehle schmerzt von dem rohen Schmerz, der in mir wütet. Es ist zu viel, das auf mich einstürmt.
Es ist genau das passiert, wovor die Damnati mich unbedingt beschützen wollten. Ich bin in den Fängen der Immortali, die weiß die Götter was mit mir vorhaben, um ihre Ziele zu erreichen. Und ich zweifle nicht daran, dass sie vor nichts zurückschrecken werden, um mich zu zwingen, ihnen behilflich zu sein. Auch wenn ich unsterblich bin und der Tod keine Drohung für mich darstellt, gibt es genug andere Methoden, um mich gefügig zu machen, und ich bin mir sicher, dass sie sie alle beherrschen. Mehrere Hundert Jahre dürften mehr als genug gewesen sein, um ihre Fähigkeiten als Foltermeister zu vervollkommnen.
Ich zwinge einen abgehackten Atemzug in meine widerstrebenden Lungen, und meine Gedanken wandern zu Santo, Orela, Adone und Scuro. Innerhalb weniger Tage sind sie zu meinen Freunden und Vertrauten geworden. Was ist mit ihnen geschehen? Haben sie es rechtzeitig vom Vulkan heruntergeschafft, oder wurden sie unter den Lavamassen begraben?
Obwohl ich noch immer bis in die letzte Faser von Wut auf Santo erfüllt bin, ist die Vorstellung zu viel für mich, dass er dasselbe Schicksal wie ich erlitten haben könnte. Als Ewiglicher würde er so etwas überleben und bei vollem Bewusstsein in einem Gefängnis liegen, das ihn wie eine zweite Haut umschließt und zu absoluter Bewegungslosigkeit verdammt.
Das Bild, wie er zerschlagen auf dem Parkplatz am Vesuv steht und unaufhörlich meinen Namen brüllt, während ich mit dem Helikopter immer höher steige, ist wie mit Säure in meine Seele gebrannt.
Das kann es noch nicht gewesen sein, beschließe ich mit einer Entschlossenheit, die von Zorn und Sturheit genährt wird. Ich werde mich sammeln und dann von hier entkommen, koste es, was es wolle. Ich werde zu Santo zurückkehren und ihm die Abreibung verpassen, die er verdient hat. Und dann kann ich mich mit der Frage auseinandersetzen, warum da trotz allem noch immer diese brennende Sehnsucht in meiner Brust sitzt, die genauso dringend danach verlangt, ihn zu küssen, wie ihn zu schlagen.
Ich stehe noch immer am Fenster, die Stirn gegen das glatte Glas gepresst, als ich ein Geräusch höre, das eine eisige Welle durch meinen Körper schickt.
Das Knirschen eines Schlüssels im Schloss.
Mir bleibt keine Zeit, um zu überlegen, wie ich mich verhalten soll. Welchen Gegenstand aus dem kargen Zimmer ich mir schnappen soll, um zumindest das Gefühl zu haben, mich verteidigen zu können.
Die Tür schwingt auf, und eine Person tritt in mein Zimmer, deren Lächeln von Grausamkeit und Schmerz spricht.
Marcellus ist hier.
Kapitel Zwei
Rom, 79 n. Chr.
Die Welt, wie Aliqua sie kannte, brach auseinander.
Es war die grassierende Seuche, die Rom mit kaltblütiger Unerbittlichkeit aus den Angeln hob. Nichts schien Bestand zu haben angesichts der Toten, die jeden Tag zu Dutzenden zu beklagen waren und zu den Grablegen außerhalb der Stadtgrenzen gebracht werden mussten.
Seit der Nacht, in der Dominus Faustus der Seuche erlegen war, hingen Trauer und Entsetzen wie ein undurchdringliches schwarzes Tuch über dem Domus Pomponius. Jedes Mitglied des Haushalts schien gelähmt angesichts der Tatsache, dass nicht einmal ein so wohlhabender und einflussreicher Mann wie Faustus der Krankheit etwas entgegenzusetzen gehabt hatte. Er, der ein Leben lang die Götter durch üppige Gaben und Gebete milde gestimmt hatte, war nicht von ihnen beschützt worden. Apollo zürne der Familie, wisperten die Haussklaven, was dadurch unterstrichen wurde, dass er auch die Tochter des Hauses hatte erkranken lassen. Octavia wusste noch nichts vom Tod ihres Vaters, denn sie befand sich die meiste Zeit in einem fiebrigen Delirium und war kaum noch ansprechbar.
Aliqua machte sich entsetzliche Sorgen um sie. Ja, ihre Herrin war stets launisch, fordernd und selten freundlich zu ihr gewesen, aber niemand verdiente es, so jung von einer Krankheit dahingerafft zu werden. Ein ganzes Leben lag noch vor Octavia, und Aliqua fühlte sich verpflichtet, sich um sie zu kümmern, um zu verhindern, dass Mors auch sie noch holen würde.
Marcellus war da allerdings anderer Meinung. Seit dem Abend, an dem sein Vater gestorben war und er Aliqua verprügelt hatte, verlangte er vermehrt nach ihr. Er bestellte eine andere Dienerin ab, die von nun an seine Schwester pflegen sollte, und bestand darauf, dass Aliqua ihn ständig begleitete.
Auch an diesem Tag befand sie sich an seiner Seite. Faustus’ Beisetzung fand statt.
Seit seinem Tod war er vier Tage und Nächte auf einem prächtigen Paradebett im Atrium des Hauses aufgebahrt gewesen, gewaschen und parfümiert und nach griechischer Tradition mit einer Münze für den Fährmann der Unterwelt im Mund. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen im Haus, von Familienangehörigen und Bekannten, die seinen Tod beklagten und sein Leben rühmten. Marcellus hatte darauf verzichtet Klageweiber zu verpflichten, die sonst den Toten besangen – und momentan ohnehin sehr gut beschäftigt waren.
Nun war Faustus in einen Sarg gebettet worden, der auf einer Bahre zur Begräbnisstätte außerhalb der Stadt getragen wurde. Marcellus führte als Sohn und Erbe den Trauerzug an, den neben zahlreichen Trauergästen auch Musikanten begleiteten, um Faustus einflussreichen Status zu demonstrieren. Zusammen mit Theos lief Aliqua hinter Marcellus her, gepeinigt von der Sommerhitze, die unbarmherzig auf sie niederbrannte. Der Trauerzug kam zu langsam vorwärts, Schweiß perlte über Aliquas Stirn, und die Flöten und Trommeln dröhnten ihr bald in den Ohren. Unauffällig sah sie sich nach allen Seiten um, konnte in dem Gedränge aber kein Mitglied der Familie Omodeus entdecken. Seit Faustus’ Todesnacht hatte sie Sanctius nicht mehr gesehen, auch wenn sie jeden Abend in den Garten geschlichen war, in der Hoffnung, er möge noch einmal auftauchen. Die Blessuren, die Marcellus’ Prügel ihr beschert hatten, waren in bemerkenswerter Geschwindigkeit abgeheilt, und sie wünschte sich, dass Sanctius es sehen könnte und wüsste, dass es ihr gut ging. Aber offenbar vereinnahmten ihn die Kranken in seiner eigenen Familie zu sehr, oder – die Götter mochten gnädig sein – er war selbst erkrankt?
Dieser fürchterliche Gedanke begleitete sie, bis sie endlich die Via Appia erreichten. Die geschäftige Ausfallstraße, die in den Süden bis nach Brundisium führte, war gesäumt von Grablegen und prächtigen Mausoleen, die jeden Tag von den nach Rom strömenden Massen bewundert wurden. Auch die Familie Pomponius hatte hier ein schmuckes Grab errichtet, in dem Faustus seine letzte Ruhe finden würde. Abseits der Straße war bereits ein Scheiterhaufen errichtet worden, auf dem der Leichnam den Traditionen gemäß eingeäschert werden würde.
Aliqua zog sich so weit an den Rand des Geschehens zurück wie möglich. Die Hand nervös um ihren Anhänger aus Blutstein geschlossen, beobachtete sie die Riten, die vollzogen wurden, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Sie war froh, für den Moment aus Marcellus’ unmittelbarer Nähe entkommen zu sein, denn die ganze Zeit bewachte er sie mit Argusaugen, als wäre sie ein wertvoller Schatz, der ihm gestohlen werden könnte.
Sie hatte von Anfang an seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber in den letzten Tagen war etwas anders geworden. Ja, für ihn war sie noch immer eine Sklavin, die niemals so viel wert sein würde wie ein freier Bürger Roms, aber dennoch … Sein Verhalten hatte sich verändert. Obwohl er sie stets unmittelbar bei sich hielt, war er ihr nicht mehr zu nahe gekommen, hatte sie weder berührt noch anderweitig angegriffen. Er nannte sie nicht einmal mehr Anonyma. Es war, als hätte er einen eigentümlichen Waffenstillstand beschlossen, nachdem Sanctius aufgetaucht war und Marcellus ihn beschworen hatte, zusammenzuarbeiten, um Octavia zu retten. Aliqua fragte sich noch immer, was es damit auf sich haben mochte.
Knisternd und qualmend fing der Scheiterhaufen Feuer, als er von Marcellus und anderen Mitgliedern der Familie Pomponius mit Fackeln in Brand gesteckt wurde. Sie wandten die Gesichter von dem Holzstoß ab, gleichzeitig brandete eine neue Welle von Klagegesängen auf.
Aliqua wollte sich die Ohren zuhalten, weil es so laut war, dass es ihre eigenen Gedanken übertönte.
Erneut ließ sie den Blick über die Menge gleiten, und endlich entdeckte sie ein bekanntes Gesicht. Es war Sanctius’ Vater, der auf dem Sklavenmarkt um sie gefeilscht hatte, bis Faustus ihn überboten hatte. Groß gewachsen und mit ernster Miene stand er unter den Trauergästen, schaute aber nicht in ihre Richtung.
Ein Windstoß ging durch die Umstehenden und ließ die Flammen knisternd hochlodern. Viele der Umstehenden sahen sich aufgeregt um, sie fassten sich an die Brust oder den Nacken, und auch Aliqua nahm wahr, was sie spürten. Ungreifbare Spannung lag in der Luft, als wäre sie von Blitzen aufgeladen, und ein Gefühl, als lägen wissende Blicke auf ihr, ließ ihren Nacken prickeln.
Dies konnte nur eines bedeuten. Götter waren unter ihnen.
Aliquas Hand zuckte wie von selbst zu dem Anhänger, der an ihrer Kehle ruhte, als sie spürte, wie der schwarze, schillernde Stein sich an ihrer Haut erwärmte. Schnell schloss sie ihre Finger darum. Dies war schon einmal passiert, an dem Abend, an dem sie sich aus dem Haus hatte schleichen wollen, um Sanctius zu treffen, und Marcellus sie überwältigt hatte. Der Stein war glühend heiß geworden und hatte Wellen von etwas durch ihren Körper geschickt, das sie noch heute erschaudern ließ. Es hatte sich angefühlt wie eine Macht, die aus den tiefsten Abgründen der Dunkelheit aufgestiegen war, gnadenlos und gewaltig. Und doch wie etwas, das ihr nicht fremd war.
Heute passierte nichts dergleichen, obwohl der Hämatit langsame, warme Impulse durch sie schickte.
Gemurmel setzte ringsum ein und übertönte beinahe den Totengesang, als alle flüsternd spekulierten, welche Gottheiten zu der Beisetzung gestoßen sein mochten. Vielleicht der Götterbote Mercur, der den Verstorbenen in die Unterwelt begleiten würde. Oder Libitinia, die Göttin der Bestattung, welche die Einhaltung der Begräbnisgebräuche überwachte. Oder … das Raunen wurde leiser, beinahe ängstlich … Pluto selbst, der Gott der Unterwelt! Aliqua sah jede Menge nervös hüpfender Kehlköpfe, als der Name dieser Gottheit aufkam. Ihr Herzschlag beschleunigte sich, und sie sah sich suchend um, obwohl sie wusste, dass es zwecklos war. Die Götter traten nie in Gestalt auf und fuhren auch höchst selten in Menschen, um durch deren Münder zu sprechen. Ihre bloße Präsenz genügte, um in der Trauergemeinde Unruhe zu schüren.
Das Knistern in der Luft schwächte sich allmählich ab, und allgemeines Aufatmen war zu hören. Wer auch immer unter ihnen gewesen war, hatte an den durchgeführten Riten und Totengaben offenbar nichts auszusetzen gefunden und würde sie nicht strafen.
In Aliquas Mund blieb ein seltsamer metallischer Geschmack zurück. Sie hatte schon von Beisetzungen gehört, die einen Gott erzürnt hatten, der daraufhin das Feuer des Scheiterhaufens so hoch hatte schlagen lassen, dass mehrere Menschen in seiner Nähe zu Tode gekommen waren.
Stattdessen hob sich die Stimmung, als man feststellte, dass Faustus eine besondere Huld zuteilgeworden sein musste. Er würde ins Elysium eingehen und die ewige Glückseligkeit genießen dürfen.
Aliqua hatte die Hand noch immer um ihren Anhänger geschlossen und wagte nicht zu atmen. Sie wusste nicht, woher diese Gewissheit kam, aber irgendetwas sagte ihr, dass dieser Besuch der Götter nichts mit der Beisetzung zu tun hatte.
Sie hatten etwas gesucht.
Jemanden.
Santo
Obwohl ich bei unserer Ankunft in Rom noch immer von brennendem Tatendrang erfüllt war, musste ich mich doch zuerst den Bedürfnissen meines Körpers beugen. Und der verlangte dringend nach Schlaf.
Wie betäubt bin ich in die Wohnung gewankt, nachdem die anderen mich davor abgesetzt haben, und eine Erschöpfung, die ich nicht mehr abschütteln konnte, hat von mir Besitz ergriffen. Ich bin auf direktem Weg in mein Schlafzimmer gelaufen, auch wenn ich noch einige Momente vor der geschlossenen Tür von Aliquas Raum verharrte. Sie war nun schon einige Nächte nicht mehr dort, aber mir war klar, dass ihr Duft und ein Hauch ihrer Anwesenheit noch immer da sein würden.
Trotzdem habe ich mich abgewandt und bin in mein eigenes Zimmer zurückgekehrt. Nach dem ganzen Mist, der noch immer unausgesprochen zwischen uns steht, hat es sich falsch angefühlt, in ihr Refugium vorzudringen. Selbst wenn sie jetzt hier wäre, würde sie meine Nähe nicht wollen. Das weiß ich genau, und es reißt einen weiteren Krater in mein schwarzes Herz. Ein Herz, für dessen Verfall ich selbst über Jahrhunderte gesorgt habe.
Die Tage seit Aliquas Befreiung waren nichts als eine Täuschung, eine Illusion, der ich mich hingegeben habe. Ich wusste genau, dass meine Taten und Geheimnisse früher oder später zusammenbrechen würden wie ein Kartenhaus und alles herauskommen würde. Aber ich war gierig. Ein gieriger Bastard, der sich alles genommen hat, was er nicht haben durfte. Das Gefühl, Aliqua wieder nahe zu sein, während sie sich an nichts aus unserer Vergangenheit erinnern konnte, war zu verlockend. Das Vertrauen, das sie nicht hätte haben dürfen … die Anziehung, der ich nicht hätte nachgeben dürfen. Anstatt sie zu warnen und ihr die Wahrheit zu erzählen, konnte ich ihr nicht widerstehen. Es war viel zu verlockend, dieses vergiftete Gefühl eines neuen, unbescholtenen Anfangs.
Jetzt graut der Morgen vor den Fenstern meines Schlafzimmers, und ich starre an die Decke und beobachte die wandernden Streifen aus Licht und Schatten. Ich habe den Großteil des vergangenen Tages verschlafen, doch es fühlt sich so an, als wäre keine Sekunde vergangen, seit wir gestern um diese Zeit auf dem Vulkan gestanden haben. Glasklar sehe ich Marcellus vor mir, der Aliqua am Nacken packt wie einen Hund. Der Zorn wallt in mir hoch wie etwas Lebendiges, das meinen Atem teilt und sich an meinem Blut nährt.
Noch immer bin ich voller Asche und Staub und beschließe zu duschen, bevor ich irgendetwas anderes tue. Auf dem Weg ins Bad rieselt eine Schmutzspur hinter mir her, und die Klamotten, in denen ich geschlafen habe, fallen als staubender Haufen auf den Fliesenboden.
Nach dem Duschen inspiziere ich mein Gesicht im Spiegel. Unter dem Wasserstrom habe ich jede Menge getrocknetes Blut abgewaschen, das von mehr oder weniger schweren Verletzungen herrührte. Meine Nase hat einiges abbekommen, aber zum Glück scheint sie nicht gebrochen zu sein. Ein Faustschlag hat meine Oberlippe aufplatzen lassen, was unangenehm ist, aber auch nicht weiter schlimm. Der Rest sind Prellungen und Wunden, die nicht der Rede wert sind. Vielleicht ein paar geprellte Rippen.
Tatsächlich begrüße ich den dumpfen Schmerz, der meinen Körper im Moment erfüllt. Die Unsterblichkeit hat mich in den letzten Dekaden abstumpfen lassen, und das Ziehen und Pochen ist eine Erinnerung daran, dass ich noch immer lebe und etwas empfinde. Es zeigt den Unterschied zwischen simplem Existieren und Lebendigsein auf. Etwas, das ich beinahe vergessen hatte, ehe Aliqua wieder aufgetaucht ist.
Mit zusammengebissenen Zähnen suche ich mir frische Klamotten aus dem Wandschrank in meinem Zimmer.
Auf dem Weg in die Küche, in Gedanken schon ganz bei einer Tasse heißen Kaffees, halte ich abrupt inne. Ein Schauer von Aufmerksamkeit rauscht über meinen Rücken und warnt mich, dass ewigliche Energie in der Nähe ist. Es ist nur ein leichtes Prickeln, das jeder und jede Ewigliche mit sich trägt, seit wir den Trank der Unsterblichkeit von den Göttern erhalten haben. Er hat uns ein Körnchen göttlicher Energie verliehen, das ich noch immer wahrnehmen kann. Und ein besonders aufgepeitschter Funken Unsterblichkeit ist gerade ganz in der Nähe.
Ich fahre auf den Absätzen herum, als die Wohnungstür so heftig aufgestoßen wird, dass sie an die Wand knallt und die Bilderrahmen ringsum zum Klappern bringt. Für den Bruchteil einer Sekunde gehe ich von feindlichem Eindringen aus, dann erkenne ich eine vertraute Gestalt, die aber nicht weniger bedrohlich auf mich zuschießt.
Schlitternd kommt meine Schwester Orela vor mir auf dem spiegelblanken Steinboden zum Stehen. Sie strahlt eine Wolke aus Wut und Funken sprühender Aufregung aus, die sogar ich wahrnehmen kann, obwohl ich keinerlei emphatische Fähigkeiten besitze. Ich kenne Orela besser als mich selbst, aber gerade ist sie so außer sich, dass sie mir wie eine Fremde vorkommt.
Ihre blauen Augen, die sonst wie ruhige Quellen aussehen, in denen unglaublich alte Geheimnisse versunken liegen, sind jetzt hart und dumpf. Ein unheimliches silbernes Flackern durchzieht ihre Iris und lässt mir den Atem tief in der Kehle stocken.
»Du!«, schreit sie, und ihre Stimme überschlägt sich. »Was bei unseren verfluchten Scheißseelen ist passiert?«
Ich starre sie an und stelle erschrocken fest, dass ich Orela vollkommen vergessen habe. Während wir anderen auf dem Vesuv waren, ist sie schlafend und ahnungslos in Tivoli zurückgeblieben, wo sie sich zuvor mit Aliqua vor den Immortali versteckt hatte.
Als ich nicht reagiere, wird sie noch lauter. »Ich wache auf und finde nichts als einen mickrigen Zettel, auf dem steht, dass Aliqua und du mich nicht wecken konntet und auf dem Weg zum Vesuv seid! Weil Marcellus befreit wird! Und seitdem nichts. Von keinem von euch!«
Wenn sie es könnte, da bin ich mir absolut sicher, würde Orela in diesem Moment Feuer spucken. Ihre langen schwarzen Haare wogen unter einer nicht existenten Brise, und sie fletscht vor Zorn die Zähne.
»Ich musste das Ehepaar Bruno dazu überreden, mich nach Rom zu fahren, sonst würde ich noch immer in der Villa sitzen und verrückt werden vor Sorge! Im Radio sprechen sie von nichts anderem als den Erdbeben und dem Quasi-Ausbruch des Vesuv. Und behaupte ja nicht, dass ihr damit nichts zu tun hattet. Ich weiß, dass das alles nicht natürlich war!«
Orela tobt und pulsiert, als wäre sie selbst ein kleiner Vulkan, und ich lasse ihren Zorn auf mich herniedergehen. Mehrmals öffne ich den Mund, um etwas zu sagen, aber kein Laut kommt über meine Lippen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es ihr sagen soll. Sie weiß noch nichts von Aliquas Schicksal, und es wird sie niederschmettern. Und es wird verdammt unangenehm, laut auszusprechen, was gestern Morgen passiert ist.
»Wo ist Aliqua? Mit ihr muss ich auch ein Wörtchen reden«, zischt Orela und späht an mir vorbei, als vermutete sie, Aliqua würde sich hinter meinem Rücken verstecken.
Der Atem, der noch immer in meiner Brust feststeckt, verdichtet sich zu einem schmerzhaften Klumpen. Ich schaffe es kaum zu sprechen.
»Sie ist nicht hier.« Meine Stimme klingt, als hätte ich Kieselsteine geschluckt. Spitze, harte Brocken, die mich von innen aufschlitzen, während ich mich bemühe, verständliche Worte zu formen.
Ich sehe Orela an, dass sie zu einer weiteren Schreikanonade ansetzen will, doch dann stockt sie. Ihre Lippen teilen sich, und sie mustert mich mit schief gelegtem Kopf.
Bemerkt sie jetzt, dass etwas nicht in Ordnung ist? Kann man es mir ansehen?
Schwachsinn, natürlich kann man das.
Ihre Pupillen weiten sich, und der Silberhauch in ihrem Blick verschwindet. »Was ist passiert?«
Als ich nur müde den Kopf schüttle, fasst mich Orela an den Händen und führt mich ins Wohnzimmer. Die Sonne taucht den großen Raum inzwischen in strahlende Helligkeit, vor der ich am liebsten die Augen verschließen würde.
Zusammen mit Orela lasse ich mich auf das große Sofa sinken. Nachdem ich mich mehrmals trocken geräuspert habe, beginne ich ihr zu erzählen, was passiert ist, seit ich in den frühen Morgenstunden in Tivoli angekommen bin. Ich lasse kein Detail aus. Nicht, dass Aliqua mich damit konfrontiert hat, dass sie mit Orelas Hilfe die Wahrheit über unsere gemeinsame Vergangenheit herausgefunden hat. Wie der Zorn und Schmerz ihre Züge verwüstete und die Erkenntnis, dass ich ihr Vertrauen verloren habe, mich von innen aufgeschlitzt hat.
Ich rede immer weiter.
Adones Anruf, der uns über Marcellus anstehende Befreiung am Vesuv informiert hat. Die Entscheidung, Orela in ihrem tiefen Schlaf zurückzulassen, und unsere rasende Fahrt auf dem Motorrad zum Golf von Neapel.
Und alles, was sich auf dem Parkplatz unterhalb des Kraters des Vesuv abgespielt hat.
Orela ist vollkommen still, während ich erzähle, doch ihre Miene wird mit jedem Wort wächserner. Sie ist so blass, mit dunklen Schatten, die unter ihren Augen liegen, und die Sorge gräbt sich immer tiefer in ihre Züge.
»Ich wusste es«, haucht sie schließlich tonlos. »Ich bin aufgewacht und hatte diese Ahnung, dass etwas Schreckliches passiert ist. Auch deswegen war ich so außer mir. Da war dieses Gefühl, dass ich hätte da sein müssen, aber zu weit weg war und nichts ausrichten konnte.«
»Nein, Orela.« Entschlossen schüttle ich den Kopf. Schon seit Jahrhunderten ist es ein Problem, dass sie Dinge ahnt und sich im Nachhinein die Schuld gibt, nicht gehandelt zu haben. Die Sache ist aber die, dass sie nie genau weiß, was sie spürt, und daher auch nicht sagen kann, wo sie eingreifen müsste. Ihre Ahnungen sind einfach zu ungenau.
»Es tut mir leid, dass wir dich zurückgelassen haben, aber angesichts der Umstände würde ich es wieder so machen. Du warst vollkommen ausgeknockt nach der Hypnose, und zu dritt hätten wir auch gar nicht auf mein Motorrad gepasst. Dich trifft keine Schuld.«
»Dich aber auch nicht.«
»Da bin ich anderer Meinung.«
Sie setzt sich gerade auf, ein Zierkissen vor die Brust gepresst. »Sie haben euch überwältigt Santo, du hattest keine Chance!«
»Genau das ist es doch!«, brause ich auf, und endlich platzt die Lethargie von mir, die mich gelähmt hat wie eine starre Rüstung. »Ich hätte meinen Verstand einsetzen müssen und es überhaupt nicht so weit kommen lassen dürfen! Was hab ich mir dabei gedacht, mich alleine mit Aliqua den Immortali entgegenzustellen? Ich hätte … ich hätte…« Meine Stimme bricht ab.
Wie aus weiter Ferne höre ich Orela sprechen. »Ihr dachtet, dass ihr Marcellus’ Befreiung noch aufhalten könntet, nicht wahr? Dass ihr dort ankommt und euer Auftauchen genügt, um die Immortali lange genug abzulenken, bis die Verstärkung eintrifft. Aber wenn du es unbedingt so sehen musst, dann hat sich Aliqua genauso kopflos verhalten wie du. Ihr habt euch zusammen in diese Situation gebracht.« Sie verstummt kurz, und ihre Brauen ziehen sich zusammen. »Vielleicht war es auch eine Falle von Remo. Er hat euch die Informationen übermittelt, nicht wahr?«
Vollkommen überrascht fahre ich zu ihr herum. »Was soll das heißen?«
Orela zuckt mit den Schultern. »So wie ich das sehe, hat er euch zu spät informiert. Ja, ihr habt eine Weile von Tivoli bis zum Vesuv gebraucht, aber da waren die Immortali ja längst am Werk. Das erste Erdbeben, das Aliqua geweckt hat, zeigt das. Das war mitten in der Nacht, und Remo hat sich erst in den frühen Morgenstunden bei euch gemeldet. Er war offenbar Teil der Bergungsmission und hätte euch schon sehr weit im Voraus informieren können.«
Ich blinzle benommen, komme aber nicht umhin zu erkennen, dass Orela recht hat. Remo, der kürzlich beschlossen hat, zu den Immortali überzulaufen und den wir mit ein wenig Nachdruck zu unserem Informanten gemacht haben, hat sich Zeit gelassen. Viel Zeit.
Hat er uns wissentlich ins offene Messer laufen lassen? Damit wir erst zu einem Zeitpunkt am Vulkan ankommen, zu dem Marcellus längst befreit war?
Ich habe nicht übel Lust, mich sofort auf den Weg zu machen und diese kleine Ratte aufzuspüren.
»Ciiiiiiaaaaoooo!«
Orela und ich fahren gleichzeitig auf dem Sofa herum, als plötzlich eine Stimme aus dem Eingangsbereich trällert.
Wo wir vom Teufel sprechen, das ist Adone, Remos Bruder. Wenn er selbst noch nicht darauf gekommen ist, wird ihn Orelas Erkenntnis ganz sicher genauso brennend interessieren wie mich.
Unser Cousin kommt hereingerauscht, eine fettgetränkte Papiertüte im Arm, Scuro auf den Fersen, der ihm wie ein übermüdeter Schatten folgt.
»Wie zum Teufel kommt ihr hier rein?«, brumme ich. Die beiden haben definitiv nicht geklingelt. Und sie haben auch noch nie einen Schlüssel besessen, denn dann hätte ich keine einzige ruhige Minute mehr.
»Machst du es dir inzwischen zur Angewohnheit, Türen aufzubrechen?« Ich spiele auf den Tag an, an dem wir Remo in der Wohnung seiner Freundin überrumpelt haben und Adone wie ein Profi die Tür geknackt hat.
Adone rollt mit den Augen. »Wenn ihr eure Tür offen stehen lasst, müsst ihr euch nicht wundern, wenn Leute hereinkommen. Seid froh, dass es nur wir sind. Immerhin habe ich Nervennahrung dabei.« Er wackelt mit der Papiertüte, die aus einer Pasticceria zu stammen scheint. Adone hat eine unstillbare Schwäche für Gebäck aller Art.
Ich werfe Orela einen vorwurfsvollen Blick zu, doch sie achtet gar nicht auf mich, sondern steht von der Couch auf, um in die Küche zu gehen.
»Ich mache uns Kaffee, dann treffen wir uns gleich oben auf dem Dach. Wir brauchen einen Schlachtplan.«
Kapitel Drei
Aliqua
Marcellus kommt in mein Zimmer geschlendert, ein argloses Lächeln auf den Lippen, als wäre er nicht mein Entführer, der mich in diesem düsteren Raum gefangen hält.
Mein Blick gleitet über ihn.
Im Gegensatz zu mir hat er sich inzwischen gewaschen und alle Reste von Staub und erkalteter Lava beseitigt, die nach seiner ewig langen Gefangenschaft unter der Erde an ihm gehaftet sind. Ich selbst kann ein Lied davon singen, wie hartnäckig dieser Dreck ist. Bei mir hat es einer Dusche und eines Vollbads bedurft, um sauber zu werden.
Mir fällt auf, wie blass seine Haut ist, was wahrscheinlich an der langen Zeit ohne Sonnenlicht liegt. Früher war sein Teint dunkler, beinahe golden. Doch seine Augen haben nichts von ihrem berechnenden Glanz verloren.
Auch er schaut mich an, lauernd wie ein Raubtier, das es genießt, sein Opfer in die Enge zu treiben. Aber ich habe nicht vor, mich von ihm zu einem Opfer machen zu lassen, nicht mehr. Die Vergangenheit steht zwischen uns wie ein albtraumhafter Schatten, der plötzlich Gestalt angenommen hat, aber ich will nicht zulassen, dass es mich überwältigt.
»Na, hattest du Sehnsucht nach mir?«, stoße ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Mokant neigt Marcellus den Kopf. »Seltsam, dasselbe wollte ich dich gerade fragen, Serva.«
»Ich weiß nicht, was die letzten zwei Jahrtausende mit deinem Kopf angestellt haben, aber ich bin definitiv nicht mehr deine Sklavin. Die Nutzungsrechte sind abgelaufen.«
Marcellus gluckst, während er noch immer an der geschlossenen Tür steht. Fast kommt es mir so vor, als wollte er die Distanz zu mir nicht überbrücken.
»Zu schade, dass die Sklavenhaltung abgeschafft wurde, das würde alles so viel einfacher machen.« Er schnalzt mit der Zunge. »Aber daran, dass du ein Nichts bist, hat sich trotzdem nichts geändert.«
Wütend kneife ich die Augen zusammen. »Lieber bin ich ein Nichts als so verkommen wie du und die Immortali.«
»Mit solchen Aussagen wäre ich in Zukunft lieber vorsichtig. Wenn die Immortali mit ihrem Vorhaben, die Götter zurückzuholen, erfolgreich sind, dann bedeutet das auch die Rückkehr zur alten Ordnung. Dann wirst du an deinen angestammten Platz in der Hackordnung zurückkehren.« Selbst durch das düstere Zimmer hindurch sehe ich das Glühen seiner Augen. Gier, er giert nach dem, was sie planen. Und nach allem, was ich über meine Gabe erfahren habe (was zugegeben wenig ist, aber genug, um mich festzulegen), weiß ich, dass ich eine zentrale Rolle in seinen Plänen spiele. Ich gehe stark davon aus, dass er mich nicht nur der alten Zeiten willen entführt hat.
»Über meine Leiche!« Abscheu färbt meine Stimme dunkel, Marcellus’ Mundwinkel zucken.
»Damit kann ich leider nicht dienen, Liebes. Du wirst noch gebraucht.«
Meine Finger zucken, aber ich halte mich zurück. Seit der Hypnose mit Orela weiß ich, dass es in der Vergangenheit den ein oder anderen körperlichen Zusammenstoß zwischen uns beiden gab und dass ich mich nie gegen ihn zur Wehr setzen konnte.
Marcellus’ aufgeworfene Lippen kräuseln sich. »Ich sehe dir an, dass du liebend gern einen Streit mit mir vom Zaun brechen würdest, aber deswegen bin ich nicht hier.«
»Ach nein? Worüber willst du dann reden? Die tolle Aussicht hier?« Theatralisch deute ich auf das verrammelte Fenster. Er folgt meiner Geste und zieht die Brauen leicht zusammen.
»Dein Zimmer hat einen wunderbaren Blick auf den Park«, erklärt er.
»Herrlich, kann mich kaum dran sattsehen.«
Ein Prusten entweicht Marcellus, und er macht ein paar Schritte in den Raum hinein. Ich habe darauf gewartet, dass er sich in Bewegung setzt, doch prompt versteift sich mein Körper.
»Für dich ist es nicht von Interesse, wo genau wir uns befinden. Alles, was du wissen musst, ist, dass dieser Ort bestens abgeschirmt ist, wodurch du uns auch nicht durch deine praktische kleine Gabe entwischen kannst.«
Prompt öffne ich den Mund, um nachzufragen, aber er schnalzt mahnend mit der Zunge. »Es gibt interessantere Dinge, über die wir uns austauschen können, Anonyma.« Sein Grinsen verrät, wie sehr er es genießt, meinen alten Schimpfnamen zu verwenden. »Wir beide haben eine Aufgabe vor uns, an der wir arbeiten müssen.«
»Ich glaube kaum. Du hast mich vielleicht entführt, aber ich werde ganz sicher nicht mit dir zusammenarbeiten.«
»Es war leider notwendig, dich von dieser Horde Brüllaffen wegzubringen, die so schnell bereit war, dich zu verteidigen. Du hast dieses Talent, dass andere dich lieb gewinnen und vor Schaden bewahren wollen. Koste es, was es wolle.«
Aus seinem Mund klingt es, als besäße ich die Gabe, alle um mich herum in Stinktiere zu verwandeln.
»Du hast da ein paar einflussreiche Freunde, die für dich den Hals hinhalten. Aber leider sind sie zu dickköpfig, um zuzuhören, geschweige denn die Wahrheit zu erkennen. Ich hoffe, dass du dich als einsichtiger erweist.«
»Wenn du mich von irgendetwas überzeugen willst, hättest du meine Freunde vielleicht nicht als Brüllaffen bezeichnen sollen. Oder mich im ersten Atemzug daran erinnern, dass ich in deinen Augen weniger wert bin als der Dreck unter deinen Fingernägeln«, zische ich in kaum verhohlener Rage.
»Oh, da verstehst du mich aber falsch. Ich mag dich für das verachten, was du bist, aber ich schätze dich über die Maßen für das, was in dir schlummert. Du bist der Schlüssel zu den Göttern, und ich bin entschlossen ihn zu benutzen.«
Was in mir schlummert … will er damit andeuten … woher weiß er?
Sein Grinsen vertieft sich. »Ich habe dich schon damals beobachtet, Aliqua, und weiß, was dir und allen anderen um dich herum nicht bewusst ist und nie bewusst war.« Er kommt noch einen Schritt näher. Jetzt, da er nur noch eine Armlänge von mir entfernt ist, trifft mich das dunkle Glühen in seinen Augen mit voller Wucht. Es ist ein Inferno aus Entschlossenheit und Gier. Und noch etwas, das ich nie bei Marcellus erwartet hätte: Schmerz. Eine uralte, bodenlose Traurigkeit, deren Ausdruck mich seltsamerweise an Santo erinnert. Auch er hat diesen Abgrund in sich, der mich jedes Mal mitzureißen droht, wenn er ihn mich sehen lässt.
Dieser Ausdruck gibt Marcellus etwas Menschliches. Er hat sich schon immer benommen, als wäre er ein Gott unter Sterblichen. Brutal, Selbstherrlich, Arrogant. Hätten die römischen Götter je eine eigene Gestalt besessen, dann hätte ich sie mir wie Marcellus vorgestellt. Vielleicht ist er deswegen so versessen darauf, sie zurückzuholen. Damit sie ihn endgültig zu einem der Ihren machen. Wahrscheinlich würde er seinen Körper mit Handkuss dafür anbieten, von einem Gott als Gefäß in Besitz genommen zu werden.
»Ich mache dir ein Angebot.« Marcellus steht jetzt direkt vor mir, und ich kann ihm nicht länger ausweichen. Mein unterer Rücken stößt gegen das Fensterbrett, das ich mit beiden Händen umklammere.
»Du zeigst etwas Vernunft und erklärst dich bereit, mir zuzuhören. Und ich meine wirklich und unvoreingenommen zuhören. Dann darfst du dieses Zimmer verlassen und überall im Haus herumwandern. Falls nicht … tja, dann bleibst du hier drin, und ich muss andere Wege finden, um dich kooperativ zu stimmen. Es liegt an dir, ob du mir freiwillig hilfst«
Brodelnd erwidere ich seinen Blick. »Ich fürchte, ich lasse es drauf ankommen, was deine Kreativität so hergibt, Dominus.«
Er schürzt die Lippen und fletscht die Zähne wie ein Wolf. »Überleg es dir gut, ob du mich herausfordern willst. Dir mag es vielleicht gelungen sein, einen Vulkan zu besänftigen, aber du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt, wenn du dich mit den Immortali anlegst. Sie werden es nicht lange hinnehmen, dass du dich verweigerst. Sie wollen sehen, dass ich Fortschritte bei dir mache.«
Sein Atem streift mein Gesicht wie ein betäubendes Parfum, das nach Anis und Finsternis riecht. Obwohl er mir so unverhohlen mit den Immortali droht, spüre ich keine Angst. Ich weigere mich, wieder von ihm in die Rolle der hilflosen Sklavin drängen zu lassen, die ich einmal war. Mir ist klar, dass ich gerade kaum Optionen habe. Mich zu verweigern, ist die beste Möglichkeit, um Zeit zu schinden, bis ich einen Weg gefunden habe von hier zu entkommen – oder Santo und die anderen es schaffen, mich aufzuspüren. Denn sie suchen doch nach mir, oder?
Das Chaos in meinem Herzen mal beiseitegeschoben, glaube ich fest daran, dass Santo mich nicht meinem Schicksal überlassen wird. Nicht, wenn ich danach gehe, wie verzweifelt er meinen Namen gebrüllt hat, als der Helikopter mich in die Luft entführt hat. Aber es dürfte schwierig für sie werden. Ich befinde mich mit ziemlicher Sicherheit in einem Unterschlupf der Immortali, und soweit ich es mitbekommen habe, sind die für Damnati so gut wie unaufspürbar.
Aber da ist noch Remo, fällt mir ein. Adones jüngerer Bruder, der zu den Abtrünnigen übergelaufen ist, uns aber trotzdem die entscheidende Information über Marcellus’ Befreiung geliefert hat. Wenn er sich auch an diesem Ort aufhält, könnte ich ihn vielleicht dazu bringen, mir zu helfen. Sofern er mir über den Weg läuft … was in diesem Zimmer eher unwahrscheinlich ist. Ich beiße mir auf die Unterlippe und frage mich, ob es die richtige Entscheidung war, Marcellus so impulsiv abblitzen zu lassen. Ich könnte viel mehr erreichen, wenn ich aus diesem Zimmer dürfte. Und wenn ich beteuern würde, ihm zuzuhören, heißt das ja nicht, dass ich ihm glaube und an seinen Plänen teilnehme.
Also straffe ich mich und wappne mich für das, was ich gleich sagen werde. »Gib mir ein wenig Bedenkzeit, okay?«
Marcellus’ Ausdruck wird selbstgefällig, und meine Gelenke knacken, als ich die Finger noch fester um das steinerne Fenstersims schließe. Wahrscheinlich denkt er, dass mich seine Drohungen haben einknicken lassen.
Ich kann ihn einfach nicht ausstehen.
»Das hört sich doch schon viel besser an.« Er streckt die Hand aus und berührt leicht meine Wange, doch mein Entgegenkommen hat Grenzen. Abrupt reiße ich den Kopf zurück und knalle dabei gegen die Fensterscheibe, was ihm ein Kichern entlockt.
»Ich sehe schon, das wird eine äußerst interessante Zeit mit dir werden.«
Die Hände in den Hosentaschen vergraben, dreht er sich um und stolziert zur Tür.
Kapitel Vier
Rom, 79 n. Chr.
»Aliqua!« Marcellus’ Stimme hallte durch das Haus, und ertappt rappelte sie sich von ihrem Platz an Octavias Bett auf, wo sie die letzte Stunde gekauert hatte. Sie hatte versucht, ihr etwas Brühe einzuflößen, während sich Ulpia, die für diese Aufgabe neu abgestellt worden war, eine Ruhepause in Aliquas alter Schlafkammer gönnte. Jetzt erschien die ältere Sklavin zerzaust im Durchgang und scheuchte Aliqua mit aufgeregtem Wedeln ihrer Hände hinaus.
»Geh schon, wenn der Dominus nach dir verlangt«, zischte sie, und Aliqua sprang hastig auf. Ihre Beine waren unter ihr eingeschlafen und stachen bei jedem Schritt hinunter ins Atrium. Inzwischen war der Abend hereingebrochen, und sie fragte sich, wonach Marcellus zu dieser späten Stunde der Sinn stehen mochte.
Er wartete bereits vor der Pforte, nur Theos an seiner Seite. Obwohl er als Erbe von Faustus Pomponius zu den einflussreichsten Bürgern der Stadt gehörte, verzichtete er gegenwärtig auf eine große Entourage, wenn er ausging. Als wollte er vermeiden, dass zu viele Menschen wussten, wohin er ging und was er trieb.
»Wo warst du?«, schnarrte er, als Aliqua dir Treppe herunter gehastet kam.
Sie setzte zu einer Antwort an, doch Marcellus bedeutete ihr nur mit einer ungeduldigen Geste, sie möge sich beeilen, und gemeinsam mit Theos folgte sie ihm hinaus. Die Pforten des Hauses waren noch immer mit immergrünen Zypressen- und Pinienzweigen geschmückt, die allen Vorbeigehenden zeigten, dass dieses Heim Trauer trug.
Sie erklommen den mons Esquilinus, und Aliqua umklammerte fest ihren Anhänger, als sie an turmhohen Insulae vorbeikamen, die eine Aura von Armut und Dreck ausdünsteten. Das Greinen von Kindern, aufgeregtes Bellen und Gackern und Fetzen von Streitgesprächen waren zu hören. Mit einem angewiderten Laut ließ sich Marcellus von Theos ein Taschentuch reichen, das er sich vor Mund und Nase presste, ohne langsamer zu werden. Es ging immer steiler bergauf, bis sie die Armenunterkünfte hinter sich gelassen hatten und zu den Villen gelangten, die die Hügelkuppe bevölkerten.