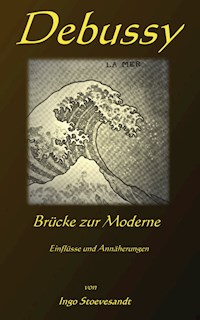Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wie klingt eigentlich Musik aus Vietnam? Oder aus Laos, Kambodscha, oder Myanmar? Was ist eine sprechende Geige oder ein Schüttelorgel? Anhand ausgewählter Musikinstrumente aus seiner Sammlung versucht der Musikethnologe Ingo Stoevesandt eine erste Übersicht über die musikalische und vor allem instrumentale Vielfalt dieser Region zu geben. Musik aus Südostasien, das ist Musik mit Instrumenten aus Bambus, Stein und Seide. Manche dieser Instrumente existieren bereits seit über tausend Jahren und haben auch unsere Musikinstrumente beeinflusst. Dabei erfährt man über die Instrumente auch Interessantes über die Volksgruppen, ihren Glauben, ihre Bräuche und Traditionen. Denn genau so wichtig wie das Instrument ist auch immer der Mensch dahinter, der es spielt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INSTRUMENTARIUM
Die traditionelle Musik Südostasiens
und ihre Musikinstrumente
von
Ingo Stoevesandt
© 2022 www.musikausasien.de
Vorwort
Geopolitisch betrachtet versteht man unter dem Begriff “Südostasien” heute folgende Länder:
China, Laos, Kambodscha, Myanmar, Vietnam, Thailand, Indonesien, Malaysia und die Philippinen.
In dieser geographisch riesigen Region versammeln sich hunderte unterschiedliche Volksgruppen, von denen fast jede ihre eigene Kultur und damit auch eine eigenständige Musiktradition kennt. Dieses Mosaik komplett darzustellen ist in Buchform unmöglich, da es viel zu umfangreich wäre.
Natürlich gibt es Enzyklopädien, die genau das versuchen, jedoch scheitern sie schnell an der Unvollständigkeit, und vor allem an der Aktualität, denn die Kulturen und Traditionen der Asiatischen Völker sind im steten Wandel, vor allem Musiktraditionen und die damit verknüpften Instrumente können manchmal innerhalb einer einzigen Generation komplett verschwinden.
Die Vielfalt der Sprachen macht einen Zugang ebenfalls schwierig, und eine wirkliche Dokumentation der Historie der Musikkulturen ist auch nur lückenhaft vorhanden oder oft durch den Blick des Kolonialismus verfälscht, da viele Beschreibungen von “Reisenden” des 19. Jahrhunderts stammen, die dann die Völker und ihre Musik aus westlicher Sicht beschreiben.
Eine Übersicht in Katalogform kann also niemand bieten, und auch eine akademische Behandlung der Musiktraditionen und ihrer Instrumente überlasse ich lieber Anderen.
Ich möchte vielmehr versuchen, anhand ausgewählter Musikinstrumente aus meiner Sammlung meine Faszination für die Musik aus dieser Region zu teilen und Neugierde auf diese außergewöhnlich vielfältigen Musiktraditionen zu wecken.
Wer einmal die sphärische Musik der Gongs eines Indonesischen “Gamelan” Orchesters gehört hat, wird den besonderen Reiz dieser Musik verstehen. Wenn man jedoch gleich darauf die Musik eines “Hsaing Waing” Orchesters aus Myanmar hört, dürfte die Verwirrung groß sein, denn viel zu “fremd” klingt da plötzlich die Musik.
Grundsätzlich zwingt uns die Asiatische Musik zu einer ungewohnten Musikrezeption: Wir können sie nicht einfach “konsumieren”, sie ist keine Musik für das “Nebenbeihören”, sondern fordert unsere volle Aufmerksamkeit. Damit ist sie nicht immer bequem zu hören, belohnt jedoch den Hörer mit einer Fülle an Details und überzeugt durch ihre Ausdruckskraft.
Für mich hat diese Musik eine “Brückenfunktion”, denn da sie oft die gesamte “Kultur” eines Volkes in sich vereint, vor allem Tanz und Religion, aber auch Sprache, Literatur und Weltanschauung, kann sie als “Brücke” für eine Verbindung zwischen unserer und der Asiatischen Kultur dienen. Betrachtet man einzelne Instrumente, wird man nicht selten überrascht, wie viel Einfluss diese manchmal Jahrtausende alten Instrumente auf die Entwicklung unserer eigenen Europäischen Instrumente hatten. Nicht nur durch Marco Polo's fragwürdige Reise entlang der Seidenstraße wissen wir um die alte Verbindung zwischen Europa und Asien, auf der nicht nur Handelsgüter, sondern auch Musikinstrumente in beide Richtungen gereist sind.
So erleben wir in den Asiatischen Musikinstrumenten nicht nur eine lebendig erklingende Musikgeschichte der letzten Jahrtausende, sondern manchmal auch eine Verbindung zur Geschichte unserer eigenen Musikkultur.
Bei allem “Exotismus” der Asiatischen Musiktraditionen interessiert mich vor allem, was uns dabei verbindet:
Über die Kenntnis der Musikinstrumente und ihrer Klänge wird das “Fremde” plötzlich vertraut, und im Idealfall entdeckt man etwas Verbindendes, Gleiches oder Ähnliches, sei es im Bau des Instruments, oder in seinem Klang, oder in der Form der darauf gespielten Musik.
Dabei faszinieren mich die vorgestellten Instrumente nicht nur durch ihre zum Teil Jahrtausende alte Geschichte, sondern auch durch ihre manchmal als “primitiv” beschimpfte Einfachheit.
Während ein Konzertflügel aus einer komplizierten Mechanik besteht, die ein solches Instrument schnell so viel kosten läßt wie eine Doppelhaushälfte, besteht eine Indonesische “Suling” einfach aus einem Bambusrohr mit einigen Grifflöchern und einem Mundstück.
Die Kreativität, mit der in Südostasien aus den einfachen Materialien, die in der direkten Umgebung wachsen, erstaunliche Klänge erzeugt werden, hat mich oft überrascht.
Und so schrill, schräg oder auch “fremd” ein Instrument erklingen mag - wenn man sich näher damit beschäftigt, wird nicht nur dieser Klang bald vertrauter, sondern auch der Mensch dahinter, der es spielt.
1. Die traditionelle Musik Chinas
Wie schafft man es, die ca. 5000 Jahre Musikgeschichte eines Großreiches wie China in wenigen Worten zu charakterisieren?
Die Antwort muss wohl lauten: Gar nicht.
Und da ein solches Vorhaben ähnlich unrealistisch ist wie die Abhandlung der abendländischen Musikkultur in zwei Sätzen, möchte ich lieber kurz über grundsätzliche Anforderungen schreiben, die einem Europäisch geprägten Musikliebhaber beim Anhören dieser Musik begegnen können:
Warum klingt diese Musik so anders, so "fremd"? Oder gibt es vielleicht Entsprechungen zu unserer Musik? Und sind diese Erkenntnisse der Chinesischen Musik auch auf andere Asiatische Musik übertragbar?
Für einen Europäischen Hörer klingt die Chinesische (und auch andere traditionelle Asiatische) Musik zuerst einmal eher "fremd". Das liegt natürlich vordergründig an den Klängen der fremden Instrumente, die sich zum Teil einer Klangerzeugung bedienen, die im Europäischen Raum wenig verbreitet ist, wie auch die Klassifizierung der Chinesischen Instrumente erkennen läßt:
Ähnlich der in Europa gängigen Einteilung in verschiedene Klangerzeuger werden in China die Instrumente nach dem Material klassifiziert, aus dem sie zum größten Teil hergestellt werden. Die Chinesische Klassifizierung kennt acht solche Kategorien:
Metall, Stein, Erde und Leder,
Seide, Kürbis, Bambus und Holz.
Die Aufzählung der Materialien macht bereits einen Unterschied zu Europäischen Instrumenten deutlich:
Instrumente aus Stein, Erde (gemeint ist Ton), Seide oder Bambus gibt es in Europa nicht.
Ebenso fremd wie die Instrumente erscheinen uns aber auch die gespielten Töne. In Europa ist unsere Hörgewohnheit geprägt von Kadenzen und der Dur-Moll-Harmonik. Die Chinesische Musik kennt jedoch keine dieser Harmonien.
Grundlage der Chinesischen Musik ist die (halbtonlose) pentatonische Tonleiter, in der jeder Ton Grundton einer Tonart und einer damit verknüpften Tonleiter sein kann.
Im europäischen Musikempfinden steht der Dur-Akkord für Freude, Moll für Trauer. Durch das Fehlen dieser Akkorde in der Chinesischen Musik haben wir Schwierigkeiten, mit dem Gehörten eine Emotion zu verbinden. Weil wir ihre Emotionen nicht verstehen, “spricht” die Chinesische Musik uns nicht an.
Dennoch sind dieselben Emotionen in der Chinesischen Musik vorhanden, sie sind nur anders “kodiert”. Wenn man nun noch in Betracht zieht, daß in der Chinesischen Pentatonik jeder der fünf Töne einen Eigennamen mit speziell ihm zugewiesenen Eigenschaften besitzt, so wird schnell klar, daß die Musik in der Chinesischen Kultur einen erweiterten Stellenwert und damit auch eine größere Funktion einnimmt als in Europa.
Es gibt in der Chinesischen Sprache kein Wort für Musik allein, das Wort “Musik” ist bereits eine untrennbare Einheit aus Musik, Sprache und Tanz.
Und ganz nebenbei beschreibt das Chinesische Schriftzeichen für "Musik" auch gleichzeitig den Begriff "Freude" (Besser: "Ein Ton der Freude macht").
Und seit dem Altertum wird die Musik auch als eine lyrische und wissenschaftliche Disziplin der Elite Chinas verstanden - so war der große Gelehrte Konfuzius selbst ein begnadeter Qin Spieler und Komponist.
Diese grundsätzlichen Unterschiede in der Musikauffassung scheinen den Weg zu einer besseren Rezeption der Chinesischen Musik zu verschließen. Der Zugang zur Chinesischen Musik ist jedoch nicht so schwierig wie es scheint, vor allem wenn man das augenscheinlich “Fremde” mit Vertrautem vergleicht:
Außerhalb der Pentatonik kennt die Chinesische Musik auch seit annähernd 3000 Jahren die Aufteilung der Oktave in 12 annähernd gleiche Halbtöne, diese wurden jedoch durch sog. Stimmpfeiffen bestimmt und wichen daher von der in Europa etablierten temperierten Stimmung etwas ab. Da es ebenfalls keine Mikrotonalität, wie z.B. in der klassischen Indischen Musik gibt, sind uns somit die kleinsten Tonschritte vertraut.
Die Pentatonik ist zwar in Europa ebenfalls schon lange weit verbreitet, jedoch ist sie im Europäischen Hörbewusstsein nicht so stark verankert wie die Moll-Dur-Harmonik.
Wer selbst musikalisch aktiv ist, kann sich der Pentatonik annähern, indem er auf seinem Instrument mit pentatonischen Melodien experimentiert, improvisiert oder versucht, diese nach zu singen.
Die Vielfalt der Chinesischen Musik kennt neben der Ensemble- und Vokalmusik auch ausgeprägte Solomusik.
Diese rein instrumentalen Stücke wurden schon früh in eigenen Tabulaturen notiert, die man inzwischen auch als Transkription in “westliche” Noten vorfindet.
Diese Instrumentalmusik erschließt sich dem Europäer leichter, so manche Kompositionen, z.B. für die Qin, die Guzheng oder die Pipa, erinnern uns an ein barockes Präludium.
Ein Erlebnis der besonders beeindruckenden Art ist sicherlich auch der Besuch einer Chinesischen Oper oder eines Theaterstücks. Hier werden die musikalischen Elemente mit den Emotionen der Sänger und Darsteller deutlich verknüpft.
Lohnend ist ebenfalls die Beschäftigung mit traditionellen und modernen Kinderliedern, ihre einprägsamen Formeln sind oft einfach gehalten und sind sehr hilfreich für einen ersten Zugang zur einprägsamen Pentatonik.
Ein weiterer Zugang zur Chinesischen Musik liegt in der Auseinandersetzung mit der Chinesischen Sprache und Schrift, da in der Chinesischen Kultur (und so auch in der Musik) alle Disziplinen (Musik, Mathematik, Lyrik und Prosa, Schrift, Tanz und Philosophie) untrennbar miteinander verbunden sind:
Vor allem Sprache und Musik sind streng miteinander verknüpft. Die Chinesische Silbensprache kennt sechs Intonationen für eine Silbe, so daß die Sprache selbst schon äußerst melodisch klingt und den narrativen Charakter der Melodik prägt.
Die Instrumente
Das heutige Musikleben Chinas ist bunt.
Moderne Elemente mischen sich mit Traditionellem:
Ein klassisches Sinfonieorchester spielt zusammen mit einem Lautenensemble, ein Duo aus zwei Bettlern zieht mit E-Gitarre, Mikrofon und auf den Rücken gebundenem Verstärker durch die Straßen, auf den Feldern wird bei der Arbeit gesungen, selbst in den Dörfern schallt Karaoke aus den Fernsehern, und während in den Diskotheken der großen Städte Techno aufgelegt wird, begleitet die traditionelle Chinesische Musik den Chinesen in seinem täglichen Leben, bei Hochzeit und Tod, bei Festen, Theater und Tanz.
Bei dieser Vielfalt der gespielten Musik scheint auch die Vielzahl der benutzten Instrumente unüberschaubar zu sein.
Was sind nun die zentralen Instrumente der Chinesischen Musik? Natürlich bilden die oben genannten Instrumente nur einen sehr kleinen Ausschnitt in der Vielfalt Chinesischer Musikinstrumente.
Einige, wie z.B. die Erhu oder die Sheng hört man sowohl solo als auch in Ensembles, die in vielfältigen Zusammensetzungen angetroffen werden können. Andere ,wie z.B. die Zither Qin werden ausschließlich solo gespielt. Einige der hier vorgestellten Instrumentenformen sind über 5000 Jahre alt und haben sich über die Jahrtausende nur wenig verändert. Betrachtet man zusätzlich noch die Vielfalt der in China ansässigen Völker, wird einem schnell klar, daß eine Katalogisierung der Chinesischen Musikinstrumente den Rahmen hier sprengen würde.
1.1 Die Zither Qin oder GuQin
"Zu Urzeiten schuf der mythische Herrscher Fuxi die Qin,
Um damit vor Falschheit und Niedertracht zu bewahren,
Um den Ausschweifungen und Leidenschaften vorzubeugen,
Um den Menschen zu kultivieren, seinen Verstand zu bilden,
Daß er zurückkehre zu dem, was seiner wahren Natur entspricht.”
(Aus dem “Qincao”-Katalog der Qin-Stücke, 3.Jhdt n. Chr.)
Betrachtet man diese “Wunderwirkungen” die der Qin zugeschrieben werden, wird schnell deutlich, daß mit dem Spiel dieses Instruments weitaus mehr verknüpft wird als die erklingende Musik: Vom Spieler fordert sie Konzentration und Disziplin, vom Zuhörer die Fähigkeit zur Kontemplation, von beiden geistige und musikalische Reife. Trotz dieser elitären Verknüpfung hat die Qin bis heute “überlebt”, und seit über zweitausend Jahren findet die Musik der Qin Lob und Anerkennung sowie Bewunder auf der ganzen Welt.
Die Chinesische Wölbbrettzither Guqin ist eines der ältesten weltweit noch aktiv genutzten Musikinstrumente (das “Gu” im Namen “GuQin” bedeutet “alt” oder "antik".)
Sie ist wie kaum ein anderes Instrument dazu geeignet, die Grundlagen der Chinesischen Musik hörbar zu machen. Dieses Instrument galt lange Zeit als das Instrument der geistigen Elite des Landes, und heute wird es nicht nur in China immer beliebter. Das Spiel der Guqin erfordert jedoch viel Übung und bleibt so auch heute für jeden interessierten Spieler eine Herausforderung.
Die sieben Saiten der Qin sind pentatonisch gestimmt:
(Es gibt auch entsprechende Stimmungen auf den Grundtönen F, G, und B)
Jeder Ton (und somit jede angeschlagene Saite) kann als Grundton einer eigenen Tonleiter dienen. Jede Saite kann auf drei Arten angeschlagen werden: Als leere Saite (“Töne der Erde”), als abgegriffene Saite (“Töne des Menschen”) und als Flageolet-Ton (“Töne des Himmels”).
In einem Qin-Stück erklingt normalerweise zuerst ein “Ton der Erde”, also eine leere Saite, die sich durch den Eingriff des Menschen im weiteren Verlauf in den "Himmel" erhebt. Diese musikalische Bildhaftigkeit verdeutlicht auch metaphorisch die Stellung des Menschen als Bindeglied zwischen Himmel und Erde in der Chinesischen Philosophie.
Die 13 aus Perlmutt bestehenden Griffmarken bezeichnen die Stelle, an der eine Saite im richtigen Verhältnis verkürzt wird, um einen Oberton zu erzeugen. Die Griffmarken sind ebenso wie die Saiten nummeriert. Diese Bezifferung diente der Notation, einer eigenen Tabulatur. Die frühesten Notationen sind über 1700 Jahre alt, und damit ist die Qin eines der ersten notierten Musikinstrumente der Musikgeschichte.
Die Qin ist eines der wenigen reinen Soloinstrumente Südostasiens. Der leise, intime Klang war nie für Ensembles vorgesehen und hätte dort auch zu wenig Durchsetzungskraft, die Qin diente also weniger zum Konzertvortrag als vielmehr der Selbstdisziplinierung des Spielers.
Alle Teile der Qin haben eigene Bezeichnungen, die mit positiven mythologischen Wesen wie dem Drachen oder dem Phoenix verbunden werden. Die geschwungene Decke steht für den Himmel, der gerade Boden für die Erde, und symbolisiert so die bereits angesprochene Harmonie zwischen beiden.
Jedes Instrument wird als Individuum betrachtet und trägt einen Eigennamen (wie z. B. “Singende Jade” oder “Harmonie der Wolken”), der auf der Unterseite eingraviert wird. Dadurch wird das Instrument auch seinem Spieler zugewiesen, denn als eigenständige Persönlichkeit sollte dieses Instrument nur von seinem Spieler und niemand sonst gespielt werden. Früher wurde das Instrument sogar beim Tod des Spielers in sein Grab gelegt, um zu verhindern, daß “Unbefugte” das Instrument “entweihen”.
Das Alter einer Qin bestimmt man, indem man die Anzahl und Form der Risse im Lack untersucht. Je älter ein Instrument ist, um so mehr wird es geschätzt. Die Qin wird aus dem Holz des Wuton-Baumes hergestellt, und das Holz sollte auch heute noch mindestens hundert Jahre lagern, um den typischen Ton der Zither zu garantieren.
Die Qin ist eine leise Bass Zither. Die Diskussion, ob Saiten aus Seide besser klingen als die gebräuchlichen Metallsaiten füllt in China ganze Internetforen. Früher galt die Musik der Qin als elitär, sie wurde nicht im Konzert vorgetragen, sondern zuhause zur Kontemplation gespielt, und höchstens einem verständigen Freund vorgespielt, der bestenfalls selbst Qin Spieler war.
Heute erfreut sich die Qin nicht nur in China großer Beliebtheit. Neben den schon früh notierten “antiken” oder “traditionellen” Stücken, die bereits früh auf andere Instrumente wie die Pipa oder Guzheng übertragen wurden, gibt es inzwischen auch viele moderne Stücke oder Transkriptionen für die Qin.
Die Musik der Qin ist meist zweistimmig, oft auch nur einstimmig. Charakteristisch sind die Spieltechniken der linken Hand, die eine Art “Tapping”, Slidings, Vibrati oder auch so genannte “stumme Nebentöne” erzeugen.
Es ist heutzutage gar kein Problem, im Internet aktuelle oder auch “klassische” Musik der Qin zu finden. Wer einmal den eigentümlichen Klang dieser Zither gehört hat, wird sich schnell darin verlieben.
1.2 Die Zither Guzheng
Ungefähr zur gleichen Zeit, als der mythische Herrscher Fu Xi die Qin entwickelt haben soll, gab es auch eine große Zither mit einem Kasten als Resonator. Diese Zither namens Se soll bis zu 50 Saiten gehabt haben, Ausgrabungen haben bisher jedoch nur Instrumente mit bis zu 25 Saiten zutage gebracht. Im “shi jing” (“Buch der Lieder”) aus dem 6. Jahrhundert v.Chr. wird auch erstmals der Nachfolger der Se erwähnt, die Kastenzither Guzheng. Diese Zither erfreut sich heute ebenso wie die Guqin in China und weltweit großer Beliebtheit.
Diese Zither hat die Entwicklung anderer Asiatischer Zithern maßgeblich beeinflußt, sei es die Dan Tranh in Vietnam (siehe dort), die Koto in Japan oder die Kayagum und das Geomungo in Korea. Alle genannten Zithern haben nicht nur den kastenförmigen Unterbau als Resonator gemeinsam, sondern auch die in Pyramidenform gebauten Stege bzw. Saitenhalter:
Diese Pyramiden erfüllen zwei Funktionen: Einerseits lassen sie sich verschieben und so die Stimmung der Saite schnell verändern, andererseits wird dadurch die Saite erhöht, und so kann man einen Ton einer gezupften Saite nachträglich durch Druck von oben auf die schwingenden Saite verändern, was Vibrati, Bendings und Glissandi ermöglicht.
Die heute weit verbreitete Version der Guzheng hat 21 pentatonisch gestimmte Saiten, Grundton ist meist D, so daß insgesamt 5 Oktaven zur Verfügung stehen:
D – E – F# – A – H – d – e – f# – a – h – d1 – e1 – f#1 (usw.)
Es gibt auch kleinere Bauformen mit 16 Saiten oder größere mit bis zu 25 Saiten, die hier vorgestellte Version mit 21 Saiten hat sich jedoch als Standard durchgesetzt.
Die oben genannte, in westlichen Ohren Dur klingende Pentatonik ist zwar gebräuchlich, moderne Spieler experimentieren aber auch gerne mit anderen Stimmungen.
Da sich die Pyramiden verschieben lassen, kann man auch zwischen zwei Musikstücken schnell hier und da einen Halbton verschieben, und so auch phrygische, dorische oder andere interessante Skalen nutzen.
Der Name “zheng” kann onomatopoetisch verstanden werden, also lautmalerisch für den erzeugten Ton. Der Ursprung für die Chinesischen Zithern darf aber in Halbröhrenzithern aus Bambus vermutet werden, was auch in der oberen Hälfte des Schriftzeichens für “zheng” erkennbar ist, wo sich das alte Zeichen “zhu” für Bambus verbirgt.
Der Kastenförmige Resonator verstärkt den Ton, daher ist die Guzheng viel lauter als die Guqin, und daher auch vielfach in Ensembles anzutreffen. Sie ist aber auch ein beliebtes Soloinstrument, das inzwischen sehr virtuos gespielt wird.
Dabei zupft der Spieler mit der rechten Hand die Saiten, mit Hilfe von mit Klebeband an den Fingern befestigten Plektren, die wie verlängerte Fingernägel benutzt werden.
Die linke Hand wiederum erzeugt die bereits erwähnten typischen Verzierungen, also Vibrati, Glissandi und Beugungen der Tonhöhe. Typisch ist auch die schnelle Tonrepetition einer Saite, wie sie z.B. auch beim Spiel der Laute Pipa typisch ist.
Auch für die Guzheng sind vielfach Musikbeispiele leicht im Internet zu finden. Empfehlenswert sind Künstler wie das aus Kanada stammende Duo Mei Han und Randy Raine-Reusch, die vielfach mit neuen Stimmungen und Spieltechniken experimentieren, wodurch die klangliche Vielfalt der Guzheng erst recht verdeutlicht wird.
1.3 Die Laute Pipa
Ein ebenso beliebtes, heutzutage auch sehr virtuos gespieltes Soloinstrument, ist die Laute Pipa. Diese Laute hat eine interessante Entstehungsgeschichte:
Der Name steht wahrscheinlich für die zwei verschiedenen Anschlagsarten (“pi” und “pa”, eigentlich "tan" und "tiao", nach außen und nach innen anschlagen), die für diese und andere Instrumente in China gelten.
Unter dem Namen "Pipa" wurden zuerst drei verschiedene Instrumente zusammengefasst, die über die Seidenstraße nach China einwanderten. Erste Erwähnung findet die Pipa um 220 v.Chr, doch ähnliche Instrumente dürften bereits weit vorher bekannt gewesen sein. Charakteristisch ist der birnenförmige Korpus, der sich jedoch erst später aus einem kreisrunden Korpus entwickelte (wie z.B. bei der heute noch genutzten Ruan oder der Yueqin), und ähnliche Instrumente in Japan (“Biwa”) und Vietnam (“Tyba”) beeinflusste.
Der fast massive, schwere Korpus der Pipa besteht aus einen durchgehenden Stück Mahagoni oder Rosenholz. Die antike Version hatte fünf oder vier Saiten, heute sind es fast immer vier Saiten, und die heutige, unter Spielern gebräuchliche Stimmung ist:
A – D – E – a
Charakteristisch ist der Sekundschritt in der Mitte, der auch die für die Pipa typischen Akkorde erzeugt. So fungieren die ersten drei Saiten als Bass, entsprechend den Tonstufen einer Kadenz, während die Melodie meist auf der letzten Saite gespielt wird.
Früher hielt man die Pipa beim Spiel wie eine Gitarre, heute hält man sie aufrecht, die rechte Hand zupft mit künstlich verlängerten Fingernägeln oder Aufsätzen die Saiten, während die linke Hand auf den insgesamt 24 Bünden einen Ton abgreift oder moduliert.
Die Aufteilung des Griffbretts in die schwarz gefärbten pyramidenförmigen Einkerbungen namens “xiang”, die den ursprünglichen (antiken) Tonumfang markieren, sind nicht nur durch die Bauart von den nachträglich hinzugefügten 24 Holzstegen zu unterscheiden: Die xiang liegen außerhalb der Sichtweite der Ausführenden, da der Kopf der Pipa parallel zum Kopf des Spielers zum Publikum zeigt. Die xiang werden dennoch zur Veränderung des Tones genutzt, sei es um den angezupften Ton stark zu vibrieren, zu glissandieren oder nachträglich die Intonation zu ändern. Wie auch bei den Zithern steht die Verzierung eines Tones im Zentrum der klassischen Musik für die Pipa.
Die klassische Musik der Pipa eignet sich hervorragend, um Europäisch "geprägte" Ohren auf Chinesische Musik einzustimmen. Künstler wie die in Kanada lebende Solistin Liu Fang haben ein umfangreiches Repertoire im Internet zugänglich gemacht.
Die traditionellen Sammlungen der Musikstücke (z.B. die Sammlung der Gebrüder Hua aus dem Jahr 1819) reichen weit in die Geschichte der Solo- und Instrumentalmusik Chinas zurück, und geben Aufschluss über Kompositionsprinzipien, die durch ihre (nicht programmatischen) Titel, sowie die Verwendung modaler Sequenzen und Motiventwicklungen, an den Formelreichtum der Europäischen Barockmusik erinnert.
Die bildhaften Titel der Musikstücke dienten auch zur Einteilung in die musikalische Kategorie einer Sammlung:
"wen" (friedlich) und "wu" (kriegerisch), "xiban" (westlich) und "ba ban" (acht Takte)