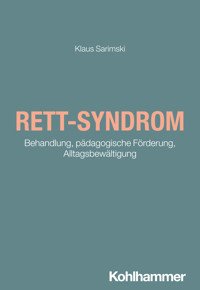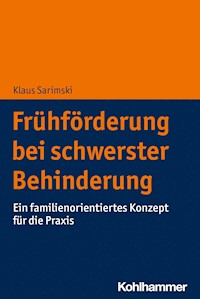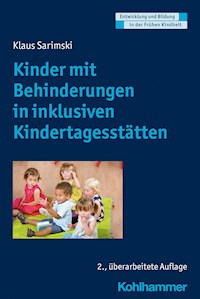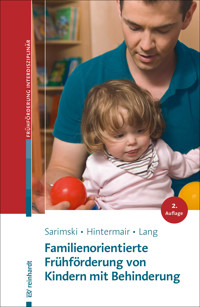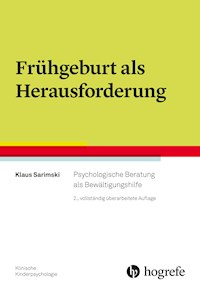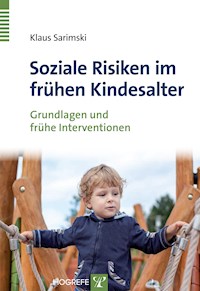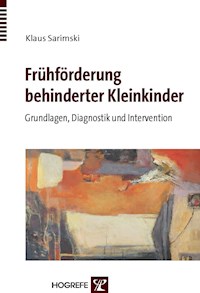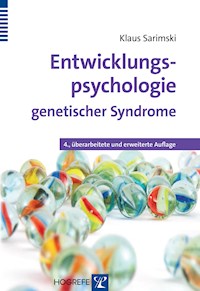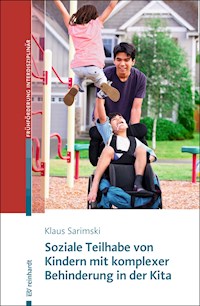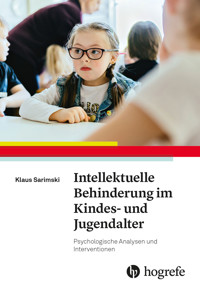
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Kinder und Jugendliche mit intellektueller Behinderung sind individuelle Persönlichkeiten mit individuellen Stärken und Schwächen beim Erwerb von Kompetenzen und der Bewältigung sozialer Anforderungen. Sie benötigen deshalb eine differenzierte Unterstützung, für die fundiertes Wissen über Entwicklungsprozesse sowie Möglichkeiten der Förderung und Intervention erforderlich ist. Dies liefert der vorliegende Band mit einem umfassenden und gut verständlichen Überblick. Zunächst werden Ursachen, Diagnostik intellektueller und adaptiver Kompetenzen sowie empirische Forschungsergebnisse zum Verlauf der kognitiven, sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklung behandelt. Es schließt sich eine Darstellung evidenzbasierter Interventionen zur Förderung von sprachlichen, mathematischen, sozialen und alltagspraktischen Kompetenzen sowie des Schriftsprachenerwerbs im Kontext von Frühförderung und Schule an. Ein eigenes Kapitel beschäftigt sich mit Fragen der sozialen Teilhabe bei schwerster Behinderung. Weitere Kapitel thematisieren auffälliges Verhalten und psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung. Nach einem Überblick über Prinzipien der Diagnostik und Behandlung sowie über spezifische Verhaltensmerkmale bei genetischen Syndromen werden Interventionen bei u.a. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, ängstlichen und depressiven sowie autistischen Verhaltensauffälligkeiten, Stereotypien und selbstverletzendem Verhalten dargestellt, und die Forschungslage zur Beurteilung ihrer Wirksamkeit wird bewertet. Der Band schließt mit einem Überblick zur Belastung der Eltern und Geschwister ab und zeigt Möglichkeiten der psychologischen Unterstützung auf. Damit gibt das Buch Fachkräften, die mit Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung und deren Familien arbeiten, differenziertes Wissen für ihre Praxis an die Hand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Klaus Sarimski
Intellektuelle Behinderung im Kindes- und Jugendalter
Psychologische Analysen und Interventionen
Prof. Dr. Klaus Sarimski, geb. 1955. 1975–1980, Studium der Psychologie in Köln. 1980–1981 Psychologe an einem Pädagogischen Frühförderzentrum. 1981–2007 Psychologe im Kinderzentrum München. 2007–2021 Professor für Sonderpädagogische Frühförderung und Elementarpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, seit 2021 im Ruhestand. Arbeitsschwerpunkte: Genetische Syndrome, familienorientierte Frühförderung und psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © stock.adobe.com / Iryna
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2024
© 2024 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3163-5; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3163-6)
ISBN 978-3-8017-3163-2
https://doi.org/10.1026/03163-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Gewidmet dem Gedenken an
Prof. em. Dr. Otto Speck (1926 – 2023)
Inhaltsverzeichnis
Statt eines Vorworts – ein persönlicher Blick zurück
Teil I: Grundlagen
1 Definition, Klassifikation und Prävalenz
1.1 Definition einer intellektuellen Behinderung
1.2 Beurteilung von Kompetenzen
1.3 Einteilung nach Ursache oder Schweregrad
1.4 Prävalenz
2 Ursachen und Komorbiditäten
2.1 Biologische Grundlagen der Entwicklung
2.2 Genetisch bedingte Entwicklungsstörungen
2.3 Andere pränatale Ursachen
2.4 Peri- und postnatale Ursachen von Entwicklungsstörungen
2.5 Apparative und genetische Untersuchungsverfahren
2.6 Komorbiditäten
3 Diagnostik intellektueller und adaptiver Kompetenzen
3.1 Struktur intellektueller Kompetenzen
3.2 Diagnostik intellektueller Kompetenzen
3.3 Struktur, Zusammenhänge und Entwicklung adaptiver Kompetenzen
3.4 Diagnostik adaptiver Kompetenzen
Teil II: Entwicklung in verschiedenen Bereichen
4 Integration und Organisation von Fähigkeiten
4.1 Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Strategiebildung
4.2 Sprachverarbeitung und pragmatischer Sprachgebrauch
4.3 Sozial-emotionale Kompetenzen
4.4 Motivation und Selbstregulation im sozialen Kontext
5 Syndromspezifische Entwicklungsverläufe
5.1 Down-Syndrom
5.2 Fragiles-X-Syndrom
5.3 Williams-Beuren-Syndrom
5.4 Weitere Syndrome mit spezifischen Entwicklungsprofilen
Teil III: Interventionen zur Förderung von Kompetenzen
6 Kommunikation und Sprache
6.1 Wortschatz und Satzbildung
6.2 Unterstützte Kommunikation
7 Schriftspracherwerb
7.1 Erwerb von Lesekompetenzen
7.2 Förderung von Lesekompetenzen bei intellektueller Behinderung
7.3 Lesekompetenzen von Kindern mit spezifischen genetischen Syndromen
7.4 Förderung von Lesekompetenzen bei nicht oder wenig sprechenden Kindern
8 Mathematische Kompetenzen
8.1 Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen
8.2 Mathematische Fähigkeiten bei Kindern mit intellektueller Behinderung
8.3 Förderung mathematischer Kompetenzen
9 Soziale Kompetenzen und Alltagsfertigkeiten
9.1 Förderung sozialer Kompetenzen
9.2 Förderung von Alltagsfertigkeiten
Teil IV: Entwicklung im sozialen Kontext
10 Frühförderung
10.1 System der Frühförderung
10.2 Prinzipien und Effektivität familienorientierter Frühförderung
10.3 Beratung zur Förderung von entwicklungsförderlichen Interaktionen
10.4 Beratung in inklusiven Kindertagesstätten
11 Förderung in der Schule
11.1 Schulische Förderung an unterschiedlichen Bildungsorten
11.2 Soziale Teilhabe von Kindern mit intellektueller Behinderung
11.3 Unterstützung von Lehrkräften in inklusiven Schulformen
11.4 Vorbereitung des Übergangs in das Erwachsenenalter
12 Soziale Teilhabe bei schwerster Behinderung
12.1 Schwerste Behinderung
12.2 Soziale Beteiligung im Alltag
12.3 Soziale Beteiligung in Kindertagesstätte und Schule
Teil V: Interventionen bei auffälligem Verhalten und psychischen Störungen
13 Prinzipien der Diagnostik und Behandlung
13.1 Diagnostisches Vorgehen
13.2 Prävalenzen und Risikofaktoren
13.3 Psychologische Interventionen
13.4 Wirksamkeit von psychologischen Behandlungsmaßnahmen
14 Verhaltensphänotypen bei genetischen Syndromen
14.1 Konzept von Verhaltensphänotypen
14.2 Fragiles-X-Syndrom
14.3 Prader-Willi-Syndrom
14.4 Williams-Beuren-Syndrom
14.5 Down-Syndrom
14.6 Weitere Syndrome
15 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und Störungen des Sozialverhaltens
15.1 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
15.2 Oppositionelle Störungen des Sozialverhaltens
15.3 Störungen des Sozialverhaltens mit aggressivem Verhalten
15.4 Eltern- und familienzentrierte Maßnahmen
16 Ängstliche und depressive Verhaltensauffälligkeiten
16.1 Ängstliche Verhaltensauffälligkeiten
16.2 Depressive Störungen
17 Autistische Verhaltensauffälligkeiten
17.1 Diagnose und Klassifikation
17.2 Autistische Verhaltensauffälligkeiten bei intellektueller Behinderung
17.3 Interventionen
18 Stereotypien und selbstverletzendes Verhalten
18.1 Stereotypien
18.2 Selbstverletzendes Verhalten
19 Störungen des Ess- und Schlafverhaltens
19.1 Probleme der Nahrungsaufnahme
19.2 Pica
19.3 Rumination
19.4 Schlafstörungen
Teil VI: Herausforderungen für die Familie
20 Familie: Belastung und Bewältigung
20.1 Diagnosemitteilung – ein potenzielles Trauma
20.2 Anpassungsprozesse im familiären Alltag
20.3 Erlebte Belastung bei verschiedenen genetischen Syndromen
20.4 Beurteilung der Belastung und familienorientierte Beratung
20.5 Unterstützungsbedürfnisse und Hilfen für Geschwister
Literatur
Sachregister
|11|Statt eines Vorworts – ein persönlicher Blick zurück
Es sind jetzt ziemlich genau 50 Jahre vergangen, seit ich zum ersten Mal Kinder mit einer intellektuellen Behinderung kennengelernt habe. Ich habe meinen Zivildienst – so nannte man das damals, wenn jemand den „Dienst an der Waffe“ verweigerte – in einer Schule für Geistigbehinderte begonnen. In jenen 18 Monaten habe ich unterschiedliche Persönlichkeiten, beträchtliche Lernschwierigkeiten und ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten erlebt, von denen ich zuvor nichts wusste. Zu den Klassen, denen ich zugeordnet war, gehörte z. B. Roland, ein sehr freundlicher, wenn auch nicht sehr bewegungsfreudiger Junge, der mich in sein Herz geschlossen hatte, Matthias, der lieber unter seiner Lederjacke auf dem Boden der Klasse saß, statt mitzuarbeiten, und Rolf, der Stühle und Tische umwarf, wenn ihm etwas nicht passte. Alle Lehrkräfte waren mit viel Engagement bei der Sache (nur der Schulleiter war Sonderpädagoge, „meine“ Klassenlehrerin hatte eine orthopädagogische Ausbildung in den Niederlanden absolviert, die anderen Fachkräfte waren in der Regel Erzieherinnen mit einer Zusatzausbildung), aber es fehlten erkennbar Konzepte, die spezifisch auf die Bedürfnisse von Kindern mit geistiger Behinderung abgestimmt waren. Ein Schulpsychologe, der um Rat zum Umgang mit problematischen Verhaltensweisen gefragt wurde, räumte ein, dass er von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung „keine Ahnung“ habe.
Diese ersten Erfahrungen haben mich neugierig gemacht, mehr über die Besonderheiten der Entwicklung von Kindern mit intellektueller Behinderung, die Möglichkeiten ihrer Unterstützung und ein geeignetes Vorgehen zur Veränderung belastender Verhaltensweisen zu lernen. Ich habe Psychologie studiert mit dem Ziel, nach dem Abschluss des Studiums mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und ihren Eltern zu arbeiten. So ist es dann auch 41 Jahre lang gekommen.
Als ich in den 1970er Jahren studiert habe, gab es zwar erste Lehrstühle für Geistigbehindertenpädagogik und Psychologie in Sonderpädagogischen Handlungsfeldern an den Pädagogischen Hochschulen, aber im Studium der Psychologie kamen die Bedürfnisse dieser Kinder nicht vor. Auf der Suche nach Literatur bin ich in den Bibliotheken von medizinischen Instituten und der (meinem Studienort benachbarten) Abteilung für Heilpädagogik auf einige englischsprachige Fachbücher und einige Tagungsbände (von den ersten Tagungen der internationalen |12|Fachgesellschaft IASSID) gestoßen. Die amerikanischen Handbücher von Norman Ellis und Edward Ziegler waren gerade in erster Auflage erschienen. Dort wurde unterschieden zwischen „persons with familial retardation“ und „persons with organic retardation“; die meisten Befunde bezogen sich allerdings auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in den USA in Heimeinrichtungen lebten. Differenzierungen nach unterschiedlichen medizinisch-genetischen Ursachen waren noch unbekannt.
Es gab wenige Fachzeitschriften, in denen unter dem Titel „mental deficiency“ oder „mental subnormality“ – so hieß das damals – Artikel erschienen, in denen mit quantitativen Methoden die Entwicklungsmerkmale bei geistiger Behinderung untersucht wurden, sowie einige Texte zur Anwendung „klassischer“ lerntheoretischer Prinzipien zur Förderung und Verhaltensmodifikation. Insgesamt war die Zahl der psychologischen Beiträge zum Verständnis der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung in den 1970er Jahren jedoch noch sehr überschaubar.
Einige Zeit nach dem Abschluss des Studiums hatte ich das Glück, eine Stelle in der Klinik des Kinderzentrums München zu erhalten. Prof. Dr. Theodor Hellbrügge war Direktor dieser Einrichtung, eine beeindruckende Persönlichkeit, die als Kinderarzt wesentliche Beiträge zur Frühdiagnostik und Frühtherapie – so nannte er es – von Kindern mit unterschiedlichen Behinderungen initiiert hat. Er ist dem Kinderzentrum bis zu seinem Tod im Jahre 2014 – er wurde 94 Jahre alt – treu geblieben. Fast gleichzeitig hatte ich Gelegenheit, Prof. Dr. Otto Speck kennenzulernen – Lehrstuhlinhaber für Geistigbehindertenpädagogik in München, der die Entwicklung dieses Fachgebiets in Deutschland über Jahrzehnte geprägt hat und als Nestor der interdisziplinären Frühförderung für viele Kolleginnen und Kollegen ein Vorbild war. Prof. Speck ist eine Woche vor Abschluss dieses Manuskripts im Frühjahr 2023 im Alter von 97 Jahren in München verstorben. Ihm ist dieser Band in großem Respekt vor seiner Lebensleistung gewidmet. Beide Professoren begrüßten psychologische Beiträge zur Pädiatrie und Sonderpädagogik, um den Bedürfnissen behinderter Kinder gerecht zu werden.
In den letzten 40 Jahren hat sich nun die internationale empirische Forschung zu Analysen und Interventionen bei Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung zu einem sehr umfangreichen, breit gefächerten Arbeitsgebiet entwickelt. Die Publikationen sind kaum noch zu überblicken. Leider haben sie – so war über die ganze Zeit mein Eindruck – zu wenig Beachtung in Deutschland gefunden. In manchen deutschen Fachbüchern finden sich Kapitel, in denen keine einzige englischsprachige Arbeit zum jeweiligen Thema erwähnt wird. Auf internationalen Kongressen treffen sich viele Kolleginnen und Kollegen aus englischsprachigen Ländern, den Benelux-Staaten und Skandinavien, aber die Zahl der deutschsprachigen Teilnehmenden ist meist sehr klein. In deutschen Fachzeitschriften kommt „intellektuelle Behinderung“ nur selten vor. Selbst die Heraus|13|gebenden einer Zeitschrift, die ausdrücklich der empirischen Sonderpädagogik gewidmet ist, haben es nicht leicht, Autorinnen und Autoren für Beiträge zu finden, wenn sie ein Themenheft zur „geistigen Behinderung“ vorbereiten möchten.
Das mag vielfältige Gründe haben. In den Hochschulen haben die Inhabenden der sonderpädagogischen Lehrstühle oft andere Schwerpunkte für Forschung und Lehre gesetzt. „Psychologie in Sonderpädagogischen Handlungsfeldern“ spielt eine untergeordnete Rolle. Es gibt kaum Psychologinnen und Psychologen, die sich auf dieses Arbeitsgebiet spezialisieren. In der Praxis fehlt es an Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung und psychischen Störungen haben. Kinder- und jugendpsychiatrische Einrichtungen halten nur an wenigen Standorten ein spezialisiertes Beratungs- und Behandlungsangebot vor.
Ich finde, die empirisch fundierten Erkenntnisse, die nun – im Jahre 2024 – international zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung, zur Förderung ihrer Kompetenzen und zur Intervention bei psychischen Auffälligkeiten vorliegen, verdienen ein höheres Maß an Beachtung. Ich habe mich daher bemüht, diese Erkenntnisse zusammenzutragen – es handelt sich quasi um das gesammelte Wissen, was ich im Studium und zu Beginn meiner psychologischen Tätigkeit vor 40 Jahren vermisst habe und so dringlich gebraucht hätte.
In meiner 25-jährigen Tätigkeit am Kinderzentrum München und anschließend – in der Ausbildung von Sonderpädagoginnen an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg – habe ich bestätigt gefunden und weitergetragen, was ich im Zivildienst kennengelernt hatte: Kinder und Jugendliche mit intellektueller Behinderung sind sehr individuelle Persönlichkeiten mit Stärken und Schwächen beim Erwerb von Kompetenzen und differenzierten Hilfebedürfnissen bei der Bewältigung sozialer Anforderungen im Alltag. Sie haben Anspruch auf eine Unterstützung ihrer Entwicklung und sozialen Teilhabe, die auf wissenschaftlichen Forschungsergebnissen beruht – d. h. „evidenzbasiert“ ist.
Ich habe versucht, diesem Anspruch nahezukommen und das derzeit verfügbare Wissen in einem Band zugänglich zu machen. Ich hoffe sehr, dass Studierende und Fachkräfte aus den Bereichen der Psychologie, Heil- und Sonderpädagogik, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Pädiatrie, Ergo-, Physio- und Sprachtherapie ihn nützlich für ihre eigene Arbeit finden.
München, im Januar 2024
Prof. i. R. Dr. Klaus Sarimski
|15|Teil I: Grundlagen
|17|1 Definition, Klassifikation und Prävalenz
In diesem einleitenden Kapitel werden die aktuelle Definition einer intellektuellen Behinderung, ihre Einteilung nach Ursachen und Schweregraden, die Unterscheidung von intellektuellen und adaptiven Kompetenzen sowie die Ergebnisse von Studien zur Prävalenz von intellektueller Behinderung im Kindes- und Jugendalter vorgestellt. An dieser Stelle sei auch auf die Praxisleitlinie Intelligenzminderung verwiesen, die unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (2021) veröffentlicht wurde. Sie enthält ebenfalls Informationen zu Definition und Epidemiologie der intellektuellen Behinderung.
1.1 Definition einer intellektuellen Behinderung
In der internationalen medizinischen und psychologischen Fachliteratur wird zur Definition einer intellektuellen Behinderung die Formulierung des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition“ (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013) zugrunde gelegt. Sie stimmt weitgehend mit der aktuellen Fassung der Definition durch die „American Association on Intellectual and Developmental Disabilities“ (AAIDD, 2001), die international führende Fachgesellschaft, überein. Beide Referenzquellen definieren eine intellektuelle Behinderung als bedeutsame, im Kindesalter beginnende und dauerhafte Einschränkungen der intellektuellen Funktionen, die mit bedeutsamen Einschränkungen der adaptiven Kompetenzen einhergehen, die sich in konzeptionellen, sozialen und praktischen Fähigkeiten zur Bewältigung der sozialen Anforderungen im Alltag zeigen.
Die intellektuelle Behinderung wird dabei in ein biopsychosoziales Verständnis von Behinderung nach der „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF; World Health Organization [WHO], 2001; deutsche Ausgabe: WHO, 2005) eingeordnet. Danach wird eine Behinderung sowohl von den funktionalen Kompetenzen eines Individuums gemäß seiner biologisch-medizinischen Voraussetzungen als auch den sozialen Bedingungen bestimmt, unter denen es in seiner Umwelt aufwächst. In diesem Verständnis von Behinderung werden verschiedene Perspektiven integriert (Schalock et al., 2018):
die biomedizinische Perspektive, die genetische und physiologische Faktoren als mögliche Ursachen der intellektuellen Behinderung betont,
|18|die psychologisch-pädagogische Perspektive, die Lernbeeinträchtigungen, intellektuelle und andere psychologische Merkmale von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung betont,
die soziokulturelle Perspektive, die die sozialen Zuschreibungsprozesse, die gesellschaftlichen Haltungen und sozialen Erfahrungen betont, die Menschen mit intellektueller Behinderung machen,
die rechtliche Perspektive, die den Anspruch von Menschen mit intellektueller Behinderung auf Gleichbehandlung gemäß den allgemeinen Menschenrechten betont.
Die Terminologie hat sich im historischen Verlauf verändert und unterscheidet sich etwas zwischen den kinder- und jugendpsychiatrischen Klassifikationssystemen. Früher wurden für diesen Personenkreis in den meisten englischsprachigen Ländern die Bezeichnungen „mental retardation“, bzw. „mental deficiency“ verwendet, in England „severe or profound learning disabilities“, im deutschen Sprachraum die Bezeichnung „geistige Behinderung“. In der „International Classification of Diseases“ (ICD-10; WHO/Dilling et al., 2015) wurde der Begriff der „Intelligenzstörung“ verwendet und als ein Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten definiert; besonders beeinträchtigt seien Fertigkeiten, die sich in der Entwicklungsperiode manifestieren und die zum Intelligenzniveau beitragen, wie Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten. Für die 11. Revision, die seit 01.01.2022 von der WHO in Kraft gesetzt wurde, befindet sich eine deutsche Version in Vorbereitung (WHO/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022); in dieser Entwurfsfassung wird der Begriff der „Störung der Intelligenzentwicklung“ vorgeschlagen. In der deutschen Version des DSM-5 (APA, 2015) wird der englische Begriff der „intellectual disabilities“ als intellektuelle Beeinträchtigung (intellektuelle Entwicklungsstörung) übersetzt.
In diesem Buch wird der Begriff „intellektuelle Behinderung“ dem Begriff der „intellektuellen Beeinträchtigung“ vorgezogen, um den Personenkreis eindeutig abzugrenzen von Kindern und Jugendlichen mit leichteren intellektuellen Beeinträchtigungen, die im deutschen Sprachraum früher als „Lernbehinderung“ bezeichnet wurden, und deutlich zu machen, dass bei diesem Personenkreis ein dauerhafter und umfassender Unterstützungsbedarf besteht.
Um die Diagnose einer intellektuellen Behinderung nach den Kriterien des DSM-5 fachgerecht zu stellen, müssen mehrere Bedingungen beachtet werden:
Die Diagnosestellung einer intellektuellen Behinderung orientiert sich nicht ausschließlich am Intelligenzniveau, sondern stellt die Unterstützungsbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zur Förderung ihrer Lebensqualität in den Vordergrund.
Es müssen bedeutsame Einschränkungen sowohl im Bereich der intellektuellen Fähigkeiten als auch im Bereich der adaptiven Kompetenzen vorliegen.
|19|Das Ziel der psychologischen Untersuchung eines Kindes oder einer bzw. eines Jugendlichen ist nicht primär die Bestimmung eines Testwertes, sondern die Beschreibung eines Profils von Kompetenzen (Einschränkungen und individuellen Stärken).
Für die Untersuchung der Kompetenzen müssen valide Beurteilungsverfahren verwendet werden, die die kulturelle und linguistische Diversität der Population berücksichtigen.
Die Einschränkungen müssen im Kontext der Anforderungen betrachtet werden, die in einer Gesellschaft typisch für das Alter und die Lebenswelt des betreffenden Kindes sind.
Zur Diskussion
In der deutschsprachigen Sonderpädagogik stößt die Verwendung der Definition nach DSM-5 oder AAIDD auf vielfältige Widerstände. In neueren Grundlagenwerken wird von „Menschen mit zugeschriebener geistiger Behinderung“ (z. B. Schuppener et al., 2021) gesprochen. Die Autorinnen und Autoren weisen damit darauf hin, dass es sich bei der Diagnose um eine soziale Zuschreibung handelt, die mit einem Risiko von Ausgrenzung und Diskriminierung verbunden ist. Es werde damit eine Teilgruppe beschrieben, die sich in ihren Fähigkeiten und ihrem Verhalten von der Mehrheit unterscheidet, deren Selbstverständnis aber deutlich von dieser professionellen Zuschreibung abweichen könne. Das spiegelt sich auch in der Forderung von Gruppen der „Self-Advocacy-Bewegung“ (z. B. Mensch zuerst – Netzwerk People First Deutschland e. V., n. d.) wider, statt des Begriffs der „geistigen Behinderung“ den Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ zu verwenden.
Ein Recht aller Menschen auf soziale Teilhabe („human rights approach“) und Selbstbestimmung („self-determination“) ist ebenso unstrittig wie der Respekt vor den individuellen Sichtweisen der Fähigkeiten, Interessen, Bedürfnissen und Rechten von Betroffenen. Die Verwendung des Begriffs „Lernschwierigkeiten“ und die Postulation einer ausschließlich sozialen Konstruktion von intellektueller Behinderung als Ausdruck gesellschaftlicher Kategorisierungs- und Ausgrenzungsprozesse würde jedoch den dauerhaften und gravierenden Beeinträchtigungen des intellektuellen Verarbeitungsvermögens und den Unterstützungsbedürfnissen dieser Kinder und Jugendlichen nicht gerecht.
1.2 Beurteilung von Kompetenzen
Bei der Beurteilung von Kompetenzen ist zwischen maximalen und typischen Kompetenzen zu unterscheiden (Thompson et al., 2017). Maximale Kompetenzen lassen sich in strukturierten Testsituationen beurteilen, wie sie bei der Durchführung von Intelligenztests gegeben sind. Typische Kompetenzen werden über Beobachtungen in Alltagssituationen eingeschätzt, wie sie in adaptiven Kompetenz|20|skalen vorgesehen sind. Auf diese Weise ergibt sich ein umfassendes Bild („big picture“) der persönlichen Kompetenzen, aus dem abgeleitet werden kann, welche Maßnahmen indiziert sind, damit das Kind oder die bzw. der Jugendliche die individuellen Anforderungen der Umwelt zu bewältigen vermag. Diese Maßnahmen können sich sowohl auf die Förderung von individuellen Kompetenzen als auch auf Anpassungen der Umgebung beziehen, mit denen die reduzierten Kompetenzen kompensiert werden sollen.
Intelligenz lässt sich operational definieren als allgemeine mentale Fähigkeit, die schlussfolgerndes Denken, Planen, Problemlösen, Verständnis für komplexe Sachverhalte und Lernfähigkeit einschließt (Schalock & Luckasson, 2021). Zur Beurteilung der intellektuellen Fähigkeiten muss eine klinische Einschätzung sowie ein standardisierter Intelligenztest durchgeführt werden, der auf hinreichend aktuellen Normwerten beruht und die kulturellen und sprachlichen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt, die mit diesem Verfahren untersucht werden.
Bei der Interpretation von Testergebnissen sind statistische Konfidenzintervalle zu berücksichtigen, um dem Messfehler dieser diagnostischen Instrumente gerecht zu werden. Für die Entscheidung, ob bei einem Kind oder einer bzw. einem Jugendlichen die Diagnose einer intellektuellen Behinderung zu stellen ist, wird ein Grenzwert von zwei Standardabweichungen unter dem Mittelwert verwendet. Unter Berücksichtigung des Messfehlers bedeutet dies: Wenn das Testverfahren so skaliert ist, dass der Mittelwert bei 100 liegt und die Standardabweichung 15 beträgt, liegt der Grenzwert bei 70. Aus dem statistischen Messfehler des Instruments ergibt sich dann eine Spanne, in dem der „wahre Wert“ der Person, die untersucht wird, mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit liegt.
In den Testmanualen wird der statistische Messfehler meist für verschiedene Altersbereiche getrennt angegeben. Als Orientierung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit das „wahre“ Testergebnis in einem Konfidenzintervall von +/– 5 Punkten um das ermittelte Testergebnis liegt. Ein Testergebnis von 70 lässt beispielsweise annehmen, dass der „wahre“ Wert zwischen 65 und 75 liegt. Das Kriterium für die Diagnose einer intellektuellen Behinderung sollte daher nur dann als erfüllt angesehen werden, wenn der Intelligenztestwert unter 65 liegt.
Mit der Definition der intellektuellen Behinderung nach DSM-5 ist kein grundsätzlicher Verzicht auf IQ-Tests verbunden. Die Durchführung eines Intelligenztests bei der Untersuchung eines Kindes oder einer bzw. eines Jugendlichen mit (Verdacht auf) intellektueller Behinderung wird vielmehr weiterhin als obligatorisch angesehen (vgl. Kap. 3.2). Die Beurteilung der adaptiven Kompetenzen hat aber im Verständnis der DSM-5-Definition das gleiche Gewicht und ist ebenfalls mit einem standardisierten Verfahren vorzunehmen, das eine differenzierte Einschätzung der Fähigkeiten zu Selbstständigkeit und sozialer Teilhabe im Vergleich |21|zu Gleichaltrigen in Bezug auf die Erwartungen erlaubt, die an ein Kind oder eine Jugendliche bzw. einen Jugendlichen dieses Alters im sozialen Kontext gestellt werden. Adaptive Kompetenzen werden in der Regel über Befragungen von Bezugspersonen eingeschätzt, die mit dem Kind oder der bzw. dem Jugendlichen gut vertraut sind und über ihr bzw. sein typisches Verhalten im Alltag Auskunft geben können (vgl. Kap. 3.3).
1.3 Einteilung nach Ursache oder Schweregrad
Die intellektuelle Behinderung kann nach Ursachen oder Schweregraden unterteilt werden. Bei der Unterteilung nach Ursachen werden prä-, peri- und postnatale Ursachen unterschieden (vgl. Kap. 2). Eine Unterteilung nach Schweregraden kann nach dem Grad der intellektuellen Beeinträchtigung, der Beeinträchtigung der adaptiven Kompetenzen oder dem Unterstützungsbedarf („support needs“) vorgenommen werden.
In älteren Versionen des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM) wurden zwei Schweregrade nach dem Ergebnis von Intelligenztests unterschieden. Bei einem Intelligenztestergebnis von 50 bis 70 wurde von einer leichten Intelligenzminderung, bei einem Ergebnis unter 50 von einer schweren Intelligenzminderung gesprochen. In der ICD-10 wird der Schweregrad unterteilt in leichte Intelligenzminderung (IQ 50 bis 70), mittelgradige Intelligenzminderung (IQ 35 bis 50), schwere Intelligenzminderung (IQ 20 bis 35), schwerste Intelligenzminderung (IQ < 20).
Auch in dieser Hinsicht liegt im DSM-5 eine Veränderung vor. Der Schweregrad wird nun in leicht, mittel, schwer und sehr schwer (extrem) auf der Basis der adaptiven Fähigkeiten unterteilt (vgl. Kap. 3.3). Mit der Orientierung an den adaptiven Kompetenzen wird der Beobachtung Rechnung getragen, dass ein genereller IQ-Wert allein die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes oder einer bzw. eines Jugendlichen in realen Alltagssituationen nur unzureichend abzubilden vermag und dass die Validität solcher Einschätzungen im unteren Grenzbereich (z. B. IQ < 35) fragwürdig ist. Die Orientierung an den adaptiven Fähigkeiten wird dem Anspruch, die Unterstützungsbedürfnisse eines Kindes oder einer bzw. eines Jugendlichen im Alltag zu beschreiben, eher gerecht als die ausschließliche Beurteilung der intellektuellen Fähigkeiten.
Für die Praxis
Es ist bereits an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Grenzwerte zur Abgrenzung einer intellektuellen Behinderung von einer allgemeinen intellektuellen Fähigkeit (sogenannter g-Faktor) ausgehen, ohne die Struktur der intellektuellen Fähigkeiten und möglicherweise zu differenzierenden Stärken und Schwä|22|chen zu berücksichtigen. Kinder und Jugendliche mit intellektueller Behinderung stellen jedoch keine homogene Gruppe dar. Vielmehr kann sich die intellektuelle Behinderung in sehr unterschiedlichem Schweregrad und in unterschiedlichen Profilen von Stärken und Schwächen präsentieren.
Zu empfehlen ist daher ein multidimensionaler diagnostischer Ansatz, der eine neuropsychologische Testbatterie zur differenzierten Beurteilung von kognitiven Funktionen (Gedächtnis, exekutive Funktionen, Sprachverstehen u. a.) umfasst sowie eine adaptive Kompetenzskala und Verhaltensbeobachtungen im Alltag, die eine Beschreibung der konzeptionellen, sozialen und praktischen Fertigkeiten eines Kindes oder einer bzw. eines Jugendlichen ermöglichen. Zu einem multidimensionalen diagnostischen Ansatz gehört auch eine Einschätzung der Entwicklungsumgebung und der sozialen Erwartungen, die an ein Kind oder eine Jugendliche bzw. einen Jugendlichen gestellt werden. Auf diese Weise wird der Fokus der Untersuchung von den Defiziten der Kinder und Jugendlichen auf ihre Ressourcen und ihren Unterstützungsbedarf bei der Bewältigung der Anforderungen in ihrer jeweiligen sozialen Umgebung gelenkt.
1.4 Prävalenz
Nach einer Metaanalyse von 52 epidemiologischen Studien, die Maulik et al. (2013) vorlegten, variiert die Prävalenz einer intellektuellen Behinderung in Abhängigkeit vom Alter der untersuchten Gruppe, des Vorgehens bei der Datenerhebung (flächendeckende Befragung aller Haushalte vs. administrative Datenerhebung oder Auswertung von Klinikdaten) sowie der Untersuchungsmethode (psychologische Untersuchung vs. klinische Klassifikation nach ICD/DSM). Als Mittelwert ist von einer Prävalenz der intellektuellen Behinderung bei Kindern und Jugendlichen in industriell hochentwickelten Ländern von 1.0 % bis 1.2 % auszugehen.
Zu diesem Ergebnis kam z. B. auch eine Studie in Finnland, bei der ein nationales Register ausgewertet und die jeweiligen Raten pro Geburtsjahrgang im Zeitraum zwischen 1996 und 2007 bestimmt wurden (Westerinen et al., 2017). Die Zahl der diagnostizierten Fälle stieg mit Eintritt in die Schule (d. h. dem Zeitpunkt, in dem in Finnland bei allen Kindern ein Screening auf Entwicklungsprobleme durchgeführt wird) und erreichte bis zum Ende des Jugendalters eine kumulative Prävalenz von 1.19 %. Van Naarden Braun et al. (2015) analysierten die Daten, die seit 1991 flächendeckend bei Schulkindern in einer Region der USA erhoben wurden. Sie ermittelten für 2010 eine Prävalenz von 1.36 %. Beide Studien kamen zu dem Schluss, dass die Prävalenz der intellektuellen Behinderung in den letzten beiden Jahrzehnten weitgehend stabil geblieben ist. In dieser Hinsicht unterscheiden sich |23|die Ergebnisse von Studien zur Häufigkeit einer Autismus-Spektrum-Störung (mit oder ohne intellektuelle Behinderung), die in dem gleichen Zeitraum stetig zugenommen hat.
In den meisten Fällen (etwa 85 %) handelt es sich um eine leichte intellektuelle Behinderung (nach den Einteilungskriterien der ICD-10); bei 10 % der Kinder liegt eine mittelgradige intellektuelle Behinderung, bei 4 % eine schwere und bei 2 % eine schwerste Behinderung vor (King et al., 2009). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung liegt die Häufigkeit einer schweren und schwersten intellektuellen Behinderung bei 0.3 % bis 0.4 % (Roeleveld et al., 1997; Leonard & Wen, 2002).
Epidemiologische Studien geben auch Aufschluss über die Verteilung der Ursachen. Die Ergebnisse variieren wiederum in Abhängigkeit von den Erfassungsmethoden. Es werden in der Regel weniger Fälle mit eindeutiger Ursache gefunden, wenn sich die Erhebung lediglich auf die Aktenlage beschränkt. In allen Studien ist jedoch der Prozentsatz pränataler Ursache bei Kindern mit schwerer intellektueller Behinderung wesentlich höher als bei einer leichten Behinderung (vgl. Abb. 1; z. B. Stromme & Hagberg, 2000). Dabei stehen genetische Ursachen im Vordergrund. Hou et al. (1998) kamen in Taiwan bei einer flächendeckenden Untersuchung von mehr als 11000 Kindern, die eine Sonderschule oder -einrichtung besuchten, zu einer Rate von 36.5 % genetischer Ursachen bei schwerer Behinderung gegenüber 11.4 % bei leichter intellektueller Behinderung. Bei 55 % der Gesamtgruppe lag eine pränatale Ursache vor, bei 9.5 % konnte eine perinatale Ursache und bei 3.3 % eine postnatale Ursache bestimmt werden. Bei 32 % der Kinder ließ sich keine eindeutige Ursache klären.
Abbildung 1: Ursachen intellektueller Behinderung (in %; Stromme & Hagberg, 2000)
|24|Mit den Fortschritten der genetischen Untersuchungsmethoden in den letzten Jahren lassen sich zunehmend mehr Fälle, bei denen zunächst keine Ursache festgestellt werden konnte, auf kleine Deletionen und Re-Arrangements von Genen im Subtelomerbereich zurückführen (Xu & Chen, 2003). Nach neueren Zahlen ist daher bei 30 % bis 50 % der Fälle intellektueller Behinderung von einer genetischen Ursache auszugehen (Kaufman et al., 2010; Rauch et al., 2012; Srour & Shevell, 2014).
Zur schweren intellektuellen Behinderung liegen weitere Studien vor, die die pränatalen Ursachen differenzieren. In einer populationsbasierten epidemiologischen Studie in Finnland ließ sich unter 461 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer schweren intellektuellen Behinderung bei mehr als 35 % ein genetisches Syndrom als Ursache identifizieren, bei 7 % eine angeborene Stoffwechselerkrankung, bei 14 % eine prä- oder perinatale Infektion und bei 3 % eine perinatale Asphyxie (Arvio & Sillanpää, 2003).
Internationale Studien zeigen überdies, dass intellektuelle Behinderungen leichten Grades bei Kindern und Jugendlichen häufiger auftreten, die in Armutslagen aufwachsen (Emerson, 2007). Dies zeigt sich deutlich in epidemiologischen Untersuchungen, die in Ländern mit niedrigem Einkommen durchgeführt wurden. Aber auch in den USA und in England – Ländern mit hoher Armutsquote – ist der Anteil von Kindern aus Familien in Armutslagen unter den Kindern und Jugendlichen mit leichter intellektueller Behinderung signifikant höher als in anderen westlichen Ländern. Dazu tragen ungünstige Entwicklungsbedingungen in den Familien, eine unzureichende gesundheitliche Versorgung der Kinder sowie eine Mangelernährung und – nicht selten – eine Exposition zu Schadstoffen in der Umwelt (z. B. Blei; vgl. Kap. 2) bei. Als Ursache für die Entstehung einer schweren Behinderung spielt der sozioökonomische Status der Familien keine Rolle (Durkin & Rubinstein, 2021).
|25|2 Ursachen und Komorbiditäten
Zum besseren Verständnis der Ursachen einer intellektuellen Behinderung wird in diesem Kapitel ein kurzer Überblick über biologische Grundlagen der Entwicklung gegeben. Anschließend werden genetische und andere pränatale sowie peri- und postnatale Ursachen beschrieben, apparative und genetische Untersuchungsverfahren zur Klärung der Ursache dargestellt und Komorbiditäten (Zerebralparese, Epilepsie und Sinnesschädigungen) geschildert. Bei vielen Kindern und Jugendlichen mit schwerer intellektueller Behinderung („Mehrfachbehinderung“) tragen diese zusätzlichen Entwicklungsstörungen zu einem komplexen Unterstützungsbedarf bei; sie erfordern medizinische Behandlungsmaßnahmen und die Begleitung durch ein interdisziplinäres Team.
2.1 Biologische Grundlagen der Entwicklung
Neuronale Reifung
Die Grundeinheiten des Gehirns stellen die Neuronen dar, die als Träger elektrochemischer Signale und ihrer Verbindungen für das Senden und Empfangen von Signalen zur Informationsübertragung verantwortlich sind. Sie bestehen aus einem Zellkörper, den Dendriten und einem Axon, das elektrische Signale vom Zellkörper zu den Verbindungen mit anderen Neuronen leitet. Die Anschlussstellen zwischen dem Axonende des sendenden Neurons und den dendritischen Verzweigungen eines empfangenden Neurons heißen Synapsen. Gliazellen sind ein anderer Hauptbestandteil des Gehirns. Sie üben unterstützende Funktionen aus und bilden u. a. die Myelinscheiden, die die Axone umhüllen, was die Geschwindigkeit und Effizienz der Informationsübertragung erhöht. Gliazellen fungieren auch als neurale Vorläuferzellen während der pränatalen Hirnentwicklung (vgl. Abb. 2).
Zwischen der dritten und achten Schwangerschaftswoche bilden sich die Körperorgane aus. Das zentrale Nervensystem geht aus dem Neuralrohr hervor. Aus seinem vorderen Teil entwickelt sich die Hirnblase, die sich rasch in End-, Zwischen- |26|und Mittelhirn differenziert. Auf diesen Prozess folgt die innere Strukturierung. Es bilden sich Neuroblasten aus, die zu Nervenzellen ausreifen und sich spezialisieren.
Diese Neurogenese (Vermehrung von Neuronen durch Zellteilung) findet im zweiten Trimester der Schwangerschaft statt. Sie beginnt 42 Tage nach der Empfängnis und ist etwa nach 18 Wochen abgeschlossen. In diesem Zeitraum wandern die Neurone zu ihrem endgültigen Bestimmungsort, wachsen und differenzieren sich in Axon und Dendriten aus, werden über eine große Zahl von Synapsen miteinander verbunden und bilden einen Dendritenbaum. In einem breit angelegten und flexiblen Verzweigungsmuster der Dendriten spiegelt sich die Kapazität für die Aufnahme und Weiterverarbeitung der Signale und für wachstums- und lernbedingte Veränderungen.
Abbildung 2: Schematische Darstellung der neuronalen Reifung
Im Verlauf dieser embryonalen Entwicklung bildet sich der zerebrale Kortex aus, die Großhirnrinde aus sogenannter „grauer Substanz“, die sich aus verschiedenen Gehirnlappen zusammensetzt. Die beiden Hirnhälften (Hemisphären) übernehmen dabei unterschiedliche Funktionen und sind durch den Balken (Corpus callosum) miteinander verbunden. Okzipital-, Temporal-, Parietal- und Frontallappen sowie das Kleinhirn sind dabei vorrangig für bestimmte Verhaltensaspekte (Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen, Speicherung, Handlungssteuerung, Emotionsregulation u. a.) wichtig. Die Hirnfunktionen sind jedoch nicht in umschriebenen anatomischen Regionen lokalisiert, sondern erfordern das Zusammenwirken von komplexen neuronalen Netzwerken.
Die Ausreifung der Hirnareale und die Bildung von Synapsen ist mit der Geburt des Kindes noch nicht abgeschlossen, sondern die Prozesse der Synaptogenese und der Myelinisierung setzen sich danach fort. Dabei reifen die sensorischen Areale |27|im hinteren Teil des Gehirns wesentlich früher aus als die Bereiche im vorderen Teil, die primär für die exekutiven Funktionen (vgl. Kap. 4.4) verantwortlich sind.
Genetische Grundlagen der Entwicklung
Der Kern jeder Körperzelle enthält 46 Chromosomen, die zur Hälfte von der Mutter und vom Vater ererbt werden. Die Chromosomen bestehen aus Strängen von DNA (Dexoxyribonukleinsäure)-Molekülen, die ihrerseits aus etwa 30 000 Genen bestehen. Die DNA-Moleküle setzen sich aus unterschiedlichen Basen in linearer Anordnung zusammen (Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin; A, T, G, C), die die genetische Information für die Produktion von spezifischen Protein-Moleküle tragen, welche ihrerseits für das Wachstum und die Steuerung der körperlichen Funktionen in den Organen einschließlich des Gehirns verantwortlich sind.
Die meisten Gene enthalten jeweils Informationen für die Produktion eines spezifischen Proteins, d. h. die biochemischen „Bauanleitungen“, die für die Entstehung und die Funktionen eines Organismus notwendig sind, und steuern sie über epigenetische Kodes. Manche von ihnen werden nur in wenigen Zelltypen für kurze Zeit angeschaltet (z. B. bei der Entwicklung der Gliedmaßen in der embryonalen Entwicklung), andere bleiben an den Grundfunktionen fast aller Körperzellen dauerhaft beteiligt. Das wiederkehrende An- und Abschalten von Genen wird durch Regulatorgene gesteuert. Gene funktionieren jedoch nicht isoliert, sondern immer in ausgedehnten Netzwerken, in denen die Expression eines Gens Voraussetzung für die Expression anderer Gene ist. Das führt zu einer enormen Vielfalt der Genexpression und möglicherweise zu einer Kaskade von (Folge-)Symptomen im Falle der Mutation eines Gens.
Die Gene sind in mikroskopisch sichtbaren Strukturen angeordnet, die wir Chromosomen nennen. Die meisten menschlichen Zellen enthalten 23 Paare von Chromosomen, die von der Mutter und dem Vater ererbt sind. Im Verlauf der Meiose (Reifeteilung) kommt es zu einer Aufteilung der Chromosomenpaare, dabei ist es vom Zufall abhängig, welches Element eines Paares in eine neue Eizelle beziehungsweise Spermienzelle übergeht. Ein Chromosomenpaar bestimmt das Geschlecht des Kindes (XX bzw. XY); ein männliches Wesen enthält somit zwei unterschiedliche Genstrukturen auf diesem Chromosomenpaar. Die übrigen 22 Chromosomenpaare werden Autosomen genannt.
Entstehung von Entwicklungsstörungen
In jedem Stadium der neuronalen Reifung – Bildung des Neuralrohrs und des End-, Zwischen- und Mittelhirns, Zellmigration und Vermehrung von Nervenzellen durch Zellteilung (neuronale Proliferation), Ausbildung von Dendriten und Syn|28|aptogenese sowie Reorganisation von Synapsen und Ummantelung der Nervenfasern (Myelisierung) – kann eine Entwicklungsstörung entstehen.
Im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel stehen als Ursache für Reifungsstörungen des Gehirns (Fehlbildungen und Funktionseinschränkungen) genetische Einflüsse sowie infektiöse und toxische Einwirkungen im Vordergrund. Sie stören die neuronale Proliferation und Migration und führen zu einer Reduzierung der Zahl der neuronalen Zellen oder zu Fehlern bei ihrer Distribution.
Im dritten Schwangerschaftsdrittel sind es primär Schädigungen der weißen und grauen Substanz durch hypoxische oder infektiöse Ereignisse, die für Störungen der Hirnentwicklung verantwortlich sind. Mangelhafte Sauerstoffversorgung des Gehirns oder eine Hirnblutung als Komplikation bei sehr unreifer Geburt oder schwere Entzündungen in der Neonatalperiode und Krampfanfälle stören die Ausbildung und Organisation von Synapsen und die Verschaltung von neuronalen Netzwerken.
Störungen der Myelinisierung und Schädigungen des Kortex können darüber hinaus als Folge von angeborenen Stoffwechselstörungen, Sauerstoffmangel während oder nach der Geburt (Hypoxie und Asphyxie), postnatalen Erkrankungen, Schlag- oder Krampfanfällen entstehen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über mögliche Ursachen von Entwicklungsstörungen.
Tabelle 1: Ausgewählte Ursachen für intellektuelle Behinderung
Genetische Störungen
Chromosomenstörungen (Veränderungen in der Zahl oder Struktur der Chromosomen)
Ererbte monogenetische Störungen (autosomal dominant, rezessiv oder X-gebunden)
De-novo-Mutationen
Copy-Number-Varianten
Mitochondriale Störungen
Infektionen und Stoffwechselerkrankungen der Mutter
Mütterliche Infektionen (Toxoplasmose, Zytomegalie, Masern u. a.) während der Schwangerschaft
Chronische Erkrankungen (z. B. Diabetes, Schilddrüsendysfunktion)
Infektionen des Kindes
Perinatale Infektionen (z. B. nach sehr unreifer Geburt)
Postnatale Infektionen (z. B. Meningitis)
Teratogene Störungen
Pränatale Alkoholexposition bei Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft
Prä- oder postnatale Exposition zu toxischen Metallen (z. B. Blei, Kupfer)
Asphyxien
Mangelnde Sauerstoffversorgung (z. B. als Komplikation nach einer sehr unreifen Geburt)
|29|2.2 Genetisch bedingte Entwicklungsstörungen
Genetisch bedingte Entwicklungsstörungen können unterschiedliche Ursachen haben. Dazu gehören vor allem
Veränderungen der Zahl oder Struktur der Chromosomen,
einzelne Genmutationen („monogenetische Störungen“),
sogenannte Copy-Number-Varianten (CNV),
mitochondriale Störungen.
Dabei kann die intellektuelle Behinderung zusammen mit oder ohne auffällige körperliche Symptome auftreten. Im ersten Fall spricht man von genetischen Syndromen, im zweiten Fall von einer nicht syndromalen genetischen Störung. Mehr als 750 genetische Veränderungen sind bislang als Ursache von intellektuellen Behinderungen identifiziert (Vissers et al., 2016). Tabelle 2 gibt einen Überblick über einige genetisch bedingte Entwicklungsstörungen und ihre Zuordnung zu verschiedenen Kategorien, in die sie unterteilt werden.
Numerische und strukturelle Chromosomenstörungen
Numerische und strukturelle Chromosomenstörungen können durch lichtmikroskopische Chromosomendiagnostik (konventionelle Zytogenetik zur Erstellung eines „Karyogramms“) identifiziert werden. Numerische Chromosomenaberrationen (einschließlich der Trisomie 21, Down-Syndrom) sind die Ursache für etwa 11 % der intellektuellen Behinderungen (Rauch et al., 2006).
Numerische Aberrationen können durch Fehler bei der Bildung der Keimzellen („non-disjunction“) während der Reifeteilung entstehen. In diesem Fall bildet sich eine Zygote aus Eizelle und Spermium mit mehr oder weniger Chromosomen, als es dem normalen Chromosomensatz entspricht. Dies kann ebenfalls Einfluss haben auf die Gen-Dosis, die die Entwicklungsprozesse steuern. Ein solcher Fehler bei der Zellteilung liegt beim Down-Syndrom vor, bei dem sich die Eizelle der Mutter nicht richtig teilt und das befruchtete Ei eine zusätzliche Kopie des Chromosoms 21 enthält (d. h. „überzähliges Chromosomenmaterial“) und dadurch eine chromosomale Imbalance entsteht.
|30|Tabelle 2: Genetisch bedingte Entwicklungsstörungen (Auswahl)
Kategorien
Beispiele
Numerische Chromosomenveränderungen
Down-Syndrom (Trisomie 21)
Trisomie 18
Neurokutane Syndrome (Phakomatosen)
Neurofibromatose Typ I/II
Tuberöse Sklerose
Hippel-Lindau-Syndrom
Monogenetisch bedingte Syndrome
Bardet-Biedl-Syndrom
Cornelia-de-Lange-Syndrom
Mowat-Wilson-Syndrom
Rubinstein-Taybi-Syndrom
Smith-Magenis-Syndrom
Imprintingstörungen
Prader-Willi-Syndrom
Angelman-Syndrom
Lyosomale Erkrankungen (Enzymdefekte)
Mukopolysaccaridosen
Tay-Sachs-Erkrankung
Metachromatische Leukodystrophie
Mitochondropathien
Leigh-Erkrankung
Andere Stoffwechselstörungen
Phenylketonurie
Smith-Lemli-Opitz-Syndrom
Lesch-Nyhan-Syndrom
Morbus Wilson
Hirnfehlbildungen
Holoprosenzephalie
Corpus-callosum-Agenesie
Aicardi-Syndrom
Lissenzephalie
Mikrozephalie
Zur Diskussion
Zu den Standards der pränatalen Diagnostik gehört eine Ultraschalluntersuchung, bei der das Wachstum des Fetus kontrolliert und stärkere körperliche Fehlbildungen identifiziert werden können. Bei einem erhöhten Risiko für Geburtsdefekte oder höherem Alter der Schwangeren (über 35 Jahre) kann eine Amniocentese oder eine Choriozottenbiopsie (CVS) durchgeführt werden, mit der strukturelle Veränderungen des Chromosoms und das Vorhandensein bestimmter Proteine im Blut des Babys untersucht werden können.
Eine zusätzliche Blutuntersuchung kann zur frühen Identifikation chromosomaler Abweichungen – z. B. des Down-Syndroms – durchgeführt werden. Mittlerweile gilt |31|ein Bluttest (PraenaTest oder Panorama-Test), der ab der neunten Schwangerschaftswoche durchgeführt werden kann, als zuverlässig in der Erkennung einer Trisomie 21, Trisomie 18 oder Trisomie 13. Die Kosten werden von den Krankenkassen übernommen.
Die Möglichkeit zur pränatalen Diagnostik wird von den meisten Schwangeren als positiv im Hinblick auf eine selbstbestimmte Entscheidung über die Fortsetzung der Schwangerschaft gewertet (Steinbach et al., 2016). Kritiker fürchten jedoch, dass diese einfachen und kostengünstigen vorgeburtlichen Bluttests auf Chromosomenabweichungen zu mehr Schwangerschaftsabbrüchen führen können. Zudem sehen sie die Gefahr, dass im Zuge dieser Entwicklung der Lebenswert von Menschen mit Behinderungen generell infrage gestellt werden könnte.
In der Tat entscheiden sich in Europa im Durchschnitt 80 % der Eltern im Falle eines positiven Testergebnisses für einen Abbruch (Shaffer et al., 2006; Hawkins et al., 2013). Bei der Diagnose „Down-Syndrom“ variieren die berichteten Abbruchraten von 67 % bis 97 % (Shaffer et al., 2006; Natoli et al., 2012).
Die Entscheidung, ob eine Schwangerschaft fortgesetzt oder abgebrochen wird, wird vor allem von dem Bedürfnis bestimmt, sich als Person oder Paar und das Kind vor Belastungen zu schützen, die als unerträglich empfunden werden. Sie hängt ab von der Einschätzung der Auswirkungen der Behinderung auf die Lebensqualität von Kind und Familie und der Einschätzung der gesellschaftlichen Haltung sowie der Unterstützungsmaßnahmen, die zur Verfügung stehen (Choi et al., 2012). Eine pränatale Diagnostik sollte deshalb immer mit einer ergebnisoffenen Beratung verbunden sein, in der die Schwangere und ihr Partner bzw. ihre Partnerin über das vorliegende Wissen zu den Entwicklungsperspektiven bei der jeweiligen Chromosomenstörung, die Möglichkeiten der Förderung und der Unterstützung für Familien, in denen Kinder mit einer Behinderung aufwachsen, informiert werden und ihre individuelle Sichtweise sowie ihre Einschätzung der Bewältigungskräfte respektiert und sorgfältig reflektiert wird.
Autosomal dominante und rezessive Genveränderungen
Viele genetisch bedingte Entwicklungsstörungen lassen sich auf die Mutation einzelner Gene zurückführen. Dabei sind verschiedene Vererbungsmuster zu unterscheiden. Die Mutation kann autosomal dominant oder rezessiv auftreten oder „de-novo“ entstehen.
Die Unterscheidung von autosomal dominanten und rezessiven Störungen hat eine Bedeutung für das Verständnis der Auswirkungen von genetischen Mutationen in Abhängigkeit vom Trägerstatus der Eltern. Etwa ein Drittel der menschlichen Gene weist zwei (oder mehr) unterschiedliche Formen auf (sogenannte „Allele“), die die Ausprägung eines Merkmals beeinflussen. Wenn es in zwei Allelen besteht, ist eines dominant, das andere rezessiv. Das dominante Allel dominiert |32|die Ausprägung des Merkmals. Das rezessive Allel kommt nur dann zum Ausdruck, wenn kein dominantes Allel vorhanden ist.
Im Fall einer autosomal-dominanten Störung befindet sich auf einem Allel in jedem Gen-Paar eine Mutation, während das andere Allel unverändert ist. Bei einer solchen Mutation besteht eine 50%ige Wahrscheinlichkeit der Weitergabe an den Nachwuchs. Autosomal-dominante Mutationen können daher in mehreren Generationen einer Familie gehäuft auftreten. Dieses Vererbungsmuster liegt z. B. bei der Tuberösen Sklerose oder bei der Neurofibromatose vor.
Bei autosomal-rezessiven Veränderungen ist eine Mutation in beiden Allelen eines Gens vorhanden. Die betreffenden Individuen gelten dann als Überträger; wenn zwei Elternteile eine solche genetische Veränderung haben, besteht eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass im Falle einer Schwangerschaft bei dem entstehenden Kind eine Entwicklungsstörung vorliegt. Dies ist bei den meisten angeborenen Stoffwechselstörungen (metabolischen Störungen) der Fall. Dazu gehört z. B. die Phenylketonurie (PKU), die Galaktosemie, das Hunter-Syndrom und das Lesch-Nyhan-Syndrom. Ein Teil von ihnen ist bei frühzeitigem Erkennen der Störung behandelbar, d. h. der Entwicklung einer intellektuellen Behinderung kann vorgebeugt werden.
Die Auswirkungen der Mutation hängen von der jeweils betroffenen DNA-Sequenz ab, bei der ein Verlust oder ein Re-Arrangement stattgefunden hat. Wenn das Protein, das an diesem Ort gebildet werden soll, für die Hirnreifung von Bedeutung ist, kann die Struktur des Gehirns und die Ausbildung der neuronalen Netzwerke beeinträchtigt werden. Etwa 650 genetische Veränderungen sind derzeit als Ursache für eine autosomal-dominante Ursache einer intellektuellen Behinderung identifiziert worden (Wieczorek, 2018).
Die Häufigkeit von autosomal-rezessiven genetischen Veränderungen unter den Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung wird auf etwa 10 % geschätzt (Jamra, 2018). Das Risiko für das Auftreten einer solchen Entwicklungsstörung ist bei blutsverwandten Eltern deutlich erhöht.
X-gebundene Genveränderungen
Bei einer X-gebundenen Vererbung ist die Mutation auf dem X-Chromosom lokalisiert. In diesem Fall trägt ein weibliches Individuum die Mutation; diese kann, muss aber nicht zu einer Störung führen, da Mädchen und Frauen über ein zweites X-Chromosom verfügen. Bei männlichen Individuen, die nur über ein X-Chromosom verfügen, kommt es dagegen regelmäßig zu einer Entwicklungsstörung. Bei ca. 10 % der Jungen mit intellektueller Behinderung kann eine solche X-chromosomal gebundene Ursache nachgewiesen werden. Derzeit sind mehr als 100 Genorte auf dem X-Chromosom identifiziert, deren Mutation mit einer intellek|33|tuellen Behinderung einhergeht. In etwa 90 % handelt es sich dabei um monogenetische Veränderungen, in ca. 10 % der Fälle um chromosomale Kopienzahlvarianten („copy-number variants“), Translokationen und komplexe chromosomale Rearrangements.
„Copy-number variants“ sind Veränderungen von kurzen DNA-Sequenzen von zwei bis sechs Basenpaaren, die im Genom oft wiederholt werden. Sie enthalten keine eigenen Kodes zur Proteinbildung, sind aber für die Regulation der Proteinmenge, die durch spezifische Gene produziert wird, von Bedeutung. Variationen in solchen Wiederholungssequenzen sind z. B. charakteristisch für das Fragile-X-Syndrom (CGG-Repeatexpansion). Das Fragile-X-Syndrom ist mit etwa 2 % die häufigste monogene Ursache für eine intellektuelle Behinderung (Tzschach, 2018).
Da das X-Chromosom etwa 1500 Gene trägt, während das kleinere Y-Chromosom nur 200 Gene trägt, besteht bei Jungen eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit für die Ausprägung einer Entwicklungsstörung, die von rezessiven Allelen auf ihrem X-Chromosom herrührt. Das erklärt, dass die Prävalenz von intellektueller Behinderung insgesamt höher ist als bei Mädchen. Bei Mädchen liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ihrem zweiten X-Chromosom eine dominante Allele des Gens vor, sodass bei ihnen eine mögliche Störung nicht zum Ausbruch kommt.
Mitochondriale und Imprinting-Störungen
Nicht alle genetisch bedingten Entwicklungsstörungen lassen sich durch die hier beschriebenen Vererbungsmuster erklären. Dazu gehören mitochondriale DNA-Variationen, genomische Imprinting-Variationen und sogenannte Variationen in Satelliten-Sequenzen.
Obgleich der Großteil des genetischen Bauplans eines Lebewesens im Zellkern hinterlegt ist, enthalten Zellen mit Zellkern verschiedene weitere kleine Organisationseinheiten, die bestimmte Funktionen in der Zelle übernehmen. Mitochondrien gehören zu diesen sogenannten Zellorganellen. Mutationen in der mitochondrialen DNA können ebenfalls für Entwicklungsstörungen verantwortlich sein, z. B. solche, die mit einer Muskelschwäche einhergehen, und für neurodegenerative Erkrankungen. Solche Störungen können von der Mutter ererbt sein oder spontan auftreten.
Genomisches Imprinting ist ein epigenetischer Prozess, bei dem die männliche und die weibliche Keimbahn bestimmte Genregionen so prägen, dass nur das väterliche oder nur das mütterliche Allel eines Gens aktiv ist. Genomische Imprints werden in primordialen Keimzellen gelöscht, während späterer Phasen der Keimzellentwicklung neu etabliert und bei den somatischen Zellteilungen während der postzygotischen Entwicklung stabil weitergegeben. Fehler in der Entfernung der Imprints, ihrer Etablierung oder ihrer Erhaltung führen zu falschen epigenetischen Mustern und Expressionsprofilen, die spezifische Erkrankungen verursachen kön|34|nen. Zu den genetischen Syndromen, bei denen diese Prozesse eine Rolle spielen, gehören das Prader-Willi-Syndrom und das Angelman-Syndrom.
Zusammenhänge zwischen Genmutation und neurologischer Reifung
Die Zusammenhänge zwischen einer Genmutation und der Ausprägung der Entwicklungsstörung sind sehr komplex. Das zeigt sich an der großen Variabilität in ihrem klinischen Erscheinungsbild. Auch bei gleicher zugrunde liegender Mutation kann die Ausprägung von Auffälligkeiten der Entwicklung sehr unterschiedlich sein („Expressivität“). Außerdem variiert die phänotypische Ausprägung mit dem Alter, d. h. Symptome der Entwicklungsstörung können in bestimmten Altersgruppen weniger ausgeprägt (und damit schwerer zu erkennen) sein als in anderen Altersgruppen.
Trotz der Fortschritte der neurowissenschaftlichen Forschung sind die Zusammenhänge zwischen der Mutation, die die in den Genen kodierte Proteinproduktion stört (in den meisten Fällen: abschaltet), und dem Auftreten der Symptome einer intellektuellen Behinderung noch unzureichend geklärt. Alle Stufen der neuronalen Entwicklung (Zellbildung, neuronale Migration und Differenzierung, Axon- und Synaptogenese) und die Funktion der synaptischen Signalübertragung können betroffen sein. Die Erklärung von Zusammenhängen zwischen einer Störung der Proteinproduktion und Störungen des Hirnwachstums (Mikrozephalie), der Kortex-Struktur sowie Auffälligkeiten in der Dichte und Struktur der Dendritenverzweigungen und synaptischen Übertragung in neuronalen Netzwerken bleibt daher heute noch weitgehend hypothetisch (vgl. Abb. 3).
Abbildung 3: Hypothetisches Modell der Zusammenhänge bei der Entwicklung genetisch bedingter Störungen
|35|2.3 Andere pränatale Ursachen
Die Ausbildung der Struktur des Gehirns, des neuronalen Netzwerkes aus Synapsen und seine Funktionen können nicht nur durch genetische Prozesse, sondern auch durch Infektionen und andere schädliche Einflüsse gestört werden. In der frühen Entwicklungsphase ist das Gehirn in besonderer Weise vulnerabel für solche teratogenen Schädigungen.
Zu den möglichen pränatalen Ursachen für eine intellektuelle Behinderung gehören:
Infektionen der Mutter während der Schwangerschaft (z. B. Zytomegalie-Infektion, Herpesvirus-Infektion, Maserninfektion, Infektion mit dem Zika-Virus, Toxoplasmose),
Alkohol, Drogen oder die Einnahme bestimmter Medikamente während der Schwangerschaft (z. B. Antikonvulsiva zur Behandlung einer Epilepsie der Mutter),
die Exposition zu Umweltgiften (z. B. PCB, Blei).
Das Ausmaß der Schädigung hängt ab vom Zeitpunkt (d. h. dem Gestationsalter, in dem der Fetus damit in Kontakt kommt) und der Dosis des Teratogens. Ob es zu schweren Entwicklungsstörungen kommt, hängt dabei auch von der individuellen genetischen Disposition ab (Martin & Dombrowski, 2008; Riccio & Sullivan, 2016).
Mögliche intra-uterine und perinatale Infektionen werden unter dem Akronym TORCH zusammenfasst (Toxoplasmose, Varizellen-, Röteln-, Zytomegalie- und Herpesvirus-Infektionen). Eine Prävention von Entwicklungsstörungen beim Fetus ist durch rechtzeitige Impfung und sorgfältige pränatale Überwachung der Schwangerschaft möglich. Ein Beispiel für eine neu aufgetretene kongenitale Infektion war die Schädigung durch den Zika-Virus, die bei Feten in Brasilien und anderen amerikanischen Staaten zu einer Häufung von Fällen einer Hirnfehlbildung (Mikrozephalie), Anfällen, Skelettfehlbildungen u. a. geführt hat.
Die Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die durch Parasiten verursacht wird, die z. B. bei rohem Fleisch oder in Ausscheidungen von Katzen vorkommen können. Die Infektion verläuft bei Erwachsenen meist unbemerkt oder bewirkt lediglich grippeähnliche Symptome. Bei einer Infektion im ersten Schwangerschaftsdrittel besteht jedoch ein hohes Risiko für eine Fehlgeburt oder schwere Schädigungen des Embryos. Bei einer Infektion im zweiten oder dritten Schwangerschaftsdrittel können Augenschäden, eine Epilepsie oder die Ausbildung eines Hydrozephalus die Folge sein, die oft in den ersten Monaten noch nicht erkennbar sind und erst als Spätmanifestationen auftreten. Bei 18 % bis 33 % der Neugeborenen mit Symptomen einer Toxoplasmose-Infektion bei der Geburt zeigt sich in Nachuntersuchungen eine intellektuelle Behinderung (Röser et al., 2010; Olariu et al., 2011).
|36|Bei der Zytomegalie (auch: Cytomegalie, CMV-Infektion) handelt es sich um eine virale Infektionskrankheit, die alle Körperflüssigkeiten befällt und ebenfalls über das Blut und die Plazenta an das ungeborene Kind übertragen wird. Die Infektion kann auch perinatal durch den Kontakt mit infiziertem Zervikalsekret, Muttermilch oder Blutprodukten erworben werden und stellt insbesondere bei frühgeborenen Kindern ein hohes Risiko dar. Insgesamt verlaufen mehr als 80 % der Infektionen in der Schwangerschaft ohne Folgen für Mutter und Kind. 5 % bis 15 % der Kinder erleiden jedoch dauerhafte Schädigungen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine Mikrozephalie, intellektuelle Behinderung, neuromuskuläre Störungen oder eine Hörschädigung (Martin & Dombrowski, 2008; Diav-Citrin, 2011). Eine Infektion mit Windpocken (Varizellen), Herpes-Simplex-Virus, Epstein-Barr-Virus, Mumps oder Masernvirus ist ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für Störungen der embryonalen Hirnreifung verbunden.
Eine Alkoholexposition in der Schwangerschaft kann zu Dysmorphien, Wachstumsstörungen, kognitiven Einschränkungen und neuropsychiatrischen Störungen führen. Man spricht dabei von fetalen Alkoholeffekten (FAE), in schweren Fällen von einem fetalen Alkoholsyndrom (FAS). Eine pränatale Alkoholexposition stört die Prozesse der neuronalen Migration, Organisation, Synapsenbildung und das Hirnwachstum. Sie hat Einfluss auf verschiedene epigenetische Prozesse (Genexpression und DNA-Methylisierung, ohne die DNA-Sequenz selbst zu verändern), bewirkt auf diesem Wege Veränderungen in der Funktion von Nervenzellen und kann zu komplexen Entwicklungsstörungen führen (vgl. Kap. 5.4).
Insbesondere in unterentwickelten Ländern muss auch eine mütterliche Mangelernährung, Vitamin-, Eisen- oder Jodmangel und die Exposition zu Schwermetallen, z. B. Blei oder Quecksilber, als Ursache für eine intellektuelle Behinderung in Betracht gezogen werden. Schadstoffe gehen vom mütterlichen in den fetalen Blutkreislauf über und erreichen das Baby auch nach der Geburt über die Muttermilch. Auch diese Stoffe können die Zelldifferenzierung, neuronale Proliferation und Migration im ersten und zweiten Schwangerschaftsdrittel stören (Martin & Dombrowski, 2008).
Metabolische Störungen bei der Schwangeren stellen eine weitere mögliche Ursache für Störungen der Hirnreifung des Kindes dar (Martin & Dombrowski, 2008). Sie können bei präkonzeptioneller Adipositas, die in den letzten Jahrzehnten unter Schwangeren deutlich zugenommen hat, einem Diabetes mellitus oder einer abnormen Schilddrüsenfunktion (Hypothyroidismus) eintreten. In diesem Fall besteht ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung einer Präeklampsie. Eine Präeklampsie (oder EPH-Gestose) geht mit hohem Blutdruck und Eiweißansammlungen im Blut einher, die Wachstumsstörungen beim Kind auslösen können. In ihrer schwersten Form (HELPP-Syndrom) mit Zerfallen der roten Blutkörperchen, gestörter Leber- und Nierenfunktion sowie Gefahr einer Hirnblutung ist sie für die Schwangere le|37|bensgefährlich. Durch eine vorzeitige Plazentaablösung kann sie auch das Überleben des ungeborenen Kindes gefährden.
2.4 Peri- und postnatale Ursachen von Entwicklungsstörungen
Risiko bei sehr unreifer Geburt
Von einer Frühgeburt spricht man, wenn ein Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche (SSW) zur Welt kommt. Als sehr unreif gilt es, wenn es vor der 32. SSW, als extrem unreif, wenn es vor der 27. SSW geboren wird. Je früher und damit unreifer ein Kind geboren wird, desto höher ist das Risiko einer körperlichen oder intellektuellen Behinderung durch Sauerstoffmangel, Hirnblutungen und Infektionen.
Ein länger dauernder Sauerstoffmangel (Hypoxie, Asphyxie) kann zu Zellschäden und bleibenden Gewebsveränderungen des Gehirns führen. Hirnblutungen können bei frühgeborenen Kindern durch Blutdruckschwankungen entstehen, die aufgrund der noch sehr fragilen Blutgefäße eines frühgeborenen Kindes auftreten können. Bei einer Hirnblutung III. Grades kommt es dadurch zu einer blutungsbedingten Ventrikelerweiterung, bei einer Blutung IV. Grades zu einer Zerstörung von Hirngewebe. Dauerhafte Gewebsveränderungen werden als Periventrikuläre Leukomalazie (PVL) bezeichnet (Sarimski, 2020). Schädigungen durch eine Hypoxie oder Hirnblutung können jedoch auch bei reifgeborenen Kindern in den ersten Lebenswochen eintreten. Je nach Schwere und Dauer der Hypoxie können auch in diesen Fällen schwere Entwicklungsstörungen die Folge sein.
Durch die Verbesserungen der intensiv-medizinischen Versorgung frühgeborener Kinder konnte eine Reduzierung der Risiken für eine intellektuelle Beeinträchtigung durch diese frühen Komplikationen erreicht werden. Ältere Studien, z. B. die Bayerische Entwicklungsstudie, bei der sehr unreif geborene Kinder nachuntersucht wurden, die im Jahre 1985/1986 zur Welt kamen, berichteten noch eine Rate von 26 % an Kindern mit einer intellektuellen Behinderung im Schulalter (Wolke & Meyer, 1999).
In einer neueren multizentrischen Studie, bei der die Entwicklung von mehr als 1800 sehr unreif geborenen Kindern (Geburtsgewicht < 1 500g), die im Jahre 1997 zur Welt kamen, über mehrere Jahre verfolgt wurde, wurde bei Kindern ohne schwere neurologische Schädigungen oder Sinnesbehinderungen bei 21 % eine leichte kognitive Beeinträchtigung und bei 11 % eine intellektuelle Behinderung festgestellt (EPIPAGE-Studie; Larroque et al., 2008; Beaino et al., 2011). Der mittlere IQ lag mit 93.7 um 12.7 Punkte unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe. |38|Wenn man die Häufigkeit von Zerebralparese, Sinnesbehinderung und intellektueller Behinderung in dieser Studie zusammenfasst, wiesen 5 % eine schwere Behinderung, 9 % eine Behinderung mäßigen Grades sowie 25 % eine leichte Behinderung auf (vgl. Abb. 4).
Eine Metaanalyse von 30 Studien, die die Entwicklung von mehr als 10 000 Kindern einbezogen, die bis zum Alter von 6 Jahren nachuntersucht wurden und erst nach 2006 geboren waren, spricht ebenfalls für eine Reduzierung des Risikos für die Ausbildung einer intellektuellen Behinderung nach sehr unreifer Geburt. Allerdings zeigen auch die Ergebnisse dieser Metaanalyse, dass bei 14.7 % am Ende der Vorschulzeit ein Intelligenztestbefund im Bereich der intellektuellen Behinderung festgestellt wurde (Pascal et al., 2018). Insgesamt muss also davon ausgegangen werden, dass 10 % bis 15 % der Kinder, die gegenwärtig zu früh geboren werden, trotz verbesserter intensivmedizinischer Versorgung eine intellektuelle Behinderung entwickeln werden.
Das Risiko für die Ausbildung einer intellektuellen Behinderung variiert mit dem Grad der Unreife bei Geburt und der Grad einer Hirnblutung (Bolisetty et al., 2014). So wurde z. B. in der englischen EPICure-Studie, in der extrem frühgeborene Kinder (Geburtsgewicht < 1 000g) bis ins Schulalter nachuntersucht wurden, bei 21 % ein IQ < 70 diagnostiziert (Marlow et al., 2005).
Abbildung 4: Anteil von Kindern mit Behinderungen bei sehr unreif geborenen Kindern in der EPIPAGE-Studie im Alter von 5 Jahren (N = 1 817; Larroque et al., 2008)
|39|Postnatale Ursachen für Hirnschädigungen
Zu den postnatalen Ursachen für Hirnschäden (Jacobsen & Gwerner, 2021) gehören:
bakterielle oder virale Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis),
traumatische Hirnverletzungen (z. B. durch Unfälle),
Tumorerkrankungen,
Epilepsie-Syndrome (z. B. West-Syndrom, Lennox-Gastaut-Syndrom).
Durch die Standardimpfungen gegen Hämophilus-, Pneumokokken- und Meningokokken-Infektionen ist die Häufigkeit dieser Erkrankungen deutlich zurückgegangen. Eine wirksame antibiotische Therapie ist bei frühzeitiger Diagnose möglich. Das gilt auch für eine Virusenzephalitis (Hirnentzündung) infolge einer Herpes-Simplex-Infektion.
Traumabedingte Hirnschädigungen können im Kontext von Verkehrsunfällen, Ertrinkungsunfällen, Sportunfällen oder Misshandlung („shaken-baby syndrome“) entstehen. Je nach Schwere der Verletzung und dem Alter der Kinder, die solche Verletzungen erleiden, können komplexe Beeinträchtigungen der neuropsychologischen Funktionen (Aufmerksamkeitssteuerung, Gedächtnis, exekutive Funktionen, Sprachkompetenzen) oder eine intellektuelle Behinderung die Folge sein (Anderson et al., 2012; Crowe et al., 2012). In vielen Fällen erholen sich Patientinnen und Patienten im frühen Kindesalter jedoch weitgehend von diesen Verletzungen bzw. können nicht betroffene Hirnregionen die Funktion von geschädigten Hirnregionen übernehmen („neuronale Plastizität“).
Zu den möglichen postnatalen Ursachen einer Hirnschädigung gehört schließlich eine Tumorerkrankung oder eine Enzephalopathie im Rahmen eines Epilepsie-Syndroms (z. B. West-Syndrom, Lennox-Gastaut-Syndrom). Solche Epilepsie-Syndrome im Kindesalter gehen mit unterschiedlichen Anfallsformen (vgl. Kap. 2.6) einher und sind meist schwer zu behandeln. Sie führen in den meisten Fällen zu schweren Entwicklungsstörungen.
2.5 Apparative und genetische Untersuchungsverfahren
Zur Klärung der Ursache einer intellektuellen Behinderung können elektrophysiologische Methoden, sogenannte bildgebende Verfahren und humangenetische Untersuchungsverfahren eingesetzt werden. Sie gehören zum Arbeitsfeld der Kinderneurologie und des Facharztbereichs für Humangenetik.
|40|Elektrophysiologische und bildgebende Untersuchungsverfahren
Zu den elektrophysiologischen Methoden, die die Arbeitsweise des Gehirns untersuchen, gehören die Ableitung eines Elektroenzephalogramms (EEG), bei dem die durch Neuronenaktivität hervorgerufenen Hirnströme gemessen werden, und die Abteilung von evozierten Potenzialen, die Veränderungen in der elektrischen Aktivität des Gehirns widerspiegeln, die als Reaktion auf die Präsentation eines bestimmten Reizes auftreten.
Unter den bildgebenden Verfahren sind Verfahren, die die anatomische Struktur des Gehirns untersuchen, zu unterscheiden von Verfahren, die die funktionale Hirnaktivität abbilden. Zur ersten Gruppe gehört die Magnetresonanztomografie (MRT) und die Positronen-Emissions-Tomografie (PET). Mit diesen Verfahren lassen sich die durch die Hirnströme induzierten Magnetfelder messen. Sie liefern dreidimensionale, hochauflösende Bilder von Hirnstrukturen und erlauben die Identifizierung von strukturellen Auffälligkeiten des Gehirns und die Messung des Volumens verschiedener Strukturen (weiße und graue Hirnsubstanzen). Durch das hohe Auflösungsvermögen der bildgebenden Verfahren können auch kleinste Veränderungen im Hirngewebe, Fehlanlagen, Myelinisierungsstörungen, Balkenanlagestörungen und andere Veränderungen der Hirnstruktur nachgewiesen werden. Zu einigen genetischen Syndromen (z. B. Down-Syndrom, Williams-Beuren-Syndrom und Fragilem-X-Syndrom) und angeborenen Stoffwechselstörungen liegen Forschungsbefunde vor, die mit solchen bildgebenden Verfahren erhoben wurden.
Die MRT nutzt Magnetfelder und Radiowellen (keine Röntgenstrahlen). Sie ist non-invasiv und risikoarm. Sie erfordert allerdings bestimmte Untersuchungsbedingungen (Ruhelage und Toleranz für Enge und Geräusche in der Ableitungsröhre), die in der klinischen Praxis bei Kindern mit intellektueller Behinderung meist nicht hergestellt werden können bzw. eine medikamentöse Sedierung oder Narkose nötig machen.
Eine funktionale Magnetresonanztomografie (fMRT) zeichnet den zerebralen Blutfluss in unterschiedlichen Gehirngebieten und ihrer funktionalen Konnektivität als indirekter Indikator neuronaler Aktivität bei der Bearbeitung kognitiver Anforderungen auf. Aktive Hirnareale weisen einen höheren Sauerstoffgehalt im Blutdurchfluss im Vergleich zu anderen Arealen auf. Die Interpretation der Ergebnisse basiert auf Hypothesen, welche Hirnareale bei bestimmten Anforderungen in Anspruch genommen werden könnten. Die Untersuchung erfordert ebenfalls bestimmte Ruhebedingungen, Kooperationsbereitschaft und Motivation des Individuums zur Bearbeitung der Aufgabe, sodass auch diese Methode in der klinischen Praxis bei der Untersuchung von Kindern und Jugendlichen mit intellektueller Behinderung (noch) keine Anwendung finden kann.
|41|Humangenetische Untersuchung
Der Beitrag einer Fachärztin oder eines Facharztes für Humangenetik zur Klärung der Ursache einer intellektuellen Behinderung kann in der Identifizierung eines genetischen Syndroms bestehen, d. h. eines spezifischen Phänotyps, der auf eine einzelne Ursache – eine Chromosomenstörung oder eine monogenetische Veränderung – zurückgeführt werden kann. Die charakteristischen Merkmale von mehr als 1 000 Syndromen sind in entsprechenden Datenbanken weltweit zugänglich (z. B. OMIM). Diese Merkmale sind bei den meisten Syndromen allerdings in ihrer Ausprägung variabel und viele von ihnen fakultativ (also nicht obligatorisch) für die Diagnosestellung. Daher steht der Humangenetiker vor der Aufgabe, aus der differenzierten Untersuchung der Entwicklungsmerkmale eines Kindes, das ihm vorgestellt wird, zunächst eine Hypothese abzuleiten, welches Syndrom vorliegen könnte. Diese Hypothese wird dann mit zyto- und molekulargenetischen Laborverfahren überprüft.
Das Karyogramm als Ergebnis der zytogenetischen Untersuchung zeigt den Chromosomensatz eines Individuums. Die einzelnen Chromosomen unterscheiden sich in ihrer Länge und Struktur und können im Labor zu Paaren angeordnet und durchnummeriert werden. Jedes Chromosom enthält ein Zentromer und zwei „Arme“ unterschiedlicher Länge (p- und q-Arm). Mit dieser Laboruntersuchung können numerische Chromosomenabweichungen (z. B. beim Down-Syndrom) oder Duplikationen, größere Deletionen und Translokationen festgestellt werden. Eine Chromosomenanalyse ist immer indiziert, wenn bei einem Kind eine intellektuelle Behinderung vorliegt und (größere oder kleinere) körperliche Auffälligkeiten, in denen es von den anderen Familienmitgliedern abweicht.
Durch die Verbreitung neuerer Labormethoden (Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, „FISH“, und chromosomale Mikroarrays, „CMA“) und neuen Techniken zur Gensequenzierung (Hochdurchsatz-Sequenzierungsverfahren, Exom-Sequenzierung und Genom-Sequenzierung) lassen sich mittlerweile auch kleinere Strukturveränderungen und chromosomale Imbalancen zuverlässig diagnostizieren, die einer genetisch bedingten Entwicklungsstörung zugrunde liegen können. Dazu gehören Deletionen eines Chromosomensegments, eine Duplikation, eine Erweiterung der Repeat-Sequenzen, Translokationen oder Inversionen (Engels, 2018).
So können mit der Subtelomer-Analyse kleine Deletionen an endständigen spezifischen Sequenzen auf den p- und q-Armen des Chromosoms („Subtelomere“), sichtbar gemacht werden. Mit der Array-CGH (Array-based Comparative Genomic Hybridization) lassen sich Kopienzahlveränderungen der DNA nachweisen, die aufgrund ihrer Größe in der konventionellen Chromosomenanalyse nicht erkannt werden können. Wenn ein Verdacht auf ein spezifisches genetisches Syndrom besteht, bei dem der Ort der Genmutation bekannt ist, kann eine sogenannte „Fluoreszent-in-situ-Hybridisierung“ (FISH) die Diagnose bestätigen. Mit den |42|dabei verwendeten spezifischen DNA-Sonden können Veränderungen in den genomischen Regionen nachgewiesen werden, die für das jeweilige Syndrom charakteristisch sind.
Zur Diskussion
Sonderpädagogische Fachkräfte stehen den Bemühungen zur Klärung der Ursache einer intellektuellen Behinderung durch neurophysiologische oder humangenetische Untersuchungsverfahren mitunter skeptisch gegenüber. Aus ihrer Sicht trägt die Klärung der medizinischen Diagnose nicht zur Planung und Praxis der pädagogischen Förderung bei und verstellt womöglich den Blick auf die individuellen Entwicklungsbedingungen, Entwicklungsverläufe, Ressourcen und Unterstützungsbedürfnisse eines Kindes.
Vielen Eltern ist es jedoch ein wichtiges Anliegen, die Ursache der Behinderung ihres Kindes zu kennen. Dieses Wissen kann dazu beitragen, mögliche Selbstvorwürfe abzuschwächen, in der Fürsorge für ihr Kind etwas versäumt zu haben. Zudem erlaubt die Klärung der Ursache, sich ein Bild von den Entwicklungsperspektiven zu machen, sofern Forschungsbefunde zur kognitiven, sprachlichen und sozial-emotionalen Entwicklungsprognose bei Kindern und Jugendlichen mit der jeweiligen Diagnose zugänglich sind. Sich ein Bild von der möglichen gemeinsamen Zukunft zu machen, kann insbesondere in der ersten Zeit nach der Diagnosemitteilung irrationalen Ängsten vorbeugen, Entwicklungspotenzial sichtbar machen und einer Überforderung des Kindes durch realistische Erwartungen an seine Entwicklungsmöglichkeiten entgegenwirken.
Die Klärung einer Diagnose macht es ihnen darüber hinaus möglich, sich mit anderen Eltern auszutauschen, bei deren Kindern die gleiche Ursache für eine Entwicklungsstörung vorliegt. Elternselbsthilfegruppen, die sich bundesweit zu vielen seltenen Erkrankungen und Behinderungen gebildet haben, bieten einen solchen persönlichen Austausch über Entwicklungsverläufe und Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten und unterstützenden Hilfen. Die modernen digitalen Möglichkeiten erleichtern die Kontaktaufnahme zu anderen Eltern in solchen Selbsthilfegruppen. Eine zentrale Anlaufstelle bei der Suche nach Kontakten ist das „Kindernetzwerk“.
Schließlich kann die Klärung der Diagnose auch ein wichtiger Baustein zur Planung der pädagogischen Förderung sein. Zu den häufigeren genetischen Syndromen liegen mittlerweile umfangreiche Forschungsbefunde zu spezifischen Entwicklungsprofilen und Verhaltensmerkmalen vor, die für Kinder und Jugendliche mit diesen Syndromen charakteristisch sind. Sie sind unter dem Konzept der „Verhaltensphänotypen“ zusammengefasst (Sarimski, 2014). Selbstverständlich ersetzt das Wissen um solche Merkmale nicht die individuelle Untersuchung des Entwicklungsprofils und der Verhaltensmerkmale eines Kindes, kann aber einen wertvollen Beitrag zur Klärung von Schwerpunkten der Förderung und Anpassung an spezifische Unterstützungsbedürfnisse liefern (vgl. Kap. 5).
|43|2.6 Komorbiditäten
Bei vielen Kindern mit intellektueller Behinderung liegen Begleitstörungen (Komorbiditäten) vor; die häufigsten assoziierten Entwicklungsstörungen sind Zerebralparesen, Epilepsie und Sinnesbehinderungen.
Zerebralparese
Formen, Schweregrade und Prävalenz einer Zerebralparese
Bei einer Zerebralparese (auch: Cerebralparese, „cerebral palsy“, CP) handelt es sich um eine Störung der Bewegungskoordination und Haltungskontrolle infolge einer (nicht progressiven) Schädigung des zentralen Nervensystems, die in der fetalen Entwicklungsperiode oder im Säuglingsalter entstanden ist. Nach ihrer neurologischen Form werden drei Arten von CP unterschieden:
spastische Parese,
dystone-dyskinetische Paresen,
ataktische Paresen.
Nach den beteiligten Muskelgruppen wird von einer Tetraplegie (alle Extremitäten sind betroffen), Diplegie (die beiden unteren Extremitäten sind vorwiegend betroffen), Monoplegie (nur eine Extremität ist betroffen) und Hemiplegie (eine Körperseite ist betroffen) gesprochen.
Die motorischen Funktionen können bei einer CP sehr unterschiedlich betroffen sein. Kinder mit einer Hemiplegie oder spastischen Diplegie sind in der Regel in der Lage, selbstständig zu laufen, während Kinder mit einer umfassenderen Bewegungsstörung häufig auf einen Rollstuhl zur Fortbewegung angewiesen sind. Bei einem Teil der Kinder mit einer CP sind auch die Handfunktionen eingeschränkt, sodass sie bei Aktivitäten des täglichen Lebens auf Unterstützung angewiesen sind.
Die Prävalenz der CP liegt nach den Ergebnissen einer Übersicht über die bis 2004 verfügbaren epidemiologischen Studien bei 2.5 : 1 000 (d. h. ca. 0.25 %; Odding et al., 2006). In der bereits zitierten Studie, bei der flächendeckend alle Kinder und Jugendliche in einer US-Region in den Jahren von 1993 bis 2010 untersucht wurden, betrug die Prävalenz 3.4 : 1 000 (Van Naarden Braun et al., 2015). In einer nationalen Erhebung, die im Jahre 2012/2013 in den USA durchgeführt wurde, lag die Rate bei 2.9:1 000 (Maenner et al., 2016). Die häufigste Form ist eine spastische Parese, die bei über 85 % der Kinder diagnostiziert wird. Die Häufigkeit einer dyskinetischen Störung liegt bei 6 % bis 15 %, die Häufigkeit einer Ataxie bei 3 %.
|44|