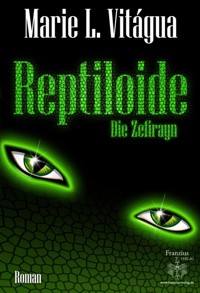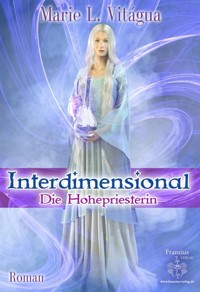
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als ihre Welt immer weiter dem Schwarzen Lord anheimfällt, begibt sich die junge Naina Lara de Fontaindío auf die Wanderschaft zur Ur-Quelle der Liebe, welche von der Göttin des Lichtes gehütet werden soll. Dort erfährt sie eine intensive Ausbildung zur Hohepriesterin. Bis sie zwischen die Intrigen zwischen Gut und Böse gerät und erfährt, dass es gilt, beides hinter sich zu lassen. Dieses Buch erklärt die Rückbesinnung auf die eigenen Kräfte und Vermögen und wie die eigenen Urkräfte des Seins entfaltet werden können. Es handelt sich hierbei um den Charakter der Naina Lara de Fontaindío, bereits beschrieben im ersten Teil der Trilogie "Die verbotene Macht" und auf vielfachen Wunsch ergänzt. Ein faszinierender Einblick in eine Macht jenseits irdischer Begrifflichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Interdimensional
Die Hohepriesterin
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenImpressum
Marie L. Vitágua
Interdimensional
Die Hohepriesterin
Roman
Copyright © 2015 Marie Lara Vitágua
Bremen, Deutschland
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlag: Jacqueline Spieweg
Marie.L.Vitá[email protected]
Prolog
Ich beginne diese Zeilen nach einem Todeserlebnis in diesem Leben und nach der Phase des Wiedereinstiegs in den Körper, welche langsam und mühevoll war; doch nicht so tragisch wie die Nächste werden würde. Der Tod ist nicht, was wir meinen und doch, was wir glauben. Die universelle Quelle der All-Liebe ist die Schöpfung und alles, was ist. Sie ist ein Naturgesetz. Und sie zeigte mir, wozu die Macht der Liebe imstande ist.
Ich heiße Naina Lara aus dem Hause de Fontaindio und ich bin die Hohepriesterin der Quelle allen Lebens, der reinen, allmächtigen Liebe. Ich bin das und werde das immer sein, da die Seele keine Zeit kennt.
Wer meine Geschichte findet, möge sie lesen, wahrlich verstehen und sich fürderhin gestatten, an sich Selbst zu glauben.
1. Überfall
Ich stoppte ruckartig, als ich die vier Reiter sah, die mir schnell entgegen kamen. Sie trieben ihre Tiere unbarmherzig an und ritten alles nieder, was sich in ihrem Weg befand. Ich rettete mich mit einem Sprung hinter einen Gemüsekarren, dessen Inhalt jetzt auch noch umkippte und mich unter Unrat begrub. Das würde Ärger geben, wenn ich zu Hause mit dreckigem Kleid und unverrichteter Dinge ankam.
Doch als ich den Kopf gerade wieder heben wollte, sah ich, dass einer der Reiter an der Ecke kehrtmachte, die Straße zurück ritt und zielstrebig auf mich zukam. So etwas Bedrohliches hatte ich noch nie gesehen. Wenige Meter vor mir blieb er plötzlich stehen und schaute sich suchend um. Ich verkroch mich noch tiefer hinter dem Karren.
Das Tier war eine skurrile Mischung aus geiferndem Hundekopf, dicken Pferdebeinen und Drachenschuppen mit einem langen, stacheligen Schwanz. Der Reiter, der behände von seinem Tier gesprungen war, war einer der Schergen Lord Jaweels. Die Augen tiefrot, dämonisch und die hagere Gestalt in einen schwarzen Mantel gehüllt, kam der Schwarzmagier auf mich zu. Ich schauderte und duckte mich tiefer. Meine kleine Statur verschwand im Schatten der Hauswand hinter dem Karren.
Ich versuchte, mich frei von allen Gefühlen und Gedanken zu machen, die ein anderer hätte wahrnehmen können und verlangsamte meine Atmung auf ein Minimum. Das hatte mich meine Mutter gelehrt und mit meinen sechs Jahren beherrschte ich die Kunst des Unsichtbarmachens mittlerweile sehr gut. Das war sehr nützlich in diesen Tagen, an denen wir uns auch ab und zu mit Stehlen von Lebensmitteln über den langen Winter bringen mussten. Denn wir lebten am Rande der Blutzone, jener Grenze zwischen den Ländern, die immer wieder Überfällen durch die Soldaten Lord Jaweels ausgesetzt war.
Auch jetzt rettete mir die Kunst, mich tief in mich zu versenken und die Gedanken anzuhalten, wieder das Leben. Der Schwarzmagier stiefelte an mir vorbei auf zwei kleine Jungen zu, die er mit einem gezielten Schlag gegen die Halswirbelsäule brutal betäubte. Er las sie auf, als hätten sie kein Gewicht und hängte sie einfach wie Jagdtrophäen über den Sattel seines Tieres. Die ganze Straße war verstummt: Nichts und niemand wagte, sich zu bewegen. Das änderte sich erst, als der Reiter wieder auf sein Tier gestiegen war, zu seinen Gefolgsleuten aufgeschlossen hatte und alle schon eine Weile davongeritten waren. Dann plötzlich legte sich die unnatürliche Ruhe und das Geschrei, Weinen und Gezeter setzte ein. Vorsichtig erhob ich mich und schaute mich um, als eine alte Frau mich an der Schulter anfasste. „Naina“, sagte sie, „sie waren auch bei euch… dein Bruder.“ Ich schaute sie entsetzt an, sprang auf und rannte.
Auch heute noch kann ich, wenn ich die Augen schließe, das grauenhafte Bild wieder hervorrufen, welches sich damals unwiederbringlich in mein Gedächtnis einbrannte, als ich unsere Siedlung erreichte. Dort, wo zuvor noch die Häuser gewesen waren, war jetzt nichts mehr. Mein Elternhaus war einfach verschwunden, wie alle Häuser und Gärten der kleinen Ortschaft auch. Eine unnatürliche Stille wehte über die Öde. Alles glich einer Steppe aus grauem Felsboden, über die der Wind strich. Es waren auch keine Tiere mehr da. Bis zum Saum des Waldes war es, als wäre hier nie eine Siedlung gewesen. Nur der ferne Wald schien mir vertraut.
Ich konnte später nie sagen, wie lange ich in der Asche nach Spuren gesucht hatte. Dabei wusste ich doch, dass Magie keine Spuren hinterließ. Nur Leere und graue Asche. Ohne zu weinen, saß ich danach zitternd auf dem Boden und starrte auf das, was hätte dort sein müssen, aber verschwunden war.
Irgendwann erhob ich mich und lief los, denn ich wusste, dass ich hier keineswegs bleiben konnte. Meine Eltern waren tot, das fühlte ich. Mein Bruder wurde wahrscheinlich verschleppt. Ich war nun ganz allein. Hier kannte ich niemanden. Meine Eltern hatten uns Kinder aus Angst, einmal den Kinderhäschern des dunklen Lords zum Opfer zu fallen, immer gut versteckt. Niemand wusste, wozu sie Kinder raubten und niemand hatte die Kinder je wiedergesehen. Es gingen jedoch schreckliche Geschichten um, die von Experimenten und grausamen Vorgängen in seiner Festung erzählten. Diese Geschichten reichten, um uns von Menschen fernzuhalten, denn diese konnten uns verraten.
Auch Erwachsene verschwanden. Tauchten sie doch wieder auf, waren sie nicht wiederzuerkennen. Kalt und gefühllos vernichteten sie oft ihre gesamte Familie, verrieten oder manipulierten ihre Freunde und setzten sich danach brutal als Bürgermeister, Stadtrat oder Höheres durch. Nie zum Wohle aller; sie wirtschafteten nur in die eigene Tasche. Mein Vater erzählte abends stets von ihren Untaten.
Mein Vater war Gelehrter und Lehrer gewesen und hatte die Kinder der Siedlung unterrichtet, was er später heimlich machen musste. Er baute auch die Bibliothek auf, die später jedoch geschlossen worden war. Meine Mutter hatte als Heilerin gearbeitet, bis dies zu gefährlich wurde. Danach webte sie Kleidung und verkaufte heimlich Gemüse und Kräuter. Meine Eltern hatten stets darauf geachtet, dass wir unsichtbar blieben. Unsere Kleidung bestand aus weiten Umhängen in unauffälligen Farben und mit einer Kapuze, die außerhalb des Hauses stets tief über den Kopf gezogen wurde. Sie hatten meinen kleinen Bruder und mich zu Hause unterrichtet - uns beide, obwohl ich ein Mädchen war.
Draußen hielten wir uns stets dicht an der Hauswand und liefen hinter dem Haus gleich in den Wald. Das war unser Spielplatz. Dort hatten wir auch eine kleine Lichtung angelegt, wo wir heimlich Gemüse und Kräuter zogen. Im Wald hatten wir viele Spielkameraden. Dort gab es unzählige Wesen, die mit normalen Augen nicht zu sehen waren. Wir schufen uns eine ganz eigene Welt: Auf einer Lichtung, neben dem Feld, welches meine Mutter für das Gemüse nutzte, spielten wir. Wir bauten aus dem Holz Unterstände und suchten uns gezielt die exotischsten Freunde. Der Wald war voll von Wesen.
Nach dem Unterricht waren wir bis zum späten Nachmittag im Wald. Danach halfen wir meiner Mutter bei ihren Aufgaben im Haus. Nur sehr selten wagten wir uns bis an den Markt der Dorfmitte. Meist blieben wir in Rufweite zu unserem kleinen Haus. Wenn unser Vater heimkam, lauschten wir seinen Ausführungen und Erläuterungen. Wir aßen gemeinsam zu Abend und dann lauschten wir den spannenden Erzählungen meiner Mutter. Diese hörte ich besonders gerne. Sie sagte, sie habe sie von ihrer Mutter. Diese Erzählungen waren immer schön, sehr andersartig und erzählten von einem Land der Harmonie und Verbundenheit. Sie handelten von Fülle, Füreinander und Verständnis. Oft träumte ich von diesem Land, in dem es keinen Mangel gab.
Denn die Gefolgsleute von Lord Jaweel verbreiteten Furcht und Schrecken, wo sie nur konnten, und breiteten sich bereits über den gesamten Norden aus. Wir hatten einen Schutzwall errichtet, doch er kam immer weiter gen Süden. Nun waren sie auch in unserer Siedlung angekommen und hatten gleich alles niedergebrannt. Alle waren tot. Auch die Ernte und die Tiere waren vernichtet. Es würde nun im ganzen Umfeld immer unerträglicher werden. Lord Jaweel hatte keinen Respekt und verfolgte nur eigene Pläne der Macht. Er hatte Schulen der Magie gegründet und diese schwarzen Magier zogen nun mordend und raubend immer wieder durch die Region, immer nach mehr Land und Einfluss strebend. Wer einmal unter diesen Einfluss geriet, war nicht mehr derselbe; es hieß, sie versteinerten das Herz, töteten das Gewissen und machten jeden zu einem ergebenen Gefolgsmann Jaweels.
Die Schwarzen waren nun schon bis zur Mitte des Landes und jetzt sogar bis an den Fluss vorgedrungen. Ich musste hier weg. Ich lief in den Wald und holte dort die vergrabene Tasche aus seinem Versteck. Sie beinhaltete die wertvollsten Bücher der Familie, einige Münzen und etwas Wegzehrung. Ich nahm an Essbarem mit, was sonst noch so vorhanden war. Dann blickte ich mich um und verabschiedete mich von all meinen Freunden des Waldes. Und dann ging ich. Ich ging, um den Ort zu suchen, von dem meine Mutter mir heimlich so viele Nächte lang erzählt hatte. Auch sie kannte ihn nur aus Erzählungen ihrer Mutter, denn niemand, den wir kannten, war je dort gewesen.
Wie hatte ich ihre Geschichten geliebt. Ein Ort, an dem es ganz anders sein sollte als hier. Dort gab es Freiheit und ausreichend Nahrung für alle. Dort hatten alle Platz, wurden geachtet und respektiert. Dort musste sich niemand verstecken und niemand hatte je Angst. Es war wie ein Paradies, erzählte sie, ein Ort voller Liebe und Frieden. Ein Ort, den es also wahrscheinlich gar nicht gab. Aber was sollte ich sonst tun? Ich lief einfach los. Immer Richtung Sonne. Wo sollte der Ort sonst sein? Etwas anderes kam mir in dem Moment nicht in den Sinn. Also machte ich mich auf den Weg. Erst Jahre später sollte ich bestimmen können, warum ich so selbstverständlich und genau in südliche und in keine andere Richtung lief.
Wie lange ich gelaufen war, wusste ich nicht. Ich legte mich hin, wenn ich müde war, und lief weiter, sobald ich aufwachte. Aber zunächst immer außer Sichtweite von Menschen. Der Wald schenkte mir ein wenig Nahrung und die Flüsse zu trinken. Ich brauchte nicht viel. Ich lief einfach. Je weiter ich kam, desto freundlicher waren die Menschen. Ihre Sprache klang ein ganz wenig anders; etwas härter im Ausdruck. Doch ihr Wesen war froh und ihre Augen lachten immerfort. Sie umarmten sich offen und herzlich zur Begrüßung und zum Abschied und scherzten viel. Die Kinder freuten sich, spielten miteinander frei auf den Straßen. Sie liefen ohne Vorsicht herum. Offene Felder mit Getreide und Gemüse sah ich. Später auch Obstbäume. Immer wieder bemerkte ich Menschen auf den Straßen ihre Ware tauschen. Noch nie hatte ich so viel frisches Gemüse gesehen. Noch nie hatte ich so fröhliche und angstfreie Menschen gesehen.
So traute ich mich bald, auch einmal bei einem Hof halt zu machen. Dort sprachen mich die Bewohner freundlich an. Für das Versprechen, den vorderen Hof zu reinigen und die Tiere zu füttern, ließen sie mich im Stall schlafen. Ich bekam sogar eine warme Mahlzeit. Das motivierte mich, bei dem nächsten Hof um Arbeit und einen Platz zum Schlafen zu fragen, und ich wurde nie abgewiesen. Im Gegenteil. Je weiter ich ging, desto wärmer wurde nicht nur die Luft, sondern auch die Menschen wurden offener und herzlicher. Zweimal fuhr ich auch bei einem Bauern auf dem Karren eine Weile mit. Er gab mir unbekannte Früchte zum Probieren, die wunderbar süß und zart waren und von denen meine Hände klebten.
Ich erzählte niemandem, woher ich kam. Doch ich zeigte ihnen die Richtung, in die ich wollte, wenn sie fragten. Ab und zu hörte ich sie den Blütenwald erwähnen, hinter dem sich hinter einer hohen Mauer ein gigantischer Palast erheben sollte. Ganz in Form einer riesigen Blüte. Die Göttin des Südens persönlich lebe da, hieß es. Ich lauschte gebannt. Gab es sie wirklich?
Jetzt lachte die Sonne von einem wolkenfreien Himmel herab und die Landschaft hinter den Bergen erschien mir wunderschön. Die Farben der Pflanzen und Seen spiegelten sich im Himmel und schufen eine bezaubernde, farbenprächtige Klarheit. Die Vielzahl an Blumen und Tieren ließ mich staunen. Die Landschaft wurde immer flacher und weitläufiger, durchzogen mit Salz- und Süßwasserseen.
Und hier wurde ganz offen und direkt von der Königin der Königinnen gesprochen. Der Palast, in Form einer gigantischen Blüte, sollte innerhalb einer endlosen, weißen Mauer liegen, die nur in der Schwingung der Liebe zu überwinden war. Es wurden nur Mädchen aufgenommen, die eine Prüfung zu bestehen hatten. Nach einer intensiven Ausbildung schwärmten die Priesterinnen als Heilerinnen wieder aus oder blieben in der Verwaltung des Reiches.
Mit Aufmerksamkeit und Wohlwollen führte die Königin die ihren aus ihrem Blütenpalast. Eine Göttin sollte sie sein. Alle Menschen waren hier frei und niemand litt an Mangel oder Krankheit. Ich wagte, das kaum zu glauben.
Doch irgendwann hatte ich den Ort gefunden, den trotz aller Reden zuvor kaum jemand gefunden hatte. Denn plötzlich war der Wald, den ich seit Tagen durchwanderte, zu Ende. Ich stand vor der weißen Mauer. Wie in den Geschichten meiner Mutter und der Menschen auf meinem Weg dehnte sich diese Mauer aus so weit das Auge reichte – ohne Tür, ohne Tor.
2. Der Blütenpalast
Ohne sichtbaren Eingang und unüberwindbar, dehnte sich diese unendlich weiße Mauer vor mir aus. Dort stand ich nun. Meine Füße taten mir weh und ich wusste mir keinen Rat mehr. Ich sah nur eine unübersehbar hohe, weite Mauer. Ich hatte mich an das Gehen gewöhnt. So plötzlich anzukommen, irritierte mich. Müde und ratlos setzte ich mich ins Gras.
Ich war wohl eingenickt, denn plötzlich schrak ich hoch. Irgendetwas hatte mich berührt. Als ich den Schemen sah, zuckte ich überrascht zusammen. Nur ein Schmetterling, dachte ich dann, doch ein großer und schillernd schöner. Neugierig geworden, versuchte ich dieses Wesen näher zu betrachten, doch es entzog sich dem Auge in faszinierender Weise. Als ich es näher anschauen konnte, bemerkte ich ein Wesen wie eine Fee so zart. Dieses Wesen war von so lichter und schöner Gestalt, dass es mich wie magisch anzog. Nie zuvor hatte ich so etwas Schönes gesehen. Wie ein Schmetterling, doch fast durchsichtig schillernd in Pastelltönen tanzte sie auf zierlichen Füßen, ohne je den Boden zu berühren. Sie war sogar größer als ich und das Schönste war: Sie schien zunächst ebenso überrascht wie ich, dass wir uns sehen konnten, und lachte dann trällernd – wie ein Glasperlenspiel.
Es war ein Feenwesen in einem feinen, weißen Kleidchen und mit einem strahlenden Lächeln. Sie tanzte ein paar Schritte auf mich zu und musterte mich liebevoll. Ich war fasziniert. Auf wundersame Weise kannte ich sie, ja fühlte schier eine Verbundenheit wie eine Schwesternschaft. Sie schien mir etwas sagen zu wollen und irgendwie auf mich zu warten. Als ich nicht reagierte, zeigte sie auf etwas, was ich nicht sehen konnte. Sie schien erneut etwas zu sagen, doch ich verstand nicht. Für meine Ohren klang es wie Musik. Leise, melodiös und sehr hell. Da die Fee so lieblich war und neugierig geworden, beschloss ich, einfach zu folgen. Bei unseren Spielen im Wald hatten wir das auch immer so gemacht. Ich ging einfach, die interessante Art von Wesenheit nachahmend, hinterher. Das Wesen schlüpfte durch einen Spalt in der Mauer, den ich vorher nicht gesehen hatte und der auch nicht zu sehen gewesen wäre, hätte das süße Wesen seinen Kopf nicht lächelnd gerade wieder herausgestreckt und gewinkt. Ich schlüpfte hinterher und war drin. Ich war durch die unüberwindlichste Mauer der bekannten Welt gekommen und nur mit Hilfe eines mich mit Liebe und Verbundenheit erfüllenden Feenwesens, welches mich nun mit einem trillernden Lachen wieder verließ. Ich dankte, zu Tränen gerührt.
Da stand ich nun vor dem Wunder der Baukunst – dem Blütenpalast. Weiße und rosa Mauern mit durchsichtigen, rechteckigen Aussparungen, die glänzten. In Form einer Blüte gebaut und unermesslich groß. Inmitten einer weitläufigen Landschaft aus gepflegten Bäumen und Blumen mit sauberen Wegen und liebevoll angelegten Gärten ringsherum. In jedem Blütenstrang sollten sich die Novizen-Zimmer befinden. In der Mitte sollte sich der Tempel befinden und in dem Gebäudeteil, der den Blütenkelch darstellte, sollten die Gemächer der Königin sein. Die Räume der Königin der Quelle der Liebe, der geweihten Göttin des Südens. Diese Gemächer hätten einen wunderschönen Ausgang zum Meer, hatte ich gehört. Von der Königin selber sprach alles nur im ehrfurchtsvollen Flüsterton. Auf meiner Reise hierher hatte ich einiges Wundersames gehört. Sie sei die Vertreterin der reinen universellen Quelle der Liebe und wunderschön. Sogar eine Göttin. Sie sei gütig und weise, gerecht und stets die Mutter allen Lebens. Wie schön es hier war, Reinheit und Klarheit so weit das Auge reichte.
Einige Minuten stand ich staunend vor diesem Wunder an Schönheit – dem Palast der Königin – dem Blütenpalast und bewegte mich dann den Pfad entlang auf das Gebäude zu. Es wurde schon dunkel, denn die Sonne war schon seit Langem orangerot hinter dem Horizont versunken. Es war den ganzen Tag über sehr warm gewesen und ich war erschöpft. Ich ging zum Haupttor und klopfte. Niemand kam. Doch als ich gerade das zweite Mal klopfen wollte, schwang die Tür einfach auf. Ich schaute erstaunt hinein, doch im großen Eingangsbereich war niemand. Also folgte ich dem Geruch von frischem Brot und warmem Eintopf und stand kurze Zeit später plötzlich in der Küche. „Nanu“, fragte mich eine Frau mit unzähligen Lachfältchen erstaunt. „Wie kommst du denn hierher?“ Wahrheitsgemäß antwortete ich: „Die Tür war offen und ich hatte Hunger.“ Die Dame lachte vergnügt. „Und wie heißt du, liebes Kind?“ Ich antwortete: „Naina.“ Die Dame nickte mir aufmunternd zu: „Na dann setz dich doch, Naina und sei willkommen. Ich heiße Martha und bin hier die Köchin.“
Mit diesen Worten drückte mich Martha auf die Bank am Ofen und schob mir einen Teller Eintopf und frisches Brot vor die Nase. Nach einem fragenden Blick und einem aufmunternden Nicken, schlang ich alles in mich hinein. Was danach kam, weiß ich nicht mehr so genau. Es kamen wohl noch einige nette, junge und ältere Menschen in die Küche und Martha sagte noch oft: „Darf ich euch Naina vorstellen.“ Doch behielt ich nicht einen einzigen Namen der lachenden Gesichter im Gedächtnis, ich war zu müde. Alle waren so nett und ich fühlte mich so richtig angenommen und akzeptiert – so, wie ich war. Als ich satt war, schlief ich mitten in der warmen, duftenden Palastküche ein. Und mir wurde am nächsten Morgen erzählt, dass ich gewaschen und auf das Zimmer gebracht worden war, ohne dass ich davon aufwachte.
3. Die Prüfung
Ich kann mich nicht erinnern, je so gut geschlafen zu haben, und erwachte durch Gelächter auf dem Gang und einem forschen Klopfen an der Tür. Eine Frau schaute herein und wünschte mir einen guten Morgen, ehe sie sich einen Stuhl heranrückte und sich vor mein Bett setzte. Als ich mich aufsetzte und sie neugierig ansah, begann sie schon zu sprechen: „Liebes Kind, ich bin Cesca. Da du hereingekommen bist, wird sich heute zeigen, ob du bleiben kannst. Denn dazu wirst du einer einfachen Prüfung unterzogen. Doch zunächst geh dich waschen. Du findest eine Waschgrotte, wenn du von dem Zimmer aus rechts den Gang bis an sein Ende durchgehst. Nach dem Waschen komm wieder hierher. Hier in der Truhe sind frische Gewänder für dich. Ich werde dir jemanden schicken, der dir für die erste Zeit im Palast der Blüte zur Seite stehen wird. Danach folgt das Morgenessen. Die Küche hast du ja schon ganz alleine gefunden“, schmunzelte sie. „Aber die große Speisehalle ist direkt dahinter. Wir treffen uns nach der Morgenandacht und besprechen alles Weitere. Hast du das verstanden?“, schloss Cesca. Ich konnte nur nicken, die Deutlichkeit ihres Wesens und ihrer Worte ließen nur das zu. Und schon verließ die Dame eiligen Schrittes das Zimmer. Doch nicht, ohne mir zuvor ein warmes Lächeln zu schenken. Dann schloss sie die Tür wieder hinter sich.
Langsam setzte ich meine Füße auf den Boden und stellte fest, dass ich sauber war und in einem feinen Hemd steckte. Das Material war mir völlig unbekannt und so weich wie aus Federn, die sich leicht an den Körper schmiegten. Ansonsten war das Zimmer nur mit dem Bett, einem Stuhl, einer Anrichte sowie einer Truhe ausgestattet. Mein altes Bündel lag ungeöffnet darauf. Meine alten Kleider waren verschwunden. Aber denen trauerte ich keinesfalls nach. Die Umhänge in der Truhe, in die ich jetzt hineinschaute, waren strahlend weiß und wunderschön.
Als ich die Tür öffnete und auf den Gang spähte, war niemand zu sehen. Ich tapste in die angegebene Richtung und lief ein paar Stufen hinab an das Ende des Ganges. Dort blieb ich vor Erstaunen erst mal auf der Stelle stehen. Es war wirklich eine Grotte, voll mit leicht fließendem, plätscherndem und glasklarem Wasser. Sanfte Stufen führten hinein und an den Seiten waren Aussparungen zum Verweilen und es lagen Badesteine bereit. In Mulden an den Wänden waren fein säuberlich Tücher gestapelt und es duftete herrlich nach Rosen. Das versprach ein Vergnügen zu werden, denn das Wasser war nicht tief und es waren Halteseile zum Festhalten gespannt worden. Ich zog das Hemd aus, legte es sorgsam beiseite und stieg voller Hingabe in das Wasser. War das himmlisch. Zu Hause hatten wir nur den Bach im Wald zum Waschen gehabt. Nur einmal hatte ich gehört, in vornehmen Häusern gäbe es Zuber. Aber ein solches Becken, das war etwas, wovon ich meinen Eltern und meinem Bruder allzu gerne erzählt hätte.
Etwas wehmütig ob dieser Erinnerung, kletterte ich an den Rand und blickte nach oben. Ich staunte erneut. An der Decke sah ich ein Wasserbecken und ein Mädchen darin. Wenn ich die Hand hob, hob auch das Mädchen an der Decke die Hand, nur irgendwie andersherum. Ich nickte und das Mädchen nickte. Und ich erkannte: Das war ich. Zum ersten Mal konnte ich mich selber sehen, meine ganze Figur. Doch ich schaute nicht lange hin. Denn ich begriff nun, warum meine Eltern immer dafür gesorgt hatten, dass meine Haare unter dem Tuch verborgen blieben und ich niemals jemandem in die Augen blicken durfte. Ich wusste jetzt, warum sie mir so intensiv beigebracht hatten, mich unsichtbar zu machen. Das Mädchen, welches ich sah, welches ich war, hatte Haare so weiß wie Winterregen und Augen in der Farbe Azur, oft auch in tiefen Gewässern zu finden. Die Augen groß, die Wangen hoch und die Figur sehr mager. Irgendwie sonderbar. Doch ich hatte nie darüber nachgedacht und würde es jetzt auch nicht tun. Meine Eltern hatten uns in Liebe erzogen und daran die entsprechenden Regeln geknüpft. Diese schlossen solche Bewertungen aus. Ich stieg aus dem Wasser, kuschelte mich in eines der großen Tücher und ging zurück.
Als ich das Zimmer wieder betrat, wartete dort bereits ein junges Mädchen und stellte sich als Ferike vor. Sie war etwas älter als ich, hatte helle Haare, die ihr lose bis auf die Schultern fielen und ein freundliches Gesicht. Sehr lieb und aufmerksam half sie mir, die Kleidung anzuziehen und begleitete mich dann in den großen Speiseraum, in dem lange Bankreihen und Tische standen. Diese waren beladen mit Brot, frischer Butter und vielem, was ich noch nie gesehen hatte. Dort, wo wohl schon jemand gesessen hatte, war der Platz leer. Doch an manchen Plätzen standen Teller und Besteck. Ferike zeigte mir, wo ich mich hinsetzen durfte, und erklärte mir die Dinge auf den Platten als Aufschnitt. Sie demonstrierte mir, wie ich mit dem Besteck umzugehen hatte und nach ein wenig Übung meisterte ich das. Wenn es auch langsamer ging damit zu essen, als mir lieb war. So viel Essen hatte ich noch nie gesehen und ich wähnte mich im Paradies. Anschließend säuberten wir unseren Platz und brachten die Teller in den Abwaschraum. Dort wuschen wir gleich alles ab und stellten es wieder bereit.