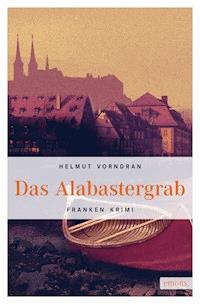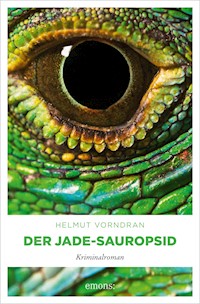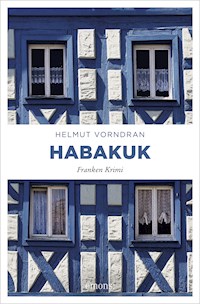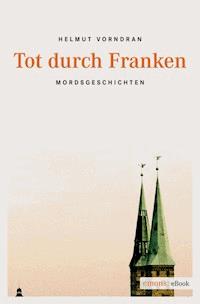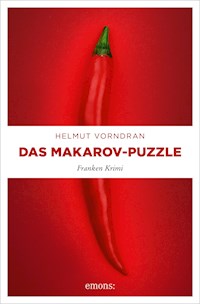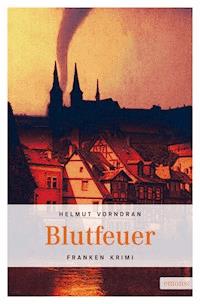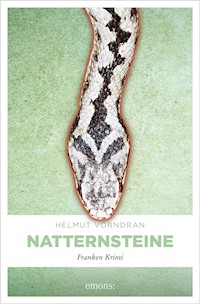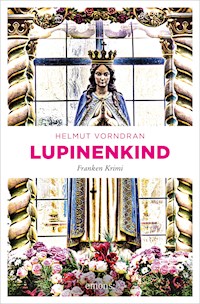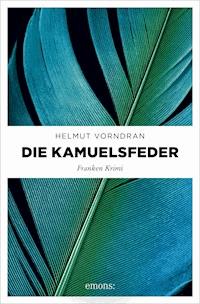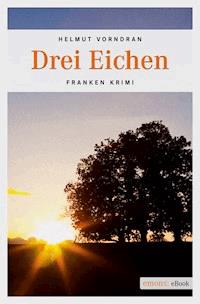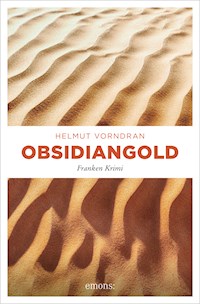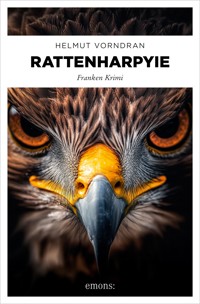Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 45 v. Chr., zwei Jahrtausende vorunserer Zeit. Vom Chiemsee bis an die Rhön sind die Völker in Bewegung. Die germanischen Hermunduren sind kurz davor, die keltische Stadt Melkabos einzunehmen. Auch der junge keltische Schmied Mavo will an den Germanen Vergeltung üben. Ihr Fürst Sokulast hat seine Geliebte Noreya geraubt. Wird er sie je wiedersehen? An Samhain, der Nacht der wandelnden Ahnen, lernt Mavo, dass nichts auf der Welt unmöglich ist, denn plötzlich taucht ein seltsamer Fremder auf, der behauptet, aus einer anderen Zeit zu stammen …Ein Roman über das Leben und den Tod, über die Kultur und den Niedergang der Kelten. Spannend, mystisch, humorvoll.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 880
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt ins oberfränkische Bamberger Land verlegt und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.
www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Im Anhang finden sich ein Personenverzeichnis und ein Glossar. Der Abdruck der Keltischen Weisheiten erfolgt mit freundlicher Genehmigung der dtv Verlagsgesellschaft, München. Jean-Paul Bourre: Keltische Weisheiten. Aus dem Französischen von Elisabeth Liebl. ©2009 Presses du Châtelet, Paris. ©
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: shutterstock.com/AridOcean Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-074-4 Ein Kelten-Roman Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Is maith an scéalaí an aimsir.Die Zeit erzählt die besten Geschichten.
Gälisches Sprichwort
Vorwort
Dieser Roman ist ein Experiment. Er ist es deshalb, weil wir so wenig über unsere keltische Vergangenheit wissen. Jeder von uns hat beispielsweise über das Mittelalter den Kopf voller Klischees. Über die Kelten wissen wir nur sehr wenig. Es gibt keine schriftlichen Zeugnisse, und ihre Bauten sind verschwunden, waren sie doch weitestgehend aus Holz und Lehm. Trotzdem faszinieren sie uns, weil sie das erste wirkliche Volk Mitteleuropas waren, das Volk, von dem wir abstammen.
Dies ist ein Buch über Krieger, Druiden, Sieger und Besiegte, eine Geschichte über Tod und Leid. Es ist aber auch ein Buch über eine Kultur voller Mystik, Naturverbundenheit, Lebensfreude und faszinierender Weisheiten. Es gibt darin keine Drachen, Zauberer oder Feen, denn es soll ein historisch möglichst korrekter, vor allem aber spannender, bisweilen auch humorvoller Roman sein über das Leben der keltischen Stämme vom Alpenrand bis an die nördlichste Grenze des keltischen Ausbreitungsgebietes in Bayern, die Rhön. Ein Roman über ein untergegangenes Volk, auf dessen Boden und Vermächtnis wir immer noch stehen und leben.
Circa 400 vor Christus
Er kam aus den Tiefen des Alls, nach Millionen von Jahren am Ziel seiner langen und endlos scheinenden Reise. Nichts ist ewig im Universum, und so sollte auch seine Zeit nun enden. Der Meteorit befand sich auf Kollisionskurs mit einem Planeten. Groß, wolkenumfangen, blau leuchtend hing er direkt vor ihm im All. Auf diesem größtenteils von Wasser bedeckten Himmelskörper würde seine Existenz erlöschen.
Er war massiv, dicht und schwer. Viele andere seiner Art bestanden aus Eis oder nur aus Gas oder Staub. Sein Körper war aus Metall geformt, das noch vom Anbeginn des Universums stammte. Genauer gesagt aus vielen verschiedenen Metallen und Stoffen, die er im Laufe seines langen Lebens auf seiner Flugbahn durch das All angezogen und aufgesammelt hatte. So hatte er nicht etwa an Masse verloren, sondern zugelegt. Die letzte Kollision mit einem anderen Brocken im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter hatte seine Bahn so verändert, dass er nun direkt auf diesen Planeten zuraste.
Die Schwerkraft streckte bereits ihre langen Finger nach ihm aus und zwang ihn immer mehr nach unten. Schon nach kurzer Zeit rieben sich die Moleküle der Atmosphäre an seiner Oberfläche, er begann sich zu erhitzen. Das Blau der Ozeane wich, er flog auf festes Land zu, auf eine massive Bergkette, an deren Fuß ein großer, von weiten Wäldern umgebener See ruhte. Die Reibung der Atmosphäre wurde schließlich zu hoch, die Kräfte, die auf seinen unförmigen Körper wirkten, zu stark.
Der Meteorit war schon seit einiger Zeit in einen roten, wild lodernden Feuerschweif gehüllt. Er explodierte mit einem lauten Knall am Firmament, zerfiel in Hunderte Einzelteile, die nun ihrerseits als todbringende Feuerbälle dem Boden entgegenrasten. Ein schrecklich schönes Schauspiel, das viele Berge und Flüsse weit zu sehen war.
Bis der Himmel über ihnen einstürzte, hatten die keltischen Familien am Gleivoisca, dem Glänzenden See, der über zweitausend Jahre später den Namen Chiemsee tragen würde, ein friedliches Leben geführt. Sie waren alaunische Kelten vom Stamm der Noriker. Einfache Bauern, Handwerker oder weiter südlich auch Bergleute, die in mühevoller Arbeit Erze und Salz aus den Bergen der Alpen förderten. Ein Volk, das im Frieden mit sich und der Natur lebte. Aber dieser Tag veränderte alles, er schuf die große Klage einer ganzen Kultur. Erst verdunkelte sich der Himmel, dann war ein gewaltiger Blitz am Firmament zu sehen. Sekunden später regnete es riesige, todbringende Feuerkugeln.
Die Einschläge waren gewaltig, apokalyptisch. Das Leben aller Kelten vom See bis zum Alpenrand wurde binnen Sekunden mit Leid und Tod versehen, ins Chaos gestürzt, ausgelöscht. Einige der größten Brocken fielen in den friedlich daliegenden See, der nun mit einer gewaltigen Flut über seine Umgebung herfiel und das Land überschwemmte. Aus den größten Kratern wurden Dreck und Staub nach oben in die Atmosphäre geschleudert, sodass sich die Kraft der Sonne abschwächte und ihre wärmenden Strahlen den Boden nicht mehr fanden.
Mit den Jahren füllte sich der See allmählich wieder mit Wasser aus den Bergen, das die geschmolzenen Reste des Meteors überdeckte und am Grund des Sees verbarg. Der Himmel blieb derweil trüb, die Sonnenstrahlen schwach. Es wurde kalt im Land der Kelten. Die Natur verging, Pflanzen verdarben, Tiere verendeten. Raue Winde, Hunger und Not trieben schließlich alles menschliche Leben in Richtung Süden über das große Gebirge in die Flucht.
Es sollten mehr als hundert Jahre vergehen, bis die Temperaturen wieder anstiegen, die Natur sich erholte und Menschen sich aufs Neue dauerhaft am Glänzenden See niederließen. Aber die Erinnerung an diese Katastrophe hatte sich für immer und ewig in das kollektive Gedächtnis eines Volkes gebrannt. Seither schauten die Kelten bei Blitz und Donner nach oben zu den Göttern und hatten Angst, dass ihnen der Himmel erneut auf den Kopf fallen könnte.
Prolog
Mein Name ist Professor Dr.Alexander Konrad. Ich finde mich bestenfalls etwas stur, andere halten mich jedoch für verrückt. Als Leiter der Grabung war ich für alles, aber auch wirklich alles verantwortlich. Konzeption, wissenschaftliche Betreuung und Beschaffung der Gelder. Nun gut, vielleicht muss man ein Stück weit geistesgestört sein, um sich einen solchen Irrsinn aufzuerlegen. Ohne ein Mindestmaß an Beharrlichkeit und Sendungsbewusstsein, ohne ein Quäntchen Wahnsinn im Blut wäre manch historisch bedeutende Stätte, wie etwa die ägyptischen Königsgräber oder Troja, aber niemals entdeckt worden. So etwas vollbringen nur professionelle Irre, die es geschafft haben, für ihre durchgeknallten Thesen einen potenten Geldgeber zu finden. Menschen oder Institutionen mit erklecklichem finanziellen Background, die sich von Personen wie mir, Archäologen mit derlei Visionen, angezogen fühlen. Wahrscheinlich weil sie selbst im Oberstübchen nicht immer ganz rundlaufen und von daher eine gewisse Sympathie für Menschen entwickeln, die ihren schrägen Lebensplan auch noch offen und selbstbewusst zur Schau tragen.
Ich hatte mir genau diesen Ruf hart erarbeitet. Ich hatte so lange gebohrt, gedrängt, gebettelt, gelogen und mit einigen Leuten die Nächte durchgesoffen, bis ich bekam, was ich wollte, nämlich diese eine Ausgrabung. Die Versprechen, die ich deswegen irgendwann einmal wem auch immer gegeben hatte, waren mir schon gar nicht mehr alle im Gedächtnis. Sie waren mir auch fast egal, ich hatte über die Jahre allein mein Ziel vor Augen. Schließlich erreichte ich es. Das Geld war da. Die Grabungsgenehmigung wurde erteilt, nachdem die obere und untere Naturschutzbehörde und vor allem das allmächtige Denkmalamt mir endlich grünes Licht gegeben hatten. So konnten wir ab Anfang August unsere Grabung abstecken, das große Zelt als Wetterschutz darüber aufbauen und wenige Tage später mit dem Abtrag der ersten Bodenschicht beginnen. Neben dem Wetterschutzzelt gab es noch ein zweites, welches wir als provisorisches Auswertungszentrum für eventuelle Funde nutzten. Auf schlichten Bierbänken und -tischen wurde alles untersucht, was von archäologischem Interesse sein konnte, was der durchgesiebte Boden des Hochplateaus hergegeben hatte.
Es war der Beginn der Sommerferien in Bayern, was zur Folge hatte, dass sich in schöner Regelmäßigkeit Touristen aus allen Landesteilen um das Absperrband der Grabung scharten und uns neugierige Fragen stellten. Darum ließ ich schleunigst ein Schild anfertigen, auf dem die wichtigsten Daten unseres Unterfangens standen inklusive eines fetten Hinweises »Bitte nicht stören!« und gemeinerweise derartig viel lateinischem Vokabular und Fachbegriffen, dass sich nach dem Lesen des komplizierten Textes und der strengen Ansage nur noch die wenigsten Bergbesucher eine Frage zu stellen trauten. Es war nicht meine erste Ausgrabung, ich wusste, wie man Abstand herstellte.
Natürlich löcherten mich Kollegen, Studenten und Gott und die Welt mit der Frage, warum wir genau hier, an dieser Stelle gruben und nicht irgendwo anders. Es gab haufenweise andere Flecken auf dem Staffelberg, die aus wissenschaftlicher Sicht vielversprechender waren. Also warum zum Teufel wollte ich unbedingt genau an dieser Stelle graben? Als Antwort bekam der verzweifelte Fragesteller immer die gleiche Antwort von mir zu hören: »Weil ich es so will.« Das Basta sprach ich als renommierter Keltologe nie aus, aber es schwang jedes Mal deutlich mit.
Drei Monate waren vergangen, ohne dass wir aus dem kalkigen Boden sonderlich interessante oder gar außergewöhnliche Fundstücke zutage gefördert hätten. Dann, eines Nachmittags, rief mich Tim Behrendt, mein eifrigster Student, zu einem Fund, mit dem er nicht wirklich zurechtkam. Der blonde Hüne aus Erlangen zeigte auf einen flachen Brocken am Boden der Grabung, aus dem an einer Seite etwas herausragte. Ein metallenes Etwas, weniger als einen Zentimeter dick. Als ich in die etwa einen Meter tiefe Grube gestiegen war und den verdreckten Klumpen in die Hand nahm, nein, ihn eigentlich aus dem Erdreich herausriss, bemerkte der verblüffte Student, dass sein Grabungsleiter Mühe hatte, die Fassung zu bewahren. Ich musste mich, nachdem ich wieder aus dem Loch hinausgeklettert war, auf einem der Biertische abstützen. Die Glieder drohten den Dienst zu versagen, und meine Stimme zitterte, als ich zu ihm sagte: »Sehr gut, Tim, ganz ausgezeichnet. Wir machen dann Schluss für heute. Es ist schlechtes Wetter angekündigt, und schließlich haben wir ja schon Ende Oktober. Ihr geht jetzt alle schön nach Hause und macht euch eine warme Stube, ja?« Aufmunternd klopfte ich ihm auf die Schulter.
Tim hätte schon gern gewusst, warum ich so merkwürdig auf den Fund reagierte, das sah ich ihm an. Schließlich hatte er da etwas ganz Besonderes gefunden, das schien offensichtlich. Doch es hatte ein freundliches und gleichzeitig sehr bestimmtes Basta in der Antwort seines Grabungsleiters gelegen.
Es fiel mir nicht leicht, so schroff zu sein, aber alles in mir war in Aufruhr. Ich hatte große Mühe, meine Gefühle nicht laut in die Welt hinauszuschreien, doch ich riss mich zusammen. Und Tim gab sich zufrieden. Na gut, vielleicht gibt es ja morgen eine Auflösung des Rätsels, dachte er wohl und ließ es dabei bewenden. Er warf noch einen letzten neugierigen Blick auf seinen Fund in meiner Hand, dann zog er den Reißverschluss seiner Goretex-Jacke bis unter das Kinn.
Das mit dem Wetter stimmte ja auch, von Osten zogen schon die ersten Regenwolken heran. Bald schon würde es dunkel werden; im Tal war in Richtung Fränkische Schweiz bereits der erste Nebel am Boden auszumachen. Der Winter stand in den Startlöchern. Tim nickte mir noch einmal kurz zu, dann wandte er sich um und gesellte sich zu den anderen beiden Studenten, um ihnen die freudige Nachricht mitzuteilen. Ein Abend in einer warmen fränkischen Wirtschaft mit Bier und diversen deftigen Speisen lockte, da brauchte er das ungewohnt frühe Arbeitsende nicht lange zu begründen.
Innerhalb einer halben Stunde war sämtliches Instrumentarium sicher verstaut und die Studentenschaft auf dem Weg nach unten. Fast zeitgleich schloss der Wirt drüben in der Staffelbergklause nach seinem vorerst letzten Arbeitstag für einen Monat seine Tür zu, denn er würde nun wie jedes Jahr einige Wochen Urlaub machen. Wer im November unbedingt hier hinaufwollte, musste seine Kulinarien selbst mitbringen, was aber nur die wenigsten taten. Heute, bei dem angekündigten Sauwetter, sowieso nicht.
Es dauerte gar nicht lange, dann war niemand mehr da, und es wurde sehr still auf dem Hochplateau des Staffelberges, zweihundertneunzig Meter über dem Maintal.
Ich stand reglos am Rande der tiefen Grube, die meine jungen Archäologen gegraben hatten. Äußerlich wirkte ich sicher völlig ruhig, doch in meinem Inneren brodelte seit wenigen Minuten ein Vulkan. Entgegen allen Einwänden, entgegen all den spöttischen Blicken und abfälligen Bemerkungen hatte ich als Grabungsort für meine Studenten genau die richtige Stelle festgelegt. Keiner von ihnen hatte wirklich daran geglaubt, tiefer als zehn bis zwanzig Zentimeter graben zu können. Spätestens dann würde man am Fels des Plateaus kratzen. Aber in den letzten zwölf Wochen waren sie voller Verwunderung statt nach wenigen Zentimetern auf den erwarteten harten Werkkalk des Staffelberges auf weichen, durchmischten Boden gestoßen. Allerlei kleinere Gerätschaften aus Eisen und gebranntem Ton hatten sie zutage gefördert. Nichts, was unerwartet gewesen wäre, nichts, was man nicht schon von anderen Oppida her gekannt hätte. Trotzdem waren sie voller Bewunderung für ihren Professor. Woher hatte er gewusst, dass sich genau hier ein solches Loch im Boden befand?
Inzwischen waren sie in fast einem Meter Tiefe angelangt. Trotzdem war ich immer ungeduldiger, immer unzufriedener geworden. Ich hatte auf etwas gewartet, was meine Studenten aber nicht fanden, mein persönliches Troja, mein Königsgrab, meine Pyramide. Oft war ich nach Grabungsende selbst in die Grube gestiegen und hatte im Boden gekratzt, leider ebenso vergeblich. Doch nun, nach fast genau drei Monaten, hielt ich jetzt endlich jenes Artefakt in meinen Händen, das zu finden ich mehr gehofft als geglaubt hatte.
Die letzten Sonnenstrahlen krochen rot über die Kalkklippen des Staffelberges, und ich hob den lehmigen Brocken nach oben in das Abendlicht, um mit zitternden Fingern den Kern des Objektes weiter freizulegen. Mit dem Daumen schob ich vorsichtig etwas Schmutz beiseite. Es ging leicht, so leicht, als wäre der Fund nicht 44 vor Christus, sondern erst vor wenigen Tagen hier vergraben worden. Die abgerundete metallische Kante unter meinen Fingern war zwar schon etwas angegriffen, aber der Edelstahl schimmerte mit etwas Putzen leicht durch. Die dunkle Glasschicht, die ihn oben und unten passgenau bedeckte, hatte noch weniger Korrosion erfahren, sie glänzte dunkel und schwarz. Nur in der Mitte der Eckbiegung war etwas davon leicht abgeplatzt, und ein Sprung im dunklen Glas war zu erkennen.
Da war es, es gab keinen Zweifel, ich erkannte es genau.
Sutos– Werden
Alles ist im Wandel. Alles ist dem Gesetz des Wandels unterworfen. Die Launen der Menschen ebenso wie die Veränderungen am Himmel. Nichts ist fest oder endgültig. Kein Baum bleibt an seinem Platz, kein Fluss, der nicht eines Tages aufhört zu fließen. Nichts wird geboren, das nicht stirbt, und nichts stirbt, ohne wiedergeboren zu werden. Eines geht im anderen auf und vollendet sich in ihm. Die Welt ist ein Kreislauf, der immer wiederkehrt und alles erneuert. Werden, Leben, Vergehen. Es sind diese magischen drei Dinge, die uns alles, was ist auf dieser Welt, erklären. Dies ist das Gesetz der Götter, der Natur, um alles neu werden zu lassen. Alles wandelt sich. Da jeder Tag ein neuer Tag ist, erneuere auch du dich, Tag für Tag.
Keltische Weisheit
Mavo gobann se– Mavo, der Schmied
Als er aus dem See auftauchte, stand die Sonne nur noch knapp über dem Horizont. Aber das Wasser war warm, und das Licht der Sonne reichte weit genug in die Tiefe, dass er sehen konnte, was er sehen wollte.
Die Götter hatten es gut mit ihm gemeint, vielleicht etwas zu gut, denn der Beutel an dem ledernen Gurt, den er sich umgebunden hatte, wog schwer.
Mavo, »der Gelenkige«, hatte seine Mutter ihn genannt. Mit weiser Voraussicht, könnte man meinen, doch natürlich hatte sie nicht ahnen können, wie treffsicher sie gewählt hatte. Denn der Knabe war zu einem ansehnlichen jungen Mann herangewachsen, der seinem Namen alle Ehre machte. Von kräftigem Wuchs und einnehmender Gestalt, muskulös und wendig, mit braunen, neugierigen Augen und langem, dunklem, leicht gewelltem Haar. Dazu von den Göttern mit außerordentlichen Fähigkeiten gesegnet. Niemand in Brivera war jemals so flink so hoch geklettert wie er. Niemand aus dem Dorf rannte so schnell so weit. Und vor allem schwamm niemand so gut oder tauchte so lange und unerschrocken in die Tiefen des Gleivoisca wie Mavo, Sohn des Baodan und der Doidirith. Letzteres hatte er zweifelsohne von seiner Mutter geerbt, die ebenfalls schwamm wie ein Fisch.
Mavo bemerkte, dass er beim Schwimmen mit voller Kraft ins Wasser treten musste, um seinen Kopf über Wasser zu halten. Der Glänzende See kämpfte mit ihm, wollte sein Eigentum zurück. Vielleicht gönnte ihm die Göttin, die am Grunde des Sees wohnte, seinen Fund nicht. War das Opfer, das er ihr dargebracht hatte, womöglich zu gering gewesen? Zweifel schlichen sich in seine Gedanken, die er aber sofort wieder vertrieb. Zweifel waren der Tod eines jeden Unterfangens. Er war Mavo, der beste Schwimmer rings um den See, von Brivera, seinem Heimatort, bis Bedaio am anderen Ende des Glänzenden Wassers. Er würde diesen Fund bis ans Ufer bringen, da konnte die Göttin Adarca in ihrem nassen Reich mit ihm ringen, wie sie wollte.
Keuchend bewegte er sich mit wilden Schwimmbewegungen auf das Ufer zu, das aber nur langsam näher kam. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, der Atem drang pfeifend in seine Lungen und genauso pfeifend wieder hinaus. Die stille Kraft, die Beharrlichkeit, die ihn schon seit seiner Kindheit auszeichnete, verbot es ihm, den schweren Klumpen an seinem Körper einfach loszuschneiden und in die Tiefen des Sees zu entlassen. Er wollte ihn unbedingt haben. Noch nie hatte er ein so großes Stück gefunden, und womöglich würde es niemals wieder passieren.
Er schwamm weiter, bis schwarze Flecken vor seinen Augen tanzten und seine Arme vor Anstrengung und Müdigkeit langsam verkrampften. Seine Kräfte verließen ihn endgültig. Er sah sich schon in die kalten Tiefen des Glänzenden Sees hinabsinken, als seine linke Hand etwas zu fassen bekam. Verzweifelt krallte er seine unterkühlten Finger um das glitschige Etwas, dann zwang er auch die Finger der rechten Hand, sich daran festzuhalten.
Keuchend versuchte er, Luft in seine schmerzenden Lungen zu bekommen, und klammerte sich mit aller Kraft an seinen Retter in der Not. Als die schwarzen Schatten von seinen Augen wichen, erkannte er, wo er war. Er hatte nicht zu seinem flachen Strand zurückgefunden, sondern war nach Norden abgetrieben. Hier waren die Ufer steil und steinig. Doch genau an dieser Stelle wuchs ein Baum so weit über das Wasser, dass ein starker Ast sich zur Oberfläche hinneigte und ihm nun die Hand reichte. Fast musste er lächeln. Andere, mächtigere Götter wollten ihn wohl nicht Adarca überlassen.
Mavo schätzte die verbleibende Entfernung bis zum Ufer. Es war gar nicht weit, vielleicht zwanzig Fuß. Aber er war sich nicht sicher, ob seine Arme noch zu irgendeiner Bewegung fähig wären, wenn er diesen Ast loslassen würde. Allerdings waren die Alternativen begrenzt. Es hieß schwimmen oder sterben. So überlegte er nicht lange und ließ los. Das Gewicht an seiner Hüfte zog ihn sogleich etliche Fuß unter Wasser, doch er zwang seinen Körper mit äußerster Willensanstrengung zum Dienst und arbeitete sich wieder zur Oberfläche empor. Widerwillig gehorchten ihm die klammen Glieder, und Sekunden später erreichte er das rettende Ufer. Zitternd, aber mit einem euphorischen Gefühl stand er schließlich auf sicherem Boden und schickte, nackt und erschöpft, wie er war, einen wilden Triumphschrei über den See der untergehenden Sonne entgegen. Boudi, Sieg, er hatte gewonnen.
Mit glänzenden Augen öffnete er den Beutel, der an dem Lederriemen um seine Hüfte hing, und hielt den Inhalt nach oben in das fahle Abendlicht. Es war ein schwarzer, unförmiger metallischer Klumpen, fast so groß wie ein Kinderkopf, der gerade erst den mütterlichen Schoß verlassen hatte. Schwarz schimmernd lag er in seiner Hand. Es war dieses seltsame Erz, das man nur hier– am, vor allem aber im Gleivoisca– fand. Allerdings sah dieser Klumpen noch einmal anders aus als das, was er bisher entdeckt hatte. Noch größer. Noch dunkler, noch glänzender.
Die Alten und Weisen im Dorf hatten ihm als Kind immer und immer wieder die Geschichte von dem Tag erzählt, als der Himmel über dem See eingestürzt war und die flammenden Bruchstücke des Firmaments alles Leben ausgelöscht hatten. Bei jedem Gewitter, das sich im Frühjahr oder Sommer zusammenbraute, verschwanden die Angehörigen seines Stammes in ihren Häusern und hofften mit großer Furcht in ihren Herzen darauf, dass die Götter nicht noch einmal so mit ihnen zürnen würden und den Himmel dort beließen, wo er hingehörte.
Die verbrannten, im Feuerregen zu Klumpen geschmolzenen Bruchstücke des Himmels, die in den See gestürzt waren, bestanden aus einem Erz, wie er es sonst nicht kannte. Es zeigte ganz erstaunliche Eigenschaften, wenn er es dem Isarnon hinzufügte, dem Eisen, das die Bergleute am Fuße der Alpen zutage förderten. Das Ergebnis war ein Isarnon von einer Härte und Elastizität, wie er es noch nirgendwo gesehen hatte. Und heute hatte er einen ganz besonders großen Teil des Himmelserzes geborgen. Er würde es mit dem Isarnon zusammenschmieden und weiter damit experimentieren. Mal sehen, welche Sorte Eisen er damit würde schmieden können.
Er ließ den Brocken Erz wieder in seinem Beutel verschwinden und tätschelte noch einmal dankbar den Stamm des Baumes, der ihm seinen Ast ins Wasser gereicht hatte.
»Ar fheabhas go raibh maith agath, anecto vernos«, murmelte er, mir geht es gut, dank dir, meinem Beschützer Erlenbaum. Dann machte er sich auf den Weg zurück zum flachen Ufer des Sees. Morgen würde er Adarca ein großes Opfer darbringen, um sie zu besänftigen, schließlich wollte er noch mehr aus ihrem Reich entführen, da durfte er kein Risiko eingehen. Ohne den Segen der Göttin würde sie ihn irgendwann am Grund des Gleivoisca festhalten.
Mit den Fingern seiner linken Hand tastete er nach seinem Halsring. Das Silber, aus dem er gefertigt worden war, fühlte sich beruhigend kühl an.
Mit diesem Gedanken schritt er erschöpft, aber auch stolz davon.
Ingrun hatte sich allmählich in Ekstase gesungen, ihr Oberkörper bewegte sich nun so heftig, dass ihr langes graues Haar wild durch die Luft peitschte. Sie kniete vor dem lodernden Feuer und sang eine alte, immer wiederkehrende Melodie mit einem ebenso alten Text, den außer ihr keiner der Umstehenden verstehen konnte. Ihre Hände hielten etwas fest umschlossen, als wäre es ihr größter Schatz. Ingrun war die bedeutendste Priesterin und damit die Seherin des Stammes der Hermunduren, die wichtigste Person nach dem König. Von ihrem Urteil über die Weissagungen der Götter machten die Hermunduren ihre Handlungen abhängig, von ihrer Deutung der Zeichen ließen sie sich leiten. Niemand zweifelte an ihren seherischen Fähigkeiten.
Vor fünfzehn Jahren hatte es einmal ein König der Sueben gewagt und war gegen den Rat seiner Seherin in den Krieg gezogen. Die Götter hatten ihm befohlen, mit dem Kampf noch zu warten, sonst sei er dem Untergang geweiht. Aber Gaius Julius Cäsar, Heerführer der römischen Legionen, hatte die Sueben unter Ariovist so lange provoziert, bis dieser schließlich gegen den Willen der Götter handelte. Er und sein Volk wurden von den römischen Legionen vernichtend geschlagen. Es war ein Gemetzel mit Tausenden von Toten. Das suebische Volk, zu dem auch die Hermunduren gehörten, hatte sich hinter das Roinos-Gebirge zurückgezogen, um sich zu erholen und seine Wunden zu lecken. Die Stämme waren stark und fruchtbar. Junge Männer wuchsen heran und wurden zu Kriegern, die Familien erstarkten wieder.
Aber da gab es noch die Kelten. Kelten von den Stämmen der Volker und Helvetier, die mit ihren überlegenen Waffen über das Gebirge kamen, um ihre Kinder, Männer und Frauen zu rauben. Sie brachten Verderben und Tod über die Familien der Hermunduren. Sogar den jungen König hatten sie geraubt und wahrscheinlich als Sklaven verkauft. Aber die Hermunduren waren nicht gewillt, sich noch länger wie Vieh von der Weide treiben zu lassen. Sie waren nun zahlreicher und mutiger als je zuvor und voller Hass auf ihre keltischen Nachbarn südlich des Flusses.
Winimar, der Bruder des Königs, hatte jetzt die Führung der Hermunduren übernommen und den keltischen Angreifern im letzten Jahr mit seiner neu formierten Reiterei empfindliche Verluste zugefügt. Genutzt hatte es freilich nichts. Die Kelten wurden zwar geschwächt, am Ende waren sie aber trotzdem wieder mit ihrer Beute abgezogen. Doch die Zeiten änderten sich nun. Die Stämme des Nordens hatten sich erhoben und strebten nach Süden. Im Westen kämpften die Chatten, im Osten die Markomannen, und auch die Hermunduren würden zu den Waffen greifen, schon morgen, wenn es nach Winimar ginge. Alles, was sie jetzt noch brauchten, war der Segen der Götter. Wenn Wodan nicht seine schützende Hand über die Krieger hielt, waren sie von vorneherein verloren, dann würden sie enden wie der unglückliche Ariovist. Also mussten sie abwarten, was die Seherin sprach.
Ingruns Körper wand sich nun in den wildesten Zuckungen, mit geschlossenen Augen stieß sie nur noch abgehackte, unverständliche Wortfetzen aus. Dann, ganz plötzlich, riss sie ihre Arme nach oben, und ein furchteinflößender, kreischender Schrei drang aus ihrer heiseren Kehle.
Winimar und seine Getreuen hielten gebannt den Atem an. Ein wüstes Sammelsurium einzelner Knochen von Hühnerbein und Eulenflügel, der Inhalt ihrer zuvor so sorgsam geschlossenen Hände, wirbelte durch die Luft und fiel direkt vor der knienden Seherin in den Staub. Sie beugte sich darüber, um sie zu studieren. Ingruns Augenlicht war nicht mehr das Beste, sodass sie die Nase fast bis zum Boden neigte.
Alle anderen im Raum konnten aufgrund der rauchgeschwängerten Luft nicht viel erkennen. Es hätte ihnen auch nicht geholfen, denn nur die Seherin konnte den Wurf der Knochen deuten und sich ein Urteil über Wodans Willen und das Schicksal des Volkes erlauben.
Niemand sprach ein Wort, niemand bewegte sich vom Fleck, ein jeder wartete voller Ehrfurcht auf die Worte von Ingrun, der Seherin, die irgendwann ihren Oberkörper wieder hob und mit glänzenden Augen zu sprechen begann.
»Mein Volk, hört, was ich gesehen habe. Hört die Absichten der heiligen Götter, hört unser Schicksal. Es ist von den Göttern bestimmt, dass es zum Kampfe kommen soll. Das Volk der Hermunduren soll zu den Waffen greifen und sich den Völkern aus dem Süden widersetzen. Nehmen wir unser Schicksal an, wird die Zeit der Angst und des Hungers vorbei sein. Das Land im Süden ist für die Hermunduren bestimmt. Winimar, der Sieg ist uns gewiss.«
Laute Jubelrufe erfüllten von einem Moment auf den anderen das Haus von Winimar. Schwerter und Äxte wurden nach oben gereckt, und auf Winimars Gesicht war ein grimmiges Lächeln zu sehen. Aber Ingrun war noch nicht fertig mit ihrer Weissagung. Da war noch etwas sehr Wichtiges, das beachtet werden musste. Ingrun sprang auf, und wieder stieß sie diesen entsetzlichen, unheimlichen Schrei aus. Sofort erstarb jegliches Rufen. Erschrocken blickten alle in ihre Richtung. Nur noch das Knacken und Knistern des Feuers war zu hören.
»Wodan hat dir eine Frist auferlegt, Winimar«, rief Ingrun beschwörend mit zitternden, hocherhobenen Armen. Ganz eindeutig hatte die Zeremonie sie mitgenommen. Sie war schon alt und in letzter Zeit sehr schwach. Nur mühsam hielt sie sich auf ihren alten Beinen. Allein ihr eiserner Wille ließ sie noch aufrecht stehen. »Du darfst die Kuppen des Roinos erst überqueren, wenn dein Bruder zurückgekehrt ist, Winimar. Warte, bis der König heimgekommen ist. Gehst du vorher über die Berge, so sind wir alle verloren. Gedenke Ariovists Schicksal und achte den Willen der Götter, Winimar!« Ihre Stimme bebte nun, sie schwankte immer mehr. Mit fiebrigen Augen und krächzender Stimme schrie sie Winimar ihren letzten Satz ins Gesicht: »Achte den Willen der Götter!«
Dann verließen sie von einem Moment auf den anderen ihre Kräfte, und sie sackte in sich zusammen. Direkt neben dem Feuer blieb sie liegen, ihre Augen blickten leblos zur Decke des verrauchten Hauses, während sich ihre langen grauen Haare wie ein Kranz um ihren Kopf gelegt hatten. Ingrun hatte zum letzten Mal die Knochen geworfen und eine Botschaft der Götter verkündet. Ingrun, Seherin der Hermunduren, war tot.
Doidirith lächelte verschmitzt in sich hinein, während sie mit einem raschen Blick in den Gluttopf den Zustand ihrer Feuerreserve überprüfte. Das Schlimmste, was einer Keltenfrau passieren konnte, war das Erlöschen des häuslichen Feuers. Es bedeutete große Schande für sie und ihre Sippe, das durfte auf keinen Fall passieren. Jetzt im Sommer, da die Luft auch in der Nacht mild und warm vom See herüberwehte, musste man sich um das Feuer bemühen, weil es nur zum Kochen und nicht zum Wärmen gebraucht wurde. Da verlor frau ihre Feuerstelle schon mal gern aus den Augen, doch sie durfte nicht nachlässig sein. Auch und vor allem nicht an so einem aufregenden Tag wie heute. Es war Lughnasadh, ihr Lieblingsfest. Heute Nacht würden sie das große Fest des Sommers begehen und Lugh für die warmen hellen Tage danken, ehe der Herbst und die Erntezeit begannen. Es war ein Fest der Freude, der Liebe und der jungen Leute. An Lughnasadh wurden schon immer die meisten Winterkinder gezeugt. Auch Mavo, ihr Sohn, war an Lughnasadh vor genau zwanzig Sommern von ihrem Gefährten Baodan in sie gelegt worden.
Kurz durchzuckte ein Schmerz ihren Körper, als sie daran dachte, denn Baodan war nicht mehr bei ihr. Er war im Streit um Ehre und Recht von Umbargh und seiner Familie erschlagen worden, aus Neid und Bosheit mit einem Dolch erstochen. Alle in Brivera wussten das. Nur Zeugen gab es keine.
Einst war Baodan einer der besten Krieger in der Halle des Fürsten gewesen, doch zum großen Erstaunen aller hatte er den Hof ihres Stammesoberhauptes Attonorix verlassen und seine Leidenschaft und sein Leben dem Isarnon gewidmet. Die hohe Kunst am Stahl war beim Volk der Noriker fast genauso hoch angesehen wie der Rang eines Kriegers. Das war außergewöhnlich unter den Stämmen der »Kelten«, wie die Griechen sie nannten. Und außergewöhnlich waren auch Baodans Fertigkeiten, sein Talent, den Stahl zu schmieden. Bald schon genoss er den Ruf, der beste Schmied auf dem Gebiet des Noricumss zu sein. Nur deswegen hatten sie ihn umgebracht. Den Kopf im Wasser, war er leblos die Brigenna hinuntergetrieben.
Von Brivera aus am großen Gebirge entlang bis nordwärts nach Mhorabriga, der großen Stadt der Vindeliker, war Baodan als der Beste seines Handwerks gerühmt worden. Selbst bei den Helvetiern in Menosgada hatte man seine Erzeugnisse gehandelt. Klingen, für die er höchste Preise erzielen konnte. Preise, die am Ende nur noch die römischen Händler bezahlen wollten. Fast alles, was Baodan an Dolchen und Schwertern produzierte, nahm den Weg über das große Gebirge nach Süden zu den Römern. Goldene Zeiten waren das gewesen. Doidiriths Seele wurde schwer, wenn sie an diese glücklichen Tage dachte. Ihre Hand umfasste wehmütig die Fibel, eine Bronzespange, die ihr Gewand zusammenhielt. Auch eines der wunderbaren Dinge, die Baodan fertigen konnte wie niemand sonst.
Sie waren wohlhabend gewesen, hatten viele Rinder und Schweine ihr Eigen genannt. Selbst eine Sklavin hatte Baodan für sie kaufen können. Eine Sklavin! Das konnten sich normalerweise nur Fürsten oder bestenfalls die wohlhabenderen Gutsherren leisten. Sie hatten noch viele Kinder haben wollen, nicht nur Mavo, denn Kinder waren Glück, Sinn und Segen des Lebens, die Zukunft des Volkes und der Stolz der Eltern. Wie gern hätte sie eine ganze Heerschar von ihnen gehabt. Ja, die Götter hatten sie wahrlich gesegnet. Dann, in der Nacht zur zwölften Wiederkehr von Mavos Geburt, hatten Umbargh und seine Brüder Baodan aus Missgunst ermordet. Weil sie nicht vermochten, was er konnte. Weil sie nur Schmiede waren, er aber ein Genie. Nachdem sie als Familie von Schmieden über Generationen in der Gunst des Fürsten gestanden hatten, war der strahlende Baodan gekommen, hatte an ihrer Stelle das köstliche Fleisch in der Halle von Attonorix, Fürst der Alaunen, gegessen, und sie standen in der Ecke oder gar draußen vor dem Tor. Baodan hatte ihnen alles genommen. Ihren Status, ihre Ehre, ihr Geld. So war erst der Neid und schließlich der Hass über sie gekommen, und sie hatten Doidirith den geliebten Gefährten genommen.
Das war nun acht Sommer her. Doidirith hatte gut gewirtschaftet und dabei Mavo erzogen. Was Wuchs und Körperkräfte betraf, kam er nach ihr, hinsichtlich Geist, Gemüt und Talent eindeutig nach seinem Vater. Als er sich im vierzehnten Sommer seines jungen Lebens mit seinen Altersgenossen im Schwertkampf messen musste, wollte bald keiner mehr gegen ihren Mavo antreten. Zu ausgeprägt waren seine körperlichen Fähigkeiten, zu überlegen sein Geschick mit dem Cladios, dem Schwert. Der Erste Ambactus des Fürsten, Elviomar selbst, hatte ihrem Sohn den Halsring für den besten jungen Krieger angelegt und danach persönlich Mavos weitere Ausbildung übernommen. Über die Jahre war er voll des Lobes über Mavos Können gewesen. Bis, tja, bis Mavo nach vier Sommern als junger Krieger dem Beispiel seines Vaters gefolgt war und das Schwert aus der Hand gelegt hatte. Eigentlich absolut undenkbar für einen keltischen Krieger, der Erfolg auf dem Schlachtfeld versprach höchstes Ansehen und einen Platz am Kessel des Fürsten. Aber Mavo war vom Isarnon, dem Eisen, genauso fasziniert und gefangen wie sein Vater. Baodans Blut floss in seinen Adern, und so wandte er sich voller Hingabe der Schmiedekunst zu. Er ging nach Bedaio am anderen Ende des Gleivoisca und lernte von den dort ansässigen, viel gerühmten Schmieden. Er lernte so schnell, dass er bereits nach einem Jahreskreis wieder vor ihr stand und sagte, dass er die alte Schmiede seines Vaters wieder in Betrieb nehmen werde. Das war vor zwei Sommern. Und heute, an Lughnasadh, würde er zum ersten Mal am Isarnion teilnehmen, der Schwertprüfung der Noriker.
Wieder lächelte Doidirith, während sie den eisernen Deckel zurück auf den Glutkrug legte. Mavo war der jüngste Schmied, der jemals an der Schwertprüfung teilgenommen hatte. Aber er würde gut abschneiden, da war sie sich sicher, besessen, wie er war. Nicht einmal Augen für die jungen Frauen am See hatte Mavo. Zu sehr war er auf seine Arbeit mit dem Isarnon konzentriert. Er stand mit dem Eisen auf und ging mit ihm zu Bett. Manchmal schlief er auch gar nicht, sondern wachte die ganze Nacht am Rennofen.
Sie wandte den Kopf hinüber zu der jungen Frau, die sich mit Geduld an ihrem, Doidiriths, Webstuhl abmühte. Noreya war nicht hier, um bei Doidirith besondere Finessen des Webens zu erlernen. Die junge Frau hatte eindeutig ein Auge auf ihren Sohn geworfen, was dieser aber noch gar nicht bemerkt hatte. Für ihn war Noreya immer noch das kleine Mädchen, mit dem er früher loszog, um draußen im See zu schwimmen oder nach Kostbarkeiten zu tauchen. Aber Noreya war zu einer Frau herangewachsen, die heute an Mavos Seite Lughnasadh begehen wollte. Sie hatte bereits ihr schönstes Kleid angelegt, ein Gewand aus Leinen in weinroter Farbe, und ihr dunkelbraunes Haar von ihrer Schwester kunstvoll nach hinten flechten lassen. Nur von Schmuck war, außer ein paar kunstvoll gedrehten Lederbändchen, nichts zu sehen. Woher auch, Noreyas Familie galt zwar als ehrlich und arbeitsam, aber ihr Einkommen war das von eher schlichter Handwerkskunst.
Die Absichten der jungen Dame waren für Doidirith offensichtlich, konnte sie doch ihre Gefühle sehr gut nachvollziehen. Allerdings würde sich Noreya bei Mavo wohl durch einen massiven Wall aus Eisen und Stahl kämpfen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Bevor der für einen norischen Schmied wichtigste Wettkampf nicht geschlagen war, würde Mavo keinen Gedanken an irgendwelche Lustbarkeiten verschwenden, komme, was da wolle. So weit kannte sie ihren Sohn, war es doch mit Baodan seinerzeit nicht anders gewesen.
Draußen war die Sonne schon fast untergegangen, und sicher waren die Ersten bereits unten am Ufer des Sees, um die Boote fertig zu machen. Irgendwann würden die Carnyces ertönen und mit ihrem Dröhnen alle Uferbewohner zum Wasser rufen. Dann hieß es übersetzen zur großen Insel im See, dem Talamorivo, ihrem großen Festplatz.
Die Tür wurde geöffnet, und Mavo kam herein. Er sah etwas mitgenommen aus, aber durchaus zufrieden. Seine weichen schwarzen Locken umrahmten immer noch etwas feucht das braun gebrannte Gesicht, und seine dunklen Augen funkelten. Auch Noreya hatte sich umgedreht und sah Mavo mit einer Mischung aus Besorgnis und Vorfreude an. Der hielt stolz seinen sichtlich schweren Lederbeutel in die Höhe und rief: »Schaut her, ihr Frauen, was euer Mann erbeutet hat! Großes Glück ist mir von den Göttern zuteilgeworden. Ich meine, morgen ein zusätzliches Opfer für Adarca erbringen zu müssen. Nicht dass sie mir zürnt und mich demnächst in einen Fisch verwandelt.«
Doidirith lachte, allerdings mehr über die Großspurigkeit ihres Sohnes als über seine Ankündigung.
»Du hast dich in Adarcas Reich wahrlich bewährt, mein Sohn. Aber glaube mir, um dich Mann nennen zu dürfen, bedarf es noch der einen oder anderen Heldentat auf ganz anderem Gebiet«, meinte sie schmunzelnd.
Auch Noreya hatte ein verschämtes Lächeln aufgelegt, sagte aber nichts. Stattdessen schielte sie mehr oder weniger versteckt auf Mavos Männlichkeit, die dieser immer noch nackt und ungeniert durch die Gegend trug. Eine leichte Röte überzog ihre Wangen, und sie schaute schließlich hilfesuchend zu Doidirith, die sich erbarmte und laut in die Hände klatschte. »Los jetzt, du tapferer Krieger«, rief sie fröhlich, »bekleide dich und hole dein eisernes Bündel, wie es sich für einen Schmied der Alaunen gebührt. Sonst legen die Boote ohne dich ab. Du willst Noreya doch wohl nicht ohne Begleitung auf die große Insel fahren lassen und noch dazu dein Isarnion verpassen, oder?«
Mavo entgegnete nichts, sondern lächelte erst seine Mutter an, dann Noreya.
»Nichts von alledem, Mutter, ich bin sofort bereit.« Er drehte sich um und ging nach hinten, am Kessel des Hauses vorbei, der ruhig über der schwelenden Feuerstelle hing. Am rückwärtigen Ende des Hauses befand sich sein Lager, und dort stand auch eine kleine hölzerne Truhe mit seinem Festtagsgewand darin.
Doidirith ging auf Noreya zu und schaute ihr lächelnd in die Augen. Dann beugte sie sich vor und flüsterte ihr leise ins Ohr: »Lass Lughnasadh wirken und sieh, ob Mavo dir heute gewogen ist, mein Kind. Aber bedränge ihn nicht vor Ende des Isarnions, er wird keine Augen für dich haben, glaube mir. Ich kenne ihn, er ist wie sein Vater, der zu den Göttern gegangen ist. Wenn Mavo sich zwischen dem Eisen und der Liebe entscheiden muss, wird er sich immer neben das Isarnon legen und nicht auf das Lager eines schönen Weibes. Seine Lust speist sich aus eisernen Quellen, das musst du immer bedenken.« Doidirith seufzte, während Noreya sie irritiert anschaute, und trat einen Schritt zurück, um sie genau zu betrachten.
Noreya war wirklich eine schöne junge Frau geworden. Ihre Züge waren ebenmäßig, die Finger feingliedrig, die Brüste wohlgeformt und ihr Becken breit genug, dass sie ohne Angst gebären konnte. Außerdem gab es, soweit Doidirith bekannt war, in Noreyas Familie keine Fälle von Schwachsinn oder missgestalteten Gliedmaßen, ihre Kinder sollten daher ebenso gesund geboren werden. Wenn sich Mavo tatsächlich von Noreya erweichen ließe, wenn es dem Mädchen gelänge, ihn für sich einzunehmen, dann hätte sie beileibe nichts dagegen.
»Komm«, sagte Doidirith und nahm Noreya an die Hand. Sie ging mit ihr zu ihrem Schlafplatz, bückte sich und kramte in einem alten Lederbeutel. Dann hatte sie gefunden, was sie suchte. Sie nahm den linken Arm der jungen Frau und schob ihr zwei farbige Reifen über das Handgelenk.
Noreya entwich ein freudiger Schrei, sodass Mavo besorgt herüberblickte. Aber seine Mutter bedeutete ihm sofort, dass alles in Ordnung war. »Kümmere du dich um deine eisernen Schwerter, mein Sohn. Das hier sind Frauensachen, das geht dich nichts an.«
Sogleich beschäftigte sich Mavo wieder mit dem Bund seiner karierten Hose und focht einen ungewohnten Kampf mit den feinen Kleidern.
Noreya betrachtete fasziniert die beiden Glasringe an ihrem Handgelenk, als könnte sie nicht glauben, was sie da sah. Ein glatter, ebenmäßiger gelber und ein breiterer Ring in einem tiefen Blau, der noch dazu reich und fein gearbeitet war, glitzerten im Feuerschein. Dazu steckte Doidirith ihr nun eine silberne Fibel an die Brust, mit Verzierungen, wie Noreya sie noch nie zuvor gesehen hatte. Das war äußerst wertvoller Schmuck, das Geschmeide von hochgestellten Menschen, die am Kessel von Gutsherren oder gar Fürsten saßen. Wie kam Doidirith dazu, ihr diese teuren Stücke zu überlassen?
»Danke, Doidirith, aber ich verstehe nicht…«, stotterte Noreya, während sie mit Tränen des Glücks kämpfte.
Doidirith lächelte einen Moment lang still vor sich hin, bevor sie sie etwas bremste. »Das ist kein Geschenk, mein Kind. Die Sachen möchte ich morgen wiederhaben, verstanden? Aber ich mag dich. Und da du es heute mit dem Gott des Eisens zu tun bekommst, sollst du nicht unbewaffnet zur Schlacht mit ihm gehen. Diese Reifen können dir vielleicht helfen, gegen das Eisen zu bestehen«, meinte sie bedeutungsvoll.
Ach, wie gern hätte Doidirith auch wieder Gefühle für einen Mann entwickelt, der mit ihr das Leben und das Lager teilte. Ab und an versuchte es einer, teilweise kamen die Männer sogar von weit her, um die schöne Alaunin zu überzeugen. Allein, keiner konnte sich in ihr Herz betten, denn dort lag noch immer Baodan und wollte nicht weichen. So hatte sie nun den Ruf einer »Isarna«, einer »eisernen Frau«. Und da war es wieder, das Eisen, das über ihre Familie herrschte.
Sie kam nicht mehr dazu, ihre Gedanken zu vertiefen, denn vom See schallte ein durchdringendes Röhren zu ihnen herauf, als wollte eine keltische Heerschar in den Krieg ziehen.
»Los jetzt, die Carnyces rufen!« Doidirith klatschte in die Hände. »Wir müssen los, packt eure Sachen.«
Mavo, der sich sein Lederbündel über die Schulter geschwungen hatte, kam bereits angelaufen und griff nach Noreyas Hand, während das Mädchen immer noch wie gebannt auf den neuen Armschmuck schaute. Er riss sie förmlich aus ihrer ehrfurchtsvollen Starre und eilte mit ihr zum See hinunter, seine Mutter mühelos hintendrein. Die Kampftrompeten dröhnten immer weiter, sie schickten ihren lauten Ruf vom Seeufer zu den Menschen hinauf, und allerorten konnte man Noriker unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Ranges in die gleiche Richtung laufen sehen.
Entlang des Ufers lagen nun alle verfügbaren Boote bereit, und die Bootsführer warteten mit brennenden Fackeln auf ihre Fahrgäste, die nun so schnell es ging zum Festplatz hinüberwollten. Man konnte schon aus der Ferne das große Feuer sehen, das die Druiden auf der Insel entzündet hatten. Das große Fest des Sommers wartete auf sie.
Lachend rannten Mavo und Noreya an den Gruppen von Menschen vorbei, die Brivera entströmten. Sie waren schneller als alle, schneller sogar als Doidirith, die einmal flinker hatte laufen können als ihr Gefährte Baodan. Aber sie ließ es ohne Bedauern geschehen. Es war Lughnasadh, die Nacht des Sommers, der Ernte und der Freuden. Da musste schon jeder selbst schauen, wo er blieb.
Mavo zog Noreya weit nach rechts zu einem eher kleinen Boot, an dem ein mürrisch dreinblickender Fischer mit seiner rußenden Fackel stand.
»He, warum willst du unbedingt zu Iurnan, dem Griesgram?«, rief sie entrüstet. Iurnan und sein ebenso übellauniger Sohn Adnu waren zwar von außerordentlich kräftigem Wuchs, aber sie stanken, und der tumbe Adnu würde sie mit seinen lüsternen Blicken bestimmt verschlingen wie ein Bär den gefangenen Lachs. Aber Mavo lachte nur.
»Weil die beiden das schnellste Boot haben und weil außer uns bestimmt keiner mit ihnen fahren will«, entgegnete er fröhlich und watete bereits ins Wasser. Als er sich umwandte, stand Noreya in ihrem weinroten Kleid noch immer am Ufer und belegte ihn mit einem strafenden Blick. Ach so, ja, daran hatte er natürlich nicht gedacht. Misstrauisch beäugt von den beiden Fischern warf er sein Bündel ins Boot, dann watete er zurück zu Noreya, packte sie an der Hüfte und hob sie wie einen Sack Getreide auf seine Schulter. So trug er sie trockenen Fußes zum Boot.
»Sag, Mavo, hat man euch Schmieden nicht beigebracht, dass ihr eure Frauen ehren und gut behandeln sollt? Ich bin doch kein Stück Isarnon, das du zum Feuer schleppst, du grober Kerl!«
Aber Mavo hörte gar nicht hin. Frauen schnatterten gern und viel. Wie Gänse, wenn der Hirte sie zum Wasser trieb. Wenn man dem Gerede zu viel Aufmerksamkeit schenkte, verlor man schnell mal das Ziel aus den Augen. Das hatte ihm der Druide erzählt, als er ihn zu seiner Mannwerdung im vierzehnten Sommer seines Lebens danach gefragt hatte. »Dein Gewand ist doch trocken, oder?«, argumentierte er, als er Noreya über die Bordwand des Fischerkahns gehoben hatte.
Er erhielt keine Antwort. Noreya war bereits damit beschäftigt, einen Platz in dem Boot zu finden, der nicht nach Fisch stank oder von deren Resten irgendwie verdreckt war. Schließlich gab sie es auf und entschied, stehen zu bleiben und sich am Mast festzuhalten. Als Mavo über die Reling kletterte, sah sie, dass doch noch jemand dieses Boot zur Überfahrt nutzen wollte. Es waren Eobrinthan und Galla. Die zwei waren ähnlich jung wie Noreya und Mavo. Allerdings hatten sie schon beschlossen, einen Bund einzugehen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Druiden um den Segen der Götter bitten würden. Sie setzten sich irgendwohin, egal, wie es dort roch oder aussah. Das war den beiden völlig gleich, sie waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
»Ich glaube, du kannst ablegen, Iurnan«, rief Mavo spöttisch, als der Fischer noch immer keine Anstalten machte, überzusetzen. »Heute wird keiner mehr mit deinem Boot fahren wollen. Der Fürst spendiert gebratenes Schwein und süßen Wein, da will niemand etwas mit deinem öligen Fisch zu tun haben.«
Winimar saß mit Dankmar, seinem getreuen Heerführer, nunmehr allein am Feuer, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ingrun hatte für ihre letzte Weissagung ihr Leben gelassen und war zu den Göttern gegangen. Winimar verstand ihre Botschaft wohl und hatte auch nicht die Absicht, gegen den Willen der Götter zu handeln. Er war nicht Ariovist, der Wille der Götter war für ihn Gesetz. Doch er wollte tun, was ihm im Rahmen dieses Gesetzes zu tun möglich war.
Die Aussage von Ingrun war klar und eindeutig gewesen. Es war Zeit für die Hermunduren, zu kämpfen. Aber sie konnten das Roinos-Gebirge nicht überqueren, solange Winimars Bruder nicht zurückgekehrt war. Die Helvetier hatten ihn geraubt und wie viele andere ihres Volkes in den Süden verkauft. Wo genau er sich aufhielt und wie sie zu ihm gelangen konnten, das stand in den Sternen. Aber sie mussten versuchen, ihn zu finden, das Schicksal des ganzen Volkes stand auf dem Spiel.
»Ich übertrage dir diese Aufgabe, Dankmar«, sagte Winimar entschlossen.
Dankmar nickte bereitwillig, auch wenn er wusste, dass er sich damit auf ein äußerst schwieriges Unterfangen einlassen würde.
»Nimm dir so viele Männer, wie du brauchst, die besten, die du finden kannst«, ermunterte ihn Winimar.
Wieder nickte Dankmar, bevor er erwiderte: »Ich werde Swidger wählen, noch ein paar andere, aber nicht mehr als zehn. Wir können die Markomannen um Hilfe bitten, damit wir nicht durch die Gebiete der Helvetier ziehen müssen. Sie befinden sich im Kampf mit den Boiern im Osten. Vielleicht gelingt es uns mit ihrer Hilfe, unerkannt den großen Fluss Danuvios zu erreichen und von dort aus die Keltenstadt Mhorabriga. Nur dort werden wir erfahren können, wo wir deinen Bruder finden.«
Winimar stimmte zu. Das, was Dankmar sich da ausgedacht hatte, war ein guter Plan. Alle Sklaven, die man nicht direkt von Menosgada nach Westen zu den Römern brachte, wurden über Mhorabriga Richtung Süden gehandelt, das war bekannt. Die beiden erhoben sich, und Winimar legte Dankmar seine beiden Hände auf dessen Schultern. »Du hast die wichtigste Aufgabe zu erfüllen, die ich dir auferlegen kann, Dankmar. So gehe denn nach Mhorabriga und walte ganz nach deinem Gutdünken. Wenn du den Feind bestechen musst, bestich. Wenn du lügen musst, lüge. Wenn du töten musst, töte. Egal, was zu tun dir auferlegt wird, tu es, wenn es nur dazu dient, meinen Bruder zu finden. Aber bedenke auch: Wenn du stirbst, Dankmar, dann sind wir verloren, dann wird auch unser Volk mit dir sterben.«
Dankmar sagte nichts darauf. Er nickte knapp, verneigte sich vor Winimar, drehte sich um und ging nach draußen, um seine Männer zu wählen.
Winimar folgte ihm nicht, sondern setzte sich wieder ans Feuer, um nachzudenken. Dieser Sommer war zukunftsweisend für sein Volk. Das Gelingen der Mission würde darüber entscheiden, ob sie kämpfen und ihre Freiheit und neues Land erlangen konnten. Alles hing nun davon ab, ob Dankmar den verschleppten König finden konnte oder nicht. Dann würden die Hermunduren kämpfen oder für immer untergehen.
Iurnan verzog trotz Mavos Aufforderung keine Miene, während sein Sohn Adnu in Richtung der anderen Boote schaute. Tatsächlich legten zwei größere Curocos bereits vom Ufer ab, und es war niemand mehr zu sehen, der sich in ihre Richtung bewegte. Wer fuhr schon gern mit dem stinkigen Fischer Iurnan, wenn es nicht unbedingt sein musste? Diese Abneigung der meisten Einwohner von Brivera beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit, auch Iurnan fuhr lieber allein. Er betrachtete seine Fracht mit einem Ausdruck allergrößter Abscheu. Zwei turtelnde Pärchen. Das war ja noch weitaus ekelhafter als der vergammeltste Aal, den er jemals aus dem See gezogen hatte. Aber sein Sohn gab ein ungeduldiges Grunzen von sich, und so stiegen beide zu den anderen ins Boot, nahmen ohne zu zögern die Ruder in die Hände und begannen, das Wasser zu bearbeiten.
Bald darauf wusste Noreya, warum Mavo dieses Boot gewählt hatte. Nicht im Traum hätte sie gedacht, dass der kleine Fischerkahn durch menschliche Kraft eine solche Geschwindigkeit entwickeln könnte. Schon nach kurzer Zeit zogen sie an den beiden großen Curocos vorbei, die vor ihnen abgelegt hatten. Es war eine warme Sommernacht und völlig windstill, sodass Segel nichts genutzt hätten. Es kam auf die bare Muskelkraft an, und davon hatten Iurnan und Adnu reichlich zu bieten. Ihre verschwitzten Körper glänzten im Licht der Fackeln, das von dem großen Boot zu ihnen herabschien, während sie es überholten. Der Kahn glitt zügig durch das Wasser des Gleivoisca, und bald war nur noch das leise Keuchen der beiden Fischer zu hören.
Vor ihnen wuchs Gleivomaros, die große Insel des Sees, aus dem Wasser, und sie konnten sehen, dass das riesige Feuer in der Inselmitte von vielen kleinen brennenden Brüdern und Schwestern umgeben war, die ihre Funken hoch in den Himmel warfen. Leise knirschend lief das Boot schließlich auf Grund, und Mavo und Eobrinthan sprangen nach draußen, um die Frauen ans Ufer zu tragen.
Das Boot war von der entlassenen Fracht erleichtert, Iurnan und Adnu ebenfalls. Die Gefühlsduselei von Lughnasadh verursachte bei beiden immer ein grässliches Unwohlsein, das sich ungefähr so anfühlte wie der Bauch, wenn sie unbekanntes rohes Fleisch gegessen hatten. Aber auch Lughnasadh war irgendwann vorbei, und dann konnten sie wieder in Ruhe ihre Fische aus dem Wasser ziehen und mussten nichts reden oder sich anhören.
Etwas höher am Ufer empfing ein Druide, den Mavo gut kannte, die Neuankömmlinge.
»Gesegnet seist du, Helico, Weisester aller Gelehrten«, rief Mavo fröhlich und senkte sein Haupt. Auch Noreya verneigte sich schüchtern vor dem ganz in Weiß gekleideten alten Mann, sagte aber lieber erst mal nichts.
»Ah, Mavo, Sohn der Doidirith. Du bist gewachsen, wie ich sehe. Sowohl an Körper als auch an Mundfertigkeit. Ich hoffe, dein Geist und deine Ehrfurcht vor den Göttern konnten mit dem schnellen Austrieb deiner Äste und Blätter mithalten«, entgegnete der Druide mit unbewegter Miene.
Fürs Erste war Mavo ein wenig verunsichert, konnte er doch nicht einschätzen, ob ihm Helico nun wohlgesinnt war oder nicht. An Lughnasadh einen missmutigen Druiden am Bein zu haben, wäre eher ungünstig für den weiteren Verlauf des Abends. Vielleicht war es erst einmal besser, die Formen des Umganges zu wahren. »Ja, äh, ich, also wir, haben reichhaltige Opfergaben für die Götter dabei, gesegneter Helico«, stotterte er, während Noreya einfach nur den Boden anstarrte. Niemals würde sie einen Druiden so ungeniert ansprechen, wie Mavo es tat, und schon gar nicht in diesem ungebührlichen Ton.
Auch Mavo merkte nun, dass er sich mit seiner vorlauten Art womöglich etwas vergaloppiert hatte, und scharrte verlegen mit dem Fuß im Sand.
»Nun, welch reichhaltige Gaben für den großen Lugh haben wir denn mitgebracht, junger Schmied?«, fragte der Druide. Er stand locker auf seinen Stab gestützt vor ihnen, das Haupt mit den schütteren grauen Haaren leicht zur Seite geneigt, und blieb dabei im Tonfall wie in seiner Haltung völlig unverbindlich.
Mavo schaute seinen alten Lehrer an wie ein kleiner Alaune, der in seinem ersten Winter feine weiße Schneeflocken vom Himmel fallen sieht.
»Die Opfergaben, nun ja«, begann er. Dann besann er sich und beschloss, statt langer Reden lieber sein Bündel aufzuknüpfen und als Beweis alles vorzulegen. Während er den Bulga aufschnürte, schaute er– was dem Druiden natürlich nicht verborgen blieb– immer wieder aufs Wasser, wo die nächsten Boote bereits näher kamen. Hoffentlich befragte ihn Helico nicht zu lange, er wollte doch mit Noreya als Erstes an den Feuern sein und den schönsten Platz ergattern. Dann war der Bulga endlich offen. »Hier, oh Helico«, Mavo zeigte auf den Inhalt, »Getreide, frisch vom Feld, ein Stück Erz und eine Schwertspitze Salz.« Fragend schaute er den Druiden an, der alles leise brummend betrachtete. Gleich waren die nächsten Schiffe am Ufer, aber Helico ließ keine Eile erkennen.
»Salz, aha, immerhin. Und was ist das da, auch ein Opfer?«, fragte der Druide neugierig und klopfte mit seinem Stab gegen einen langen, in Stoff eingewickelten Gegenstand.
»Nein, oh Helico, das ist mein Cladios für das Isarnion. Ich möchte meine Schmiedekunst heute von den Göttern prüfen lassen.«
Der Druide schaute erstaunt auf. Das Cladios für den Wettkampf? Ein Leuchten trat in seine Augen. »Zeig es mir«, sagte er, woraufhin Mavo das Bündel hob, das Tuch entfernte und sein Werk an den Druiden übergab.
Helico nahm das Schwert an sich und schwang es mit erstaunlicher Behändigkeit durch die Luft. Es war ein schlichtes Schwert. Schlicht in Form und Gepränge. Da waren keine Verzierungen oder unnötige Gravuren angebracht. Dafür schimmerte es makellos im Mondlicht, völlig ebenmäßig gearbeitet, in einem eigentümlichen hellen Grau. Ein Ton, wie der Druide ihn an einem Schwert bisher noch nie gesehen hatte. Er führte das Schwert noch zwei-, dreimal gegen einen imaginären Feind, dann gab er es an Mavo zurück und sagte: »Es scheint mir etwas dünn und ist ungewohnt leicht, aber es liegt gut in der Hand. Ich hoffe doch, es hat mehr innere Werte, als die äußere Erscheinung vermuten lässt, junger Schmied.«
Seine funkelnden Augen straften seine Worte Lügen, als er Mavo nun mit einem warmen Lächeln eine Hand auf die Schulter legte und zwischen ihm und Noreya hin- und herschaute. »Mögen die Götter mit dir sein, Mavo, Sohn der Doidirith. Und auch mit dir, Noreya, Tochter der Betnina. Du darfst deinen hübschen Kopf ruhig heben, mein Kind, so viel kann dich der Boden vor deinen Füßen nun auch wieder nicht lehren.«
Noreya hob verschämt den Blick, während Helico, der Druide, noch schnell einen Schritt nach vorne trat und seinen Mund an Mavos Ohr schob. »Sei auf der Hut, Mavo«, raunte er. »An diesem Isarnion wird auch Umbargh teilnehmen, der Erste Schmied des Fürsten. Du weißt, was das bedeutet.« Mavo nickte stumm. »Sei auf der Hut«, wiederholte Helico noch einmal leise, während sich hinter ihnen mit einem Knirschen im Sand das nächste Boot ankündigte.
Der Druide nahm seine ursprüngliche, auf den Stab gestützte Position wieder ein. »Geht nun«, rief er den beiden zu. »Ehrt und feiert Lughnasadh, ich werde auch die anderen Neuankömmlinge nach ihren Opfergaben befragen, sodass ihr euch einen schönen Platz sichern könnt.« Er zwinkerte kaum merklich und wandte sich mit erhobenen Händen Eobrinthan und Galla zu, die erwartungsvoll näher kamen.
Mavo grinste. »Los, komm! Helico verschafft uns etwas Zeit«, raunte er Noreya zu und packte ihre Hand. Zusammen rannten sie in Richtung Inselmitte davon– mit einem absoluten Hochgefühl, denn sie durften in dieser warmen Nacht die Ersten sein, die Lugh ehrten.
Die Insel war innerhalb kürzester Zeit fast vollkommen von Menschen bedeckt, die zwischen den Feuern saßen und sich dem Bier hingaben. Später, wenn das Isarnion vorüber war, würde der Fürst sogar Wein ausgeben. Natürlich nicht an alle, sondern nur an für ihn besonders wichtige Günstlinge oder aber die Erbringer bedeutender Leistungen. Die besten Schmiede des heutigen Abends waren ganz bestimmt dazu fähig, die Aufmerksamkeit des Fürsten zu erregen, und der Gewinner des Isarnions, der Gobann mit dem zähesten Schwert, durfte sogar mit dem Fürsten in dessen Kreis sitzen, mitten unter den besten Kriegern der Alaunen.
Mavo schauderte es vor Aufregung, wenn er nur daran dachte. Einst, vor vielen Jahren, hatte sein Vater zwischen den Kriegern des Fürsten gesessen, so hatte seine Mutter es ihm erzählt. Er selbst hatte nur noch eine sehr dunkle Erinnerung daran. Und er war auch nicht sein Vater, er war Mavo, der Schmied, bei seinem ersten Isarnion. Natürlich war es sein großer Traum, einmal die Trophäe zu gewinnen. Aber hier waren die besten Schmiede der Noriker versammelt, eigentlich durfte er froh sein, wenn er die erste Runde überstand. Es war frevelhaft, die Gunst der Götter mit solchen Wünschen zu strapazieren. Er versuchte, sich abzulenken, und bemerkte erst jetzt, dass Noreyas linke Hand auf seinem Arm ruhte. Er betrachtete sie von der Seite, ohne dass sie etwas bemerkte. Noreya war mit ihren Gedanken entrückt und schaute lächelnd ins Feuer.
Ein warmes Gefühl durchströmte Mavo, als er sie so sah. Ja, seine Spielkameradin von früher war zu einer richtigen Frau geworden. Sie hatte sich dezent zurechtgemacht, nicht so übertrieben, wie viele Keltenfrauen es taten, vor allem die wohlhabenden, reichen. Er fühlte sich irgendwie zu Noreya hingezogen, auf eine Art, die ihm ihr gegenüber bisher fremd gewesen war. Das muss am Bier liegen, dachte er erschrocken, es macht solche übermütigen Gedanken. Was würde Noreya nur sagen, wenn sie in ihn hineinsehen könnte? Auslachen würde sie ihn.
Er sah wieder nach unten auf ihre Hand, die ruhig und sanft auf seinem Arm lag. Schöne Armringe hatte sie da, stellte er fest und begann sogleich zu überlegen, wie man diese Kunstwerke noch verbessern könnte.
Schon kreisten seine Gedanken um Rennöfen, Glasschmelze und die Herstellung von Glasschmuck. Ein Bereich, dem er sich bisher noch nicht eingehend genug gewidmet hatte, war sein Augenmerk doch nahezu ausschließlich auf den Stahl gerichtet gewesen.
Ein leichter Stoß traf seine rechte Seite, und Noreya schaute ihn lächelnd an. »Es geht los, Mavo«, flüsterte sie aufgeregt und griff nach seiner Hand.
Helico, der Druide, war an das große Feuer getreten und hob nun beide Arme in die Höhe. Schräg hinter ihm, auf der anderen Seite des Feuers, konnte Mavo Attonorix, Fürst der Alaunen, inmitten seiner Krieger sitzen sehen. Er war in eine weite braun karierte Hose gekleidet, über der er ein fein gewebtes dunkelrotes Hemd trug, in das mit Goldfäden Muster gewebt waren, und folgte wohlgelaunt dem weiteren Geschehen. An der Seite trug er, wie immer zu festlichen Anlässen, sein reich verziertes Schwert, das er in jungen Jahren einem besiegten Fürsten der Vindeliker abgenommen hatte, so besagten die Gerüchte im Volk.
Attonorix war immer noch ein stattlicher Mann, aber seine Haare wurden langsam dünner und ergrauten an den Schläfen, vollendete er doch demnächst seinen fünfundvierzigsten Sommer. Nichtsdestotrotz war er hochgeachtet und besaß eine unumstößliche Autorität, niemand zweifelte sein Urteil an. Es gab nur eine Person, die ihm widersprechen und Vorschriften machen durfte. Allein Helico, der Erste Druide, hatte als Hüter von Wissen und göttlichem Willen das Recht dazu. Das spirituelle Oberhaupt des Volkes der Alaunen und zugleich dessen höchster Richter und Hüter der Gesetze war niemandes Untertan. Auch Attonorix hatte sich in vielerlei Hinsicht dem Druiden unterzuordnen.
Es war still geworden, denn Helico begann nun mit der Zeremonie.
Doidirith hatte sich etwas weiter hinten neben einem der kleineren Feuer ins Gras gesetzt, denn sie wollte Mavo und Noreya nicht behelligen. Außerdem zog es sie gar nicht nach vorne, von hier konnte sie ebenso gut sehen. Sie wollte einfach nur die warme Luft und die festliche Stimmung genießen. In ihrem Leben war alles gut, und dies war die Zeit, es zu feiern.
Sie schloss die Augen und lauschte den Trommeln, die mit rhythmischen Klängen das ausgelassene Singen und Tanzen der Menschen begleiteten. Jetzt stimmte auch noch ein Flötenspieler mit ein. In vielen Kesseln wurde Fleisch gekocht. Der Fürst war immer sehr großzügig an den großen Festtagen, er sorgte für das leibliche Wohl, und das reichlich. Ein leerer Bauch feierte nun mal nicht gern. Und so lag eine allumfassende Fröhlichkeit in der Luft. Sie spürte, wie Lughnasadh auch nach ihr griff, sie in Schwingung versetzte und ihr Herz berührte.