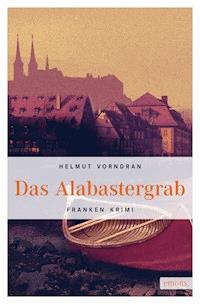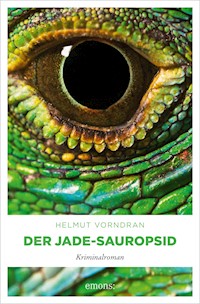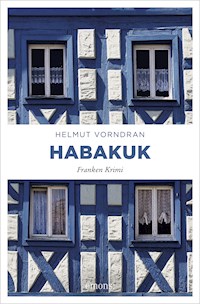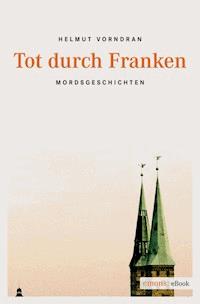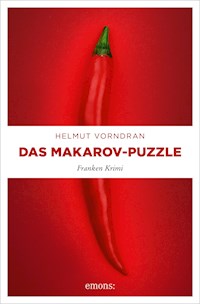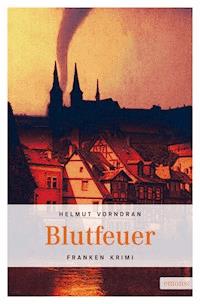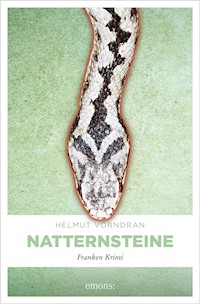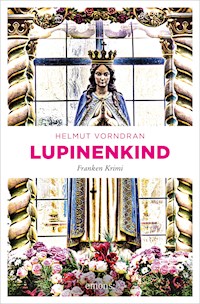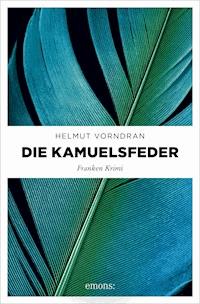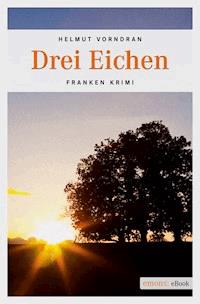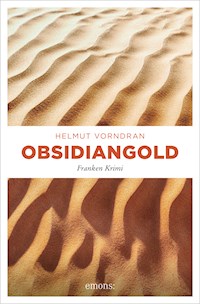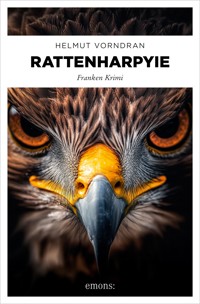Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Haderlein
- Sprache: Deutsch
Skurrile Figuren, rabenschwarzer Humor und absurde Situationskomik – Frankens Bestsellerautor legt nach. Im oberfränkischen Rattelsdorf ist der Teufel los: Erst wird das Wasser knapp, dann tauchen verätzte Leichen auf, schließlich fallen auch noch Menschen vom Himmel – und an allen Tatorten riecht es seltsamerweise nach Parfüm. Die Bamberger Kommissare Haderlein und Lagerfeld und ihre beiden Ermittlerschweine haben alle Hände und Hufe voll zu tun, die Fäden zu entwirren. Als die Spuren bis nach Kalifornien führen, ist das Chaos vollends perfekt. Und der Serientäter mordet weiter und weiter und weiter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt im oberfränkischen Bamberger Land und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen. www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman. Die geschilderten Ereignisse beruhen teilweise auf wahren Begebenheiten, Handlungen und Personen sind jedoch frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: istockphoto.com/Boonchuay1970
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-111-9
Franken Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
In jedem Moment meines Lebens begleiten mich Geister …Ich vergesse lieber meine Brille oder den Schlüssel,als das Haus ohne Parfüm zu verlassen …
Catherine Deneuve
Prolog
Das Erstaunliche und Überraschendste an Phi ist, dass alle organischen Strukturen von Menschen, Tieren, Pflanzen auf dieser Zahl basieren! Phi ist die universale Zahl für alles Leben, die Zahl des »Goldenen Schnittes«, bei dem das Verhältnis von Phi besteht.
Phi findet man überall im Universum. In den Spiralen von Galaxien, Schnecken, Muscheln, in den Harmonien der Musik, den Schönheiten der Kunst, in Mustern von Blumen und Pflanzen, in der Geometrie der Pyramiden in Ägypten und Mexiko sowie überall im menschlichen Körper. Alles, was je erschaffen wurde, stellt sich in Proportionen beziehungsweise Teilungsverhältnissen dieser Zahl dar! Deshalb spricht man bei der irrationalen Zahl Phi auch von der »göttlichen Teilung«. Als Abbild der göttlichen Schöpfung ist sie ein zentraler Begriff der heiligen Geometrie.
Phi Φ=1,6180339…
Teil 1
Kinder des Todes
GUERLAIN / MITSOUKO
Mitsouko ist eine legendäre Liebesgeschichte zwischen würzigem Pfirsich und Patschuli. Der geheimnisvolle Duft von GUERLAIN, der vor fast hundert Jahren eingeführt wurde, behält seinen mythischen Charakter und bleibt zeitgemäß. Mitsouko war ein Meilenstein der Parfümeurskunst und der erste Duft, der Pfirsich mit holzigen Aromen kombinierte. Dieses avantgardistische Parfüm hat einen besonderen Platz in der Linie der GUERLAIN-Düfte, da es gleichzeitig androgyn und weiblich ist. Es beginnt mit einer Kopfnote aus Zitrusfrüchten, die harmonisch mit floralen Akkorden von Flieder und Ylang-Ylang spielt. Die Basisnote von Eichenmoos und Sandelholz verleiht Mitsouko einen einzigartigen und geheimnisvollen Ausklang.
Philip Patschuli
Das Collier
Am Morgen war der Duft mehr eine Ahnung als ein wirklicher Bestandteil der üblichen Gerüche im Treppenhaus gewesen, aber am Abend des Tages, an dem Dagobert Kaiser die Stufen vom Fahrstuhl zum Obergeschoss hinaufging, hatte sich die seltsame olfaktorische Anmutung massiv verstärkt. Sie war zuvor nicht direkt unangenehm gewesen, ganz im Gegenteil. Es hatte im Hausflur intensiv nach einem teuren Parfüm gerochen, welches jemand allzu verschwenderisch auf seinen Körper verteilt haben musste. Im Laufe des Tages hatte der Geruch jedoch eine deutliche Wandlung erfahren und eine eher fremdartige Note entwickelt, die kaum mehr Teures und nur noch wenig Angenehmes aufzuweisen hatte. Als Dagobert Kaiser, der vor vielen Jahren die Dachwohnung in diesem Haus gekauft hatte, an diesem Abend von der Arbeit nach Hause kam und das Treppenhaus hinaufschritt, war seine Toleranzgrenze erreicht. Zwar arbeitete er in einer Bank und war von daher einen höflichen und geduldigen Umgang mit Menschen gewohnt, aber was zu viel war, war zu viel. Was auch immer hinter der Tür seines Unternachbarn vor sich ging, diese strengen Aromen waren nicht zu dulden.
Dummerweise zogen sämtliche Gerüche im Haus den Gesetzen der Physik folgend nach oben, zu Dagobert Kaisers Wohnungstür im zehnten Stock. So war das eben mit dem sogenannten Kamineffekt. Es machte ihm ja auch nichts aus, Essensvorbereitungen, verstopfte Toiletten oder Zimmerbrände der Mitbewohner im Haus über seine Nase mitgeteilt zu bekommen. Denn die gleichen physikalischen Grundsätze bescherten ihm auch relativ geringe Heizkosten, da die Wärme aus den unteren Wohnungen ebenfalls den Drang verspürte, zu ihm nach oben zu wandern. Und diese begrüßenswerte Treppenhausthermik hatte nun einmal den einen oder anderen Duft im Gepäck, der in seiner Dachgeschosswelt ansonsten eigentlich nichts verloren hatte. Aber bitte, man konnte im Leben nicht alles haben, irgendeinen Tod musste man sterben. Nur was da gerade an seine Nase drang, war beim besten Willen nicht mehr tolerabel.
Natürlich wusste er, dass der Bewohner unter ihm auf einer der niedrigen Sprossen der Lebensleiter stand und in seinem irdischen Dasein noch einiges zu lernen hatte, aber das hieß ja wohl nicht, dass er mit irgendwelchen missratenen Parfümexperimenten ungehemmt die Sinnesorgane seiner Wohnungsnachbarn beleidigen durfte. Vor allem jetzt, am Freitagabend, das Wochenende stand vor der Tür. Das wollte er sich nun wirklich nicht verpesten lassen.
Also klingelte Dagobert Kaiser zum ersten Mal, seit er vor etlichen Jahren seine Eigentumswohnung gekauft hatte, bei einem der unter ihm beheimateten Nachbarn vor der Wohnungstür und ging, während er wiederholt auf den Klingelknopf neben dem leeren Namensschild drückte, noch einmal die spärlichen Informationen durch, die er in den letzten Monaten über den Bewohner dieser Wohnung hatte sammeln können.
Schon was sein Kleidungsmanagement anging, war Glenn Miller, der Mann, der die Wohnung allem Anschein nach allein bewohnte, genau am anderen Ende der Skala angesiedelt, an deren Spitze sich der Bankangestellte Kaiser bewegte. Früher hätte man einen solcherart ausgestatteten Menschen als heruntergekommenen Hippie bezeichnet. Bart, lange, ungepflegte Haare, grob gestrickte Pullover oder bunte Leinenhemden, weite, sackartige Hosen und dazu noch billige, aus Leder gefertigte Jesuslatschen. Ob und welcher Arbeit der junge Mann nachging, war nie bis zu ihm durchgedrungen. Allerdings pflegte Dagobert Kaiser keine intensiven Kontakte zu seiner Hausgemeinschaft, die er bestenfalls bei den jährlichen Wohnungseigentümer- und Mieterversammlungen traf. Dort war Glenn Miller zuletzt zwar auch gewesen, aber Kaiser hatte den persönlichen Kontakt tunlichst vermieden, womöglich war der junge Mann eine Art lebendes Biotop, und seine bunten Klamotten waren eine Brückentechnologie, um die auf ihm hausenden Kleinstlebewesen auf andere Menschen zu übertragen. Und die durchaus wohlriechende Parfümattacke der ersten Stunden diente vielleicht nur als Kaschierung für den exzessiven Cannabiskonsum ihres menschlichen Wirtes, der jetzt, im Marihuanarausch, großzügig auf weitere Parfümaktionen verzichtete.
Für Dagobert Kaiser, der in seinem ganzen Leben noch niemals Kontakt mit Rauschmitteln gehabt hatte, bestenfalls mit einem Gläschen Sekt oder Ähnlichem, war der seltsam beißende Geruch, der aus der Wohnung dieses Hippies drang, jedenfalls hochgradig verdachterregend. Auch wenn Cannabis im Bundesland Franken inzwischen legalisiert war, gehörte es nicht zum guten Ton, seine Wohnungsnachbarn großzügigerweise an diesem zweifelhaften Genuss teilhaben zu lassen. Dagobert Kaiser spürte sicherheitshalber noch einmal intensiv in sich hinein, ob er vielleicht die erste Anmutung einer durch das Passivrauchen beim Treppenaufstieg ausgelösten Fressattacke ausmachen konnte, welche ja ein untrügliches Zeichen für Cannabis sein sollte, aber davon konnte nicht die Rede sein, au contraire. Anstatt mit Appetit musste sich Kaiser mit aufkommender Übelkeit auseinandersetzen, was ihn endgültig dazu veranlasste, die Reißleine zu ziehen. Eigentlich sollte er schon längst beim Abendessen sitzen, aber diese Sache hier musste jetzt unbedingt geklärt werden.
Sekunden später hatte er sein Handy in der Hand und wählte die Nummer der Hausverwaltung. Toleranz hin oder her, sollten die sich doch darum kümmern, und zwar schnell.
Es stand der gleiche Ablauf bevor, wie er ihn inzwischen schon hunderte Male auf fast identische Art und Weise durchgezogen hatte. Obwohl er eigentlich natürliches Licht bevorzugte, richtete er heute seine transportablen LED-Scheinwerfer aus und stellte sich in Positur. Der Anzug strahlend weiß, das darunterliegende weiße Hemd am Kragen weit geöffnet, die blonden Haare frisch frisiert und geföhnt sowie die eigene Stimmung mit einem Daiquiri auf ein akzeptables Niveau gehoben – es konnte losgehen. Startklar blickte er in die Linse der nagelneuen Kamera, dann klatschte er in die Hände, drehte eine seiner berühmten Pirouetten und legte los.
Früher hatte er einfach nur sein Handy genutzt, jetzt konnte er sich eine wirklich teure Kamera leisten. Nicht dass eine Vollformatkamera für achttausend Euro für diesen Zweck unbedingt nötig gewesen wäre, ganz und gar nicht; er hatte sich das klobige Teil gekauft, einfach weil er es konnte. Er konnte sich diese Kamera leisten, ebenso wie diverse Porsches, den dritten Ferrari und inzwischen auch Zweitwohnungen in New York und Miami. Eine Wohnung in Paris hatte er noch nicht, aber es würde nicht mehr lange dauern. Ein adäquates Objekt in Paris zu finden war speziell, vor allem wenn man die Sprache nicht beherrschte, aber auch dieses Vorhaben stand kurz vor dem Abschluss: Demnächst war ein Flug nach Paris angesagt, sowohl aus geschäftlichen wie aus privaten Gründen. Wobei das Private mit dem Beruflichen bei Philip gerne einmal verschmolz, er konnte und wollte da nicht unbedingt eine strenge Trennlinie ziehen.
Sein Leben war mittlerweile eine gelebte Scheinwelt und er eine weltweit bekannte Kunstfigur, die Millionen scheffelte. Und das alles nur mit Parfüm. Also ursprünglich nicht mit dem Verkauf desselben, sondern dem Reden darüber. Philip Patschuli war ein Youtuber, ein Influencer, der vor einigen Jahren mit der Parfümberatung für meist jüngere Männer eine absolute Nische entdeckt hatte. Mit dieser Videoblogmasche machte der nunmehr fünfunddreißigjährige Bamberger mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr. Hinzu kamen noch die Erlöse aus einer eigens für ihn entworfenen Parfümkollektion, für deren teuerste Flasche man über dreihundert Euro hinblättern durfte. Er war die Nummer eins in diesem Geschäft der Parfümtester, ein vom unbekannten Franken zum Internetguru für Parfüminteressierte aufgestiegener Weltstar. Nur noch in Ausnahmefällen konnte man ihn mit einem deutschen Beitrag im Internet finden, meistens artikulierte er seine Beiträge in Englisch, das brachte das Geschäft eben so mit sich. Außerdem sprach er fließend Polnisch, da seine Eltern aus Krakau stammten, wo er noch Verwandte hatte.
Er hieß mit bürgerlichem Namen auch nicht Philip Patschuli, sondern Stefan Maciejonczyk und stammte aus Freudeneck, einem kleinen Ortsteil der Gemeinde Rattelsdorf im Itzgrund. Bis Bamberg waren es zwar nur knapp fünfzehn Kilometer, aber in die Stadt hatte es ihn erst gezogen, als er seine Ausbildung bei der Firma Wieland in Bamberg begonnen hatte, wo er sich nach diversen Weiterbildungen einen Namen machte, indem er einen schraubenlosen Steckverbinder erfand, mit dem auch der begriffsstutzigste Elektrotechniker auf der Baustelle Kabel verlegen konnte. Das hatte ihm ein großes Lob von der Firmenleitung und die Beförderung zum Abteilungsleiter in der Entwicklung eingebracht.
Vielleicht wäre Stefan Maciejonczyk aus dem kleinen Freudeneck auch in diesem Metier eine respektable Laufbahn geglückt, wäre da nicht dieses kleine Youtube-Video gewesen, welches er eigentlich mehr aus Jux ins Netz geladen hatte. Parfüm war zwar schon immer seine stille Leidenschaft gewesen, aber damit Geld zu verdienen war nicht wirklich sein Plan gewesen. Innerhalb weniger Wochen waren die Klicks in die Tausende gegangen, und auf Stefan Maciejonczyks Konto stapelten sich bald darauf sechsstellige Summen. Die Leute wollten mehr. Irgendwann hatte er sich zwischen seinem Schreibtisch in Bamberg und der schillernden Welt des kommerziellen Showbiz im Internet entscheiden müssen. Ohne langes Zögern wählte der gewesene Abteilungsleiter der Firma Wieland die Seite der höheren Einkünfte und stand nun auf dem vorläufigen Gipfel seines Erfolges.
»Willkommen bei Philip Patschuli, heute stelle ich euch vor: die besten orientalischen Düfte für den Mann«, begann Philip sein erstes sensationelles Video für den heutigen Tag.
Bei herbstlichen siebenundzwanzig Grad ließ es sich gut arbeiten. Das war nicht zu warm und nicht zu kalt, also bestes Biergartenwetter, vor allem aber angenehm bei anstrengender Büroarbeit, was die Mitarbeiter der Kriminalpolizei in Bamberg sehr zu schätzen wussten. So auch deren dienstältester Kommissar Franz Haderlein, der sich besagter Büroarbeit widmete, obwohl heute noch ein weit wichtigerer Termin auf dem Tableau stand. Ein gleichzeitig erfreulicher wie auch etwas trauriger Termin, und das kurz vor Dienstschluss. Das jüngste Mitglied der Bamberger Ermittlerfamilie, Andrea Onello, hatte vor Kurzem eine lebensverändernde Entscheidung getroffen. In einem längeren Gespräch mit ihm, Franz Haderlein, und dem Chef der Dienststelle, Robert Suckfüll, hatte sie ihren Entschluss mitgeteilt, zu ihrem Lebensgefährten Tom Callenberg nach Würzburg zu ziehen. Außerdem hatten die beiden vor, die Zwillingsmädchen Mira und Svea Dragusha zu adoptieren, die während der Ermittlungen in einem Fall in Andreas Obhut gelangt waren und beide Eltern verloren hatten. Das alles zusammen führte zwangsläufig dazu, dass Andrea Onello schweren Herzens ihren geliebten Job bei der Bamberger Kripo gekündigt hatte und zu den Kollegen nach Würzburg wechseln würde. Überraschenderweise hatte sich Fidibus wirklich ins Zeug gelegt, um die Kollegin doch noch vom Gegenteil zu überzeugen und sie hier in Bamberg zu halten, aber Andreas Entschluss stand felsenfest. Von den Bemühungen ihres Chefs war sie nichtsdestotrotz ehrlich gerührt gewesen, damit hatte sie bei diesem verpeilten Vogel nun wirklich nicht gerechnet.
Heute war Andreas letzter Arbeitstag, der im Wesentlichen aus ihrer Verabschiedung bestand. Jeder bei der Bamberger Kripo bedauerte zutiefst das Ausscheiden der sowohl blonden als auch fähigen Kollegin. Ein Zusammenspiel, welches in der realen Welt nicht allzu häufig anzutreffen war.
Noch während Franz Haderlein über all das sinnierte, öffnete sich die Tür zur Dienststelle, und die Kollegen Schmitt und Huppendorfer kamen herein. Dass der Halbbrasilianer César Huppendorfer zu diesem feierlichen Anlass einen eleganten Kleidungsauftritt hinlegte, war für Haderlein jetzt nicht die größte aller Überraschungen. Dass sich aber auch Lagerfeld für seine Verhältnisse regelrecht in Schale geschmissen hatte, das erstaunte ihn dann doch. Stoffhose, Leinenjackett, und beim Friseur war der Kollege Schmitt offenbar auch gewesen. Außerdem trug er heute keine Sonnenbrille. Dafür klemmte ein ziemlich großes Paket unter seinem Arm, das mit Papier von weihnachtlicher Anmutung eingepackt worden war. Zumindest schloss Haderlein aus den diversen Weihnachtsmännern plus Rentieren, die als Motiv tapfer durch den Schnee stapften, auf dessen winterliche Herkunft. Wahrscheinlich hatte Lagerfeld das Papier noch vom letzten Weihnachtsfest übrig gehabt, so zumindest die ganz private Vermutung des amüsierten Kriminalhauptkommissars.
Es dauerte nur wenige Augenblicke, dann öffnete sich die Dienststellentür erneut. Honeypenny betrat das Büro, in ihrer Hand zwei Hundeleinen, an deren anderem Ende jeweils eine Generation höchst erfolgreicher Ermittlerferkel neben ihr hertrappelte. Es handelte sich hierbei um die kriminalistisch erfahrene Riemenschneider und ihren Sohn Presssack, der sowohl hochbegabt als auch übergewichtig daherkam. Die schweinischen Helden der Arbeit hatten beide eine rosa Schleife um den Hals, als wollten sie an einem Schönheitswettbewerb des Bauernverbandes teilnehmen.
Der Einzige, der zur Verabschiedung der Kollegin noch fehlte, war ihrer aller Chef Robert Suckfüll, der sich in seinen gläsernen Palast zurückgezogen hatte und ziemlich intensiv irgendwelche Unterlagen studierte. Haderlein runzelte die Stirn, und auch die Dienststellensekretärin Marina Hoffmann warf bereits die ersten missmutigen Blicke auf ihren Chef. Heute standen wichtige Feierlichkeiten auf dem Plan, da würde ihr Chef doch nicht etwa schwänzen wollen? Aber der blieb, von all der vorfreudigen Unruhe in seiner Dienststelle ungerührt, auf seinem Platz und studierte irgendwelche Zettel beziehungsweise deren Inhalt.
»Na dann, auf zum großen Finale!«, verkündete Lagerfeld und entließ mit einem lauten Plopp den Korken einer Sektflasche aus seinem beengten Aufenthaltsort. Den Sektstrahl, der sofort aus der Sektflasche schoss, fing er mit seinem Mund auf, was ihm missbilligende Blicke von Honeypenny einbrachte.
»Man macht den Sekt erst auf, wenn der Jubilar selbst anwesend ist, Bernd, hast du davon schon einmal etwas gehört, Bernd?«, pfiff sie ihn erregt an, während die beiden Ermittlerferkel zu den alkoholisierten Pfützen am Boden eilten, um diese mit zufriedenem Grunzen schleunigst aufzuschlecken.
»Mmmmmmmmh!« Lagerfeld versuchte beredt, sich zum Thema zu äußern, aber der Innendruck der Sektflasche legte eine solche Zähigkeit an den Tag, dass er den Mund lieber noch dranließ, was ja auch kein wirklich unangenehmes Unterfangen darstellte.
Während die übrigen Polizeibeamten das Schauspiel kopfschüttelnd beobachteten, wurde die Tür der Dienststelle ein weiteres Mal geöffnet, und der blonde Grund für den ganzen Aufstand betrat die Räumlichkeiten der Bamberger Kriminalpolizei. Andrea Onello für ihren Teil hatte sich heute nicht extra in Schale geworfen, war sie doch sowieso immer recht modisch unterwegs. Die besonderen Umstände konnte man mehr an ihren mühsam beherrschten Gesichtszügen ablesen, die von einer gewissen Wehmut ob des endgültigen Abschiedes geprägt waren. Viel Zeit für Traurigkeiten blieb indes nicht, denn Honeypenny eilte sogleich zu ihrer kleinen Küchenzeile, um die Sektgläser zu holen. Als Lagerfeld diese füllen wollte, reichte der Sekt gerade noch für zweieinhalb Gläser, dann war die Flasche leer.
»Vergiss es!«, rief Marina Hoffmann und hob drohend den Zeigefinger, als Lagerfelds Blick lüstern zur nächsten Sektflasche auf seinem Schreibtisch schweifte. »Den Sekt schenke ab sofort ich ein, sonst ist der Schwund zu groß«, erklärte sie unter allgemeinem Gelächter der Umstehenden.
Bernd Schmitt ignorierte dies geflissentlich und machte nahtlos mit Punkt zwei seiner heutigen To-do-Liste weiter, er überreichte der langjährigen Kollegin sein sehr speziell eingepacktes Päckchen, welches Andrea Onello mit einem breiten Lächeln annahm und auch gleich öffnete. Als sie die weihnachtliche Verpackung entfernt und den Deckel des Schuhkartons geöffnet hatte, stellte sie fest, wie gut ihre Kollegen sie doch kannten. Jeder hatte so seine Schwächen und Laster, ihres war ganz eindeutig Marzipan. Mit Marzipan, egal in welcher Form und Konsistenz, konnte sie jeglichen negativen Gefühlszustand aus ihrer Seele wegessen. Wie sie es dabei schaffte, trotzdem ihre Figur zu halten, würde wohl ein ewiges Rätsel bleiben. Jedenfalls schien der exzessive Konsum der Süßigkeit bei den Kollegen einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, denn der Schuhkarton war bis oben hin gefüllt mit Marzipan. Genauer gesagt handelte es sich um Marzipanschweinchen jeglicher Größe und Couleur.
Da war es dann um die sonst so toughe Kommissarin geschehen. Die erste Träne der Rührung rann über ihre Wange und wurde mit der freien Hand sogleich wieder weggewischt.
»Hier, ihr Helden«, meinte sie lachend und hielt den Karton in die Mitte des illustren Kreises, damit sich jeder der Kollegen ein Marzipanschweinchen herausangeln konnte. Zum eher trockenen Sekt ein durchaus gelungener Kontrapunkt. Anschließend reichte sie auch Riemenschneider und Presssack zwei der rosa Leckereien hinunter, welche von den lebenden Artgenossen sofort und ohne Skrupel rückstandsfrei vertilgt wurden. Bevor die ganze Festivität jetzt aber zu sehr ins rührselige Besäufnis abrutschte, hob Franz Haderlein als Stubenältester sein Glas, damit wenigstens einer hier ein paar zeremonielle Worte absonderte.
»Also dann! Ein Hoch auf die einzige weibliche Kommissarin, die die Bamberger Dienststelle je gesehen hat. Wir wünschen dir, Andrea, dass du mit Tom dein Glück in Würzburg findest und die Kollegen dort im Unterfränkischen mit deinem besonderen Scharfsinn genauso unterstützt, wie du es hier getan hast. Wir werden dich vermissen. Mehr gibt es nicht zu sagen, prost!«
Die anderen hoben jetzt auch ihre Gläser, prosteten Andrea zu und stießen an. Der offizielle Teil schien hiermit beendet. Zumindest erhoffte sich das die befeierte Kommissarin, die vom großen Aufheben um ihre Person nichts wissen wollte. So gesehen hätte die kleine Feier ab hier einen sowohl ruhigen als auch fröhlichen feierabendlichen Verlauf nehmen können. Das klappte zunächst auch ganz gut, bis zu dem Moment, als der Leiter der Dienststelle die Tür seines gläsernen Büros öffnete und die Szenerie betrat, gekleidet in einen jägergrünen Anzug, darunter ein cremefarbenes Hemd, dessen Kragen eine breite schwarze Fliege zierte. In einer Hand hielt er einen riesengroßen Strauß dunkelroter Baccararosen, in der anderen den Zettel, den er die ganze Zeit so intensiv studiert hatte.
Alle, aber auch wirklich alle Anwesenden, sogar die beiden Vertreter der tierischen Fraktion, standen mit offenem Mund da und betrachteten das grandiose Bild, das Fidibus in seinem ungewohnten Ornat abgab. Wie ein Soldat der King’s Guard vor dem Buckingham Palace schritt dieser jetzt auf Andrea Onello zu. Zwar hatte er keine Bärenfellmütze auf dem Kopf, dafür aber diesen riesigen Strauß Blumen in der Hand. Als er vor seiner scheidenden Untergebenen stand, drückte er ihr selbigen mit einer schwungvollen Bewegung vor die Brust und stellte sich, während Andrea selbst mit beiden Armen Mühe hatte, die Blütenpracht in Empfang zu nehmen, mit dem Habitus eines englischen Offiziers in Positur. Dann hob er den mit schwarzer Tinte wild vollgekritzelten Zettel.
Es dauerte geschlagene zwanzig Minuten, bis der Hausmeister der Anlage, der von der Hausverwaltung geschickt worden war, an der Wohnungstür eintraf. Das tat er schwer schnaufend, denn er war erstens übergewichtig, zweitens schon knapp sechzig Jahre alt, und der Aufzug schaffte es nur bis zum achten Stock, weshalb Peter Genslein das letzte Stockwerk per pedes bewältigen musste. Nichts, was er mit großer Begeisterung tat, das konnte Dagobert Kaiser ihm ansehen, aber die Umstände konnte er nun mal nicht ändern. Er hatte diese Stinkerei jetzt lange genug ertragen, da musste endlich etwas passieren.
»Also, was genau ist hier los?«, fragte Genslein den finster dreinblickenden Obermieter außer Atem, ehe auch ihm der strenge Geruch in die Nase stach, der aus der Wohnung, vor der sie standen, herausmüffelte. »Da hat aber jemand ein wirklich mieses Deodorant aufgelegt«, war sein spontaner Kommentar, während er immer noch schnaufend einen Schlüsselbund aus seiner grauen Hausmeisterjacke kramte.
Als er den Generalschlüssel für die Wohnungen im Haus endlich in der Hand hielt, wollte er selbigen in das dazugehörige Schloss stecken, aber dann stutzte er und betrachtete die Tür etwas genauer.
»Sehen Sie das?«, fragte er Dagobert Kaiser und deutete auf den Türrahmen.
Dagobert schaute ihn zuerst verblüfft an, beugte sich dann aber doch zu der Stelle hinunter, auf die der Hausmeister mit ausgestrecktem Zeigefinger zeigte. Jetzt sah er es auch. Auf Höhe des Sicherheitsschlosses war im Türrahmen Holz abgesplittert, und zwar nicht zu knapp. Da hatte sich ganz offenbar jemand an der Tür zu schaffen gemacht. Hausmeister Genslein drückte probehalber gegen das Türblatt, und siehe da, die Tür machte die ersten Zentimeter ein leicht kratzendes Geräusch, aber dann schwang sie ohne weiteren Widerstand nach innen auf.
Genslein bedachte Dagobert Kaiser mit einem fragenden, fast strafenden Blick, aber der zuckte nur mit den Schultern.
»Ich habe bloß geklingelt, mehrfach, und da hat niemand aufgemacht. Ich drücke doch nicht ungefragt an fremden Türen herum«, rechtfertigte er sich. Dann hob er genau wie Genslein die Hand zur Nase und drückte sie mit Daumen und Zeigefinger zusammen. Der Gestank, der jetzt ungehemmt aus den Räumlichkeiten drang, war ja nicht zum Aushalten und hatte mit mutmaßlichen Körperpflegedüften nichts mehr zu tun.
Nach einer kurzen Schrecksekunde straffte sich der Hausmeister und schritt in das Innere der Wohnung, erstarrte jedoch in der Bewegung, als er einen Lichtschalter fand und diesen betätigte.
Dagobert Kaiser, der ihm mit zwei Metern Abstand gefolgt war, erging es genauso. Abgesehen von dem fürchterlichen Odeur sah es in der Wohnung hier aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Möbel waren umgestürzt, Geschirr und Dekoteile lagen wild verstreut auf dem Boden, und überall fand sich zersplittertes Glas.
Vorsichtig staksten die beiden Männer durch das Chaos von aufgeschlitzten Polstern und Möbelfragmenten, bis sie das mutmaßliche Schlafzimmer der Wohnung erreichten, wo sie erneut, diesmal synchron, stocksteif verharrten. Das, was sie da auf dem Doppelbett zu sehen bekamen, ließ ihnen schier das Blut in den Adern gefrieren. Dort lag eine männliche Leiche – beziehungsweise das, was noch von ihr übrig war. Der Männerkörper machte einen so übel zugerichteten Eindruck, dass Peter Genslein sofort zu seinem Handy griff und Dagobert Kaiser sich, ganz gegen seine ansonsten so beherrschte Art, auf den Teppichboden der demolierten Wohnung übergab.
»›Der Abschied‹, von Robert Suckfüll«, proklamierte Fidibus mit tragender Stimme, hob in dramatischer Geste eine Hand und legte los.
»Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
dass ich so reimend bin.
Andrea, Herrschaftszeiten,
du gehst jetzt nach Würzburg hin.
In unsrer Abteilung
ist Ruh.
Auch auf dem Klo
spürest du
kaum einen Hauch;
die Mörder schweigen im Walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.«
Den Umstehenden war das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Ihr sprachlich minderbegabter Chef wollte sich zu Andrea Onellos Abschied tatsächlich in der Verunstaltung deutscher Lyrik versuchen? Das konnte doch nur schiefgehen, das musste im Desaster enden. Andrea Onello für ihren Teil wusste nicht, wie sie mit dem reimenden Vortrag ihres Chefs im Anschluss daran umgehen sollte. Johann Wolfgang von Rilke zum Abschied? Von ihrem Chef kaputtgedichtet?
Fidibus, vom radikalen Stimmungsabfall seiner Untergebenen gänzlich unbeeindruckt, räusperte sich, dann fuhr er lautstark mit seinem in stundenlanger Denkarbeit so hart ertüftelten Machwerk fort.
»Wer reitet nach Würzburg
durch Nacht und Wind?
Es ist Andrea mit dem Blumengebind.
Sie trägt die Rosen, welch Ungemach,
die stechen sie sicher, das hält sie wach.
Kind, was birgst du so bang dein Gesicht?
Bemerkst du denn die Kollegen nicht?
Bernd und Franz mit Anzug und Hemd?
Und sieh, überall Bürowänd.
Andrea, du gehst jetzt fort von hier,
es spielten kleine Schweine mit dir.
Mit ihnen löstest du manchen Fall,
die anderen sind bei Bauer Sporath im Stall.
Andrea, Andrea, ja hörest du nicht,
was Honeypenny dir leise verspricht?
Sie schmiert und streicht, mein blondes Kind,
durch Honiggläser säuselt der Wind.
So reite geschwind über dunkles Bitumen,
in deinen Armen die Abschiedsblumen.
Erreichst Würzburg sodann mit knapper Not,
die Rosen leben, das Auto ist tot.«
Peinlich berührtes Schweigen hatte sich in der Dienststelle breitgemacht. Zum einen bedingt durch den Vortrag ihres Chefs, der wahrlich keine Jubelstürme auslöste, ganz im Gegenteil. Honeypenny verstand zwar nicht alles, was Fidibus da gerade radebrechte, aber ihr Name war gefallen und dann noch irgendwas von Honiggläsern und dunklen Gewaltdrohungen, genug, um ärgerliche Funken zu sprühen. Zum anderen war das Gesicht von Andrea Onello, während sie der Reimerei ihres jetzt ehemaligen Vorgesetzten mit zunehmender Verwirrung lauschte, lang und länger geworden, was der umstehenden Mannschaft natürlich nicht verborgen blieb. Die Einzigen, die sich an dem Vortrag sichtlich ergötzten, waren Lagerfeld, der immer breiter grinste, sowie die beiden tierischen Zuhörer Presssack und Riemenschneider, die Robert Suckfülls engagierte Worte jetzt mit fröhlichem Grunzen begleiteten. Fidibus hatte sich aus der real existierenden Welt jedoch mittlerweile ausgeklinkt, tauchte ein in die erhabenen Gefühlswelten der deutschen Klassik und intonierte voller Inbrunst das flammende Fanal seines textlichen Ergusses.
»Fest gemauert in der Erden
seh ich Glocken, braun gebrannt.
Innig muss der Abschied werden,
frisch, Kollegen, geht zur Hand.
Von der Stirne heiß
rinnen muss der Schweiß,
jagt letzte Süße in das enge Mieder,
wer Sekt hat, legt die Arbeit nieder.
Die Ferkel trösten sich mit mürben Teigen,
denn wer jetzt ein Schwein ist,
wird es lange bleiben –«
»Bravo!«, rief Lagerfeld laut, krümmte sich vor Lachen und begann zu klatschen. Auch Riemenschneider und Presssack steuerten ein begeistertes Grunzen bei. Dass sie damit ihrem Chef das Wort und den Schluss seines erhabenen Vortrages abschnitten, war diesem nicht wirklich recht.
»Ja, aber, mein Schluss …« stammelte Robert Suckfüll hilflos, nichtsdestotrotz erfreut, dass ringsum nun auch seine übrigen Untergebenen in das Klatschen einfielen, wenngleich aus gänzlich anderen Beweggründen. Es überwog die grenzenlose Erleichterung über das Ende dieser hochnotpeinlichen Darbietung, bei der einen oder anderen Person mochte auch der nachlassende Krampf in den vergewaltigten Gehörgängen eine dankbare Beifallsbekundung rechtfertigen.
Während sich Lagerfeld auf seinem Stuhl einem nicht enden wollenden Lachkrampf hingab, was Robert Suckfüll nicht so recht einzuordnen wusste, ging Andrea Onello auf Fidibus zu. Das gerade Gehörte war zwar der mit weitem Abstand schlimmste Blödsinn, den sie in ihrem ganzen Leben je vernommen hatte, trotzdem war sie auch irgendwie tief gerührt. Denn dieser ganze literarische Mist, der bei längerem Anhören bestimmt Ohrenkrebs erzeugte, musste ja trotzdem eine Heidenarbeit gemacht haben.
»Danke. Danke, Chef, das war das schönste Gedicht, das ich jemals von jemandem bekommen habe«, sagte sie, umarmte kurz und herzlich ihren verpeilten Ex-Chef und schenkte ihm zum Abschied ein warmes Lächeln. Das mit dem schönsten Gedicht war noch nicht einmal gelogen, denn es hatte ihr noch niemand je ein Gedicht geschrieben. In Ermangelung jedweder Konkurrenz hatte sich »›Der Abschied‹, von Robert Suckfüll« diesen Platz an der Sonne also ehrenhaft erobert und redlich verdient. Davon abgesehen realisierte die scheidende Kommissarin mit einem Schlag, was ihr die Zeit auf der Bamberger Dienststelle eigentlich bedeutet hatte. Das war nicht einfach nur ein Polizeidienst gewesen, nein, das Team war so etwas Ähnliches wie ein Familienersatz für sie geworden. Und ganz sicher wäre sie auch geblieben, wenn nicht Tom unter dramatischen Umständen in ihr Leben getreten wäre. Er hatte ihr Leben gerettet, und jetzt würde sie sich aufmachen, es mit ihm zu verbringen. Sie wusste, dass es richtig und gut so war, auch wenn der Entschluss sehr plötzlich getroffen wurde. Gleichzeitig spürte sie, wie sehr ihr diese verrückte Bamberger Dienststelle fehlen würde. Zumal alle hier gerade ihr Bestes taten, damit sie zum guten Ende auch noch das Heulen anfing. Selbst ihr hoffnungslos unbegabter Chef hatte sich die Mühe gemacht, ihr ein Abschiedsgedicht zu widmen. Es war grauenvoll, aber auch wunderbar.
»Wer will noch einen Sekt?«, fragte Haderlein in die seltsame Mischung aus Gelächter und grenzenloser Erleichterung hinein und schenkte nach, während Lagerfeld sich unter dem strafenden Blick seines Dienststellenleiters weiter vor Lachen auf seinem Stuhl krümmte.
In all dem Trubel gänzlich unbemerkt öffnete sich die Tür der Dienststelle ein weiteres Mal, und eine hagere Person betrat den Raum. Diese Person war nicht erwartet, geschweige denn eingeladen. Sich dieser Umstände völlig bewusst, bewegte sich der Ankömmling zwar zielsicher, aber dennoch mit einer gewissen Zurückhaltung auf die Angestellten der Bamberger Kripo zu, die mit ihren Sektgläsern in der Hand feixend den nach Luft schnappenden Lagerfeld auf seinem Stuhl beobachteten.
Die Erste, die des ungebetenen Gastes gewahr wurde, war die Dienststellensekretärin Marina Hoffmann, deren Kinnlade von einem Moment auf den anderen nach unten fiel, als sie erkannte, wer da gerade hereingekommen war. Als Reaktion rammte Honeypenny ihren Ellenbogen in Andrea Onellos Seite, die sich mit entrüstetem Blick zu ihr umdrehte. Eigentlich wollte sie Marina darauf hinweisen, dass dieser Check gerade richtig wehgetan hatte, aber dann sah sie den Grund für Marinas entgleiste Gesichtszüge und verstand auf der Stelle, warum diese ihren Arm so unsanft ausgefahren hatte. Mitten im Raum stand in einem dunkelbraunen Trenchcoat der Leiter der Erlanger Rechtsmedizin, Professor Thomas Siebenstädter.
Es durchfuhr Andrea Onello von oben bis unten, denn ihr letztes Zusammentreffen war ein absolut katastrophales gewesen, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Der Rechtsmediziner hatte ihr an seinem liebsten Wirkungsort und natürlichem Habitat, der Erlanger Rechtsmedizin, eine Art Heiratsantrag gemacht. Der war aber so dermaßen eskaliert, dass sie eigentlich gehofft hatte, diesen absonderlichen Vertreter der männlichen Spezies in diesem Leben nicht mehr wiedersehen zu müssen. Was, in Gottes Namen, wollte der hier? Misstrauisch betrachtete sie den großen, hageren Mann, der mit dem Mantel und seinem undefinierbaren Gesichtsausdruck rüberkam wie Nosferatu kurz vor einer Beißattacke.
Inzwischen hatten auch die anderen Mitarbeiter der Bamberger Kriminalpolizei die Anwesenheit des Rechtsmediziners bemerkt und sich erstaunt umgedreht. Keiner sagte ein Wort, jeder wusste um das besondere Missverhältnis von Andrea Onello und Professor Siebenstädter. Die Stimmung im Raum, die sich gerade wieder in den positiven Bereich vorgearbeitet hatte, machte auf dem Absatz kehrt, um sich schleunigst in die tiefsten Tiefen des Kellers zurückzuziehen, aus dem sie eben erst gekommen war.
Nosferatu hob das Paket, das nicht etwa dem Anlass entsprechend in ausgesuchtes, feierliches oder wenigstens buntes Papier gehüllt, sondern mit hellbraunem Paketband zugeklebt worden war, und streckte es Andrea Onello etwa auf Brusthöhe entgegen.
»Nun, Andrea, nachdem ich von Dritten erfahren musste, dass sich meine Verlo… äh, du dich beruflich wie privat umorientierst, habe ich mir die Mühe gemacht, herzukommen, um dir aufgrund unseres kurzen gemeinsamen Lebensweges ein adäquates Abschiedspräsent zu überreichen.«
Die angesprochene Kommissarin war völlig verdattert und von der Situation einigermaßen überfordert. Ihrer beider letzter persönlicher Kontakt war ein entschlossener Tritt ihrerseits in die Weichteile des Professors gewesen. Das Thema Hochzeit war damals binnen Minuten ziemlich rüde beerdigt worden, eine versöhnliche Aussprache hatte es nie gegeben. Umso verdächtiger war dieses Geschenk, zumal es ihr vom König der pathologischen Frauenversteher persönlich überreicht wurde. Die innere Verwirrung konnte vorerst jedoch nicht gelöst werden, denn zur Überraschung aller wurde ihr nun das nächste lyrische Experiment serviert. Diesmal von jemandem, dem sie noch weniger literarisches Feingefühl zuschrieb als ihrem bisherigen Chef Robert Suckfüll, und das wollte nun wirklich etwas heißen.
Ansatzlos, ohne sich auch nur im Geringsten in seiner Haltung und Mimik zu verändern, begann der Leiter der Erlanger Rechtsmedizin wie vormals Fidibus, ein selbst erschaffenes Meisterwerk der deutschen Lyrik zum Besten zu geben.
»Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum!
Wem der große Wurf gelungen,
eines Freundes Freund zu sein,
wer ein holdes Weib errungen,
mische seinen Jubel ein!«
Hier endeten abrupt die abgewandelten Zeilen aus Schillers »Ode an die Freude«. Nosferatu räusperte sich, bohrte seinen geschundenen, wehmütigen Blick ein letztes Mal tief in die Augen und die Seele seiner Fastverlobten und artikulierte das flammende, botschaftsschwangere Fanal.
»Aequalem uxorem ducere!«, stieß Siebenstädter zwischen zusammengebissenen Zähnen grimmig hervor, ehe er selbige entblößte und sein berühmt-berüchtigtes Haifischlächeln präsentierte. »Ich wünsche allen sogenannten Polizisten hier noch einen entspannten Lebensvollzug«, giftete er mit wildem Blick in die Runde, dann warf er der stocksteif dastehenden Andrea Onello einen letzten schmerzerfüllten Blick zu, drehte sich um und verließ eiligen Schrittes die Räumlichkeiten der Bamberger Kriminalpolizei.
Andrea stand da wie vom Donner gerührt und hielt sich erst einmal an ihrem eben erhaltenen Geschenk fest. Auch von den Kollegen sagte keiner ein Wort, bis ihrer aller Chef Robert Suckfüll sich räusperte und mit fester Stimme zu sprechen begann.
»Aequalem uxorem ducere, das heißt, man soll nicht über, aber auch nicht unter seinem Stand heiraten«, übersetzte er. Fragend blickte er zu Andrea Onello, denn so richtig konnte er keinen Sinn in diesem Spruch erkennen. Deren Gesichtsausdruck hatte sich zusehends verfinstert. Zwar lag die exakte Botschaft des Siebenstädter’schen Ergusses auch für sie noch ein wenig im Dunkeln, aber lyrische Glückwünsche zur Fraueneroberung und dann auch noch die Andeutung, dass dem Herrn Professor ja sowieso etwas Standesgemäßeres als Ehefrau zustehen würde, machten sie, auch wenn alles ziemlich verklausuliert und verschraubt dahergekommen war, ziemlich wütend. Was für ein arroganter Arsch. Gut, dass sie diese Ausgeburt einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung von nun an nie mehr zu Gesicht bekommen würde.
»Also, was ist jetzt, machst du das Haifischpaket nun auf oder nicht?«, ließ Lagerfeld verlauten, der sich zwischenzeitlich wieder eingekriegt hatte, da sich ja in seiner nächsten Nähe etwas weit Spannenderes ereignet hatte.
Den Blicken der anderen Teilnehmer ihrer inoffiziellen Verabschiedungszeremonie konnte Andrea Onello entnehmen, dass in der Dienststelle allgemein ein ziemlich großes Interesse daran bestand, den Inhalt dieser lieblos zugepappten Schachtel freizulegen.
Was soll’s, dachte sie. Egal, was da drin war, sie würde den Inhalt auf gar keinen Fall mit nach Hause nehmen. Honeypenny sollte den ganzen Mist, den Siebenstätter in dieses Paket gepackt haben mochte, umgehend wieder an die Erlanger Gerichtsmedizin zurückschicken. Und zwar mit dem fetten Hinweis »Adressat unbekannt verzogen«. Ein Geschenk von diesem Mann verbreitete ganz sicher nur schlechte Energie im Haus, und Siebenstädters krude Vibrations konnte sie beim Neustart ihres Lebens ganz bestimmt nicht in ihrer Wohnung gebrauchen. Sie hob den Karton in die Höhe und betrachtete ihn etwas ratlos von allen Seiten, denn um durch alle Schichten Paketband zu schneiden, mit denen Siebenstädter sein Präsent umwickelt hatte, brauchte man ja schon fast ein Spezialwerkzeug. Vielleicht sollte sie es einfach lassen und den ohnehin fragwürdigen Inhalt unbesehen zurückschicken?
Aber da hatte sie die Rechnung ohne den Kollegen Schmitt gemacht, denn der griff sich angesichts der offenbaren Hilflosigkeit seiner scheidenden Kollegin den Karton und holte aus der Hosentasche seiner Jeans flugs sein allzeit darin befindliches Schweizer Taschenmesser. Ein routinierter Griff, dann war die große Messerklinge herausgeklappt und kurz darauf das Paketband rings um den Schachteldeckel herum aufgeschnitten. Mit einem breiten Grinsen überreichte er seiner Ex-Kollegin das professorische Geschenk, welches Andrea Onello jetzt auf ihren ehemaligen Schreibtisch stellte, um den sich sogleich ein Kreis aus höchst interessierten Persönlichkeiten der Bamberger Kriminalpolizei bildete. Lediglich die beiden Ermittlerferkel Presssack und Riemenschneider gaben sich, inzwischen am Boden auf der Seite liegend, genüsslich der Verdauung ihrer schnellstens inhalierten süßen Artgenossen hin.
Andrea Onello hob den Pappdeckel vom Karton und legte ihn zur Seite. Darunter kam eine große dunkelrote Schatulle aus poliertem Wurzelholz zum Vorschein, auf der in goldenen Lettern der von Siebenstädter vorgetragene lateinische Spruch »Aequalem uxorem ducere!« verewigt war.
Andrea nahm die nur flache, jedoch schwere Schatulle aus der Schachtel und stellte sie vor sich auf den Tisch. Ein ungutes Gefühl beschlich sie, denn die Schatulle machte einen äußerst hochwertigen Eindruck. Siebenstädter würde sich zum guten Schluss doch wohl nicht noch in Unkosten gestürzt haben? Das durfte nicht sein, nicht nach all dem, was zwischen ihnen abgelaufen war. Entschlossen und beherzt griff sie zu, klappte den Deckel der Schatulle nach oben – und erstarrte.
Bei den übrigen Anwesenden war auf unterschiedlichste Art und Weise ebenfalls ein nicht unerhebliches Überraschungsmoment zu verzeichnen. Honeypenny blieb der Mund offen stehen, Haderlein kratzte sich am Kopf, César starrte erst in die Schatulle, dann auf Andrea und wieder in die Schatulle, und Fidibus machte beim Anblick des Inhalts überrascht einen Schritt zurück, während Bernd Schmitt interessiert näher trat. Niemand wagte es zunächst, irgendetwas zu sagen, bis César Huppendorfer in einer spontanen Äußerung das Wort ergriff.
»Leck mich am Arsch«, stieß er verblüfft hervor.
Dort in der Schatulle, auf dunkelroten Samt gebettet, lag eine kleine Hand. Beziehungsweise die knöchernen Überreste einer solchen. Von der Handwurzel bis zu den äußersten Fingergliedern waren die kleinen, fragilen Handknochen kunstvoll mit dünnem Silberdraht der originären Zuordnung entsprechend aneinander befestigt. Außerdem waren die Fingerknochen mit allerlei Ringen verziert, deren darauf befindliche Edelsteine unterschiedlichster Herkunft und Farbe nur so glitzerten und funkelten. Noch prachtvoller kam allerdings das silberne Collier daher, an dem die prunkvoll ausstaffierte Knochenhand befestigt war.
Als Andrea Onello die Halskette in die Hand nahm und das ganze schmuckvolle Ensemble in die Höhe hob, durchlief ein kollektives Seufzen die Gruppe der Kriminalisten. In seiner Gesamtheit war das Collier noch eindrucksvoller als auf seinem ohnehin schon dekorativen Platz auf dem dunkelroten Samt. Andrea Onello fühlte sich beim Anblick dieser teuren, aber schräg schönen Schmuckkomposition gänzlich überfordert. Was hatte sich Siebenstädter dabei bloß gedacht? Sollte sie lachen, weinen oder einfach nur schreien?
»Ist das echt?«, fragte sie unsicher in die Runde, obgleich sowohl ihr Sachverstand als auch ihr Bauchgefühl ihr längst signalisierten, dass sie hier etwas von erheblichem Wert in Händen hielt.
Auch ihrer aller Chef Robert Suckfüll schien dieser Ansicht zu sein und gab mit wichtiger Miene seine Einschätzung ab, obwohl nicht gesichert war, dass ein hochbegabter Jurist auch automatisch ein Fachkundiger in Juweliersdingen sein musste. »Also, so über den Daumen gebrochen, ich meine, so übers Knie gepeilt, kommt da schon ein hoher Betrag zusammen. Das scheinen mir doch hochwertige Edelsteine zu sein.«
Das war auch Andrea Onellos erster Eindruck. Hässlich, geschmacklos, daneben oder nicht, sie hielt hier ziemlich sicher einen fünfstelligen Betrag in den Händen. Ihre Kollegen sahen das offenbar auch so, alle bis auf Bernd Schmitt, der das Offensichtliche wieder einmal nicht wahrhaben wollte.
»Was, echt? Niemals! Das ist wieder so eine abgedrehte Nummer von unserem Lieblingspathologen. Jetzt lass dich bloß nicht von dem verarschen, Andrea«, sagte er mit abschätzigem Grinsen und ergriff, noch bevor diese reagieren konnte, den einigermaßen unberingten Mittelfinger der stilisierten Hand. »Das ist niemals echt, nicht von Siebenstädter, diesem Wahnsinnigen. Das Geglitzer ist alles Strass und das Händchen hier bloß wieder Marzipan, jede Wette.«
Sprach’s und biss unter kollektivem Aufstöhnen der Kollegen in den längsten Finger des eindrucksvollen Geschmeides. Es knirschte und knackte, dann befand sich ein Teil des knöchernen Geschenkes zwischen seinen Zähnen, mit denen er nachdenklich auf dem widerspenstigen Marzipan herumkaute.
»Schmeckt komisch …«, meinte er ernüchtert, dann klingelte das Handy von Franz Haderlein.
Der hatte seinen jüngeren Kollegen fassungslos bei dessen fataler Aktion beobachtet und beeilte sich nun, das Gespräch anzunehmen. Anrufer war der Kollege Ruckdeschl von der Spurensicherung.
»Franz, mir ham an Dodn im Ypsilonhaus. Sieht net gut aus, wenn ich ehrlich bin, ihr müsst jedenfalls kumma.« Er schilderte noch grob die besonderen geruchlichen Umstände des Tatortes, bis Haderlein schließlich genug erfahren hatte. Er legte auf und winkte César Huppendorfer zu.
»César, wir haben einen Fall«, rief er geschäftig.
Die beiden Kommissare tauschten sich noch kurz mit ihrem Chef aus und verabschiedeten sich dann herzlich von ihrer scheidenden Kollegin.
Lagerfeld hatte unterdessen sein vermeintliches Marzipan aus dem Mund genommen und betrachtete es leicht irritiert, woraufhin Honeypenny nicht mehr an sich halten konnte.
»Sag mal, Bernd, bist du noch ganz dicht? Jetzt hast du es kaputt gemacht. Das ist ja nicht zu fassen! Die Kette ist womöglich eine total teure Einzelanfertigung. Denkt ihr Männer denn immer nur ans Fressen und Saufen?« Mit resolut vor der Brust verschränkten Armen und bitterbösem Blick strafte sie das schwarze Schaf dieser Dienststelle ab, das allerdings keinerlei Schuldbewusstsein zeigte.
»Des Marzipan is wohl scho a weng älder, wahrscheinlich Weihnachten 2012, so hard, wie des is«, erklärte Bernd Schmitt nonchalant. An Andrea Onello gewandt, die nach Haderleins und Huppendorfers Weggang nun wieder konsterniert das makabre Geschmeide betrachtete, das an ihrem ausgestreckten Arm baumelte, sagte er: »Also, ich mach mich dann amal vom Acker, Andrea, viel Glück dann noch in Würzburch.« Er ließ das angeblich überalterte Marzipan in seiner Hosentasche verschwinden und verzog sich an seinen Schreibtisch, immerhin hatte er heute Nachtschicht und Wochenenddienst.
»Was soll ich denn jetzt machen?«, brach es auf einmal fast weinerlich aus Andrea Onello heraus.
»Was du jetzt machen sollst?«, wiederholte Marina Hoffmann und legte beruhigend ihre kräftige Hand auf die Schulter der zutiefst verwirrt wirkenden Kommissarin. »Na, du nimmst das alles gefälligst mit. Geschenkt ist geschenkt. Ich weiß, du wolltest den Mann eigentlich hassen bis an dein Lebensende, aber jetzt hat er dir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
»Nein, ich gebe das diesem Erlanger Ungeheuer wieder zurück, ich will das nicht behalten«, erwiderte Andrea trotzig und warf das seltsame Knochencollier unsanft zurück in die samtene Schatulle. Ein Vorgang, der auch bei ihrem Chef einen letzten Kommentar auslöste, ehe er sich wieder in seinen Glaspalast begab.
»Also, meine liebe Andrea, da würde ich lieber noch einmal nackt drüber schlafen, da brechen Sie sich jetzt sicher keinen Zacken aus dem, äh, Zahnrad. Für eine vorschnelle Entscheidung besteht wirklich kein Grund zur Veranlassung. Ich verstehe ja, dass Sie nach den Vorkommnissen an jenem denkwürdigen Abend in der Erlanger Rechtsmedizin kein grünes Bein mehr an diesem Mann lassen wollen. Aber ich rate Ihnen dringend, fahren Sie erst einmal nach Hause, entspannen Sie ein wenig, schauen Sie hinauf in den sternenblauen Nachthimmel und entscheiden Sie dann. Glauben Sie mir, das hilft. Ich irre mich niemals … und wenn, dann nur ganz selten.« Nach diesen Worten nickte Fidibus bestätigend und ging sodann zurück zu seinem verglasten Schreibtisch.
Andrea Onello nahm die Hinweise mehr oder weniger beiläufig zur Kenntnis; sie war immer noch unschlüssig, wie sie jetzt weiter verfahren sollte. Ihr Abschied hier fiel ihr so schon richtig schwer, da konnte sie derartige emotionale Turbulenzen nicht auch noch gebrauchen. Sie wirkte derart verzweifelt, dass Marina Hoffmann das Herz weich wurde und sie die scheidende Kommissarin einfach einmal so richtig in den Arm nahm.
Dan Bruckenheimer saß als Letzter der Belegschaft in den Geschäftsräumen, die morgen im Rahmen eines gewaltigen Presseevents der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten. Die enorme Größe der medialen Veranstaltung war aber nicht weiter verwunderlich. Schließlich war dies eine amerikanische Firma und der bekannteste aller Amerikaner noch dazu sein Chef. Erst die riesige Autofabrik in der Nähe von Berlin und jetzt diese Manufaktur in Bamberg. Die seltsame Bauruine direkt neben dem Bahnhof in Bamberg hatte vorher einfach keiner haben wollen. Dadurch bot sich dem Chef die Gelegenheit, für ein besonderes Projekt auch eine besondere Immobilie zu erwerben. Warum Ilon Musg plötzlich so viel Interesse an Deutschland zeigte, war ihm persönlich total egal, es war ihm sogar höchst willkommen. Immerhin hatte ihm das zu diesem Job verholfen. Manchmal war es eben doch von Vorteil, wenn man die Muttersprache der Oma bereits in der Jugend erlernt hatte. Er stand zu seiner deutschen Herkunft, er hieß ja nicht Trump. Und es war ein verdammt guter Job hier in Bamberg. Sowohl in Bezug auf das Tätigkeitsfeld der Firma und die Stellenbeschreibung als auch ganz bestimmt in Bezug auf sein Gehalt. Dafür, dass er sich bereit erklärt hatte, das Stammhaus der Firma auf dem Gelände von SpaceX in Hawthorne, Kalifornien, zu verlassen, hatte ihm Ilon schon etwas bieten müssen. Schließlich hatte er unbedingt ihn, und zwar nur ihn, für diese Aufgabe haben wollen. Und bitte, es war so weit, morgen war der große Tag der Eröffnung. Und bei dem, was dann so alles abgehen würde, war ein medialer Aufstand zu erwarten.
Längst war dafür alles vorbereitet, es gab nichts mehr zu tun, als abzuwarten, was morgen passierte. Und danach konnten sie sich dann endlich an die Arbeit machen. Nicht etwa an das, was laut groß angelegter Werbekampagne offiziell ihre Aufgabe war, er dachte an die eigentliche Arbeit. Die Sorte, die ohne viel Aufhebens im Verborgenen geleistet wurde. Und mit der man richtig Geld verdienen konnte. Nur das zählte schließlich, der Profit, allein deswegen waren sie hier.
Apropos Profit, es war an der Zeit, sich zu seinem Büronachbarn zu gesellen, es gab einiges zu besprechen.
Dan Bruckenheimer verließ die Räumlichkeiten der eröffnungsfertigen Firma TBC, schloss hinter sich ab und ging die breite Treppe hinunter. Vorbei an den Räumlichkeiten mit der eiergelben Wandfarbe, die morgen ebenfalls eröffnet werden sollten. Unter der Ägide seines Chefs war auf dem ehemaligen Atriumgelände in Bamberg ein völlig neuer Gebäudekomplex mit diversen Einrichtungen entstanden, den sich drei unabhängige Gesellschafter teilten. Aber diese gelbe Firma hier interessierte ihn nicht, sein Ziel lag am anderen Ende des Areals.
Er ging am Gebäude entlang und, als das Bahnhofsgebäude in sein Blickfeld geriet, rechts um die Ecke, wo er eine Glastür öffnete, die ein großes Firmenlogo zierte: »PHILIP PATSCHULI GMBH«. Er durchquerte den langen Verkaufsraum, in dem sich sowohl an den Wänden als auch auf diversen Glastischen in der Mitte die Parfüms dieser Welt in beziehungsweise auf ihrer Auslage tummelten. Ab morgen würden sich hier etliche Kunden versammeln, die von diversen Fachverkäuferinnen und einem Verkäufer beraten wurden, auch solche, die auf der Suche nach einem Signature-Duft für ihre individuelle Persönlichkeit waren. Dan Bruckenheimer hingegen war nicht an Düften, sondern an einem ganz bestimmten Platz in diesem Showroom interessiert. Es handelte sich um eine Wand, die den Verkaufsraum von den dahinterliegenden Büroräumen trennte. Darin befand sich zwischen hochwertig verspiegelten Regalen eine ebenfalls verspiegelte Tür, auf die der Amerikaner zusteuerte. Das Besondere an dieser Wand war aber nicht der optische Eindruck, sondern erstens der Umstand, dass die Regale noch völlig leer waren, und zweitens die Aufsteller, die zwischen den noch einzuräumenden Waren standen und eine schlichte Aufschrift trugen.
Burnt Curls – Coming soon
Ein stilles Lächeln umspielte Bruckenheimers Mundwinkel, dann öffnete er, ohne zu zögern, die verspiegelte Tür. Philip Patschuli saß an einem der runden weißen Tische im Raum dahinter und nippte an einem doppelten Espresso macchiato. Neben ihm stand eine ganze Reihe ausgepackter Parfümflakons, auf den ersten Blick orientalischen Typs, wie die Form der Gläser erahnen ließ. Davor lag ein geöffneter Briefumschlag, dem Patschuli ein Schreiben entnommen hatte. Eines, das ihm nicht besonders zu gefallen schien.
Dan Bruckenheimer interessierte das nicht im Geringsten, die Geschäfte des Youtubers waren in seinen Augen nur Spielereien, Peanuts. Auch wenn Philip damit inzwischen Millionen verdiente. Ihn interessierte nur der morgige Tag, genauer: die Präsentation des Events. Das trieb ihn um, nichts sonst. Und Philip Patschuli alias Stefan Maciejonczyk war die beste Person, die man für diesen Zweck finden konnte. Er war die Koryphäe in Sachen Parfüm im Netz, eine internationale Berühmtheit. Jeder, der sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigte, kannte ihn, und zwar quer durch alle Altersschichten. Das war auch genau der Grund, warum Ilon Musg ihn engagiert hatte. Denn wenn Ilon etwas umsetzte, dann richtig. Und genau so, mit dem Anspruch, nur für das Beste zu stehen, würde das morgen ablaufen.
»Alles bereit für morgen? Bist du bereit? Ready to rumble?«, fragte Dan Bruckenheimer und baute sich vor dem lässig dasitzenden Maciejonczyk auf.
»Na klar, Dan, alles easy. Heute Nacht räum ich die Sachen in die Regale, damit morgen nach der Präsentation auch alles an seinem Platz ist. So wild wird das ja wohl nicht werden, oder? Ihr Amis zieht eure Show für die Presse ab, und dann wird verkauft – so viel, wie geht. Business as usual, würde ich sagen.« Er lächelte ein wenig spöttisch und hob die Tasse an seine Lippen, um sich auch den Rest des Espressos einzuverleiben.
Bruckenheimer wartete einen Moment, dann ließ er die Bombe platzen. »Alles easy, na schön. Ich hoffe, dass Ilon das morgen ebenso sieht, er wird nämlich persönlich erscheinen«, erklärte er so lakonisch, als wollte er einem Konkurrenten, der gerade ein großes Geschäft abschloss – im übertragenen Sinn –, mitteilen, dass das Toilettenpapier alle war.
Beim Internetpapst für Düfte aller Art dauerte es einen Moment, bis die Bedeutung dieser Aussage durchgesickert war, dann verschluckte er sich und hustete seinen Espresso unkontrolliert durch die Gegend. Sowohl der Tisch als auch Philips ehemals strahlend weißer Anzug verlangten als Konsequenz nach einer sofortigen Generalreinigung.
»Was?«, brachte Maciejonczyk zwischen weiteren Hustenattacken heiser hervor, was Bruckenheimer nun seinerseits mit einem spöttischen Lächeln erwiderte.
Der Heißluftballon hatte bereits seit geraumer Zeit eine Höhe von etwa fünfhundert Metern erreicht. Das war für eine Ballonfahrt mit zahlenden Passagieren schon eine stattliche Höhe. Theoretisch ging noch einiges mehr, erst bei dreitausend Metern war endgültig Schluss, denn ab da begann der gesperrte Luftraum, in dem sich auch andere Luftfahrzeuge bewegten. Solche, die in der Regel Flughäfen ansteuerten. Normalerweise ließ Georg Leupold seinen Ballon bis maximal siebenhundert Meter aufsteigen, dann war in der Regel Schluss. Aber heute waren ideale Wetterbedingungen über den Windungen des Obermains, kein Wölkchen trübte den blauen Himmel, und seine Gäste wollten es höhentechnisch unbedingt wissen. So hoch es nur ging, hatten sie gemeint. Also gut, wer zahlt, schafft an, dachte Leupold. Da an einem windstillen Tag wie heute sowieso keine größeren Etappen über Land drin waren, konnte man sein Gas auch genauso gut in Höhe statt in Strecke investieren. Im Moment war allerdings Ruhe im Korb, der von einem riesigen orangefarbenen Heißluftballon getragen wurde, auf dem die Werbung einer großen bekannten fränkischen Brauerei prangte. Die drei Gäste im Korb hatten ihre erste Aufregung abgelegt, ihre Neugier bezüglich dieser Luftsportart stillen können und außerdem ihre Ballontaufe erhalten.
Die alte Idee der Ballontaufe stammte aus der Zeit des französischen Königshofes, als sich nur Adelige mit dem Ballon in die Lüfte erheben durften. Daraus entwickelte sich der Brauch, dass man mit einer Ballontaufe einen sogenannten »Adelstitel der Lüfte« verliehen bekam, sonst dürften Bürgerliche aufgrund ihres niederen Standes ja gar nicht in einen Ballon steigen. Während die einen den Täufling mit Sekt tauften, wurde dieser formelle Akt bei Georg Leupold fränkisch korrekt mit Bier vollzogen. Das war, egal mit welchen Alkoholika, die offizielle Erhebung in den Adelsstand, also die Taufe mit Ritterschlag. Dem Täufling wurde dabei zudem, ganz wichtig, das Gelöbnis auferlegt, den neuen Titel auch zu führen, also auswendig zu kennen, und niemals wieder das Wort »fliegen« im Zusammenhang mit Ballonfahrten zu verwenden. Womit auch die Frage zu beantworten wäre, warum es »mit dem Ballon fahren« und nicht »fliegen« heißt, was bei Leupolds Kundschaft hin und wieder zu fragenden Gesichtern führte. Da aber zur damaligen Zeit die Erfinder der Heißluftballonfahrt, die Gebrüder Montgolfier in Frankreich, bedeutungsschwanger erklärten, dass sie mit dem Ballon in das Luftmeer entschweben würden, verglich man das Ballonfahren seither mit dem Befahren des Meeres. Und da Schiffe bekanntlich auf dem Gewässer fuhren, schwebten ergo auch Ballone fahrend durch das Meer von Luft und Wolken.
Eine weitere von vielen Fragen, die Georg Leupold auf seinen Touren beantworten musste, war die, wohin der Ballon denn heute fahre. Der Gast wolle doch bitte da- und dorthin. Aber so einfach war die Sache natürlich nicht. Da der Heißluftballon allein vom Wind gelenkt wurde, konnte keine Route geplant und genau angesteuert werden. Der Pilot hatte hauptsächlich Einfluss auf die Höhe, in der sein Ballon dahinschwebte. Nur durch die Nutzung unterschiedlicher Höhen mit daraus resultierenden variierenden Windrichtungen konnte er Einfluss auf die Fahrtrichtung nehmen. Je nach Windgeschwindigkeit konnte man dann innerhalb einer Fahrtzeit von sechzig bis neunzig Minuten circa fünf bis dreißig Kilometer zurücklegen. Aber nicht heute. Heute war so gut wie gar kein Wind, der Ballon bewegte sich gewissermaßen im Schritttempo Richtung Westen.
Vier bis sieben Menschen passten ungefähr in einen Korb; man musste über einen Meter zwanzig groß sein und das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, um als Passagier mitfahren zu dürfen. Bei Georg Leupolds Firma »Leupold Himmelsfahrten« galt jedoch, wer über eins zwanzig groß war und Lust auf eine Ballonfahrt hatte, konnte mitfahren. Kinder unter sechzehn Jahren mussten allerdings in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. Das Ganze begann im April/Mai und endete in der Regel im Oktober, je nach Wetterverhältnissen. Wobei Leupold schon seit Jahren bemerkte, dass sich die Saison durch die fortschreitende Klimaerwärmung immer weiter nach hinten verschob. So war beispielsweise heute der siebenundzwanzigste Oktober, und tagsüber waren es zur Mittagszeit immer noch unfassbare siebenundzwanzig Grad. Dadurch konnte man zwar länger im Jahr Ballonfahrten organisieren, aber Georg Leupold machte sich inzwischen größere Sorgen um den Zustand dieser Welt.
So lehnte der Ballonführer nun auch entspannt mit verschränkten Armen auf dem Rand seines geflochtenen Korbes und sinnierte über die Welt und ihren erwärmten Zustand sowie seine heutige, bis hierhin unaufgeregte Fahrt. Es waren nur drei von ursprünglich fünf angemeldeten Gästen in seinem Korb, zwei hatten kurzfristig abgesagt, Corona, was sonst. Aber die »Baxe«, wie die Passagiere im Ballonfahrerjargon genannt wurden, hatten bezahlt, also war es ihm einerlei. Im Gegenteil, weniger Gewicht bedeutete auch weniger Gasverbrauch, sprich: eine längere Fahrtzeit. Ob der Begriff Baxe von »Passagier« oder doch eher von »Bagage« herrührte, wusste er nicht, sie hießen halt so und basta.
Unter ihnen schlängelte sich der Obermain durch die Landschaft. Auch an dem Fluss ging der Klimawandel nicht spurlos vorüber, er führte hier, nördlich von Bamberg, immer noch dramatisch wenig Wasser, wie so häufig in den letzten Jahren. Und das, obwohl heftige Tiefdruckgebiete mit reichlich Regen im Gepäck früher schon im Oktober für die eine oder andere Überschwemmung gesorgt hatten. In seiner Jugendzeit, den Sechzigern, war es im Oktober sogar bereits zu den ersten Wintereinbrüchen mit Schnee und Frost gekommen. Aber nicht in diesem Jahr und in den Jahren davor auch nicht. Stattdessen waren die Biergärten noch immer geöffnet, und die Menschen vergnügten sich lautstark und fröhlich bei nicht mehr ganz so heißen Temperaturen wie etwa im Juli oder August.
Weiter oben, in über fünfhundert Metern Höhe, war außer dem gelegentlichen Fauchen des Propangasbrenners nichts vom Lärm der Menschheit zu hören; man war hier oben, in absoluter Stille, der Welt völlig entrückt. Die Abendfahrt, in die sinkende Sonne hinein, war eine der schönsten Zeiten, in denen man dieses Hobby ausüben durfte. Dieses einmalige Erlebnis währte heute allerdings nicht mehr allzu lange. Gerade entdeckte Georg Leupold tief unter dem Ballon die kleine Ortschaft Ebing und den dazugehörigen Campingplatz am Main und hielt nach seinem Fahrer Ausschau, dem Mann mit Anhänger, der ihn nach der Ballonfahrt wieder einsammeln sollte, da war plötzlich ein seltsames Geräusch zu hören, das absolut nicht hierher passte. Im ersten Moment dachte der erfahrene Ballonführer, er hätte es hier, in dieser entrückten Luftschicht, tatsächlich mit einem Bienenschwarm zu tun, aber das konnte in über fünfhundert Metern Höhe beim besten Willen nicht sein. Was sollten denn bitte schön Bienen in dieser Höhe verloren haben? Wenige Sekunden später hatte er die Ursache der giftig summenden Geräuschquelle ausgemacht. Dem Ballon näherte sich eine Drohne. Und zwar eine von der teureren Sorte mit vier großen Rotoren und somit einigermaßen Kraft in den Elektromotoren. Georg Leupold kannte sich mit den Dingern aus, er besaß selbst auch eine und hatte sogar den speziellen Drohnenführerschein, den man für solch ein Modell brauchte. War das Steuern dieser Fluggeräte früher eine absolute Grauzone gewesen, so gab es inzwischen auch für ferngesteuerte Drohnen eindeutige Regeln und Vorschriften. Von denen eine besonders wichtige beinhaltete, dass man sich von anderen Luftfahrzeugen gefälligst fernzuhalten hatte. Genauso wie von Flugplätzen, Flugräumen oder dem Luftraum über größeren Menschenansammlungen. Was also sollte das? Was hatte diese Drohne in diesem gefährlich nahen Abstand hier zu suchen?
Bei Georg Leupold stellte sich ein überaus ungutes Gefühl ein. Denn was diese Drohne da veranstaltete, war nicht erlaubt, gefährlich und daher absolut illegal. Das schien das Fluggerät beziehungsweise dessen menschliche Steuerung unten am Boden aber nicht zu interessieren. Was ihn wunderte, denn eine Drohne dieser Größenordnung kostete eine Stange Geld. Und wer setzte schon ohne Not ein paar tausend Euro aufs Spiel? Wenn dieser Heini dort unten bei seinem Tun erwischt wurde, war sein Spielzeug weg, da kannten die Behörden kein Pardon.
Insgeheim wünschte sich Georg Leupold ein Luftgewehr, ein paar Bocciakugeln oder etwas ähnlich Weitreichendes, womit er dieses technische Ungeheuer kurzerhand vom Himmel holen könnte. Hatte er aber nicht, stattdessen begann sich sein ungutes Gefühl zu verstärken, denn das unbekannte Fluggerät steuerte jetzt direkt auf den Korb des Ballons mit seinen immer unruhiger werdenden Passagieren zu. Auch Leupolds Gäste hatten die große Drohne nämlich bemerkt und ebenso die angespannte Unruhe, die den sonst so souveränen Ballonführer erfasst hatte.
Mit leicht zusammengekniffenen Augen fixierte Georg Leupold das sich nähernde Fluggerät. Etwa zehn Meter vom Korb entfernt verharrte es mit bösartigem Summen in der Luft, die Linse der Kamera starr auf die Ballonfahrer gerichtet. Auf dem flachen Rücken der Drohne entdeckte Leupold so etwas wie ein schwarzes Päckchen, auf das er sich aber überhaupt keinen Reim machen konnte. Das gefährliche Verhalten des Drohnenpiloten hingegen bereitete ihm Sorge, der musste entweder unverschämt oder einfach nur unglaublich dämlich sein. Da die Kamera der Drohne aber ja genau auf den Korb des Ballons gerichtet war, konnte man diesem Idioten da unten wenigstens unmissverständliche Botschaften schicken. Er begann also, wild mit den Armen zu fuchteln, um dem unbedarften Drohnenpiloten zu signalisieren, dass er mit seinem Fluggerät gefälligst woandershin fliegen sollte. Womöglich hatte ja irgendein Jugendlicher von seinem reichen Papa das Teil geschenkt bekommen, ohne eine Ahnung von den strengen Regularien in der Drohnenpilotenwelt zu haben, und fand es jetzt unglaublich cool, diesen Heißluftballon einmal aus der Nähe zu betrachten. Aber es half alles Fuchteln nichts, die Drohne rührte sich nicht von der Stelle.
Nun begann Leupold samt seiner Mannschaft, neben dem Fuchteln auch noch laute Warnungen in Richtung der Drohne zu rufen, aber auch das ohne sichtbares Ergebnis. Erst als Leupold der Kamera seinen ausgestreckten Mittelfinger zeigte, einen seiner Schuhe auszog und diesen in Richtung der Drohne feuerte, begann sich das Fluggerät zu bewegen. Mit deutlich erhöhter Lautstärke stieg es giftig summend senkrecht nach oben, wahrscheinlich, um außer Reichweite von Leupolds Schuhwürfen zu gelangen. Der atmete erst einmal auf. Seinen Schuh konnte er zwar abheften, die Drohnengefahr aber schien gebannt. Jetzt konnte er nur noch hoffen, dass dieser Idiot das Teil schleunigst von ihrem Ballon wegbugsierte, nicht dass noch etwas passierte.
Der denkbar schlimmste Fall wäre der, dass die Drohne in den Ballon hineinflog und die Ballonseide beschädigte. Das war allerdings unwahrscheinlich, da moderne Drohnen wie diese mit einem Antikollisionssystem ausgestattet waren, weshalb sie auch bei unsachgemäßer Bedienung immer rechtzeitig innehielten, wenn sie gegen ein Hindernis zu fliegen drohten. Selbst ein heftiger Windstoß brachte die heutigen Drohnen nicht aus ihrer Flugbahn beziehungsweise Position. Aus Versehen würde dieses Fluggerät also keinesfalls an den empfindlichen Ballon geraten, und mit Absicht würde das ja sowieso keiner machen, der nicht völlig geistesgestört war. Und selbst wenn so etwas doch passieren und der Ballon einen kleinen Riss davontragen würde, hätte Georg Leupold immer noch genug Möglichkeiten, sich und seine Fahrgäste mit Hilfe des Brenners einigermaßen sicher zum Erdboden zurückzubringen. Nur mit der Auswahl des Landeplatzes wäre er dann ziemlich eingeschränkt.
Apropos Landeplatz. Vielleicht sollte er einfach über Funk sein »Erdferkel« kontaktieren, wie die Menschen genannt wurden, die mit Auto und Anhänger dem Ballon ihres Herrn und Meisters hinterherfuhren, um Gerät wie Mannschaft wieder aufzusammeln. Aber er beschloss, dem Fahrer erst einmal seinen Frieden zu lassen, dieser idiotische Drohnenpilot würde sich bestimmt bald eines Besseren besinnen und merken, dass er gerade einen Riesenmist baute. Also alles eigentlich noch einigermaßen im grünen Bereich. Aber dann konnte Georg Leupold sehen, dass die Drohne soeben nicht nur nach oben gestiegen war, sondern sich auch noch direkt neben der Ballonhülle platziert hatte, bestenfalls dreißig Zentimeter davon entfernt. Was sollte das werden, zum Teufel?
Langsam wurde Leupold richtig wütend. Merkte der Typ da unten eigentlich noch was? Die Rotorblätter kamen der extrem dünnen Ballonseide gefährlich nahe, und er hatte nun wirklich keinen Bock auf eine außerplanmäßige Notlandung.
Die Drohne befand sich jetzt am oberen Drittel des Ballons und verharrte dort regungslos in geringer Entfernung zur Hülle. Dann sah Leupold, dass an der Unterseite der Drohne auf einmal ein rotes Licht zu blinken begann.
Als die beiden Kommissare ihren Wagen am Ort des Geschehens geparkt hatten, betrachtete César Huppendorfer erst einmal erstaunt das seltsame Gebäude.