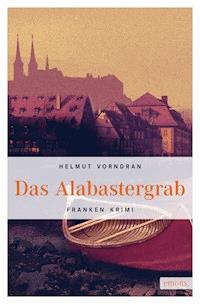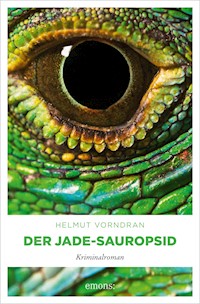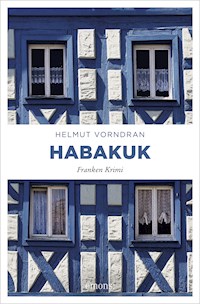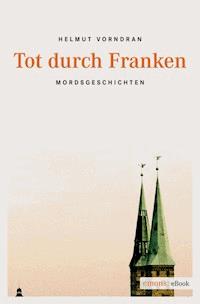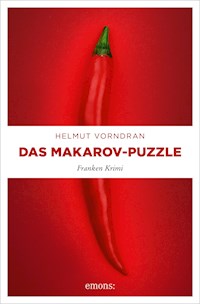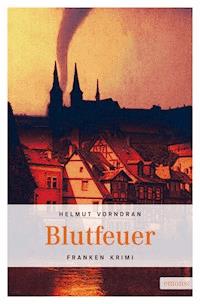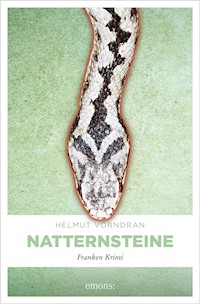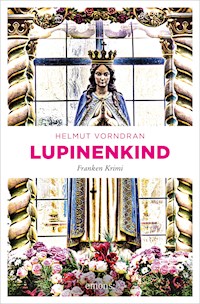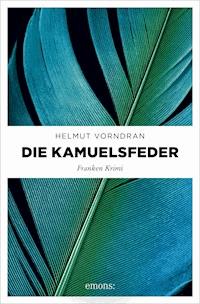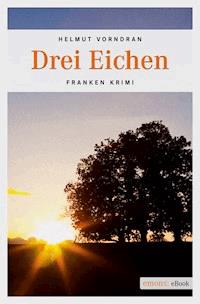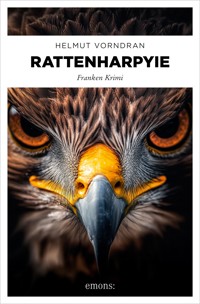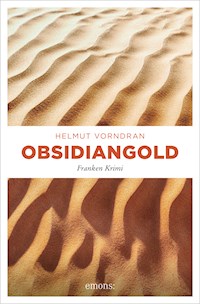
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Haderlein
- Sprache: Deutsch
Der neue Vorndran: sarkastisch, skurril und abgrundtief böse. Im unterfränkischen Ebern erwacht eine Frau aus dem Koma und verschwindet spurlos. Die Polizei ist ratlos: Die Frau hat keine Angehörigen, keine Papiere, es gibt keinen Hinweis auf ihre Identität. Dann wird im Oberfränkischen in einem ausgebrannten Mähdrescher ein Toter gefunden. Auch er ist nicht zu identifizieren. Die Bamberger Kommissare Lagerfeld und Haderlein samt Ermittlerschwein Riemenschneider und Sohn folgen der Spur einer geheimnisvollen Organisation, deren Wurzeln bis nach Afghanistan reichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Helmut Vorndran, geboren 1961 in Bad Neustadt/Saale, lebt mehrere Leben: als Kabarettist, Unternehmer und Buchautor. Als überzeugter Franke hat er seinen Lebensmittelpunkt im oberfränkischen Bamberger Land und arbeitet als freier Autor unter anderem für Antenne Bayern und das Bayerische Fernsehen.
www.helmutvorndran.de
Dieses Buch ist ein Roman. Die geschilderten Ereignisse beruhen teilweise auf wahren Begebenheiten, Handlungen und Personen sind jedoch frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/lkpro
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-981-5
Franken Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieses Buch ist Sharbat Gula gewidmet.
Du bist ein Schattenam Tageund in der Nachtein Licht.Du lebst in meinerKlagein meinem Herzenstirbst dunicht.
Friedrich Rückert (aus den Kindertotenliedern)
Prolog
Zuerst war da dieser Schwebezustand. Ich schwebte über meinem eigenen Körper, ganz in helles, weißes Licht gehüllt. Dann kamen diese Leute, die mich von der kalten Erde hoben und in einen Krankenwagen steckten. Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde ich mehrfach wiederbelebt. Das weiße Licht verschwand, in mir wurde alles schwarz. Ich befand mich in einer Art riesigen Höhle, mit zur Seite ausgestreckten Armen wie bei einer Kreuzigung an die Felswand gekettet, unter mir endloser Abgrund. Ich registrierte einen Geruch nach Fäulnis, genauer, nach verwesendem Fleisch. In der Dunkelheit tauchten plötzlich Augenpaare und Krallen auf, die mir die Haut in langen Streifen vom Körper rissen. Ich konnte nichts tun, um diesen Alptraum zu beenden, denn ich war außerhalb der Zeit. Ich war in der Ewigkeit, voller Panik, ohne Hoffnung auf etwas Gutes.
Eine starke Hand bahnte sich ihren Weg durch die Dunkelheit und ergriff meine Taille. Die Fesseln fielen von mir ab, auch die Schwärze verschwand. Dann war da erneut dieses weiße, helle Licht. Da wusste ich, dass ich ins Leben zurückgerufen werden sollte, und ich wusste auch sofort wieder, wer und wo ich war. Ich betrachtete den fremden Raum, und mir wurde bewusst, warum das alles passiert war, wieso ich es auf mich genommen hatte. Ich riss mich zusammen. So viel war passiert in meinem Leben, so viel hatte ich erlebt, erkämpft und überstanden. Also verschwendete ich keine Zeit mit Selbstmitleid, Trauer oder gar Resignation, sondern machte mich erneut auf den Weg.
Feuer
Es war spät, sehr spät sogar, als Biobauer Bernhard Sporath ein heftiges Klingeln von seiner Eingangstür her vernahm. Ein kurzer Blick aus dem Fenster bestätigte seine Vermutung, es war stockdunkel draußen. Und wenn Ende Juli draußen keine Sonne mehr schien, war es spät, schließlich ging das gleißende Gestirn im Hochsommer erst nach zweiundzwanzig Uhr unter. Bauer Sporath legte sich dieser Tage zudem spätestens um zweiundzwanzig Uhr in die Federn, denn wenn gedroschen wurde, musste er ziemlich früh raus. So hatte er auch heute bereits eine kurze Strecke Schlaf hinter sich, als auf einmal dieses schrille Geräusch durchs Haus gellte. Ein Blick auf die große Standuhr im Gang bestätigte ihm, dass es tatsächlich jemand wagte, ihn um dreiundzwanzig Uhr in der Nacht aus dem Bett zu holen. Er hatte gerade mal eine Stunde geschlafen, schlief eigentlich immer noch und war somit geistig noch viel zu träge, als dass sein Gehirn sich einen Reim auf die akustische Belästigung machen konnte. Bernhard Sporath war Biobauer und von seinem ökologischen Naturell ein begeisterter Vertreter des natürlichen Erwachens. Wecker oder anderweitige Störungen seiner Nachtruhe waren ihm zutiefst zuwider. Nun ja, diese Methode des entspannten Tagesbeginns fiel heute wohl aus, da versuchte es jemand auf die ganz harte Tour. Hoffentlich wachte seine Frau bei dem ganzen Gebimmel nicht auf, sie war auch gerade erst eingeschlafen.
Nur in Unterhose, das Handy mit aktivierter Taschenlampenfunktion in der Hand und mit einem schnell übergeworfenen großen karierten Poncho seiner Frau bedeckt, eilte er durch das dunkle Haus, tastete sich schlaftrunken auf der fahl beleuchteten Treppe nach unten und öffnete die alte Haustür seines Bauernhofes in Ebensfeld. Vor ihm stand der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr aus Ebensfeld, in voller Montur und mit verschwitztem Gesicht.
»Daniel, was gibt’s denn, Herrschaftszeiten!«, raunzte Bernhard Sporath ungehalten, blickte aber bereits sicherheitshalber ringsum in seinen Hof, ob da vielleicht irgendwelche Flammen aus dem alten Gebälk schlugen. Denn wenn die Feuerwehr vor der Tür stand, hatte das ja meistens einen feurigen Grund. Doch es war nichts zu sehen außer den dunklen Schatten der bauernhöfischen Gebäudeumrisse.
»Bei dir brennt’s!«, rief Daniel Bressig, was in Biobauer Sporath eine leicht aggressive Verwirrung hervorrief. Es war doch vollkommen offensichtlich, dass bei ihm gar nichts brannte. Was zum Geier redete der Bressig da?
Mit sich hysterisch überschlagender Stimme wiederholte Bressig: »Es brennt!«, dazu fuchtelte er wild mit seinen Armen auf und ab, als wollte er, einem Hubschrauber gleich, abheben und in die sternenklare Nacht davonfliegen.
»Jetzt griech dich erschd amal widder ei, Daniel!«, rief Sporath zurück, packte den jungen Feuerwehrkommandanten an der Schulter und schüttelte ihn, damit er seine Panik ablegte und ihm erst mal erklärte, was hier eigentlich los war.
Diese handgreifliche Aktion hatte zwei unmittelbare Effekte. Erstens kam der reichlich überfordert wirkende Bressig dadurch tatsächlich wieder zur Besinnung, und zweitens rutschte Sporath der Poncho seiner besseren Hälfte von den Schultern, sodass er dem nächtlichen Besucher nun fast nackt, nur mit seiner roten Unterhose bekleidet, gegenüberstand. Der Ebensfelder Feuerwehrkommandant hatte für diesen bekleidungstechnischen Fauxpas keinerlei Sinn, allerdings schafften es Sporaths Schüttelbemühungen immerhin, seine Adrenalinwallungen allmählich in den grünen Bereich zurückzubefördern. Sein Herz hörte auf, wie eine Kreiselpumpe zu arbeiten, und auch das Gehirn schaffte es, den Autopiloten, welcher die ganze Zeit im Panikmodus gearbeitet hatte, zu deaktivieren.
Biobauer Bernhard Sporath sah seine Chance gekommen und nahm einen neuen Anlauf zur Situationsklärung. »Also noch amal vo ganz vo vorn, Daniel. Was is bassierd? Wieso hausd du mich um die Zeid ausm Bedd? Was genau brennt etzerd?«
Daniel Bressig schaute nach oben in die klare Nacht und schnaufte noch einmal laut und vernehmlich durch, ehe er seinem Gegenüber wieder in die Augen sah. Das war immerhin sein erster Brand als Kommandant und einfach einen Tick zu viel gewesen, aber jetzt ging’s wieder, die bäuerliche Schüttelei hatte tatsächlich geholfen.
»Bernhard, du hast doch den großen Agger bei Unterbrunn, oder ned?«, stieß Bressig hervor.
Was sollte das jetzt werden, ein Austausch über agrarfachliche Fragen?
»Ja, hab ich, warum? Willst ner kaafen?«, fragte Sporath, der überhaupt nicht wusste, worauf Bressig eigentlich hinauswollte, und hielt mit dem Schütteln inne.
Aber Bressig hatte keinerlei Kaufabsichten.
»Und der Mähdrescher, wo auf dem Agger steht, des is doch aach deiner, oder ned?«, hakte der Feuerwehrkommandant ohne weitere Erklärung nach, was des Biobauern Verwirrung noch weiter steigerte.
»Ja, des is mei Mähdrescher, in Gottes Namen. Den hab ich da stehn gelasst, weil ich daham schnell was anneres machen gemusst hab und ich heud«, er verdrehte die Augen nach oben und überlegte kurz, bevor er fortfuhr, »in circa acht Stunden, sowieso auf dem Agger weiterdreschn wolld. Bassd was ned? Isses jetzt neuerdings verbodn, sein Mähdrescher aufm eichenen Agger stehn zu lassen?«
Sporath, der sich erst jetzt seiner Nacktheit bewusst wurde, bückte sich. Zwar war es eine schwüle Sommernacht, trotzdem war das Mindestmaß dessen, was er sich als Bedeckung für seinen Körper in der Öffentlichkeit wünschte, signifikant unterschritten. Er hob den karierten Poncho seiner Frau vom Boden auf und band ihn hektisch um seine Hüften, damit zumindest die hochnotpeinliche rote Unterhose dem Blick entzogen wurde.
Daniel Bressig wartete geduldig, bis der Biobauer den finalen Knoten geknüpft hatte, dann legte er ihm die Hand auf die Schulter und deutete in Richtung Hoftor. Dort waren die dunklen Umrisse des Feuerwehrautos zu sehen, das draußen an der Straße stand.
»Geh einfach mit, Bernhard, des dauerd etzerd zu lang, bis ich dir des alles erglär«, stieß Bressig hervor und schob den Bauern mit sanfter Gewalt in Richtung Einsatzfahrzeug. Sporath konnte gerade noch sein Handy in der Unterhose verstauen, dann waren sie auch schon an dem nagelneuen Löschzug der Ebensfelder Feuerwehr angelangt.
Der Chefarzt der Haßberg-Kliniken in Ebern machte gerade seinen täglichen Rundgang durchs Haus, um sich nach dem aktuellen Gesundungsstand der Patientenschaft zu erkundigen, als auf einmal seine langjährige Intensivschwester oder, korrekt ausgedrückt, die leitende Pflegefachkraft der Intensivstation ins Krankenzimmer gestürmt kam. Schwer atmend blieb sie vor ihm stehen und wurde von Dr. Rudolf Zwack umgehend mit einem überraschten, aber dennoch strengen Blick belegt. Er wollte schwer hoffen, dass Gaby Dremmel einen wirklich triftigen Grund hatte, hier mit einem so filmreifen Auftritt in das Krankengespräch hineinzuplatzen.
Mit weit aufgerissenen Augen zog Gaby Dremmel die Schulter des Chefarztes und somit auch das rechte Ohr von Dr. Zwack zu sich herunter und flüsterte ihm mit heiserer Stimme einen Satz ins Ohr. Das reichte. Auch Dr. Zwack, seines Zeichens Chefarzt und ebenso ärztlicher Leiter der Haßberg-Kliniken zu Ebern, vergaß von einer Sekunde auf die andere seine langjährige Arbeitsroutine, entschuldigte sich hastig beim gerade besuchten Patienten, drückte seinem Assistenzarzt die Krankenakten in die Hände und stürmte zusammen mit seiner Intensivschwester aus dem Zimmer. Der Assistenzarzt konnte den beiden nur völlig verdattert hinterherschauen; dann nahm er Haltung an und begann mehr oder weniger professionell damit, seine erste alleinige Visite am Krankenbett zu improvisieren.
Chefarzt Dr. Zwack starrte unterdessen ratlos auf das leere Bett in seiner Intensivstation, zu dem ihn seine leitende Pflegefachkraft geführt hatte. Das heißt, eigentlich war das hier gar keine richtige Intensivstation, sondern der Bereich, der von der Behandlung der Coronapatienten übrig geblieben war. In diesem Bett hatte bis vor Kurzem eine unbekannte Frau im Koma gelegen – und zwar schon seit mehreren Monaten. Vor ungefähr einem halben Jahr war die Bewusstlose von Bauern auf einem Feld nahe der Ortschaft Poppendorf im Itzgrund gefunden und sofort hierher nach Ebern ins Krankenhaus gebracht worden, das zwar in einem ganz anderen Regierungsbezirk lag, aber von der Entfernung her trotzdem das am nächsten gelegene Klinikum war. Entsprechend schnell hatte man sich um die Frau gekümmert und sie einer medizinischen Behandlung zugeführt. Außerdem wurde die Bamberger Polizei verständigt, da die Frau Verletzungsspuren am ganzen Körper aufwies. Woher die rührten und was zu ihrer Bewusstlosigkeit geführt hatte, vor allem aber ihre Identität blieb vorerst im Dunkeln. Die Frau hatte keine Ausweispapiere bei sich gehabt, es meldeten sich auch keine Angehörigen, sie wurde nicht als vermisst gemeldet, und weder die Fingerabdrücke noch ein Gebissabdruck noch ein DNA-Test hatte zu einem Treffer in den polizeilichen Archiven geführt. So blieb nur die Hoffnung auf ein baldiges Erwachen.
In Kürze hätte die unbekannte Frau laut Polizeidienststelle sogar Erwähnung in der Fernsehsendung »Aktenzeichen XY … ungelöst« finden sollen, um eventuell aus der Bevölkerung Hinweise auf ihre Identität zu erhalten. Aber das hat sich ja nun erledigt, dachte Dr. Zwack, als er das leere Bett betrachtete. Die Frau war verschwunden. Laut der Aussage seiner Krankenschwester hatte das Personal das gesamte Stockwerk gründlichst durchsucht, aber die Patientin war nirgends mehr aufzufinden gewesen, wie vom Erdboden verschluckt.
»Frau Dremmel, rufen Sie die Polizei, sofort«, lautete Zwacks Kommando, als er sich nach langen Sekunden der Selbstfindung endlich wieder äußern konnte.
Eine Ansage, die Gaby Dremmel sehr beruhigte. Hauptsächlich, weil die Last des ungenehmigten Verschwindens einer Patientin, noch dazu aus ihrem Verantwortungsbereich, dadurch von ihr genommen wurde.
»Den mit dem Schwein oder einen Normalen?«, fragte sie, aber ihr Chef hatte gerade keinen Sinn für solche Feinheiten.
»Ist mir völlig egal, Frau Dremmel, Hauptsache, es kommt sofort jemand, um mir das zu erklären«, stieß Rudolf Zwack hervor, bevor er sich auf dem einzigen freien Stuhl im Raum niederließ und inmitten der sonst summenden und piependen, aber mittlerweile abgestellten Gerätschaften allein zurückblieb.
Der erste Vertreter der Exekutive, der an der Brandstelle auf der Ackerfläche bei Unterbrunn eintraf, war der berühmt-berüchtigte Streifenpolizist Elias Webhan von der Polizeidienststelle Bad Staffelstein mit seinem Kollegen. Seinen zweifelhaften Ruhm hatte sich Polizeioberwachtmeister Webhan dadurch verdient, dass er es sich anscheinend in den Kopf gesetzt hatte, die Stadt Bad Staffelstein und deren weiteres Umfeld von abgefahrenen Reifen, sprich: Pneus mit zu geringer Profiltiefe zu befreien. Zu diesem Zweck führte der pflichtbewusste Polizist immer eine Schachtel Zündhölzer mit Strichmuster mit sich. Die selbst aufgemalte Skala erlaubte es ihm, die Profiltiefe am Reifen, unter dem Auto liegend, bis auf den Zehntelmillimeter festzustellen. Sein penibles Berufsverständnis führte dann durchaus das ein oder andere Mal zu einem aufgebrachten »Kundengespräch«, vor allem, wenn nur einer der vier Reifen eines Pkws gerade einmal ein Zehntel eines Millimeters unter der gesetzlichen Norm über fränkische Straßen rollte und deswegen vier Punkte und ein nicht unerheblicher Geldbetrag fällig wurden. Zudem schlug sich Elias Webhan zeit seines Lebens mit einer eher selten anzutreffenden Knopfphobie herum, welche ihm sowohl im privaten wie auch dienstlichen Bereich zu schaffen machte, vor allem aber seinem ohnehin angeknacksten Öffentlichkeitsbild zusätzlich noch abträglich war.
Heute hatte er sich mit seinem langjährigen Kollegen Polizeioberwachtmeister Alfons Schieler, der wie er noch knapp siebzehn Jahre von der Pensionierung entfernt war, auf einer eher ereignislosen Streifenfahrt durch die oberfränkische Nacht befunden, als ein Anwohner aus der kleinen Ortschaft Unterbrunn um kurz nach Mitternacht per Notruf ein großes Feuer auf freiem Feld meldete. Da sich die Beamten sowieso gerade ganz in der Nähe, nämlich auf dem Weg von Döringstadt nach Ebensfeld befunden hatten, waren sie bereits wenig später vor Ort und konnten als die schon erwähnten Ersten das flammende Schauspiel betrachten.
Man musste kein ausgebildeter Landwirt sein, um zu erkennen, dass dort auf dem Acker gerade ein ziemlich großer Mähdrescher abfackelte. Ein durchaus eindrucksvolles Schauspiel mit nicht unbeträchtlicher Hitzeentwicklung. Elias Webhan hatte schon so manches Fahrzeug brennen sehen, ein Mähdrescher war bis jetzt noch nicht dabei gewesen. Der Brand schloss sozusagen eine Lücke im Erfahrungsspeicher seiner langjährigen Laufbahn, abgefackelte Nutzfahrzeuge vom Pkw bis zur landwirtschaftlichen Erntemaschine betreffend. Ein wenig irritierend für die beiden Polizeibeamten war der Umstand, dass direkt am Straßenrand ein großer Löschzug mit Bamberger Kennzeichen parkte, um den sich zahlreiche Feuerwehrmänner in voller Montur gruppierten, die aber keinerlei Anstalten machten, sich dienstlich mit dem brennenden Mähdrescher zu beschäftigen. Ganz im Gegenteil, der große Löschzug hatte den Motor und die Lichter aus, und die dazugehörigen Feuerwehrmänner lehnten ziemlich relaxt, ja fast gelangweilt an ihrem Einsatzfahrzeug und betrachteten das Ganze mit betontem Desinteresse. Einige plauderten, einer rauchte.
Als Elias Webhan einen der Feuerwehrmänner, der sich gerade aufreizend genussvoll eine Zigarette angesteckt hatte, ansprach und ihn ratlos fragte, wieso sie denn das Feuer nicht einfach löschten, wo sie schon einmal hier waren, erhielt er eine zutiefst befremdliche Antwort.
»Der Kommandant vo die Ebensfelder Feuerwehr war vorhin da und hat uns zamgschissn, was mir da wollen. ›Des is unner Brand‹, hader sacht. Des is hier Landkreis Lichtenfels, ergo geht des die Zapfendorfer Feuerwehr gar nix aa. Mir Zapfendorfer körn zum Bambercher Landkreis, also is des ned unner Feuer, sondern des vo die Ebensfelder Feuerwehr. Des is unner Brand, hader sacht. Mir sollen gefälligst Leine ziehen, und zwar schnell. Also stehn mir halt etzerd da und guggn zu, wie der Mähdrescher runnerbrennt. Is ach amal ganz schö, aber an Feuerwehrler tut es a weng weh«, meinte der Angesprochene unter beredtem Grinsen der anwesenden Kollegen aus dem Bamberger Landkreis.
Elias Webhan verstand die Logik nicht wirklich, seine Gedankengänge wurden jedoch von den Sirenen eines sich schnell nähernden Einsatzfahrzeuges unterbrochen, welches sich als Löschzug der Ebensfelder Feuerwehr entpuppte, der, mit sämtlichen akustischen wie lichttechnischen Warnfunktionen aufwartend, aus nördlicher Richtung angefahren kam. Die Mannschaft war offenbar ziemlich gut trainiert, denn in kürzester Zeit war der Löschzug geparkt, die Feuerwehrmänner aus dem Fahrzeug gesprungen und der Schlauch entrollt. Binnen Minutenfrist traf ein armdicker Wasserstrahl auf den brennenden Mähdrescher und lieferte sich mit den daraus emporschlagenden Flammen einen heftigen Kampf.
Sofort nach dem Eintreffen der Ebensfelder Feuerwehr gingen Elias Webhan und Alfons Schieler dazu über, das Feld, auf dem sich der brennende Mähdrescher befand, gegen neugierige Passanten abzusichern, während die Mannen von der Zapfendorfer Feuerwehr (Landkreis Bamberg) in ihren Löschzug stiegen und ohne Eile die Heimreise antraten. Die beiden Polizeibeamten bekamen davon nur am Rande etwas mit, zu sehr waren sie mit ihrer improvisierten Absperrung aus Steckpfosten und rot-weißem Absperrband beschäftigt. Zwar fuhren um diese Zeit nur sehr wenige Fahrzeuge durch die Nacht, von denen kaum eines wirklich angehalten hätte, aber Vorschrift war nun mal Vorschrift. Die Aktion dauerte auch nicht allzu lange, aber immerhin lange genug, um am Ende ihrer Sicherungsarbeiten festzustellen, dass die Ebensfelder Feuerwehr noch schneller gearbeitet hatte als sie. An dem landwirtschaftlichen Arbeitsgerät züngelten nur noch kleine Flämmchen, dafür umso mehr dichter, grauer Rauch empor, der von den Scheinwerfern des Löschzuges angeleuchtet wurde. Ein Feuerwehrmann winkte ihnen von der Brandstelle aus zu, woraufhin sich Webhan und Schieler in Richtung Mähdrescher in Bewegung setzten.
Je näher sie der Brandstelle kamen, umso deutlicher wurde das Ausmaß der Zerstörung. Das landwirtschaftliche Fahrzeug der Marke »Claas« rauchte zwar noch gehörig aus allen Öffnungen, aber der immense Schaden war unübersehbar.
»Der hat seinen letzten Halm gemäht«, stellte Alfons Schieler unnötigerweise fest, während sein Kollege Webhan sofort die dahingeschmolzenen Reifen des Mähdreschers in Augenschein nahm. Der Grund für dieses besondere Interesse seines Kollegen an den abgefackelten Pneus war Schieler zuerst nicht so ganz klar, er wollte ihn aber auch gar nicht wissen, sondern wandte sich einem der Feuerwehrleute zu, der gerade einen der verwendeten Schläuche zusammenrollte. »Hallo, wo ist denn euer Kommandant? Beziehungsweise wer kann mir was Erhellendes über die Brandursache erzählen?«, fragte er.
»Unner Kmandand, der Bressig-Daniel, is zum Sporath gfahrn, damit der Bescheid waaß, dass sei Mähdrescher brennt«, entgegnete der in seine rollende Tätigkeit vertiefte Feuerwehrmann eher beiläufig. »Ich glaab ned, dass des lang dauert, bis der widder da is. Der is ja noch ned lang Kommandant und deswechen ziemlich engagiert.« Sprach’s und rollte mit der ihm eigenen Gleichmütigkeit den immer umfangreicher werdenden Schlauchkringel an Polizeioberwachtmeister Schieler vorbei in Richtung Straße.
Der nahm die Antwort einfach mal so hin. Seine Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass mit einem fränkischen Feuerwehrmann im Einsatzstress nicht wirklich zu diskutieren war. Auch wenn das Feuer inzwischen ein gewesenes war und eigentlich kein Grund für beruflich bedingte Adrenalinschübe mehr vorlag, ein Feuerwehrbeamter war immer im Stress, immer, so viel wusste Alfons Schieler inzwischen.
Für länger andauernde diesbezügliche Überlegungen gab es keinen Grund und jetzt auch keine Zeit mehr, denn ein weiterer Löschzug näherte sich mit rotierenden Lichtern und lautem Sirenengeheul der Brandstelle, bis er schließlich an genau der Stelle bremste und anhielt, an der noch vor wenigen Minuten der Löschzug der Zapfendorfer Kollegen gestanden hatte. Herausgesprungen kamen zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine der beiden, in Einsatzkleidung der Brandbekämpfung gehüllt, musste der besagte junge, engagierte Polizeikommandant Daniel Bressig sein. Der andere Typ gab Schieler allerdings Rätsel auf. Im Grunde war der Mann nackt, bekleidet nur mit einer Art Schal, den er sich um die Hüften geschlungen hatte und unter dem bei genauerem Hinsehen eine knallrote Unterhose hervorblitzte. Mutmaßlich stand hier der Biolandwirt vor ihm, dem sowohl Mähdrescher als auch Acker gehörten. Alles in allem hatte Schieler beim Anblick dieser Erscheinung jedoch eher die Assoziation eines fränkischen Land-Tarzans, den man gerade zu dessen eigener Verblüffung von seinem Baum geholt und aus dem Wald geschleppt hatte. Der Mann stand nämlich sekundenlang mit völlig entgleisten Gesichtszügen und weit offenem Mund vor der verkohlten Dreschmaschine, bis ihm schließlich doch eine halbwegs deutliche Aussage über die Lippen kam.
»Mei Mähdrescher …«, ließ er fassungslos vernehmen.
Aha, Tarzan war also endlich ansprechbar – eine gute Gelegenheit, sich der Brandursache ein wenig anzunähern, dachte Polizeioberwachtmeister Alfons Schieler und nahm die Sache in die Hand.
Eigentlich wäre für den seltsamen Fall der aus dem Krankenhaus in Ebern verschwundenen Patientin ja die unterfränkische Polizei zuständig gewesen, aber da die Frau vor einem halben Jahr im Landkreis Bamberg gefunden worden war, oblagen die Ermittlungen in ihrem Fall der dortigen Polizeibehörde, wie Dr. Zwack seither gelernt hatte. Also war er nicht sonderlich erstaunt, als derselbe seltsame Polizist bei ihm auftauchte, der schon damals den Fall für die Bamberger Kripo aufgenommen hatte. Ein dünner Typ in abgewetzten Jeansklamotten und zerknautschten Cowboystiefeln mit dünnem Pferdeschwanz und einer völlig deplatzierten Sonnenbrille. Dieser Kommissar Schmitt stand in den exakt gleichen Klamotten vor ihm wie vor einem halben Jahr, als hätte er sie seitdem nicht gewechselt. Dafür, dass dem nicht so war, würde der Chefarzt die Hand aber bestimmt nicht ins Feuer legen.
Und natürlich hatte der Kriminalbeamte im Outfit eines nordamerikanischen Kuhhirten auch wieder dieses kleine Minischwein auf dem Arm, welches er schon beim letzten Mal dabeihatte. Ein schwer zu akzeptierender Umstand für den medizinischen Leiter eines Krankenhauses. Aber bitte, das Tier war ja wenigstens klein. So ungefähr Hamstergröße, nur viel dicker, schwarz-rosa gefleckt und damit zumindest optisch zu vernachlässigen.
»Also gut, ich habe das jetzt verstanden«, fasste Bernd »Lagerfeld« Schmitt zusammen. »Diese Frau ist von einem Moment auf den anderen verschwunden. Sie wissen nicht, ob sie das allein vollbracht hat oder ob wir es hier mit einer Entführung zu tun haben. Während sie im Koma lag, sind ihre Verletzungen gut verheilt, körperliche Einschränkungen hat sie also wohl keine mehr. Die Krankenhauskluft wurde abgelegt, und die Patientin oder sonst jemand hat sich wieder ihrer eigentlichen Kleidung bemächtigt, die gereinigt und gewaschen in einem Korb neben dem Bett gestanden hatte.« Prüfend schaute er Dr. Zwack an, der zustimmend nickte. »Wenn ich das richtig sehe, haben wir zudem ein Zeitfenster von circa drei Stunden, in denen das Bett der Patientin unbeobachtet war. In dieser Zeit muss sie sich entfernt haben – oder wurde entfernt.«
Eine steile These, auf die der Chefarzt aber nicht einging, solcherlei Spekulationen waren schlicht nicht sein Metier. Der Cowboykommissar beugte sich unterdessen nach unten, stellte das Hamsterschwein zum Missfallen des Arztes auf den Zimmerboden und schaute sich suchend auf dem Bett um, in dem die Unbekannte gelegen hatte. Dann griff er sich, ohne zu zögern, eines der unsortiert auf dem Bett herumliegenden Kleidungsstücke und hielt es seinem Minischwein unter die Nase.
»Such, Presssack, such«, sagte der Kommissar, und nach kurzem Schnüffeln setzte sich das kleine Hamsterschwein auch schon in Bewegung. Es zog heftig an seiner Leine, als Lagerfeld noch etwas sehr Wichtiges einfiel. »Sagen Sie mal, gibt’s eigentlich Kameras hier im Krankenhaus, die etwas aufgezeichnet haben könnten?«
Dr. Zwacks Gesicht erhellte sich, und er nickte. »Ja, stimmt, gut, dass Sie fragen. Allerdings nur für diese Station hier, im Rest des Hauses nicht.«
»Ich brauche die Aufnahmen der letzten vierundzwanzig Stunden, ich hole sie irgendwann ab«, rief Lagerfeld rasch, denn er wurde der schweinischen Urgewalt an seiner Leine kaum noch Herr. Er winkte dem Arzt noch einmal lächelnd zu, dann ließ er sich von seinem tierischen Assistenten aus dem Zimmer hinausziehen.
Lagerfeld hegte zwar keinerlei Zweifel, dass sein vierbeiniger Lehrling nahtlos an die letzten Erfolge seiner noch jungen Karriere als Riechdienstleister anknüpfen würde, trotzdem war er von der Vehemenz überrascht, mit welcher der kleine Presssack vorwärtsstrebte. Seine Mutter Riemenschneider war ja schon ein Ass in dieser Hinsicht gewesen, aber ihr kleiner, dicker Sprössling schaffte es bereits im zarten Pubertätsalter, ihre Leistung in den Schatten zu stellen. Und das nicht nur in Bezug auf seine Schnüffelkünste, sondern auch, was seine Entschlossenheit anbelangte. Denn obwohl der kleine Presssack nur ein bestenfalls zur Hälfte ausgewachsenes Minischweinchen war, entwickelte er im Falle der polizeilichen Auftragserteilung Fähigkeiten, die weit über das normale Maß hinausgingen. Bei Kriminalkommissar Lagerfeld keimte seit geraumer Zeit der Verdacht, dass Presssacks rundlicher Körperbau womöglich weit weniger aus Fett als vielmehr aus gut versteckter Muskelmasse bestand. Denn wenn sich die vier kurzen Beinchen einmal in den Boden stemmten und der adrenalingeschwängerte Körper Fahrt aufgenommen hatte, dann musste er, Bernd Schmitt, als Presssacks Hüter und Lenker beide Hände zu Hilfe nehmen, damit sich sein Schützling nicht selbstständig machte und trappelnden Fußes in der Ferne verschwand.
Jetzt gerade steuerte Presssack, die Nase immer dicht am Boden, zuerst die Treppen ins Erdgeschoss hinunter, dann zielgenau auf den Ausgang zu, was tendenziell schon einmal auf eine eigenbestimmte Flucht aus dem Eberner Krankenhaus hindeutete. Hätte irgendwer die Frau beispielsweise in Entführungsabsicht betäubt und aus der Klinik hinausgefahren oder -getragen, hätte selbst ein so begabtes Ermittlerschwein wie Presssack seine liebe Not damit gehabt, die Spur aufzunehmen. Weshalb die Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit selbstständig unterwegs gewesen war, bestenfalls mit einer Person an der Seite, die sie womöglich dazu gezwungen hatte. Aber das waren nur Spekulationen, jetzt zählten Fakten, und es musste vordringlich festgestellt werden, wohin diese Frau, aus welchen Gründen auch immer, gegangen war.
Am Ausgang angekommen, stoppte Presssack, schnupperte wie wild am Boden und stemmte dann seine Beine gegen die Wand, welche die Pforte mit der dahinter sitzenden Empfangsdame beherbergte. Die schaute ziemlich verdattert auf das kleine Ferkel, das allem Anschein nach Anstalten machte, ihre Personenabgrenzung hinaufzuklettern und die gute Frau namens Elfi Müller in ihrem Arbeitsbereich zu besuchen. Ein Ferkel wäre zu solch einer Kletterübung natürlich niemals fähig, aber ungute Gefühle beschlichen die Pfortenfrau dann doch, und sie entspannte sich erst, als Lagerfeld die Kommunikation übernahm. Er zog einmal streng an der Leine, sodass Presssack wieder auf allen vieren landete, und hielt seinen Dienstausweis in die Höhe.
»Schmitt, Kriminalpolizei Bamberg. Hat sich heute Morgen vielleicht eine Frau hier aufgehalten beziehungsweise ist zu Ihnen gekommen, die sich irgendwie auffällig oder verdächtig benommen hat? Haben Sie da etwas mitgekriegt oder sogar etwas Ungewöhnliches an ihr festgestellt?«
Was für eine blöde Frage, dachte Elfi Müller, sie kriegte alles und jeden mit, der hier rein- oder rausging.
»Ja, natürlich. Sie meinen sicher diese junge Frau mit dem ausländischen Einschlag«, gab sie bereitwillig Auskunft. »Die kam mir zuerst ein wenig desorientiert vor, hat sich dann aber ganz normal mit mir unterhalten. Sie fragte mich, ob sie kurz telefonieren dürfe. Ich habe ihr das Telefon gereicht, und sie hat sich mit irgendjemandem in Ebern verabredet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Dann hat sie sich höflich bedankt und ist sofort zur Tür rausgegangen. Wohin, weiß ich natürlich nicht. Aber gehumpelt hat sie, das ist mir aufgefallen. So ganz rund läuft die noch nicht, hab ich mir gedacht.«
Mehr musste Lagerfeld im Moment auch gar nicht wissen. Demnach hatte die Patientin das Krankenhaus allein verlassen, ohne fremdes Zutun, und war offenbar bei klarem Verstand gewesen. Mit dieser Information konnte er schon einige Szenarien ausschließen. Blieb nur noch, die Frau möglichst schnell zu finden, dann konnte er den Fall als gelöst zu den Akten legen. Aber erst dann, denn vorher musste noch die Frage geklärt werden, wo sie sich die schweren Verletzungen eingefangen hatte, die sie überhaupt erst ins Koma beförderten. Denn entweder war an der Frau eine schwere Straftat begangen worden – oder sie war an einer beteiligt gewesen. Lagerfeld verabschiedete sich daher freundlich von der Pforten-Elfi und verließ zusammen mit Presssack das Eberner Klinikum.
Während Bernd Schmitt in Gedanken versunken dem wild an der Leine ziehenden Ferkel folgte, kramte er noch einmal alle Fakten aus seinem Gedächtnis, die den Fall der namenlosen Komapatientin betrafen. Vor fast genau sechs Monaten, also Ende Januar, war die unbekannte Frau auf einem Feld in der Nähe der Ortschaft Poppendorf im Itzgrund gefunden worden, nur wenige Meter von der Grenze zum Landkreis Coburg entfernt. Da sich der Fundort aber in der Gemeinde Rattelsdorf, also im Landkreis Bamberg, befand, war die Bamberger Kripo für die Unbekannte zuständig gewesen. Der damalige Zustand der Frau war einfach nur als fürchterlich zu beschreiben gewesen, und es bestanden Zweifel, ob sie den nächsten Tag überhaupt noch würde erleben können.
Lagerfeld hatte die Patientin damals im Eberner Klinikum besucht und sofort bemerkt, dass die junge Frau, er schätzte sie auf maximal fünfundzwanzig Jahre, konnte wegen ihres aufgequollenen Gesichts aber nicht hundertprozentig sicher sein, einen orientalischen Einschlag hatte. Vielleicht waren sie oder ihre Eltern oder Großeltern aus der Türkei oder dem Iran eingewandert, oder sie hielt sich als Asylsuchende in Deutschland auf. Einen rein deutsch-fränkischen Eindruck machte sie mit ihren schwarzen Haaren und dem dunklen Teint auf Lagerfeld jedenfalls nicht. Hier war womöglich der Grund dafür zu vermuten, dass jemand die junge Frau ihrem optischen Zustand nach übel zusammengeschlagen, sie nach Strich und Faden verprügelt hatte, was die Röntgenergebnisse auch bestätigten. Gebrochene Rippen, ein Milzriss und Hämatome am ganzen Körper, um nur einen kurzen Auszug der erlittenen Verletzungen wiederzugeben. Außerdem hatte die Unbekannte einen Schädelbasisbruch, der letztendlich zu dieser lebensbedrohlichen Gesamtsituation geführt hatte.
Als er damals mit Presssack den Fundort der Frau abgesucht hatte, stellte sich heraus, dass ihre Spur bis zur ungefähr einhundert Meter entfernten Bundesstraße 4 zurückzuverfolgen war, dann endete sie abrupt. Dort, am Aussiedlergehöft »Kaltenherberg«, schien man sie aus dem Auto geworfen zu haben. Danach hatte sie es den Spuren zufolge teils gehend, teils kriechend geschafft, die einhundert Meter über ein freies, von nächtlichem Schnee überzuckertes Feld zurückzulegen, ehe sie schließlich bewusstlos wurde und von Spaziergängern auf dem gefrorenen Boden liegend aufgefunden worden war. Dass sie bei diesen Temperaturen und schwer verletzt überhaupt überlebt hatte, grenzte eigentlich an ein Wunder; andererseits waren es gerade die kalten Temperaturen, die den Blutfluss so sehr verlangsamt hatten, dass sich der Blutverlust noch einigermaßen im Rahmen gehalten hatte.
Im Nachgang hatte Lagerfeld Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, wer diese Frau war. Aber es war wie verhext gewesen. Niemand kannte sie, niemand vermisste sie, niemand hatte je von dieser Frau gehört. Er suchte in Flüchtlingsheimen, Frauenhäusern, Vermisstenmeldungen – doch die Ausbeute war gleich null. Irgendwann hatte er den Fall ungelöst zu den Akten gelegt und gehofft, dass die Unbekannte aus ihrem Koma erwachen und das Geschehene selbst aufklären würde. Der erste Teil hatte sich nun erfüllt, der zweite eher nicht.
Presssack hatte inzwischen ein erkleckliches Stück Strecke in Richtung Eberner Innenstadt zurückgelegt, dabei zwei Kreisverkehre umrundet und Bernd Schmitt unter dem immer häufiger werdenden Grinsen und Gekicher der Menschen, die ihnen begegneten, hinter sich hergezogen. Am Marktplatz in der Nähe einer Kirche angekommen, blieb er plötzlich stehen und beschnüffelte eifrig den Boden des Fußgängerweges. Dabei drehte er sich mehrmals im Kreis, lief zehn Meter vor, zehn Meter zurück – für den Kommissar das untrügliche Zeichen, dass Presssack am Ende der Spur angelangt war. Dann jedoch setzte sich das Tier gänzlich unerwartet wieder in Bewegung, und zwar in Richtung einer ungefähr zwanzig Meter entfernt liegenden Sparkasse. Hier beschnüffelte Presssack erneut den Boden, nur um gleich darauf wieder umzukehren und die zwanzig Meter schnurstracks zurückzulaufen.
Als sich sein Ermittlerschweinchen in Ausbildung schließlich auf den Hosenboden setzte und erwartungsfroh zu ihm nach oben blickte, sah Bernd Schmitt seine Vermutung bestätigt: Hier verlor sich die Spur; die Unbekannte hatte wahrscheinlich das Transportmittel gewechselt beziehungsweise war überhaupt erst in eines eingestiegen, sodass der Mitarbeiter Presssack das Hinterherschnüffeln aufgeben musste, da konnte er so begabt sein, wie er wollte.
Lagerfeld schaute sich auf dem Eberner Marktplatz um. Er war hier bisher nur ein- oder zweimal durchgefahren, angehalten hatte er noch nie. Wozu auch? Dies war der letzte Zipfel des Landkreises Haßberge und damit die dunkle Heimat der landesweit bekannten Straßenverkehrsterroristen mit Haßfurter Autokennzeichen. Immerhin musste man den Ebernern zugutehalten, dass sich, sobald dies rechtlich möglich gewesen war, so ziemlich jeder von ihnen das alte Landkreisnummernschild EBN ans Auto geschraubt hatte, um von anderen Verkehrsteilnehmern nicht sofort und gleich als Haßfurter identifiziert zu werden. So etwas konnte durchaus übel enden, wie manch einer leidvoll zu berichten wusste.
Wie auch immer. Neben ihm war die Eberner Sparkasse in einem historischen Gebäude untergebracht, an denen es in dieser Stadt ja wirklich nicht mangelte. Ebern war stolz auf seinen historischen Stadtkern, der von den Kriegswirren und den stadtplanerischen Exzessen Nachkriegsdeutschlands weitestgehend verschont geblieben war. Auf der anderen Straßenseite befand sich das alte Rathaus und direkt gegenüber ein mexikanisches Restaurant namens »Veracruz«. Wie sich ein mexikanischer Wirt ausgerechnet in das kleine Städtchen Ebern verirren konnte, musste man auch erst mal begreifen. Jedenfalls schien es sich wie so oft um eine alte fränkische Gastwirtschaft zu handeln, in der ausnahmsweise kein Italiener oder Grieche seine Zelte aufgeschlagen hatte, sondern eben ein Mexikaner. Lagerfeld speicherte die exotische Lokalität innerlich ab, wer wusste schon, ob er hier in Ebern nicht noch länger zu tun hatte und einmal Hunger bekam.
Apropos Essen, er holte eine kleine Tüte mit gekochten Kartoffelstückchen aus seiner Jackentasche, beugte sich nach unten und lobte seinen schweinischen Mitarbeiter mit warmen Worten über den grünen Klee. Dann verfütterte er die wohlverdiente Belohnung an den neuen Star am Bamberger Ermittlerhimmel. Es würden hier in Ebern jetzt einige Befragungen nötig sein, und dazu mussten sich alle Mitarbeiter in einem akzeptablen Allgemeinzustand befinden. Im Falle seines Auszubildenden Presssack nannte sich dieser Zustand »satt«. Also sorgte Lagerfeld dafür, dass sein Mitarbeiter in selbigen versetzt wurde, was ihm mit den mitgebrachten Kartoffelstückchen auch gelang.
Presssack vertilgte seine Lieblingsspeise mit Ruhe und Gründlichkeit. Er war zwar noch jung, aber er hatte schon mitbekommen, dass er, obwohl noch in Ausbildung, es bereits zu einem gewissen Status gebracht hatte, was sein Ansehen betraf. Immer wenn er eine Aufgabe erfüllt hatte, die das Auffinden von irgendwelchen Dingen mittels seiner außerordentlichen Geruchsfähigkeiten beinhaltete, gab es zum Schluss haufenweise Lob und Anerkennung, Streicheleinheiten im Überfluss und, das war mit Abstand das Wichtigste, haufenweise gekochte Kartoffeln. Auch jetzt war sein Herr und Meister mit der soeben erbrachten Leistung wieder sehr zufrieden, die Kartoffeln waren der eindeutige Beweis.
Als Presssack irgendwann alle Kartoffeln aufgefuttert hatte, wurde es Zeit, mit der üblichen, wenn auch eintönigen Polizeiarbeit fortzufahren. Das hieß im Klartext: Zeugen befragen. Womöglich war die Frau ja hier in der Eberner Innenstadt von irgendwem gesehen worden. Vor der Befragung mussten sie diese Zeugen aber zunächst einmal finden, das bedeutete: die umliegenden Häuser abklappern, in der Hoffnung, dass jemand die Frau bemerkt hatte – und wenn es auch nur beiläufig gewesen war. Dann folgte der Teil der polizeilichen Arbeit, den Lagerfeld eigentlich ganz gern erledigte. Mit Leuten umgehen, in sie hineinspüren, des Franken Seele und Gemütszustand erforschen, um dann die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen in die Ermittlungsarbeit einfließen zu lassen, das war seine, Bernd Schmitts, große Stärke. Mochte sein älterer Kollege Franz Haderlein auch viel erfahrener, César Huppendorfer korrekter und Andrea Onello scharfsinniger sein. Am Ende kriegten sie oft nicht das aus den Leuten heraus, was sie eigentlich wissen wollten. Ihre Möglichkeiten, dem Franken auch noch das letzte Geheimnis zu entlocken, waren begrenzt. Diese Fähigkeit – sich mit einem Franken oder einer Fränkin so zu unterhalten, dass die merkten: Der Typ ist wie ich, der versteht mich irgendwie, dem erzähl ich das, was ich eigentlich für mich behalten wollte – blieb ihm vorbehalten.
Also gut, in diesem Sinne voran, dachte Lagerfeld und schaute sich noch einmal gründlich um. Wo sollte er beginnen? Hinter einem alten Brunnen auf der gegenüberliegenden Platzseite entdeckte er ein paar Tische und Stühle, ein Mann spannte gerade einen großen, viereckigen Sonnenschirm darüber auf. Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich das kleine Arrangement als italienische Eisdiele. Lagerfeld klaubte die Leine seines sehr zufrieden wirkenden Auszubildenden vom Boden auf und hielt darauf zu. Es war zwar noch früh, aber vielleicht hatte die Eisdiele schon geöffnet und der Besitzer irgendetwas von der Frau mitbekommen. Lagerfeld setzte sich an einen der kleinen Tische des Eiscafés »Alpi« und band Presssacks Leine an seinem Stuhl fest. Der Auszubildende bevorzugte den Schatten unter dem Tisch, wo er mit dem gepflasterten Untergrund optisch schier verschmolz.
Es dauerte nicht lange, und der noch recht jung wirkende Besitzer kam mit geschäftsfreundlichem Lächeln aus seinem Café herausgeschritten. Lagerfeld wusste sofort, mit welchem Typ Mensch er es hier zu tun hatte. Das da war höchstwahrscheinlich der Sohn des italienischen Cafégründers. Circa vierzig Jahre alt, geschäftstüchtig, Spross einer italienischen Einwandererfamilie, selbst aber hier in Franken aufgewachsen. Also eine Mischung aus deutscher Gründlichkeit, fränkischem Lebenssinn und italienischer Lässigkeit. Oder, um es für Außerfränkische begreifbar zu machen: Dieser Mann bewältigte seine Lebensaufgaben mit fränkischem Gemüt, deutscher Gründlichkeit – aber nicht gleich, lieber erst morgen.
»Schönen guten Morgen, der Herr, womit kann ich dienen?«, fragte der Besitzer des Cafés und legte eine aufwendig gestylte Eiskarte vor Lagerfeld auf den Tisch.
»Ein Spaghettieis mit viel Sahne und einen Cappuccino bitte«, antwortete Bernd Schmitt wie aus der Pistole geschossen, ohne dass er auch nur den geringsten Blick in die Karte geworfen hätte.
»Alles klar, vielen Dank.« Die Karte wieder an sich nehmend, drehte er sich um und eilte ins Innere seiner gastronomischen Räumlichkeiten zurück.
Lagerfeld konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Auf das neidische Gesicht seiner italoaffinen Kollegin Andrea Onello, wenn sie erfuhr, dass er hier im Zuge seiner Polizeiarbeit ein italienisches Eis plus Cappuccino bestellt hatte, freute er sich schon jetzt. Ihr Faible für alles Italienische kam nicht von ungefähr, schließlich hatte die Frau ja erkleckliche Zeit ihres Lebens mit einem italienischen Ehemann verbracht, wenn auch mit mäßigem Erfolg. Immerhin hatte sie aus dieser Ehe noch den Nachnamen behalten. Lagerfeld für seinen Teil hatte trotz grundsätzlicher Sprachgewandtheit fürs Italienische nicht viel übrig und schon gar nicht für Spaghettieis, so etwas würde er niemals freiwillig essen, aber das konnte der Eiscafébesitzer ja nicht wissen.
Da der Kommissar der einzige Gast war, spekulierte er auf eine relativ flotte Umsetzung seines Wunsches. Tatsächlich dauerte es eine ganze Weile, bis ihm sein Cappuccino inklusive einer riesengroßen Portion Spaghettieis gebracht wurde. Ehrlich gesagt hatte Lagerfeld mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Jetzt wurde ihm klar, wofür die ganze Zeit seit seiner Bestellung draufgegangen war. Das Eis sah tatsächlich aus wie echte Spaghetti, nicht so lieblos zusammengematscht wie in manch anderer italienischen Eisdiele. Die Erdbeersoße erweckte den Eindruck, aus sonnengereiften Tomaten hergestellt zu sein, und die Kokosflocken on top sahen original so aus wie Parmesan. Serviert wurden die »Spaghetti« auf einem ziemlich teuren Porzellanteller mit hochwertiger Malerei, dazu umrahmt von Minzblättern und Gewürzstreuseln.
Salvo di Maria, Betreiber des »Alpi«, bemerkte den interessierten Blick, den der fremde Gast auf den liebevoll dekorierten Teller mit dem perfekt drapierten Eis warf, und referierte sogleich bereitwillig, vor allem aber unaufgefordert die Zusammensetzung seiner kalten Komposition.
»Sie müssen wissen, mein Herr, das ist nicht irgendein Eis. Unsere Familie stellt diese Spezialität nach einem ganz besonderen Rezept her, sodass sich intensiver Geschmack auf unnachahmliche Weise mit dem zarten Schmelz unserer kulinarischen Kostbarkeit verbindet, sobald sie den Mundraum erreicht. Über Generationen wurde das Rezept weitergegeben und immer wieder aufs Trefflichste verfeinert, sodass wir mit Fug und Recht und voller Stolz behaupten können, das beste Eis in ganz Nordbayern zu servieren. Sollten Sie anderer Meinung sein, mein Herr, sollte Ihnen diese Köstlichkeit also wider Erwarten nicht zusagen, so bekommen Sie selbstverständlich auf der Stelle Ihr Geld zurück. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das in all den Jahren, die wir dieses Eis nun schon herstellen, noch kein einziges Mal passiert. Ganz im Gegenteil. Wir haben Stammkunden, die fahren Hunderte von Kilometern nur für dieses Eis. Sollten Sie sich also für gehobenste Ansprüche in der italienischen Gelateria begeistern, sind Sie hier bei uns genau richtig.« Di Maria nickte noch einmal bekräftigend und lächelte seinen Gast mit stolzgeschwellter Brust und der sicheren Gewissheit an, gleich ein überbordendes Lob für seine kulinarische Sensation zu erhalten.
Lagerfeld hatte sich den Vortrag aufmerksam angehört. Nicht dass ihn diese Arie über die Finessen italienischen Eisgenusses wirklich interessiert hätte, er selbst war ja nicht so der begeisterte Eisesser, aber man lernte schließlich nie aus.
»Okay, wenn Sie meinen. Dann bin ich ja mal gespannt«, antwortete er dem Eisdielenbesitzer nüchtern und fasste den Teller mit der rechten Hand.
Di Marias Augen begannen zu leuchten, denn gleich würde die erste Portion seiner Eissensation den Gaumen seines neuen Gastes umschmeicheln, und dann konnte nur das passieren, was einfach immer passierte. Ein Ausdruck des Erstaunens, gefolgt von absoluter Glückseligkeit, würde sich auf das Gesicht des Mannes legen. Dann begann seine Seele zu schweben, und die Welt um ihn herum verlor ihre Substanz und Gültigkeit. Nichts in seinem Dasein würde noch wichtig sein, Geld, Ruhm oder gar Sex würden zu absoluter Bedeutungslosigkeit degradiert werden. Er würde für den Rest seines Lebens nur noch dieses Eis essen wollen.
Lagerfeld nahm den Teller und stellte ihn auf den Boden, direkt vor Presssacks Nase. Zwar war sein kleiner Ermittler rundum kartoffelsatt, aber ein Eis ging immer, vor allem wenn es allem Anschein nach vom König der italienischen Eisherstellung, von Seiner Heiligkeit Salvo di Maria höchstselbst, zubereitet worden war. Presssack wedelte erfreut mit seinem geringelten Schwanz und machte sich mit laut hörbarem Schlabbern daran, die exquisite Komposition zu verschlingen.
Salvo di Marias Kopf war leicht zur Seite geneigt, da er das kleine Ferkel unter dem Tisch zuerst überhaupt nicht bemerkt hatte. In dieser Haltung erstarrte er ob des unfassbaren Frevels an seinem geheiligten Produkt. Das war nicht nur abscheulich, das war ein absoluter Affront. Ein Sakrileg, ein Verbrechen gegen die … Es fehlten ihm die Worte, um zu beschreiben, was er hier mitansehen musste. Ihm fiel auch gar nicht ein, wen er in diesem absoluten Katastrophenfall zu Hilfe rufen sollte, um Schlimmeres zu verhindern. Die Polizei, seine Mutter, den Papst? In personifizierter Hilflosigkeit rang Salvo di Maria nach Worten.
»Aber, aber …«, stotterte er mit weit aufgerissenen Augen und deutete mit wild flatterndem Zeigefinger auf das unwürdige Schauspiel unter dem Tisch.
Lagerfeld hielt es für geboten, die Unterhaltung in geordnete Bahnen zu lenken; er hatte keine Lust auf eine Szene mit einem emotional destabilisierten Eisbudenbesitzer. Er holte seinen Ausweis hervor und hielt ihn dem blutentleerten Eisgourmet direkt vor die Nase.
»Schmitt, Kripo Bamberg. Ich hätte Sie gern kurz befragt, wenn das ginge. Nehmen Sie doch Platz, damit Sie ein bisschen lockerer werden, Sie wirken etwas verkrampft.« Er deutete auf den Stuhl auf der anderen Seite des Tisches.
Die Augen di Marias, obwohl schon maximal geweitet, schienen ihren Radius noch einmal auszudehnen, sodass der gute Mann allmählich rüberkam wie ein Steinkauz mit Blinddarmentzündung. Der Tag hatte doch so entspannt begonnen, und jetzt dieser Doppelschlag des Schicksals. Ein Schwein, das sein Allerheiligstes kaputt fraß, und dann war der Typ auch noch von der Kriminalpolizei. Ganz plötzlich hatte Salvo di Maria das Bedürfnis nach einem Grappa, und zwar nach einem doppelten.
Bernhard Sporath starrte immer noch fassungslos auf seinen abgebrannten Mähdrescher, als er von schräg unten ein »Ha, wusste ich’s doch!« vernahm. Bei genauerem Hinsehen sah er im Mondschein schemenhaft zwei Beine unter dem Hinterteil seiner landwirtschaftlichen Maschine herausragen, allerdings entzog es sich seiner Kenntnis, zu wem diese blau behosten Extremitäten wohl gehören mochten. Aber abgebrannt oder nicht, das war sein Mähdrescher, also wollte er wissen, was der unbekannte Typ da unter seinem Mähdrescher verloren hatte.
»Was, was waaßt du? Wer bist denn du überhaupt?«, fragte er knurrig, während er gleichzeitig den Sitz seines behelfsmäßigen Lendenschurzes überprüfte. Abgebrannt oder nicht, das war sein Mähdrescher, also wollte er wissen, was der unbekannte Typ da unten verloren hatte.
Die Antwort vom Ackerboden ließ nicht lange auf sich warten.
»Der Reifen ist nicht komplett geschmolzen. Da sind noch ungefähr vier Quadratzentimeter Reifenfläche, die das Feuer nicht erwischt hat. Und siehe da, das Profil ist null Komma drei Millimeter unter der Norm. Des gibt Punkte in Flensburg, Sporath, vier Stück!«
Postwendend und ungeschönt hielt bei Sporath die unangenehme Erkenntnis Einzug, um wen es sich bei dem polizeilichen Rückenlieger handelte. Die Profiltiefe am Hinterrad eines abgebrannten Mähdreschers messen? Das konnte nur einer sein, Elias Webhan oder auch »Profil-Webhan«, wie man ihn im Staffelsteiner Umland hingebungsvoll nannte. Bernhard Sporath fasste es nicht. Was in Gottes Namen hatte er nur verbrochen, dass ihn der Herrgott so generös mit der Höchststrafe belegte? Nicht nur, dass sein nagelneuer Mähdrescher mutmaßlich mit pyrotechnischer Hilfe die oberfränkische Nacht illuminiert hatte, nein, nun musste ihm auch noch Profilmeister Webhan den Rest geben. Aber bitte, jetzt war es eh schon egal. Er stand hier halb nackt auf freiem Feld und schaute seiner sündhaft teuren Maschine beim Abrauchen zu, da konnte er auch noch vier Punkte in Flensburg verkraften, scheiß drauf.
»Moment, was ist denn das?«, ließ in diesem Moment eine andere Stimme vom hinteren Ende seines Mähdreschers verlauten.
Dessen rückwärtiger Teil war im Gegensatz zum vorderen mit seinem hochmodernen Klappschneidewerk von den Flammen nicht ganz so schlimm zugerichtet worden. Dies war auch der Grund, warum am Hinterrad des Mähdreschers überhaupt noch genug Gummi zum Profiltiefe Messen zu finden gewesen war. Die Flammen und die vom Brand ausgehende Hitze hatten sich noch nicht bis zum Heck vorgearbeitet, als die Ebensfelder Feuerwehr den Brand, wenn auch spät, hatte löschen können. Teilweise war sogar noch der grün-weiße Lack zu erkennen. Und eben hier, an besagtem Mähdrescherhinterteil, entdeckte Bauer Sporath nun Polizeioberwachtmeister Alfons Schieler mit seiner Taschenlampe. Mit versteinerter Miene starrte er auf den Strohauswurf, mit dem normalerweise, wenn die Getreidehalme den Hordenschüttler im Inneren der Maschine durchlaufen und ihre wertvolle Fracht abgeladen hatten, das übrig gebliebene Stroh verhäckselt oder, wie im vorliegenden Fall, einfach »unverdaut« auf das Feld ausgeworfen wurde.
Bernhard Sporath blickte zuerst ratlos in das erstarrte Gesicht des Polizeibeamten, dann dorthin, wo der Lichtkegel von Schielers Taschenlampe ruhte, nämlich auf den Strohauswurf seines Mähdreschers. Dort war im hellen Licht der Lampe nicht etwa das Produkt eines gemeinen Dreschvorganges zu sehen, dessen Reste aus dem Mähdrescher herausspitzten, mitnichten. Aus dem hinteren Ende des Claas AVERO 240 E, dem ersten rein elektrisch betriebenen Mähdrescher der Welt, hing kopfüber der verstümmelte Oberkörper einer menschlichen Gestalt. Der Schulterbereich dieses armen Menschen war gerade noch irgendwie zu erkennen, die Kleidung völlig zerfetzt und in Blut getränkt. Der Schädel hingegen war so heftig deformiert, dass sich Bernhard Storath sofort abwenden musste und sich ausgiebig in seinen Acker übergab.
»Sie heißen?«, fragte Lagerfeld den Eiscafébesitzer.
Salvo di Maria brauchte einige Sekunden, bis er sein erschüttertes Innenleben so weit sortiert hatte, dass er wieder in der Lage war, sich adäquat an einer einigermaßen kultivierten Unterhaltung zu beteiligen. Lagerfeld war das durchaus recht. Verunsicherte Persönlichkeiten waren im Ermittlungsfall ideale Gesprächspartner, da man bei einem derangierten Innenleben ziemlich sicher ehrlichere Antworten bekam, als wenn man eine gefestigte Persönlichkeit befragte, die sich jedes Wort genau überlegte. In dieser privilegierten Situation befand sich Eiscafébesitzer Salvo di Maria jedoch definitiv nicht, sein Innenleben war im Moment am genau anderen Ende der Gefühlsskala angesiedelt.
»Salvo di Maria. Ich bin der Geschäftsführer dieses … äh … Geschäfts«, stammelte der Eisgourmet verwirrt. »Was kann ich denn für Sie tun, Herr … äh … Kommissar?« Er sagte das mehr aus Höflichkeit, als dass er die Frage wirklich beantwortet haben wollte. Dabei schielten seine Ohren die ganze Zeit zu den akustischen Vorgängen unter dem Tisch, die ihm fast körperliche Schmerzen bereiteten.
Lagerfeld interessierten solcherlei Befindlichkeiten herzlich wenig, er hatte in einem Vermisstenfall, oder wie man das Verschwinden der unbekannten Frau auch immer nennen mochte, zu ermitteln.
»Es ist so, Herr di Maria: Ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau, die sich heute Morgen, vor nicht allzu langer Zeit, drüben auf der anderen Straßenseite aufgehalten hat«, erklärte Bernd Schmitt. »Schwarze Haare, Mitte zwanzig, leicht orientalischer Einschlag. Haben Sie die Frau vielleicht bemerkt?« Im Grunde rechnete er nicht mit einer ausführlichen Antwort, umso überraschter war er von dem, was er nun zu hören bekam.
»Ja, die habe ich gesehen, vor knapp zwei Stunden etwa«, erklärte Salvo di Maria, froh, etwas zu der Ermittlung beitragen zu können. Das lenkte ihn etwas von dem deprimierenden Schauspiel unter dem Tisch ab. »Sie stand drüben an der Sparkasse und hat die ganze Zeit zum Mexikaner hinübergestarrt. Kam mir ein wenig verwirrt vor, die Frau. Nicht so wie sonst.«
Jetzt war Lagerfeld aber mal so richtig verblüfft. Der italienische Eisfuzzi hier war ja ein richtiger Volltreffer! Und überhaupt, was meinte der Kerl mit »nicht so wie sonst«?
»›Nicht so wie sonst‹? Haben Sie die Frau denn schon öfter gesehen?«, fragte Lagerfeld schnell.
Di Maria nickte und sagte nachdenklich: »Ja, das ist aber schon eine ganze Weile her. Ich meine, es müsste letztes Jahr im Herbst gewesen sein. Da habe ich sie ein paarmal gesehen. War immer das Gleiche. Sie kam aus dem Mexikaner raus, stieg drüben an der Sparkasse in einen VW-Bus und fuhr weg. Dunkle Farbe, schwarz oder dunkelblau, irgend so was. Ob sie im Winter auch mal da war, weiß ich nicht, wir machen ja Mitte Oktober zu.« Er lächelte versonnen. »Die war hübsch, das ist richtig. Hat mir gefallen, sie heute mal wieder zu sehen.« Fast schien er die kulinarische Tragödie unter seinem Tisch vergessen zu haben. Aber nur bis zu dem Moment, als der kleine Presssack mit einem lauten Rülpser das Ende seiner Eisvernichtungsaktion bekannt gab. Dann kam noch ein weiterer hinterher, einer üppigen Nachspeise würdig.
»Ich glaube, ich zahle mal besser«, meinte Lagerfeld, als er in das immer blasser werdende Gesicht seines Gegenübers blickte.
Corona war vorbei, endlich, so dachte wohl so ziemlich jeder Bamberger in diesen Tagen und genoss den ersten unbeschwerten Sommer seit langer Zeit. Auf einer Polizeidienststelle war das mit dem Genießen allerdings immer so eine Sache. Natürlich war Ende Juli das Wetter angenehm und die Stimmung gut, so jedoch auch in der oberfränkischen Verbrecherschaft. War die Kriminalitätsrate während der Pandemie auch bemerkenswert gesunken, pünktlich zum Sommerbeginn und nach Einstellung aller staatlichen Impfmaßnahmen stieg sie wieder auf das übliche Niveau. Manch ein Bamberger Kommissar befürchtete sogar einen unterweltlichen Überschuss an krimineller Energie, der sich beizeiten in dem einen oder anderen Delikt entladen würde.
Im Moment war davon allerdings nur wenig zu spüren, der Sommer ging seinen gewohnten gemächlichen Gang. Vielleicht trug ja das fränkische Bier, das von Bamberger Herkunft im Besonderen, doch irgendwie zur Befriedung der allgemeinen Lage bei. Der größte Aufreger in der Polizeidienststelle Bamberg war also nicht die ansonsten allgegenwärtige Verbrechensbekämpfung, sondern zwei den Polizeiapparat betreffende Maßnahmen, welche direkt mit der neuen Ampelregierung in Berlin zusammenhingen. Zum einen wurde die Dienstwagenflotte der Bamberger Kripo gerade auf elektrischen Antrieb umgestellt, und zum anderen war vor Kurzem der private Konsum von Cannabis legalisiert worden. Dieses nette neue Gesetz hinterließ auch bei der Belegschaft der Bamberger Polizei ein gewisses Bedürfnis, die Möglichkeiten individueller Rauscherzeugung einmal selbst auszuprobieren. Zu diesem Zweck war für den heutigen Abend im »Greifenklaukeller« ein quasi halb dienstliches Event zur Marihuanaverkostung anberaumt worden.
Auf Nachfrage von Robert Suckfüll alias Fidibus, Chef der Behörde, wollte keiner seiner Angestellten jemals im Leben auch nur den geringsten Kontakt zu diesem neuerdings legalisierten Kraut gehabt haben. Der Einzige, der sich rein gar keine Mühe gegeben hatte, seine mannigfaltigen Erfahrungen im THC-Milieu zu verschweigen, war der Kollege Schmitt. Brüstete er sich doch ganz im Gegenteil sogar damit, sich in Zukunft ein zweites berufliches Standbein als Hanfsommelier aufbauen zu wollen. Dieses Ansinnen wurde von seinem Chef zwar mit einem nicht unerheblichen Widerstand bedacht, dienstrechtlich sprach jedoch nichts gegen sein Vorhaben. Natürlich nur so lange, wie Kriminalkommissar Schmitt nicht mit überhöhtem THC-Pegel in der Blutbahn zum Dienst erschien.
Für den heutigen Abend hatte sich ebenjener Kollege jedenfalls bereit erklärt, ein umfangreiches Sortiment an Cannabissorten zum Kennenlernen zu organisieren. Darüber hinaus hatte die Gemeinschaft der Testwilligen ausgemacht, dass der letzte Ankömmling die übrigen Probanden nach Hause befördern musste, da der wundersame Stoff der Marihuanapflanze eine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr ausschloss. Demnach musste sich einer oder eine opfern und auf rauscherzeugende Genussmittel verzichten. Völlig egal, ob die Marihuana, Alkohol oder Gummibärchen hießen. Und wie es das Schicksal so wollte, blieb dieser Job heute offensichtlich am selbst ernannten Grandseigneur des Hanfs, dem Sommelier der Veranstaltung, hängen. Da Lagerfeld heute als Einziger Dienst schieben musste, schienen sich bei seinen Tätigkeiten Schwierigkeiten ergeben zu haben, welche die Ausgeglichenheit der Anwesenden nun auf eine anhaltende Probe stellte. Ausgerechnet Fidibus, obschon als Chef der Dienststelle eigentlich der größte Hanfskeptiker am Tisch, wurde langsam ungeduldig ob der Verzögerung ihres Vorhabens durch den abwesenden Mitarbeiter Schmitt.
»Ja nun, liebe Untergebene«, eröffnete er seine kurze Ansprache. »Jetzt habe ich mich nach längerer Reifezeit tatsächlich dazu durchringen können, an dieser neulegalen Veranstaltung teilzunehmen, und dann werde ich hier zeitlich versetzt. Ich meine, ich habe immerhin Frau und Kind, denen ich meine nebenberuflichen Aktivitäten aufs Genaueste darlegen muss. Und inzwischen haben wir ja schon …« Robert Suckfüll blickte mit fiebrigem Blick auf sein Handgelenk, an dem sich zwar erste, der Nervosität geschuldete Schweißperlen befanden, jedoch kein Gerät, welches ihm die aktuelle Zeit vermitteln konnte. Also fuhr der Dienststellenleiter seine Extremität wieder ein, steckte sie in die Hosentasche und lamentierte weiter fröhlich vor sich hin. »Nun, was soll ich sagen. Gestern um diese Zeit war es jedenfalls schon halb acht. Unser Mitarbeiter Schmitt war ja noch nie der Zuverlässigste, was Pünktlichkeit anbelangt, womit ich seine durchaus besonderen Fähigkeiten nicht in Abrede stellen will. Aber was das Lesen einer Uhr betrifft, ist unser Kommissar Bernd Schmitt nicht gerade die hellste Torte. Ich meine sogar, dieser Schlingel will seinen Chef wieder einmal übers Ohr ziehen mit seiner ewigen Unpünktlichkeit. Das macht der doch mit Absicht, oder nicht? Was meinen denn Sie, Frau, äh, Dings, äh, Mann …«
Mit hektischem Blick adressierte Fidibus seine Sekretärin Marina Hoffmann alias »Honeypenny«, die bereits eine gesunde Gesichtsrötung aufwies, weil ihr langjähriger Chef wieder einmal ihren Namen vergessen hatte. Verpeilt oder nicht, das ging gar nicht. Man konnte ja ruhig einen Knall haben, auch als Chef einer Polizeidienststelle. Aber den Namen der engsten Vertrauten zu vergessen, die in der Bedeutungsrangfolge gleich hinter der ihm angetrauten Ehefrau rangierte, das war schon starker Tobak.
Honeypennys Zornesfalten schwollen an, und der Adrenalinspiegel in ihrem durchaus wohlgenährten Körper schoss ungeahnten Pegelständen entgegen, als endlich der sehnlichst erwartete Hanfsommelier Schmitt an den Tisch der kriminalen Belegschaft geeilt kam. Marina Hoffmann verkniff sich die bissige Bemerkung gegenüber ihrem Chef. Lagerfeld wirkte tatsächlich etwas abgehetzt, und auch sein Auszubildender machte nicht mehr den allerfrischesten Eindruck.
»Tut mir leid, ich hatte mit Presssack erst in Ebern zu tun, dann haben im Büro alle möglichen Leute angerufen und wollten irgendwelche Nebensächlichkeiten wissen. Also bin ich jetzt erst losgekommen. Ich habe es nicht einmal mehr geschafft, Presssack bei deiner Holden abzugeben, Franz«, ließ Lagerfeld pflichtschuldigst verlauten, dann reichte er das kleine Ferkel mit einem flehenden Blick, der sämtliche Gletscher dieser Welt auf einmal zum Schmelzen hätte bringen können, zu Honeypenny hinüber.
Die übrigen Anwesenden konnten sich ein Grinsen nicht verbeißen. Weder César Huppendorfer, der wie immer elegant gekleidete Halbbrasilianer, noch Andrea Onello noch der von Lagerfeld angesprochene Franz Haderlein, dessen Lebensgefährtin Manuela heute eigentlich beherbergungstechnisch für den kleinen Presssack zuständig gewesen wäre. Aber so kam das junge Ermittlerferkel unversehens zu einer Weiterbildungsmaßnahme im Bereich fränkischer Lebensvollzug. Heute mit dem Thema Tradition versus Innovation oder, anders ausgedrückt, Bier gegen Cannabis. Ein durchaus spannendes Duell, dessen überdurchschnittlicher Bedeutungsgehalt dem schwarz-rosa gefleckten Ferkel aber gerade buchstäblich am Hintern vorbeiging.
Lagerfeld ließ sich auf einem vom Kellner rasch herbeigeschafften Stuhl am Kopfende des Tisches nieder und stellte eine kleine Holzschachtel darauf ab, die mit einem kleinen goldfarbenen Nummernschlösschen zugesperrt war. Ein unscheinbares Konstrukt, einer Zigarrenschachtel nicht unähnlich. Trotzdem war natürlich jedem am Tisch klar, dass sich in dieser Schachtel keine Zigarren befanden, sondern weit spannendere Ingredienzen, nämlich die lang erwarteten Devotionalien des heutigen Abends. Robert Suckfüll mochte das als passionierter Zigarrenraucher vielleicht anders sehen, allerdings war das Bessere ja des Guten Feind. Wobei die Definition von gut oder schlecht, zumindest was die Hanfpflanze als Droge anbetraf, in solcherlei Kategorisierungen inzwischen eher fehl am Platz war.
Auf einmal lag eine Spannung in der Luft, die man mit Händen greifen konnte. Immerhin war Cannabis zeit des Lebens aller Anwesenden hemmungslos kriminalisiert worden, nun war es plötzlich legal und für jedermann zugänglich. Der Kollege Bernd Schmitt war sich seiner heutigen sehr speziellen Rolle als Aufklärer und Mittler auch durchaus bewusst, ließ sich das aber erst einmal nicht anmerken. Er holte einen kleinen goldfarbenen Schlüssel aus seiner Jeansjacke, mit dem er das Schloss an der Holzkiste öffnete. Natürlich nicht ohne die nötige Dramaturgie in seinen Bewegungen, schließlich war dies ein polizeigeschichtlich herausragender, ja geradezu epochaler Moment. Dann begann er, mehrere sorgsam in Plastiktüten verpackte Proben seiner ausgewählten Anschauungsobjekte auf dem Biertisch zu platzieren. Zum Erstaunen seines Publikums befand sich in der Auslage auch ein Gebäck, das wie vom letzten Weihnachtsabend übrig geblieben aussah. Er stellte noch ein kleines Stövchen dazu, auf das er ein rundes Kohlenstück legte, welches man vom normalen Räuchern in der Wohnung mit Weihrauch oder Ähnlichem her kannte, und betrachtete zufrieden zuerst sein Werk, dann die gespannten Gesichter der vor ihm sitzenden Kollegen und Kolleginnen. Bevor er aber etwas sagte, nahm er einen der kleinen Kekse und reichte ihn Honeypenny, die immer noch den leicht übermüdet wirkenden Presssack auf dem Arm hielt und ihn liebevoll hin- und herschaukelte.
»Hier, gib das mal meinem Auszubildenden, das hat er sich redlich verdient«, meinte Lagerfeld mit einem verschmitzten Lächeln. Dann stellte er sich in Positur, strich lässig mit der rechten Hand durch sein schütteres Haupthaar und räusperte sich, um die Bedeutung dieses Momentes zu unterstreichen. »Tja, Herrschaften, dann wollen wir mal anfangen«, verkündete er, zückte ein Stabfeuerzeug, entzündete es und hielt die Flamme an die Räucherkohle, die auf dem kleinen Räucherofen lag.
Der Greifenklaukeller mit seinen Besuchern bekam von dem seltsamen Event am Tisch der Kriminalisten, der ganz vorne und noch dazu an der Seite des Geländers stand, nur sehr peripher etwas mit. Von diesem Bamberger Keller hatte man einen phantastischen Blick auf den beleuchteten Michelsberg, da standen Gruppenaktivitäten an Nachbartischen nicht im Mittelpunkt des Biertrinkerinteresses. Und so kam es, dass ein geschichtsträchtiges Fortbildungsseminar der Bamberger Kriminalpolizei vom Bamberger Bürgertum weitgehend unbemerkt seinen Lauf nahm.
Reifenprofile waren, wenn man aus deren Tiefenmessung seinen Honig saugen konnte, zwar ein durchaus anspruchsvolles Hobby, aber auch die größte Begeisterung für solcherlei Beschäftigung musste hintenanstehen, wenn es im Dienstalltag zu Verstößen von weit größerer Bedeutung und Tragweite kam. Und eine verstümmelte Leiche, die aus dem Hinterteil eines Mähdreschers herausragte, war definitiv ein solcher Verstoß, wer auch immer ihn begangen haben mochte.
»Elias, vergiss dei scheiß Profilneurosen da unten und komm her, sofort«, fauchte Alfons Schieler den rücklings unter Biobauer Sporaths Mähdrescher liegenden Polizeioberwachtmeister Webhan an, der ob des Tons seines Kollegen sofort erkannte, dass eine Etage über ihm eine völlig andere Nummer ablief.
Also rutschte er unter dem verkohlten Gerät hervor und richtete sich ächzend zu voller Größe auf. Stocksteif und wie angewurzelt blieb er stehen, denn das, was er sah, erschütterte ihn zutiefst. Ein paar Meter neben dem Kollegen Schieler erblickte er eine Art Aushilfstarzan mit nacktem Oberkörper und Lendenschurz, der mit kindlicher Begeisterung auf das abgemähte Feld kotzte. Dabei wandte ihm der gebückt dastehende Unbekannte sein Hinterteil zu, das sich durch eine mehr schlecht als recht verdeckte knallrote Unterhose auszeichnete.
Er wollte schon einen markigen Spruch in Richtung Tarzan schicken, als ihm sein Kollege einen Ellenbogen in die Seite rammte und, ehe Webhan zu laut artikuliertem Protest ansetzen konnte, auf den Lichtkegel seiner Taschenlampe deutete, den er auf ein ganz bestimmtes menschliches Objekt gerichtet hielt.
»Ach du Scheiße«, entfuhr es dem nun schlagartig eingenordeten Polizeiwachtmeister Webhan. Sprachlos und konsterniert beäugte er den verstümmelten Leichnam.
Die nächtliche Stille wurde erst wieder mit akustischem Leben erfüllt, als der vollständig entleerte Biobauer Sporath aus dem Dunkel trat und sich zu den beiden Polizisten dazugesellte.
»Soll das so sein?«, fragte Webhan Sporath und deutete mit zaghafter Geste auf den blutigen Mähdrescherfund.
Die dämliche Frage wirkte bei Bernhard Sporath besser als ein Eimer Eiswasser über den Kopf. Mit einem Schlag war er hellwach und von den drei Anwesenden derjenige, der wusste, was nun zu tun war, nicht etwa die beiden geschockten und leicht überfordert wirkenden Streifenpolizisten aus Bad Staffelstein.
»Handy. Wo issn mei Handy? Ich waaß, wen mer aarufen müssen«, verkündete er, während er hektisch unter seiner spärlichen Bekleidung herumfummelte, um sein Mobiltelefon in der Unterhose zu orten. Kurz darauf hatte Tarzan Sporath es gefunden, warm und verschwitzt, wie es inzwischen war, und die Nummer sofort parat. Zu oft hatte er sie aus ganz anderen, weit weniger dramatischen Gründen, gewählt. »Hallo, Bernd, ich bin’s, Bernhard … Nein, mit der Riemenschneiderin is nix, mach dir kaa Sorchen. Aber du musst sofort komma, hier is was ganz Schlimmes passiert. Da hängd a Doder in meim Mähdrescher, und ich hab kaa Ahnung, wie des bassiern konnd. Na, ich bin ned besoffen, Bernd. Ich bin halber naggerd, steh mittn aufm Agger vor meim abgebrannden Mähdrescher, dem, wo hindn a dode Leiche naushänga dud. Ich hab echt kaa Lust auf dei Schbarwitzla, etzterd um Middernachd, Bernd. Die von der normalen Bolizei sin a scho da … ja, ich reich dich amal weider.« Mit diesen Worten nahm der Biobauer das Telefon vom Ohr und reichte es mit finsterer Miene dem Polizisten Webhan, der das Handy fast apathisch entgegennahm und mit schwerer Zunge seine Anwesenheit kundtat.
»Polizeioberwachtmeister Webhan … Nein, das ist keine Verarsche, es stimmt, was Herr Sporath gesagt hat. Wir haben hier ein Tötungsdelikt, einen Toten in einem Mähdrescher. Ich weiß, dass das total bescheuert klingt, Herr Schmitt, aber es ist so, wie ich es sage. Informieren Sie die Spurensicherung und kommen Sie besser sofort her. Da kann ich nichts dafür, dass ich Sie in einem ganz blöden Moment erwische, Herr Schmitt. Tut mir ja auch leid, aber das wird eine etwas größere Geschichte hier.«