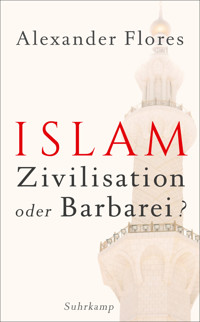
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Alles, was Sie über den Islam wissen sollten Die Debatte um den Islam ist immer eine polemische: Salafismus, Scharia, Frauenrechte, Boko Haram, IS – zu allem haben wir eine Meinung. Aber wissen wir denn wirklich, was sich hinter diesen Phänomenen verbirgt? Alexander Flores kann Abhilfe schaffen, denn er widmet sich den Fakten. Flores beschreibt einen Modernismus, der Anfang des 20. Jahrhunderts dem Islam eine weltanschauliche Öffnung ermöglichen sollte; eine Scharia, die über lange Zeit hinweg nicht drakonisches »Gottesrecht« war, sondern Orientierung für eine islamische Lebensführung. Und er erklärt, wie der Koran mit seinen verschiedenen Lesarten instrumentalisiert werden konnte und damit Radikalisierungen ermöglichte, die wir heute mehr denn je zu spüren bekommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Islam – Zivilisation oder Barbarei? Fernab jeglicher Polemik widmet sich Alexander Flores den Fakten: Er beschreibt einen Modernismus, der Anfang des 20. Jahrhunderts der muslimischen Religion eine weltanschauliche Öffnung ermöglichen sollte; eine Scharia, die über lange Zeit hinweg nicht drakonisches »Gottesrecht« war, sondern Orientierung für eine islamische Lebensführung. Und er erklärt, wie der Koran mit seinen verschiedenen Lesarten instrumentalisiert werden konnte und damit Radikalisierungen ermöglichte, die wir heute mehr denn je zu spüren bekommen. »Alexander Flores räumt souverän mit überzeichneten Bildern der muslimischen Religion auf und beschreibt genau das, was man wissen sollte.« Stefan Weidner, FAZ
Alexander Flores, geboren 1948, studierte Soziologie, Germanistik, Arabistik und Islamwissenschaft an der Universität Münster. Er forschte und lehrte an den Universitäten Essen, Birzeit (Palästina), Erlangen, Hamburg und Würzburg. 1993 wurde er an der Freien Universität Berlin habilitiert. Von 1995 bis 2014 war er Professor für Wirtschaftsarabistik an der Hochschule Bremen.
Alexander Flores
ISLAM
Zivilisation oder Barbarei?
Gefördert durch die Udo Keller Stiftung Forum Humanum
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4660.
Überarbeitete Neuausgabe. Der Band erschien erstmals 2011 unter dem Titel Zivilisation oder Barbarei? Der Islam im historischen Kontext im Verlag der Weltreligionen.
Copyright für die Originalausgabe © Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag Berlin
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlagabbildung: Gallery Stock
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-518-74355-3
www.suhrkamp.de
ISLAMZivilisation oder Barbarei?
Inhalt
1 Einleitung
2 Corpus delicti: Der Koran
3 Ein Gottesstaat?
4 Der weite Mantel des Islam
5 Fehlt da etwas?
6 Europa als Störenfried und Stachel
7 Reformismus und Apologetik
8 Islamismus, islamische Bewegungen, Salafismus
9 Das hässliche Gesicht des Islam
10 Problemfelder
11 Neuere Entwicklungen
12 Zivilisation oder Barbarei?
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Register
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
Eine Debatte
Der Islam wird in Deutschland ausgesprochen kontrovers diskutiert. Anfang 2010 gab es eine lebhafte Debatte im Feuilleton deutschsprachiger Zeitungen, in der es um Charakter und Berechtigung von Islamkritik in der Öffentlichkeit ging.1 Kritik am Islam wurde vielfach als Islamophobie bezeichnet, manche sahen Parallelen zum Antisemitismus – dem des späten 19. Jahrhunderts wohlgemerkt. Die provokant vorgetragenen Thesen von Thilo Sarrazin, der den Islam als Haupthinderungsgrund bei der Integration muslimischer Migranten identifizierte, wurden zwar in Politik und (manchen) Medien scharf kritisiert, stießen aber in breiten Kreisen auf enorme Zustimmung. Vorbehalte gegenüber Islam und Muslimen sind offenbar weit verbreitet; seit einiger Zeit werden sie verstärkt ventiliert, und zwar auf allen Ebenen der Diskussion und Argumentation. Das liegt an der Entstehung aggressiver Gruppen unter Muslimen, die nun auch im Westen spektakulär zuschlagen, und an der Präsenz großer muslimischer Minderheiten in Europa, die zwar schon jahrzehntealt sind, nun aber zum ersten Mal massiv als Problem wahrgenommen werden. Das Thema »Islam« ist stärker in den Brennpunkt des öffentlichen Interesses gerückt.
Zwei Bündel von Wahrnehmungen tauchen in diesem Zusammenhang häufig auf. Das eine ist von der Auffassung beherrscht, der Islam sei eine grundsätzlich problematische Religion. Diese Auffassung findet sich in vielen Facetten, denen gemeinsam ist, dass sie die zweifellos vorhandenen Probleme in islamischen Gesellschaften und mit Muslimen auf den Islam zurückführen. Ein anderes Wahrnehmungsbündel ist apologetisch. Es sieht den Islam als ganz normale, unschuldige Religion, vergleichbar mit den anderen monotheistischen Religionen. Nach dieser Auffassung erwachsen aus dem islamischen Glauben und seiner Praktizierung keinerlei Probleme – weder für die Muslime selbst noch gar für andere. Eine Variante dieser Auffassung behauptet sogar einen besonders heilsamen und friedlichen Charakter dieser Religion und ihrer Praktizierung.
Die zwei hier angedeuteten Sichtweisen können einiges zu ihrer Begründung anführen. Es gibt in den Äußerungen und im Handeln heutiger Muslime vieles, was für sie selbst oder für andere Muslime, aber auch für ihr Verhältnis zur nichtmuslimischen Welt ausgesprochen bedenklich ist. Und für viele dieser Denk- und Handlungsweisen kann man auch in islamischen Traditionen bis hin zum Koran Begründung oder Rechtfertigung finden. Auf der anderen Seite praktiziert die übergroße Mehrheit der Muslime ihre Religion friedlich und ohne Schädigung für andere. Auch für dieses Verhalten kann man Traditionslinien zeichnen.
Beide hier skizzierten Auffassungen können also in all ihrer Gegensätzlichkeit partielle Wahrheit beanspruchen. Sie haben aber einen Zug gemeinsam, der sie beide entwertet: ihren essentialistischen Charakter. Beide behaupten ein Wesen des Islam – schädlich im einen, harmlos oder heilsam im anderen Fall.
Diese essentialistische Sicht auf den Islam ist außerordentlich weit verbreitet, sie wird sehr unterschiedlich begründet, sie kommt auf allen Ebenen der Argumentation vor, sie findet sich bei Muslimen ebenso wie bei Nichtmuslimen, sie gibt dem Islam mal ein negatives, mal ein positives Vorzeichen. Gemeinsam ist den Vertretern dieser Sichtweise die Auffassung, dass der Islam Denken und Verhaltensweisen seiner Anhänger stark beeinflusst und dabei selbst eine weitgehend unabhängige Instanz ist. Darin soll sich der Islam von Christentum und Judentum, zumindest in ihrer modernen Gestalt, grundlegend unterscheiden.
Die wesentlichen, zur Begründung dieser Sicht vorgetragenen Argumente sind folgende: Der Islam hat durch die Autorität des Koran und das darin vertretene betont theozentrische Weltbild einen besonders rigiden Hegemonieanspruch über das gesamte Leben der Muslime. Dieser Hegemonieanspruch ist durch die Scharia, das göttliche Gesetz, institutionell abgesichert; öffentliche Instanzen, in erster Linie der Staat, sind aufgerufen, ihn durchzusetzen; es gibt keinen von der religiösen Hegemonie ausgenommenen weltlichen Bereich. Islamische Gesellschaften haben nach dieser Auffassung den Säkularisierungstendenzen der Moderne wirksam widerstanden, und darum transportiert und stabilisiert der Islam vormoderne Weltsichten.
Dass es in den Weltgegenden mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit massive ökonomische, soziale und politische Probleme gibt, dass sie sich im Großen und Ganzen mit der Demokratie schwertun, dass Frauen dort benachteiligt sind, ist unbestreitbar. Manche der Verhaltensweisen, die dafür verantwortlich sind, gehen mit islamischen Überzeugungen einher. Darum wird häufig »der Islam« für diese missliche Lage verantwortlich gemacht. Dem wird wiederum oft entgegengehalten, dass man den Islam als Religion keineswegs für diese Phänomene haftbar machen sollte, denn in seinen Kerntexten finde man keine entsprechenden Anweisungen.
Solche Überlegungen führen direkt zu der Frage, was der Islam eigentlich ist. In welchem Sinn ist es angemessen, von dem Islam zu reden, wenn die realen Überzeugungen und Handlungsweisen von Muslimen Ausfluss und Bestandteil einer bestimmten gesellschaftlichen Realität sind und nur im Hinblick darauf stimmig erklärt und beurteilt werden können, also sicherlich nicht den Islam konstituieren, und wenn die Glaubensgrundsätze und Verpflichtungen, die unzweifelhaft allen Muslimen gemeinsam sind, so allgemein und unverbindlich sind, dass sie zur Erklärung eines bestimmten Verhaltens kaum herhalten können? Etwas anders formuliert: Im Widerspruch gegen pauschale Islamanwürfe fühlt man sich gelegentlich, wenn unter Hinweis auf verwerfliche Denk- und Verhaltensweisen der Islam als solcher verurteilt wird, genötigt zu entgegnen: »Aber das liegt doch nicht am Islam selbst (oder: am Islam als Religion)!« Und in der Tat kann man oft weder in den Grundlagentexten noch im islamischen Recht Begründungen für solche Erscheinungen finden. Das Problem ist aber damit nicht ausgeräumt; denn auch wenn diese Erscheinungen weder im Dogma noch in der Scharia begründet sind, sind sie doch in gewissem Maß verbreitet und im Bewusstsein ihrer Träger originär islamisch. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma scheint mir die genaue Übereinkunft darüber zu sein, was man jeweils unter Islam verstehen will, sowie die genaue Unterscheidung seiner möglichen Erscheinungsformen.
Die heutige islamische Welt, oder um essentialistische Zungenschläge zu vermeiden: die Weltgegenden mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, ist groß. Sie ist auch nicht leicht nach außen abzugrenzen: Sie verteilt sich auf drei Kontinente, Migrationsströme und ihre Konsequenzen kommen hinzu. Wo es in diesem Buch um Entwicklungen auf ganz bestimmten Territorien geht, beziehe ich mich überwiegend auf den Teil dieser Weltgegenden, der Europa benachbart ist: die arabischen Länder, die Türkei und Iran, manchmal Teile des indischen Subkontinents, also die Region, die wir Nahen Osten oder Nahen und Mittleren Osten nennen. Das liegt vordergründig an meinem Kompetenzbereich, lässt sich aber auch mit der Überlegung rechtfertigen, dass die problematischen Sachverhalte, die hier thematisiert werden und die nach meiner Überzeugung viel mit der Nachbarschaft zu Europa zu tun haben, in diesem Teil der »islamischen Welt« am stärksten virulent wurden und werden.
Dies ist kein Buch über »den« Islam. Kompetente Darstellungen des Islam gibt es zur Genüge. Vielmehr ist es der Versuch, bestimmte in der Kontroverse um den Islam relevante Komplexe sachlich darzustellen und damit eine vernünftige Sicht auf die ganze Problematik zu ermöglichen. Es versteht sich, dass das in einer bestimmten Absicht geschieht: als Einspruch gegen den Versuch, die Muslime durch die Annahme eines stets in einem ganz bestimmten Sinn wirkenden Islam aus dem Zusammenhang universell gültiger Bewegungsgesetze menschlichen Zusammenlebens herauszunehmen, ein Einspruch, der sie in die Verantwortung für ihre eigene Geschichte stellt und damit auch der Kritik aussetzt, wo sie sachlich berechtigt ist.
Anklage und Verteidigung
Die kritische Darstellung des Islam beginnt meist mit dem Koran und dem Hinweis, dass gläubige Muslime gehalten sind, ihn als unmittelbar offenbartes, wörtlich festgehaltenes und nicht zu hinterfragendes Wort Gottes zu verstehen. Beim Inhalt des Koran konzentriert sich diese Darstellung auf den rigorosen Herrschaftsanspruch Gottes: alleinige Verehrung, Souveränität über den Kosmos und alle Aspekte des menschlichen Lebens; weiter auf die im Koran vorgenommene scharfe Abgrenzung der Muslime von allen »Ungläubigen«, auf die dort vorzufindende Ausmalung grässlicher Höllenstrafen für Ungläubige und sündige Muslime sowie auf die Anweisung zum Kampf gegen die Ungläubigen und deren Unterwerfung – tendenziell bis zur Weltherrschaft.
Weiter betont die Kritik, dass aus der im Koran und in anderen Grundlagentexten niedergelegten Grundkonzeption des Islam ein großer, seinem Anspruch nach lückenloser Katalog von Vorschriften entwickelt wurde, die Scharia, die alle Aspekte des Lebens der Muslime regeln soll. Auch die gesellschaftliche Organisation soll in erster Linie religiösen Zwecken dienen und dort, wo es nötig ist, die Scharia mit Zwangsmitteln zur Geltung bringen. Dem sollen der islamische Staat und seine Organe dienen, aber auch die Muslime selbst sind in dieser Sicht dazu aufgerufen, in einer Art von Blockwartsystem gegenseitiger Kontrolle über die Einhaltung religiöser Vorschriften zu wachen.
Es wird also hier ein verbindlicher, allpräsenter Glaube konstatiert, der durch die Einhaltung der kultischen Verpflichtungen ständig neu eingeschärft wird, die geistige und praktische Freiheit der Muslime erheblich einschränkt und oft die Gestalt eines regelrechten Obskurantismus annimmt, in welchem der Verstand gegenüber den heiligen Texten keinen Platz hat. Zur Bekräftigung dieser religiösen Hegemonie dient nach dieser Auffassung nicht nur die Drohung mit grausamen Strafen im Jenseits, sondern auch die mit der drakonischen Sanktion bestimmter Übertretungen im Hier und Jetzt, die, obwohl in der Regel nicht praktisch angewandt, doch offiziell Bestandteil der Scharia ist und die Gläubigen in Angst und Schrecken hält.
Es handelt sich also im Islam – immer nach der Auffassung der Kritiker – um eine sehr anspruchsvolle, radikal theozentrische Konzeption, die, plastisch und eingängig formuliert, durch ständige Erinnerung präsent und damit sehr wirkmächtig bleibt und deren Einhaltung überdies durch einen umfassenden Vorschriftenkatalog und durch staatliche wie gesellschaftliche Erzwingungsinstitutionen garantiert wird.
Die Kritiker stellen fest, dass es im islamischen Bereich keine Aufklärung wie in Europa gegeben habe; sie behaupten weiter, dass der Islam weder in der Theorie noch in der Praxis eine Trennung der geistlichen von der weltlichen Sphäre gekannt habe und kenne. Daher sehen sie den islamischen Bereich als resistent gegen Säkularisierung und konsequente Modernisierung. Bestimmte Aspekte der Moderne akzeptierten die Muslime, andere, vor allem die »kulturelle Moderne«, lehnten sie vehement ab. In der Folge gebe es im Islam keine Religionsfreiheit, würden die Menschenrechte nicht respektiert, würden insbesondere die Rechte der Frauen in vieler Hinsicht mit Füßen getreten. Alles das bedeute einen unaufhebbaren Gegensatz zwischen den im Grundgesetz niedergelegten konstitutiven Werten der »kulturellen Moderne« und dem orthodox verstandenen Islam. Solche Muslime, die ihre Religion ernst nähmen und mit allen Konsequenzen lebten, könnten unsere Verfassungsgrundsätze nicht als für sich verbindlich anerkennen.
Die oft getroffene Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus erscheint in dieser Auffassung als irrelevant. Die Islamisten, also diejenigen, die heute auf die Wiedererrichtung islamischer Staaten und die Wiedereinführung der Scharia dringen, seien keine Abweichler vom Islam, sondern setzten vielmehr Kernvorstellungen des orthodoxen Islam unter der Herausforderung der Moderne in die Tat um.
Im Verhältnis zur nichtmuslimischen Umwelt sieht diese Auffassung die Muslime beseelt von einem Überlegenheitsgefühl gegenüber allen anderen und getrieben von dem Drang, die ganze Welt islamischer Herrschaft zu unterwerfen. Zum Beleg wird die traditionell islamische völkerrechtliche Vorstellung von der Einteilung der Welt in ein »Territorium des Islam« und ein »Territorium des Kriegs« angeführt, wobei das Erstere, wo immer möglich, auf Kosten des Letzteren vergrößert werden soll, im Grenzfall bis zur Eroberung der ganzen Welt. In der islamischen Geschichte sieht diese Auffassung nicht nur Eroberungskriege, sondern sogar besonders grausames Vorgehen, besonders große Aggressivität, »islamischen Imperialismus«.2 Gern verweist man in diesem Zusammenhang auch auf Terror von Muslimen in der jüngsten Vergangenheit. Die meisten Belege für den problematischen Charakter des Islam sieht die hier dargestellte Konzeption in der heutigen Praxis von Muslimen: islamischer Terror, Unterdrückung religiöser Minderheiten in islamischen Ländern, andere menschenrechtliche Probleme, vor allem aber die prekäre rechtliche Lage und Unterdrückung von Frauen in vieler Hinsicht.
Die hier skizzierte Auffassung zeichnet also eine Besonderheit von Muslimen und islamischen Gesellschaften, die sie auf einen kulturellen Faktor zurückführt, der ausgesprochen prägend sein soll: den Islam selbst. Eine im Koran emphatisch formulierte Grundlage, die in wiederholter Erinnerung an positive und negative Sanktionen stets lebendig und wirkmächtig bleibt, ein daraus abgeleiteter umfassender Vorschriftenkatalog, eine politische und gesellschaftliche Organisation mit Institutionen zur Erzwingung konformen Verhaltens – alles das soll das Leben der Muslime weitgehend geprägt, sie zu aggressivem Verhalten nach außen bewegt, ihnen die Antwort auf die Herausforderungen der Moderne unmöglich gemacht haben und auch die vielen heutigen Probleme der Muslime (und anderer mit den Muslimen!) weitgehend erklären. Ein mögliches, von dem so vorgestellten Modell abweichendes Verhalten bzw. Denken von Muslimen leugnet diese Auffassung im Allgemeinen nicht, hält es aber gegenüber dem bestimmenden Muster für irrelevant. In dieser Auffassung ist der Islam Barbarei, ist er in unsere Zeit hineinragendes Mittelalter.3
Islamkritik mit den hier genannten Argumenten ist in den letzten Jahren sehr verbreitet. Die Entstehung aggressiver muslimischer Gruppen und die Präsenz großer muslimischer Minderheiten in Europa haben die »islamische Gefahr« in den letzten Jahren unterstrichen. Aber die Wahrnehmung selbst und die angeführten Argumente sind alt. In etwas anderer Form gab es sie schon im Mittelalter.4 Damals war die Polemik in aller Regel christlich inspiriert und formuliert, wie es auf der anderen Seite auch muslimische Polemik gegen das christliche Europa gab – in beiden Fällen als Begleiterscheinung realer Auseinandersetzungen. Moderne, mit aufklärerischen und menschenrechtlichen Argumenten gestützte Islamkritik gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Eine besonders plastische Formulierung stammt von dem französischen Religionshistoriker Ernest Renan, der 1883 in einem Vortrag an der Sorbonne sagte:
Jeder, der ein wenig von den Dingen unserer Zeit weiß, sieht klar die gegenwärtige Minderwertigkeit der islamischen Länder, den desolaten Zustand der Staaten, die der Islam beherrscht, und die intellektuelle Nichtigkeit der Rassen, die ausschließlich aus dieser Religion ihre Kultur und Bildung beziehen. Alle, die im Orient oder in Afrika gewesen sind, sind betroffen davon, wie unausweichlich beschränkt der Geist eines wahren Gläubigen ist, von diesem eisernen Reifen, der seinen Kopf umschließt und ihn absolut unzugänglich macht für die Wissenschaft, unfähig, irgendetwas zu lernen oder sich irgendeiner neuen Idee zu öffnen.
Und Renan glaubte auch zu wissen, woher das kommt. Seiner Meinung nach gibt es im Islam
nicht die geringste Möglichkeit der Trennung des Spirituellen vom Irdischen; [er ist] ein Zwangsregime mit Körperstrafen für den, der nicht praktiziert; ein System, das in puncto Quälerei nur noch von der spanischen Inquisition übertroffen wurde. Die Freiheit wird niemals tiefer verletzt als von einer sozialen Organisation, bei der das Dogma herrscht und das soziale Leben absolut dominiert.5
Dem Islam wird ein äußerst rigider, im Dogma und in der Scharia verkörperter Hegemonieanspruch unterstellt, der besonders wirksam sein soll, weil keine Trennung von religiösem und weltlichem Bereich ihm etwas von seiner Durchschlagskraft nähme.
Diese Auffassung wird auch in neuerer Zeit vielfach vertreten, in unterschiedlicher Weise, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, aber doch im Wesentlichen mit derselben Stoßrichtung. Sie läuft darauf hinaus, dass es sich beim Islam um ein großes, in sich konsistentes System von Überzeugungen und Vorschriften mit einer Macht über seine Anhänger handelt, die ihn von anderen ideologischen Systemen unterscheidet. In diesen Überzeugungen und Vorschriften ist nach dieser Auffassung so viel In- und Antihumanes, dass sie sowohl für die Muslime selbst wie für ihr Verhältnis zur nichtmuslimischen Umwelt große Probleme mit sich bringen. Ein Muslim, der seine Religion ernst nimmt – und das wird den weitaus meisten Muslimen unterstellt –, ist daher automatisch gefährlich und problematisch. Entsprechend muss er behandelt werden: barsche Aufforderung zur Abkehr von seiner religiösen Konzeption, Eingrenzung, Überwachung, Abwehr, im Grenzfall polizeiliche und militärische Unterdrückung.
Dieser Auffassung widersprechen andere auf zwei Wegen. Der eine ist eine Auseinandersetzung mit der Argumentationsweise der skizzierten Islamkritik. Sie legt den Finger darauf, dass diese schon die bloße Zugehörigkeit zum Islam zum Anklagepunkt erhebt und tendenziell jeden einzelnen Muslim für missliche Aspekte seiner Religion haftbar macht. Sie sieht das als Rassismus und spricht meist von Islamophobie. Die andere Weise des Widerspruchs ist eine Darstellung des Islam, die ihn als harmlose, unschuldige Religion sieht, aus deren Praktizierung weder für die Muslime selbst noch für andere irgendein Problem erwachse. Diese Art des Widerspruchs erkennt in der Regel die Verbindlichkeit des Koran für die Weltsicht und das Handeln der Muslime an, setzt aber in der Darstellung der koranischen Aussagen ganz andere, positive Schwerpunkte. Sie betont die Menschenliebe und Gnade Gottes, zitiert die Stellen des Koran, in denen von Freiheit in der Religion, von friedlicher Predigt, überhaupt von versöhnlichem Verhalten die Rede ist. Kriegerische Aktivität von Muslimen in der Geschichte wird hier als von defensiver Notwendigkeit diktierter Ausnahmefall hingestellt. Bestandteil dieses Bildes ist auch die Auffassung von der großen Rationalität der islamischen Lehre. Der Islam stehe auch der Modernisierung keinesfalls im Weg; die Säkularisierung muslimischer Gesellschaften sei entweder in gewissem Maß schon vollzogen oder nicht nötig, da es im Islam die Faktoren, die sie im vorneuzeitlichen Europa erfordert hätten, nicht gebe. Der Islamismus sei nicht mit dem Islam gleichzusetzen, sondern habe mit richtig verstandenem Islam nichts zu tun. Dem Argument von der Diskriminierung und Unterdrückung der Frauen antwortet diese Auffassung oft mit dem Gedanken, der Islam habe die Stellung der Frau in seiner frühen Zeit verbessert und sorge in seinen Bestimmungen für ihr Wohlergehen – davon abweichende reale Zustände seien nicht genuin islamisch. Auch die Behandlung religiöser Minderheiten und die Stellung zu den Angehörigen anderer Religionen seien von Toleranz und Friedensliebe geprägt. Der Islam ist also nach dieser Auffassung weder ein Problem für die Muslime, ihr Wohlergehen und ihren Fortschritt noch eines in ihrem Verhältnis zur nichtmuslimischen Welt.
So richtig es ist, dass man der pauschalen Islamkritik mit dem Hinweis auf ihre fatalen Konsequenzen widerspricht, so wichtig es erscheint, dass Muslime und andere auf die weithin harmlosen und friedlichen Dimensionen des Islam hinweisen – beide Vorgehensweisen reichen nicht hin, das Problem, um das es hier geht, angemessen zu erfassen. Denn um ein Problem handelt es sich. Es gibt tatsächlich höchst bedenkliche Äußerungen und Verhaltensweisen heutiger Muslime, und sie erhalten zumindest den Anschein islamischer Legitimität durch die Berufung auf Texte und Präzedenzfälle der islamischen Tradition. Die erstgenannte Vorgehensweise beschäftigt sich mit diesem Problemkomplex nicht, die zweite tendiert dazu, ihn zu ignorieren oder zu leugnen, indem sie die ganz andere Seite des Islam hervorhebt. Dieses Buch will sich mit der pauschalen Islamkritik durch die Nachzeichnung der Realität der islamischen Geschichte und Gegenwart auseinandersetzen, ohne deren problematische Aspekte auszublenden.
2›Corpus delicti‹: Der Koran
Die Anklage gegen den Islam beruft sich gern auf dessen wichtigsten Grundlagentext, den Koran (arab. qur'ān), und auf die Konstellation der islamischen Frühzeit, die mit der Ungeschiedenheit von religiöser und weltlicher Sphäre (»Muḥammad als Prophet und Staatslenker«) ein Modell für alle späteren Zeiten gesetzt habe.
Im Koran sehen die Kritiker prinzipiell anstößige Inhalte; die wichtigsten sind, knapp angedeutet, der absolute Anspruch Gottes auf alleinige Verehrung und Unterwerfung, die plastisch ausgemalten Höllenstrafen bei Widersetzlichkeit oder Übertretungen, die scharfe Abgrenzung gegen »Ungläubige« und das Gebot zum aggressiven Verhalten zwecks Unterwerfung der »Ungläubigen«, weiter die Frauenfeindlichkeit bestimmter Passagen.
Was steht tatsächlich im Koran? Der uns vorliegende Text ist inhaltlich wenig strukturiert. Grob lässt er sich in Texte zu mehreren Komplexen aufteilen: Ein wichtiger Teil des Koran besteht aus dem eindringlichen Aufruf zum Glauben an Gott und zu einer entsprechenden Lebensführung – gerichtet an die »heidnischen« Araber, deren religiöse Vorstellungen bis dahin wenig Konsequenzen für ihren Lebenswandel impliziert hatten. Dieser Aufruf wird beständig wiederholt, mit immer neuen Variationen in der Form und der Argumentation. Beweisgründe werden unter anderem aus der Wunderbarkeit der Natur bezogen, die nur ein allmächtiger Schöpfer so geschaffen haben könne. Gott wird als gerecht, aber im Grundtenor durchaus gnädig dargestellt. Immer wieder wird auf ein nahe bevorstehendes Jüngstes Gericht hingewiesen, bei dem die Menschen nach ihren Verdiensten und Verfehlungen beurteilt werden, und entsprechend Umkehr eingefordert. Die widrigenfalls eintretenden Höllenstrafen werden plastisch ausgemalt. Hier werden Individuen angesprochen und damit auch in individuelle Verantwortung gestellt. Die eindrücklichsten Texte dieser Art gehören wohl in die frühen Phasen von Muḥammads Wirken als Prophet.
Ein weiterer, großer Teil des Koran besteht aus Erzählungen heilsgeschichtlichen Inhalts, die meisten davon biblische Erzählungen, hier natürlich in anderer Textgestalt und mit – meist leichten – inhaltlichen Veränderungen. Muḥammad war offenbar lange davon überzeugt, dass Juden – in der Tora – und Christen – im Neuen Testament – die Offenbarung Gottes zuteilgeworden war und dass es seine eigene Mission war, nun die inhaltlich gleiche Botschaft den heidnischen Arabern der Halbinsel zu bringen, die sie noch nicht erhalten hatten. In der argumentativen Auseinandersetzung mit den »verstockten« Mekkanern werden immer wieder die ahl al-kitāb, also die Besitzer von Offenbarungsschriften, als Zeugen für die Wahrheit der koranischen Botschaft angerufen, so z. B. in Koran 17,101: »Frag doch die Kinder Israels!«1 Wohl im Zuge der realpolitischen und ideologischen Auseinandersetzung mit den Juden Medinas, die sich weigerten, Muḥammad als Propheten anzuerkennen, erfolgte allerdings eine Veränderung der muslimischen Vorstellung von den sukzessiven Offenbarungen. Danach hatten Juden und Christen die Offenbarung Gottes in richtiger Form erhalten, sie aber nicht rein und unverfälscht bewahrt, sondern im eigenen (vermeintlichen) Interesse verändert. Konsequenterweise änderte sich dann auch Muḥammads Bild im muslimischen Selbstverständnis. Von einem Propheten für die Araber wurde er zu einem für die ganze Welt einschließlich von Juden und Christen, deren heilige Schriften ja nach diesem Verständnis auch der Reinigung bzw. Wiederherstellung bedurften. Das implizierte eine Wendung gegen Juden und Christen, soweit sie an ihren Konzeptionen festhielten. Nun ist aber der Text des Koran durchaus nicht im Sinne dieser neuen Vorstellung »durchredigiert« worden, sondern enthält Niederschläge beider Auffassungen. Als Folge davon finden sich dort sowohl positive wie negative Äußerungen über Juden und Christen, ja, es gibt ein ganzes Spektrum von Auffassungen zu diesem Thema.
Die oft gestellte Frage, ob denn nun Christen und Juden in muslimischen Augen als gläubig oder ungläubig gelten, lässt sich aufgrund koranischer Aussagen nicht eindeutig beantworten. Es gibt Stellen, die sie zu den Gläubigen zählen; es gibt welche, die sie zumindest in große Nähe zu den Ungläubigen rücken (eindeutig ungläubig sind im koranischen Sprachgebrauch die arabischen Heiden); und es gibt schließlich Stellen, an denen sich der Koran von solchen ahl al-kitāb abgrenzt, die sich nicht an ihre eigenen religiösen Vorgaben halten, den Muslimen übelwollen usw. Passagen, in denen gegen die Heiden unter positivem Hinweis auf das Zeugnis von Juden argumentiert wird, stehen andere gegenüber, in denen der Koran sich unter Hinweis auf die Überlegenheit des Islam gegenüber allen anderen religiösen Konzepten auch von den ahl al-kitāb abgrenzt. Es gibt also im Text des Koran durchaus Spannungen zwischen verschiedenen Auffassungen zu dieser großen Gruppe, die es im Hinblick auf sie nicht gestatten, von einer scharfen und eindeutigen Abgrenzung gegen »Ungläubige« zu sprechen.
Ein weiterer Teil des Korantextes besteht aus Anweisungen und Kommentaren zu laufenden Ereignissen der Offenbarungszeit. Nach dem durch die heidnischen Mekkaner erzwungenen Auszug der Muslime aus Mekka, der Hidschra (arab. hidjra), war ihre wichtigste praktische Stoßrichtung der Kampf gegen die Mekkaner – wohl ganz unerlässlich, wenn man den Islam auf der ganzen Arabischen Halbinsel verbreiten wollte. Nachdem in den koranischen Texten aus mekkanischer Zeit Zurückhaltung und Resignation in der Auseinandersetzung mit den Heiden anempfohlen worden waren, erfolgte nun zunächst die Erlaubnis, dann der dringende Aufruf zum Kampf, manchmal als Defensive oder Vergeltung für erlittenes Unrecht, an vielen Stellen aber auch ohne eine andere Rechtfertigung als die Notwendigkeit, den Feind niederzukämpfen, »damit keine Zwietracht [oder Versuchung, arab. fitna] sei« (Koran 2,193 und viele andere Stellen). In dieser Frage bewegen sich die Aussagen des Koran auf einem Spektrum, das von der Anweisung zur Zurückhaltung über den provozierten Kampf bis hin zum nichtprovozierten Kampf geht – auch hier also keine ausschließliche Bejahung der Aggression, sondern unterschiedliche Optionen je nach den Umständen.
Weitere Passagen des Koran enthalten Anweisungen für die Lebensführung der Muslime, teilweise durchaus detailliert, besonders auf dem Gebiet des religiösen und des Familienlebens, während weite Bereiche des gesellschaftlichen Lebens kaum berührt werden. In der Frage der Behandlung der Frauen ist wiederum eine merkwürdige Spannung festzustellen. Während unter religiösem Aspekt die Frauen in dasselbe unmittelbare Verhältnis zu Gott gestellt werden wie die Männer und damit als Religionssubjekte den Männern gleichrangig sind, werden sie im praktischen Leben den Männern untergeordnet. Sie haben bestimmte festgelegte Rechte, aber geringere als die Männer; sie erben weniger als diese, haben geringeren Wert als Zeugen, sollen ihren Ehemännern sexuell zur Verfügung stehen, im Fall ihrer »Widersetzlichkeit« ist ein Züchtigungsrecht der Ehemänner stipuliert. Heirat mit bis zu vier Frauen wurde erlaubt, aber nur, wenn der Mann alle seine Ehefrauen gleich behandelte. Im Verhältnis zur Situation der Frauen im vorislamischen Arabien mag das alles eine Besserstellung oder den Versuch dazu bedeutet haben, war aber immer noch eine eklatante Diskriminierung.
Der Koran ist kein in sich widerspruchsfreies Dokument. Es fällt auf, dass er vielfach zum selben Thema unterschiedliche, manchmal gegensätzliche Aussagen enthält. Oft lässt sich ein ganzes Spektrum von Aussagen unterschiedlichen Tenors feststellen; bei der Behandlung des Themenkomplexes »Dschihad« werde ich das (im Abschnitt »Welteroberung?« des Kapitels 10) beispielhaft zeigen. Dieser Umstand kann keinem Leser des Koran verborgen bleiben. Die muslimischen Kommentatoren haben im Hinblick auf die Gewinnung von Handlungsanweisungen aus dem Koran das Prinzip der Abrogation (arab. naskh) entwickelt: Wenn eine Textpassage, die einer anderen widersprach, zeitlich eindeutig nach dieser offenbart wurde, setzte sie die frühere in ihrer rechtlichen Wirkung außer Kraft. Das änderte nichts an der weiteren Existenz all dieser Stellen im Korantext; ob eine Stelle nun tatsächlich abrogiert war, war eine Frage der Interpretation, also durch den Text selbst nicht eindeutig beantwortet. Die Vielfalt der koranischen Aussagen sowie der Interpretationsmöglichkeiten bei den zahlreichen uneindeutigen Textstellen wurde lange Zeit von den Muslimen nicht als störend empfunden, sondern als Gnade Gottes gesehen, der seinen Dienern auf diese Weise Spielraum und Freiheit gab. Manche sehen das auch heute noch so. Viele nehmen aber auch – neuerdings – an der Vieldeutigkeit Anstoß und wollen sie nach Möglichkeit eingrenzen.
Was ist mit den »Stellen«, d. h. mit den Passagen des Koran, die zur Unterstützung der Anklage gegen den Islam gern zitiert werden? Es gibt diese Stellen, an denen ein unvoreingenommener moderner Leser Anstoß nehmen muss. Sie gehören wohl vor allem in vier Kategorien: 1. Die plastische Ausmalung der Höllenstrafen für die Ungläubigen oder Sünder, z. B. Koran 4,55-56: »Die Hölle wird schlimm genug brennen. Diejenigen, die nicht an unsere Zeichen glauben, werden wir im Feuer schmoren lassen. Sooft ihre Haut gar ist, tauschen wir ihnen eine andere ein, damit sie die Strafe zu spüren bekommen. Gott ist mächtig und weise.« 2. Stellen, die von der Diskriminierung und Unterordnung der Frauen sprechen, so z. B. Koran 4,34 (wird im Abschnitt »Frauen« des Kapitels 10 zitiert). 3. Die Ablehnung von Angehörigen anderer Religionen, manchmal auch unter Andeutung von Bestrafungen durch Gott. Eine solche Stelle ist Koran 5,59-60: »Sag: Ihr Leute der Schrift! Habt ihr denn keinen anderen Grund, uns zu grollen, als dass wir an Gott glauben und an das, was zu uns und was früher herabgesandt worden ist, und dass die meisten von euch Frevler sind? Sag: Soll ich euch von etwas Schlimmerem Kunde geben im Hinblick auf eine Belohnung bei Gott? [Leute] die Gott verflucht hat und auf die er zornig ist und aus denen er Affen und Schweine und Götzendiener gemacht hat.« Oder Koran 5,51: »Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden! Sie sind untereinander Freunde.« 4. Stellen, in denen zum Krieg, auch zum unprovozierten Krieg gegen »Heiden« aufgerufen wird. Koran 9,5: »Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf! Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen! Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben.« Auch gegen »Schriftbesitzer« (ahl al-kitāb), strenggenommen gegen bestimmte Schriftbesitzer, wird zum Krieg aufgerufen, Koran 9,29: »Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den Jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Gesandter verboten haben, und nicht der wahren Religion angehören – von denen, die die Schrift erhalten haben –, bis sie kleinlaut aus der Hand Tribut entrichten!«
Man könnte weit mehr entsprechende Stellen zitieren, manchmal wird das auch genüsslich getan. Die Ausmalung der Höllenstrafen ist widerwärtig, nur: Ist unter Würdigung der Umstände irgendetwas anderes von einem religiösen Dokument zu erwarten, das sein Publikum eindringlich zur Umkehr auffordern will? Was steht bei Dante in seiner Beschreibung des Purgatoriums und der Hölle? Was die anderen Passagen betrifft, die sich ja auf irdische Sachverhalte beziehen, muss man sich vor Augen führen, dass die Muslime selbst diese Texte über weiteste Strecken ihrer Geschichte nicht als Handlungsanweisungen genommen, sondern souverän ignoriert haben – Gott sei Dank! Sie blieben als Texte dennoch stehen, und ein moderner Leser empfindet sie als barbarisch. Sie teilen diese Qualität aber mit ähnlichen Passagen in anderen heiligen Texten, nicht zuletzt in der Bibel, wo die Aufforderung zum Massaker stellenweise noch unbedingter formuliert ist, so z. B. Deuteronomium 20,16: »Aus den Städten dieser Völker jedoch, die der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, darfst du nichts, was Atem hat, am Leben lassen.« Auch in der Bibel ist die Zahl ähnlicher Stellen groß. Wer den Koran aufgrund seiner menschenrechtlich problematischen Passagen verdammen will, kann das tun. Wer ihn verdammt, aber die Bibel nach den strikt gleichen moralischen Maßstäben retten will, ist blind oder unredlich.2
Die Glaubensinhalte des Islam sind verhältnismäßig einfach. Ihr Kern ist das Bekenntnis zur Einzigkeit und Allmacht Gottes und zur Propheteneigenschaft Muḥammads: lā ilāha illa-llāh; Muḥammadun rasūlu-llāh (»es gibt keinen Gott außer Allah, und Muḥammad ist sein Gesandter«). Darüber hinaus ist ein Muslim gehalten, an einen kleinen Grundkanon zu glauben: die Propheten vor Muḥammad, die Engel, das Paradies, die Hölle, das Jüngste Gericht. Die Vorstellung von der absoluten Allmacht Gottes, die in einigen Passagen des Koran vorkommt, ist von manchen Gelehrten zu einer strengen Prädestinationslehre ausgebaut worden, die dem menschlichen Willen und der menschlichen Freiheit keinen Raum lässt. Das dient vielen Nichtmuslimen zum Beleg für die Vorstellung vom islamischen Fatalismus (»Kismet«). Dieser ganze Komplex muss mit einem erheblichen Körnchen Salz genommen werden. Rigorose Prädestinationsvorstellungen gibt es ja auch in anderen großen Religionen. Ähnlich wie dort sind sie auch im Islam relativiert worden. Die Vorstellung vom völligen Fehlen menschlicher Willensfreiheit war wohl vielen Menschen immer unerträglich; und darauf musste man Rücksicht nehmen. So bildete sich auch im Islam eine Denkschule heraus, die dem menschlichen Willen sehr weiten, und mehrere, die ihm einen gewissen Spielraum zugestehen. Und auch für diese Vorstellungen lassen sich im Koran und in anderen Grundlagentexten durchaus Belegstellen finden. Gern führen z. B. auch noch heutige Muslime einen Muḥammad in den Mund gelegten Ausspruch an: »Binde dein Reittier zweimal fest an, und erst dann vertraue auf Gott!« Das Spannungsverhältnis »göttliche Allmacht/menschliche Willensfreiheit« ist also im Islam ähnlich gelöst worden (bzw., streng gesprochen, unaufgelöst stehengeblieben) wie in anderen Religionen. Hier gibt es keine Besonderheit, die einen speziellen islamischen Fatalismus begründen würde.
Es gibt im Islam bestimmte ethische Prinzipien, im Grundsatz sehr ähnlich wie die der beiden anderen großen nahöstlichen Religionen Judentum und Christentum. Der große islamische Reformer Muḥammad ʿAbduh (1849-1905) hat diese Gemeinsamkeit einmal so formuliert: »Der Glaube an Gott allein und die Aufrichtigkeit in seiner Verehrung, die gegenseitige Hilfe der Menschen bei der Erzielung des Guten und der Verzicht auf gegenseitige Schädigung, soweit sie es können.«3 Ein Beleg für die Ähnlichkeit der ethischen Vorstellungen ist auch der koranische Dekalog (Koran 17,22-39), der dem mosaischen Dekalog ausgesprochen verwandt ist.4 Von den ethischen Prinzipien und im Wesentlichen auch von den Glaubensinhalten her gibt es also nichts, was den Islam in einen scharfen Kontrast (und schon gar nicht in einen Gegensatz!) zu den anderen monotheistischen Religionen brächte.5
Diese Ähnlichkeiten sind nicht verwunderlich. Der Islam ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern im Hedschas, also der Nordwestregion der Arabischen Halbinsel, in der Mekka und Medina liegen, an der Peripherie zweier zivilisatorisch hochstehender Reiche, aus dem ideologischen Spiralnebel der Spätantike gleichsam zusammengeschossen. Parallelen und Ähnlichkeiten des Inhalts und der Ausrichtung mit den anderen Religionen bleiben da nicht aus – von der Wahrscheinlichkeit von Übernahmen, wie sie viele Passagen des Koran nahelegen, ganz zu schweigen. Als Fazit der Betrachtung des Koran lässt sich festhalten, dass sein Inhalt die Auffassung eines radikal von anderen Weltreligionen abweichenden Charakters des Islam nicht rechtfertigt.
3Ein Gottesstaat?
Der Charakter des »islamischen Staats«
Oft werden die problematischen Züge des Islam auf die Umstände seiner Entstehung zurückgeführt. Sein Gründer Muḥammad sei gleichzeitig Prediger und politischer Akteur gewesen und habe so nicht nur eine Religion, einen Glauben gestiftet, sondern auch ein dementsprechendes politisches Gebilde, einen islamischen Staat gegründet, der auf kriegerische Expansion angelegt war. Muḥammads Nachfolger, die Kalifen, hätten diese Konstellation übernommen und entwickelt, und so sei eine Religion entstanden, in der religiöse und politische Organisation zusammengefallen seien, die eine immanente Tendenz zur kriegerischen Ausbreitung habe und in der Gottes Anspruch auf alleinige Verehrung menschliche Entfaltung enorm erschwere. Und das alles sei dann auch noch in die starren Regeln der Scharia, des islamischen Rechts, gegossen und damit unangreifbar gemacht worden – so sehr, dass dieser Charakter des Islam bis heute fortwirke.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























