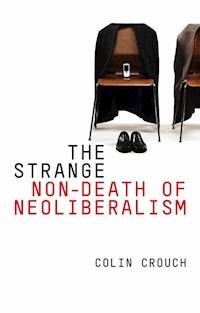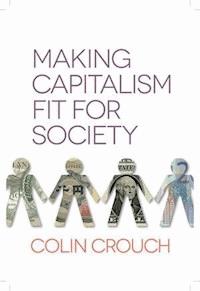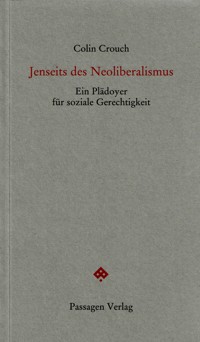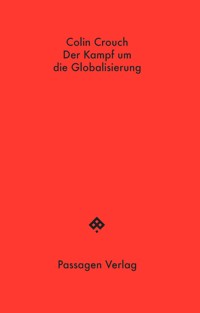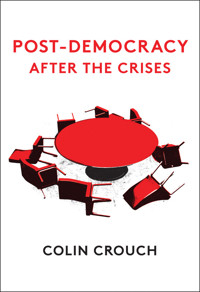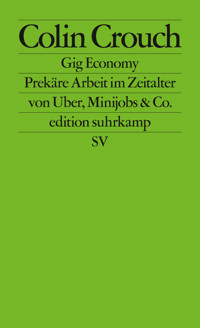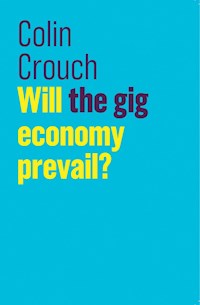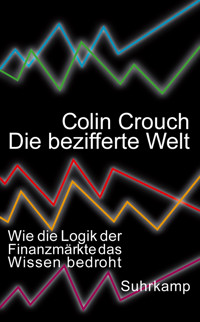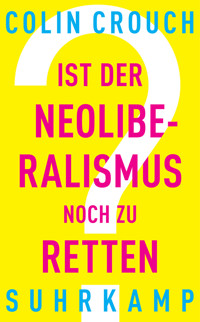
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dass es den Neoliberalismus gar nicht gibt, dass es sich dabei nur um einen »Kampfbegriff« handelt, ist zu einem Hauptargument (dem letzten?) seiner Verteidiger geworden. Kaum ein Autor hat dabei so viel zum Verständnis dieses Konzepts beigetragen wie Colin Crouch. Angesichts des rechtspopulistischen Widerstands gegen die marktradikale Form der Globalisierung, angesichts von wachsender Ungleichheit und von Tragödien wie der Brandkatastrophe im Londoner Grenfell Tower stellt Crouch nun die Frage, ob der Neoliberalismus noch zu retten ist. Jenseits polemischer »Dämonologie« und ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten, analysiert er die Schwachpunkte dieses Ansatzes. Mit der ihm eigenen Blindheit für seine sozialen Nebenfolgen ist der, so Crouch, Neoliberalismus endgültig selbstzerstörerisch geworden. Werden die Konzerne und Individuen, die bislang von ihm profitieren, das einsehen und endlich umsteuern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
3Colin Crouch
Ist der Neoliberalismus noch zu retten?
Aus dem Englischen von Frank Jakubzik
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
1 Was spricht gegen den Neoliberalismus?
Was ist Neoliberalismus?
Fazit: Das spricht gegen den Neoliberalismus
2 Das Kind im neoliberalen Bade
Ausgabenplanung und Kostendisziplin
Grenzen des demokratischen Regierens
Erleichterung des Handels, Abbau von Handelshemmnissen
Mehr Kontakte zwischen den Menschen
Fazit: Die Vorzüge des Neoliberalismus
3 Ist der Neoliberalismus reformierbar?
Die strategischen Akteure des Neoliberalismus
Der Markt und nichts als der Markt?
Neoliberalismus und Nachhaltigkeit
Massenkonsum und Ungleichheit
Der Neoliberalismus und die Angst vor Fremden
Fazit
Literatur
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
94
95
71
Was spricht gegen den Neoliberalismus?
In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2017 zerstörte ein verheerender Großbrand ein Wohnhochhaus im Londoner Stadtteil Kensington – und nicht wenige Menschen in Großbritannien und anderswo verstanden diese Katastrophe als finalen Kommentar zu einer Ideologie, an der sich die britische Politik in den vergangenen vierzig Jahren maßgeblich orientiert hat. Ein kleines Feuer, das sich in einer der Wohnungen des Grenfell Towers entzündet hatte, breitete sich rapide über das ganze Gebäude aus und kostete wohl um die einhundert Menschen das Leben – die genaue Zahl wird wahrscheinlich nie zu ermitteln sein. Ebenfalls noch nicht geklärt ist, welche Rolle die kurz zuvor installierte Fassadenverkleidung bei der Ausbreitung des Brandes spielte und warum ein Material verwendet wurde, das in Deutschland, den USA und einigen anderen Ländern nicht zugelassen ist. Allerdings besteht der berechtigte Verdacht, dass Kostenerwägungen der 8öffentlichen Hand ausschlaggebend für die Wahl der Verkleidung waren. Eine Gruppe von Bewohnern des Hochhauses hatte die zuständige Verwaltung des Boroughs of Kensington and Chelsea insgesamt neunzehn Mal auf ihre Bedenken in dieser Sache aufmerksam gemacht, jedoch keine Antwort erhalten. Wie die meisten lokalen Behörden Großbritanniens hat die Verwaltung des Boroughs das Management ihrer Liegenschaften (und zahlreiche weitere Dienstleistungen) an Privatunternehmen ausgelagert, die sich zuerst um den Profit ihrer Aktionäre und dann erst um die Qualität ihrer Leistungen kümmern. In den Stunden und Tagen nach dem Brand eilten neben Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten zahlreiche Freiwillige den obdachlos gewordenen Grenfell-Mietern zu Hilfe – Sozialarbeiter der örtlichen Verwaltung hingegen ließen sich so gut wie gar nicht blicken. Bis Anfang August hatten sie lediglich zehn der über hundert Familien, die in dem Hochhaus gewohnt hatten, mit Ausweichunterkünften versorgt. Der Borough of Kensington and Chelsea ist der reichste der Londoner Stadtbezirke und eine der teuersten Wohngegenden der Welt; viele Wohnungen und Häuser dort stehen leer, weil sie wohlhabenden Leuten aus aller Herren Ländern gehören, die sie nur gelegentlich nutzen oder als Investitionsobjekte betrachten.
Im Rat des Boroughs verfügt die Konservative Partei, der wichtigste politische Repräsentant neolibe9raler Ideen im Vereinigten Königreich, über eine absolute Mehrheit. Viele der wohlhabenden Einwohner des Bezirks verdienen ihr Geld im Finanzsektor, der die britische Wirtschaft dominiert und seinen Erfolg in nicht geringem Maß dem Einfluss des Neolibe-ralismus verdankt. Dessen Grundüberzeugungen wiederum besagen, dass die Staatsausgaben einschließ-lich der Aufwendungen für Soziales auf ein Mini-mum reduziert werden müssten, dass Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften läppisch und schädlich seien und dass gewinnorientierte Privatunternehmen öffentliche Dienstleistungen effizienter anbieten könnten als Behörden. Die Bewohner des Grenfell Towers waren Mieter von Sozialwohnungen. In einer idealen neoliberalen Welt dürfte es überhaupt keine Sozial-wohnungen geben; jeder würde mit der wie auch immer beschaffenen Behausung vorliebnehmen müs-sen, die er sich auf einem ganz und gar privaten Wohnungsmarkt leisten könnte. Unter dem Einfluss dieser Ideen haben britische Regierungen und Kommunalverwaltungen aller Parteien den Bestand an Sozialwohnungen immer weiter heruntergefahren. (1981 lag ihr Anteil noch bei 32 Prozent, der des privat vermieteten Wohnraums bei 11 Prozent, der Rest entfiel auf selbstgenutztes Wohneigentum. 2016 war der Anteil der Sozialwohnungen auf 7 Prozent gefallen und der des privat vermieteten Wohnraums auf 31 Prozent gestiegen.) Die Bewohner von Sozialbauten sind un10geliebte Überbleibsel der präneoliberalen Vergangenheit.
Daneben befürwortet der Neoliberalismus soziale Ungleichheit, da er in ihr die logische Folge mehr oder weniger marktgerechten ökonomischen Verhaltens erblickt. Wer meint, dass er zu arm ist, soll das als Anreiz verstehen, mehr Leistung zu erbringen. Dementsprechend spiegle sich in Einkommen und Vermögen eines Menschen sein gesellschaftlicher Wert wider. Ein von diesen Ideen inspirierter Gemeinderat wie der von Kensington and Chelsea kann Bewohnern eines Ortes wie des Grenfell Towers schwerlich viel Respekt entgegenbringen.
Diese und viele andere negative Folgen einer Politik, die auf niedrige Steuern und den Abbau von Regulierungen setzt, ein erhebliches Maß an Ungleichheit akzeptiert und sich kaum um soziale Belange kümmert, haben viele Menschen dazu gebracht, das neoliberale Projekt zur Gänze abzulehnen; zumindest haben sie die Überzeugung gewonnen, dass die Wortführer in Wirtschaft und Politik, die es jahrzehntelang vehement verfochten haben, nicht fähig sind, sie vor den von ihm verursachten Katastrophen zu schützen. Anderen allerdings gefällt die neoliberale Vision einer Welt, in der der Bürger nahezu sein gesamtes Einkommen für sich behält, ohne dass ihm der Fiskus etwas abknöpft, und er folglich selbst bestimmt, was er sich für sein Geld kauft, anstatt dass eine Behörde es für 11Dinge ausgibt, an denen er womöglich kein Interesse hat; in der das Leben so wenig wie möglich von staatlichen Regelungen und Vorschriften bestimmt wird; in der Unternehmen nach eigenem Gutdünken nach Profit streben können und dabei einen Wohlstand erzeugen, der nach und nach allen zugutekommt. Im Zentrum dieser Vision steht ein freier, von niemandem dominierter Markt, auf dem Verbraucher ihren individuellen Vorlieben folgen und die Waren und Dienstleistungen angeboten werden, nach denen die größte Nachfrage besteht. Der auf dem Markt gebildete Preis bestimmt den Wert der jeweiligen Waren und Dienstleistungen. Kunden, Anbieter und Volkswirtschaften handeln und konkurrieren frei und einvernehmlich miteinander; jeder macht das, was er am besten kann, und profitiert von den Beiträgen der anderen.
Ist es möglich, die Vorteile der freien Marktwirtschaft zu nutzen und trotzdem an staatlicher Sozialfürsorge, steuerlicher Umverteilung und maßvoller Regulierung festzuhalten, um die Auswüchse eines Systems zu beschneiden, das einzig auf Profitmaximierung und individuellen materiellen Gewinn abzielt und dabei extreme Ungleichheit erzeugt? In der Praxis muss die Antwort Ja lauten, denn das neoliberale Ideal ist in keiner entwickelten Wirtschaft – nicht einmal in den USA, wo neoliberale Ideen besonders dominant sind – zur Gänze verwirklicht worden. So12zialausgaben, progressive Besteuerung und Regulierungen haben ihrer Abschaffung getrotzt oder sind wieder eingeführt worden. Anders als im Kampf der Ideen kreist die Debatte zwischen Neoliberalen und ihren Kritikern in der Realpolitik also um eine Frage des Maßes: nicht um Erhalt oder Abschaffung der im entsprechenden Fall rivalisierenden Institutionen, sondern um ihre Gewichtung.
Ich gehöre zu denen, die den Eindruck haben, dass es der Neoliberalismus trotz mancher Kompromisse mit der Förderung der sozialen Ungleichheit übertrieben hat und den Werten, für die der Markt steht, also etwa Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und dergleichen, in zu hohem Maß Vorrang vor anderen einräumt. Wie lässt sich ihr Verhältnis besser ausbalancieren? Dass es sich anders ausbalancieren lässt, ist unstrittig: Es herrscht kein Mangel an Ideen, praktischen Politiken und nationalen Beispielen für einen faireren Ausgleich zwischen wettbewerbsorientierter Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit. Es ist also eine Frage des Wollens und der Macht zur Umsetzung. Weltkonzerne und wohlhabende Privatpersonen haben großen Einfluss auf die Regierungen der meisten Staaten und sie haben großes Interesse an niedrigen Steuern (zumindest für die Wohlhabenden), minderwertigen staatlichen Dienstleistungen (zumindest für die Armen) und einer geringen Regulierung der Wirtschaft. Wir brauchen die Arbeitsplätze, die die 13Konzerne schaffen, und die Waren und Dienstleistungen, die sie produzieren. Doch je wohlhabender Konzerne und Reiche sind, desto größer auch ihre Möglichkeiten, Einfluss auf Regierungen zu nehmen und eine Politik herbeizuführen, die ihren Interessen dient und sie noch wohlhabender macht, wodurch sie wieder mehr Einfluss erhalten – eine sich selbst verstärkende Dynamik. Demnach erscheint allein eine stetige Intensivierung neoliberaler Verhältnisse möglich, eine Mäßigung jedoch ausgeschlossen. Es ist eine bittere Ironie, dass dieser politische Prozess, durch den der Neoliberalismus immer fester im Sattel sitzt, vollkommen konträr zu dessen Prinzipien steht, die politischen Lobbyismus von Wirtschaftsakteuren ausschließen.
Doch die glänzende Fassade des Neoliberalismus hat Risse bekommen. Der Kollaps des Finanzsektors in den Jahren 2007 und 2008 wurde in erster Linie von ihm selbst verursacht, und die Folgen haben in den vergangenen Jahren in vielen Ländern den Volkszorn geschürt. Wie Wolfgang Streeck in seinem Buch Gekaufte Zeit gezeigt hat, ist die Weltwirtschaft zunehmend von einer privaten und öffentlichen Verschuldung abhängig, deren Ausmaß die Grenzen der Nachhaltigkeit überschreitet. Deshalb erwarten manche Beobachter, dass das gesamte Gebäude des neoliberalen Kapitalismus in nächster Zeit zusammenbrechen wird. Manche glauben, damit werde die Möglichkeit 14