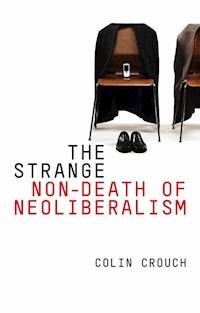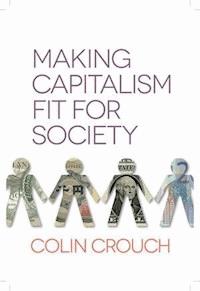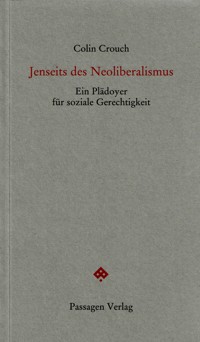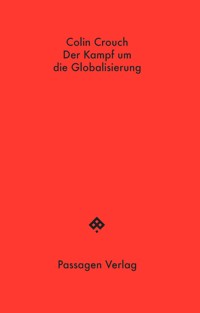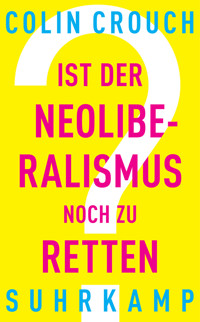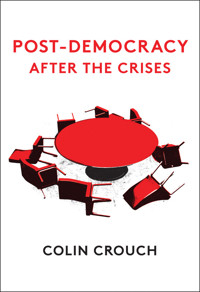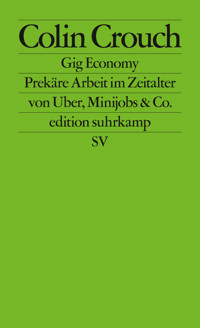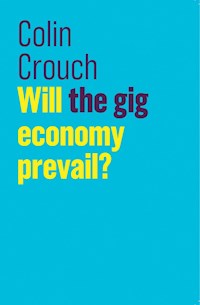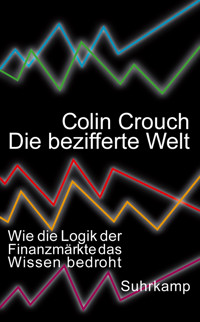
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein Staat, der seinen Ärzten 55 Pfund für jede gestellte Demenzdiagnose versprechen will. Firmen, die die Warnungen von Wissenschaftlern und Ingenieuren ignorieren und Sicherheitsmängel nicht beseitigen, weil ihnen die Beseitigung zu teuer erscheint. In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass die Logik des Neoliberalismus trotz der Krise weiterhin auf dem Vormarsch ist. Colin Crouch zeigt, wie sie sich auf alle Lebensbereiche ausdehnt: Schulen, Krankenhäuser und Polizei werden im Rahmen des großen Zahlenspiels umstrukturiert und dem Diktat der Kennziffern unterworfen; aus Studierenden und Fahrgästen sollen Kunden werden, die agieren wie Rechenmaschinen. Auf dem Weg in die »Informationsgesellschaft« bleibt eine zentrale Ressource auf der Strecke: das Wissen selbst.
Colin Crouch zeichnet nach, wie der Neoliberalismus alternative Formen des Wissens und der Expertise korrumpiert und letztlich unsere Gesellschaften gefährdet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Im Herbst 2014 wurde bekannt, der britische National Health Service wolle in Zukunft Ärzten für jede Demenzdiagnose 55 Pfund bezahlen. Die Empörung war groß: Steigt so nicht das Risiko von Fehldiagnosen? Wissen Ärzte nicht auch ohne solche Anreize, was zu tun ist? Das Beispiel zeigt, daß die Logik des Neoliberalismus trotz der großen Krise weiterhin auf dem Vormarsch ist.
Der damit verbundene Wandel betrifft alle Lebensbereiche: Schulen, Krankenhäuser und Polizei werden im Rahmen des großen Zahlenspiels umstrukturiert und dem Diktat der Kennziffern unterworfen; aus Studenten und Fahrgästen sollen Kunden werden, die agieren wie Rechenmaschinen. Auf dem Weg in die »Informationsgesellschaft« bleibt eine zentrale Ressource auf der Strecke: das Wissen selbst.
Colin Crouch zeichnet nach, wie der Neoliberalismus alternative Formen des Wissens und der Expertise korrumpiert. Anders als seine Apologeten behaupten, ist der Markt keine perfekte Wissensmaschine, die aus anonymen Entscheidungen Transparenz herbeizaubert, im Gegenteil: Läßt man die Logik der Finanzmärkte ungehindert operieren, kann sie das Immunsystem unserer Gesellschaften zerstören.
Colin Crouch, geboren 1944, lehrte bis zu seiner Emeritierung Governance and Public Management an der Warwick Business School. Sein Buch Postdemokratie (es 2540) gilt als Klassiker der Zeitdiagnose. Für Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus erhielt Crouch 2012 den Preis »Das politische Buch« der Friedrich-
Colin Crouch
DIE BEZIFFERTE WELT
Wie die Logik der Finanzmärkte das Wissen bedroht
Postdemokratie III
Aus dem Englischen von Frank Jakubzik
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2015.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2015
© Suhrkamp Verlag Berlin 2015
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Satz: Satz-Offizin Hümmer GmbH, Waldbüttelbrunn
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Inhalt
Danksagung
1. Der Neoliberalismus und das Problem asymmetrischer Information
2. Das Wissen und die Privatwirtschaft
3. Der Verfall der Moral im öffentlichen Dienst
4. Wissen für Bürger, Konsumenten oder Objekte?
5. Bürger, Kunden, Politiker, Fachkräfte und Finanzleute
Bibliographie
Für Joan
Danksagung
Ohne die Mitarbeit meiner Frau Joan hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Sie hat nicht nur große Teile des Materials gesammelt, sondern ließ mich auch an Erfahrungen aus ihrer jahrelangen Tätigkeit im englischen Schulsystem teilhaben, die das Inspektionswesen, das Berufsethos qualifizierter Fachkräfte und andere Aspekte des öffentlichen Dienstes betrafen. Zudem unterstützte sie mich im Bemühen um eine dem allgemeinen Publikum zugängliche Ausdrucksweise.
Für Hinweise und Ermutigung danken möchte ich zudem meinen Lektoren John Thompson bei Polity Press und Heinrich Geiselberger bei Suhrkamp.
Wie stets bin ich für alle verbliebenen Irrtümer und Patzer allein verantwortlich.
1. KapitelDer Neoliberalismus und das Problem asymmetrischer Information
Im Oktober 2014 wurde bekannt, daß der britische National Health Service (NHS) Hausärzten für jede Demenzdiagnose eine Prämie in Höhe von 55 Pfund in Aussicht stellte. Daß Demenzerkrankungen häufig zu spät erkannt werden, gilt seit längerem als ernstes Problem – der NHS wollte die Motivation der Ärzte, diesbezügliche Untersuchungen durchzuführen, durch den finanziellen Anreiz steigern.
Das Vorgehen stieß bei Ärzteschaft und vielen Patientengruppen auf empörte Ablehnung. In einem im British Medical Journal abgedruckten Offenen Brief an die Leitung des NHS (BMJ 2014) protestierten mehr als fünfzig Ärzte gegen die Auslobung der Prämie, die das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patienten untergrabe, das auf fachlicher Integrität, nicht auf einer Gewinnerzielungsabsicht beruhe. Einige Patientengruppen gaben ihrer Befürchtung Ausdruck, Ärzte könnten aus finanziellen Erwägungen häufiger als geboten Demenz diagnostizieren. Viele Vertreter der Öffentlichkeit zeigten sich überrascht, daß der NHS überhaupt mit derartigen finanziellen Anreizen arbeitet.
Das hätte allerdings niemanden überraschen sollen. Die Annahme, daß man Menschen in jedem Fall am besten mit Geld motiviere und sich lieber nicht auf ihre fachliche Kompetenz verlassen solle, ist seit einigen Jahren tief in den Köpfen von Managern und Entscheidern in vielen Lebensbereichen verankert. Sie hat inzwischen weit mehr Schaden angerichtet, als es ein kleiner finanzieller Anreiz für Demenzdiagnosen vermöchte. Und um diese Idee und ihre Folgen geht es im vorliegenden Buch.
Daß so viele Lebensbereiche wie möglich unter marktwirtschaftlichen Aspekten zu betrachten und damit letztlich auf die in ihnen verkörperten Geldwerte zu reduzieren seien, ist eine der zentralen Thesen des Neoliberalismus, der einflußreichsten politischen und ökonomischen Ideologie der Gegenwart. Einer überzeugten Anhängerschaft erfreut sie sich insbesondere in jenem Sektor der Weltwirtschaft, der über die größte Dynamik und den größten Einfluß auf die Politik verfügt: dem Finanzmarkt. Hier wird alles und jedes allein nach Maßgabe des mutmaßlichen Preises bewertet, den ein Käufer zu zahlen bereit ist, weil er seinerseits die Vermutung hegt, daß ein anderer Käufer einen höheren Preis zu entrichten bereit wäre, der wiederum davon ausgeht, daß ein weiterer Interessent … So entsteht ein infiniter Regreß von Preisvermutungen, die jeweils auf Mutmaßungen hinsichtlich anderswo zu erzielender Preise rekurrieren.
Die alleinige Konzentration auf den Preis darf sich durchaus gewisser Vorzüge rühmen, etwa hinsichtlich der Vergleichbarkeit unterschiedlicher Güter. Allerdings richtet die nicht weiter hinterfragte Vorstellung, daß sich der Wert eines Guts allein an dem mit ihm mutmaßlich zu erzielenden Preis bemesse, nicht selten auch erhebliche Schäden an.
Die Problematik ist allgemein bekannt und war immer wieder Gegenstand politischer Debatten: Uneingeschränktes Wirtschaftswachstum schadet der Umwelt, der Markt selbst vermag aber nichts dagegen zu tun. Dinge wie Liebe oder Zufriedenheit lassen sich nicht auf Märkten handeln, es sei denn, man definiert sie grundlegend neu. Weithin einig ist man sich auch darin, daß niemand aus Mangel an Zugang zu Geld auf grundlegende Rechte in punkto Gesundheit, Bildung, Ernährung und Wohnen verzichten müssen soll. Überdies hat uns, was weniger erwartbar gewesen ist, die Anwendung solcher »rein marktwirtschaftlicher« Verfahren auf dem Finanzsektor selbst in den Jahren 2007ff. eine katastrophale globale Wirtschaftskrise eingetragen.
Doch daneben droht, bislang kaum beachtet, ein weiteres Gebiet der Dominanz des Geldes und der inzwischen zum Leitstern fast aller politischen Entscheidungen avancierten Finanzkennziffern zum Opfer zu fallen: das der Information, der Kenntnisse und des Wissens. Diese Diagnose mag zunächst überraschen, da die neoliberale Theorie selbst ein intellektuelles Gebilde ist und ein hohes Maß an Wissen voraussetzt. Zudem führt sie das erwünschte Wirtschaftswachstum nicht zuletzt auf den Fortschritt der Wissenschaften zurück, deren Leistungsvermögen natürlich entscheidend von Informationen und Erkenntnissen abhängt.
Meine zentrale These, der Neoliberalismus sei ein Feind des Wissens, wird daher einiger Erläuterung bedürfen. Dabei kommt es mir natürlich gelegen, daß die Verfälschung von Informationen und Erkenntnissen anerkanntermaßen zu den Ursachen der erwähnten Finanzkrise gehörte.
Auf den folgenden Seiten werde ich versuchen, diese These zu untermauern und zu zeigen, welche tiefgreifenden Beschädigungen unseres Lebens – insbesondere in Hinsicht auf unsere Bemühungen um eine moralische Lebensführung – aus der Neigung des Neoliberalismus resultieren, die Manipulation von Informationen und die Diskreditierung von Fachwissen zu befördern. Zudem werde ich untersuchen, wie sich diese Neigung womöglich bekämpfen ließe.
Meine Argumentation stützt sich dabei auf folgende fünf Annahmen:
1. Der Versuch, den öffentlichen Dienst nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten umzubauen, der ein grundlegendes Bestreben neoliberaler Politik darstellt, führt zu einer radikalen Beschneidung der Kenntnisse, Kompetenzen und Qualifikationen des dort beschäftigten Fachpersonals. Die sich daraus ergebende Problematik spielte auch bei der Frage der Prämierung von Demenzdiagnosen eine Rolle.
2. Obgleich der Markt selbst eine hochelaborierte Form der Wissensproduktion darstellt, untergräbt er, wenn ihm keine Schranken gesetzt werden, andere Formen der Erkenntnisgewinnung, so etwa die wissenschaftliche, die eine der Grundlagen des modernen Lebens bildet.
3. Die klassische marktwirtschaftliche Theorie ging davon aus, daß sich die Mehrzahl der Marktteilnehmer moralisch integer verhält. Die gegenwärtig dominierende Rational-choice-Theorie prämiert hingegen Verhaltensweisen, die sich der Verfälschung und Verzerrung von Informationen und Wissen bedienen.
4. Eine marktwirtschaftliche Ökonomie zeichnet sich der ursprünglichen Idee nach dadurch aus, daß eine hohe Anzahl von Konsumenten und Produzenten am Markt teilnimmt. Der heute herrschende Neoliberalismus hingegen toleriert hohe Konzentrationen monopolartiger Marktmacht auf Anbieterseite, wodurch einige Bereiche der Wirtschaft von sehr wenigen Unternehmen dominiert werden. In manchen Fällen führt das so weit, daß einflußreiche Wirtschaftseliten den Zugang zu Informationen und Wissen kontrollieren und beides auf eine ihren Interessen förderliche Weise manipulieren können. Ich werde diese zwar einigermaßen pervertierte, aber vorherrschende Form des Neoliberalismus in den folgenden Kapiteln als »Neoliberalismus der Konzerne« bezeichnen.
5. Zum Gegenstand von Manipulationen werden auch Kenntnisse und Informationen, die unser Bild von uns selbst betreffen. Um wirklich uneingeschränkt effizient am Markt agieren zu können, müssen wir uns in egozentrische und amoralische Rechenmaschinen verwandeln. Solange wir daneben auch noch andere Verhaltensweisen an den Tag legen, ist das nicht unbedingt problematisch. Wenn jedoch der Markt und analoge Systeme auf immer weitere Lebensbereiche übergreifen, wie es heute der Fall ist, schafft das einen Anreiz, alle unsere sonstigen Eigenschaften zu unterdrücken und uns in unserem alltäglichen Handeln vor allem am Vorbild derartiger Maschinen zu orientieren.
Unter dem Strich führen diese Entwicklungen zu einem schwerwiegenden Problem: Während sich der kaum noch durch politische Regulierungen beschränkte, von der Notwendigkeit vertrauensbildenden Verhaltens befreite und von extremen Konzentrationen ökonomischer Macht verzerrte Markt in immer neue Lebensbereiche ausbreitet, laufen alle diejenigen, die keiner politischen oder wirtschaftlichen Elite angehören, in wachsendem Maß Gefahr, von seinen Anbietern übers Ohr gehauen zu werden. Zwar erregen die einschlägigen Skandale – der Verkauf fauler Finanzprodukte durch Banken und Versicherungen, unmoralische Formen der Informationsbeschaffung durch Medien, die Manipulation von Leistungskennziffern in Ämtern und öffentlichen Einrichtungen und so weiter – erhebliche Aufmerksamkeit und werden weithin mißbilligt. Zu zeigen wäre allerdings, daß zwischen diesen vermeintlichen Einzelfällen systematische Zusammenhänge bestehen und daß sich viele von ihnen darauf zurückführen lassen, daß wir einem reichlich verzerrten Verständnis von Marktwirtschaft ein Übermaß an Respekt erweisen.
Damit will ich keineswegs behaupten, daß alle Formen von Unehrlichkeit in Wirtschaft und Politik dem Markt allein anzulasten wären. Betrug und Korruption kommen in allen Wirtschaftsformen vor, am häufigsten vermutlich in vom Staat gelenkten Ökonomien, in denen überhaupt kein Markt existiert. Manche Arten solchen Fehlverhaltens resultieren allerdings sehr wohl aus der Weise, in der Märkte heute funktionieren, und sie ließen sich erheblich reduzieren, wenn die Politik der Machtfülle, die Märkte und Unternehmen heute genießen, weniger unkritisch gegenüberstünde.
Unter dieser Machtfülle hat in besonderem Maße das demokratische Gemeinwesen zu leiden, denn zuverlässige Informationen sind sein Lebenselixier. Sobald die Inhaber großer Einflußsphären über die Macht verfügen, Informationen zu unterschlagen oder die Öffentlichkeit mit einseitigen, irreführenden oder sonstwie manipulierten Informationen zu versorgen, wird das betroffene Gemeinwesen zur Geisel ihrer Eigeninteressen. In dieser Hinsicht schließt die auf diesen Seiten geführte Diskussion auch an meine Darlegungen zum Thema Postdemokratie an (Crouch 2004).
In den folgenden Kapiteln wird der Umstand, daß ungebremste Märkte und Konzerne, die eine monopolartige Stellung innehaben, eine Verminderung der Kenntnisse und Kompetenzen hochqualifizierten Personals betreiben, immer wieder eine Rolle spielen. Wenn ich dabei von Fachkräften oder Experten spreche, meine ich nicht ausschließlich Angehörige elitärer Berufe, sondern im weiteren Sinne auch Techniker, Pflegekräfte und Betreuungspersonal sowie jeden Mitarbeiter, der für die Erbringung seiner Dienstleistung eines eigenen Ermessensspielraums hinsichtlich seiner Vorgehensweise und seines Arbeitsaufwands bedarf. In jedem dieser Fälle besteht ein Spannungsverhältnis zwischen diesen Fachkenntnissen und -kompetenzen (die nicht selten exklusives Eigentum der jeweiligen Facheliten sind) und den Anforderungen eines demokratischen Miteinanders.
Sprecher der Wirtschaft wie des Staats nehmen gern für sich in Anspruch, die Interessen dieser Fachkräfte zu vertreten. Manchmal wenden sie sich aber auch gegen sie, zumeist unter Verweis auf Verbraucher- beziehungsweise Bürgerrechte. So beklagen Politiker häufig, daß das Personal des öffentlichen Dienstes ein arrogantes, unzugängliches und elitäres Gebaren an den Tag lege und es an Dienstleistungsbereitschaft mangeln lasse. Vertreter des Marktes wiederum behaupten, daß Fachkräfte, vor allem im öffentlichen Dienst, ihre Kunden gern bevormunden und sich ein eigenes Urteil darüber anmaßen, wo deren Interessen liegen – anstatt wie auf dem Markt einfach das zu liefern, was ihre Kunden verlangen, die sehr viel besser wüßten, was in ihrem Interesse sei.
Hinter der politischen Forderung, daß sich auch hochqualifizierte Fachleute nach dem Markt richten sollen, steckt zumeist das populistische Versprechen, das Konsumentenvolk von der »Bevormundung« durch diese Fachleute und ihre Kenntnisse zu »befreien« – was gleichermaßen auf Mitarbeiter im Pflegebereich wie auch auf Wissenschaftler zielt, die vor den Gefahren der globalen Erwärmung oder mit Produkten der Junkfood-Industrie einhergehenden Gesundheitsrisiken warnen. Der Markt, so meinen die Befürworter marktwirtschaftlicher Verhältnisse etwa im Gesundheitswesen, schaffe eine unmittelbare, von Störungen durch Politik und Bürokratie freie Beziehung zwischen Arzt und Patient. Viele Ärzte befürchten allerdings, die Einführung von Finanzkennzahlen und marktwirtschaftlichen Methoden könne – wie im Fall der prämierten Demenzdiagnosen – das aus ihrer Sicht unabdingbare Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und ihren Patienten zerstören.
Diese Problematik werde ich im letzten Kapitel näher beleuchten. Zunächst möchte ich meine Behauptung untermauern, daß von gewissen Formen der Marktwirtschaft die Gefahr einer allgemeinen Verdummung, einer Minderung unserer Kenntnisse und unseres Wissensstands ausgeht – und en passant eine Gefahr für unser Vertrauen in andere und unsere Bereitschaft, moralisch zu handeln.
Das soll nicht heißen, daß der Neoliberalismus die Ursache des gegenwärtig überall zu beobachtenden Vertrauensverlusts sei. Ich würde nicht einmal behaupten, daß es einen solchen Vertrauensverlust tatsächlich gibt. Vielmehr teile ich die Ansicht, die Onora O'Neill in ihrer exzellenten Arbeit zu diesem Thema (2002) vertritt: Wir haben zwar das Gefühl, daß allerorten ein Mangel an Vertrauen herrsche, bringen aber in unserem eigenen Alltag keineswegs weniger Vertrauen auf als zuvor.
Der Neoliberalismus spielt in diesem Zusammenhang vor allem deshalb eine Rolle, weil seine Advokaten unerschütterlich behaupten, daß der Markt alle Vertrauensprobleme lösen werde, weil er Vertrauen überflüssig mache. Das trifft, wie wir sehen werden, sogar in vielen Fällen zu. Aber eben nicht in allen. Und auf verschiedene Weisen kann der Markt dem Vertrauen sogar abträglich sein.
Marktanaloge Kennziffern und Rankings im öffentlichen Dienst
Ein Beispiel wird verdeutlichen, worauf sich die erste meiner oben aufgeführten Thesen bezieht, und uns zum Kern der Problematik leiten, um die es mir hier geht. Sie ist nicht unbedingt der beste Ausgangspunkt; das wäre eher der umfassendere Punkt 2. Ich habe sie dennoch an den Anfang gestellt, weil sie die politisch folgenreichste und am leichtesten zu erkennende Entwicklung betrifft.
Seit den achtziger Jahren ist es in Mode gekommen, die Leistungen von Einrichtungen des öffentlichen Dienstes meß- und vergleichbar zu machen, indem man deren Beschäftigten – Lehrern, medizinischem Personal, Pflege- und Betreuungskräften, Polizisten und so weiter – Zielzahlen vorgibt, deren jeweilige Erreichung oder Nichterreichung in Rankings übertragen wird. Diese Rankings werden veröffentlicht; einerseits, um die Nutzer eines Dienstleistungsangebots der öffentlichen Hand in die Lage zu versetzen, zwischen verschiedenen Anbietern wählen zu können, zum anderen jedoch stets, damit die Leiter und Manager öffentlicher Betriebe wie Manager von Privatunternehmen agieren und belohnt beziehungsweise bestraft werden können, je nachdem, ob sie »Gewinne« oder »Verluste« erwirtschaften.
Die dahinterstehende Absicht ist es, sowohl die Nutzer wie auch das Management öffentlicher Dienstleister in eine Lage zu versetzen, die weitestmöglich der von Kunden beziehungsweise Anbietern auf einem Markt entspricht. Die Leistungskennziffern sollen dabei die Rolle übernehmen, die auf dem Markt dem Preis zukommt.
Der Theorie des freien Marktes zufolge sieht das Procedere – das ich hier der Einfachheit zuliebe nur aus Sicht des Kunden darlege – etwa so aus: Der Kunde kauft, nachdem er sich einmal für eine bestimmte Geschmacksrichtung und Qualitätsstufe entschieden hat, eine Ware auf Grund eines simplen Preisvergleichs, also anhand eines einzigen Indikators. Das ist das Schöne am Markt: Er stellt uns in einem einzigen Datum alle Informationen zur Verfügung, die wir brauchen, um effiziente Entscheidungen zu treffen.
Nun will man also den Eltern schulpflichtiger Kinder, den Patienten, die eine Klinik suchen, oder auch den Insassen von Altenheimen anhand von Kennziffern und Rankings ähnlich einfache Vergleiche ermöglichen. Der Theorie nach hat das zwei positive Folgen. Erstens werde der einzelne Nutzer öffentlicher Einrichtungen in die Lage versetzt, seine Entscheidung für einen Anbieter selbst zu treffen, anstatt sie sich von staatlichen Autoritäten diktieren lassen zu müssen. Zweitens erstehe für alle Anbieter eines Segments ein Anreiz, ihre rankingrelevanten Leistungen zu verbessern, weil sie andernfalls Kunden verlieren – im Gegensatz zu einem öffentlichen Dienstleister alter Art, der durch nichts daran gehindert werde, einer machtlosen Kundschaft eine monopolistische und konkurrenzlose Dienstleistung so anzubieten, wie es ihm, nicht wie es der Kundschaft gefällt.
Man darf die Vorteile dieses Ansatzes nicht unterschätzen, insbesondere jene nicht, die der zweite Punkt mit sich bringt, der auch für die Manager der Einrichtungen hilfreich ist. Es kommt hier nicht so sehr auf die Wahlfreiheit des Konsumenten als Selbstzweck an, als vielmehr auf den Anreiz zur Leistungssteigerung, der für den Anbieter darin liegt, daß der Nutzer die Möglichkeit erhält, eine Wahl zu treffen.
Allerdings hat das Arrangement auch seine Schattenseiten. So kann immer nur eine Auswahl von Parametern in die Leistungsmessung einbezogen werden, da sonst die Datenmenge zu groß würde und der Konsument überfordert wäre. Aus dieser Notwendigkeit ergeben sich zwei Nachteile. Erstens wären es letzten Endes dann eben doch wieder Minister, Behördenleiter und ihre Berater, die bestimmten, was ein rankingrelevanter Leistungsparameter ist und was nicht. Auf diese Weise können sie solchen Kriterien eine größere Bedeutung verschaffen, an denen sich die Nutzer ihrer Ansicht nach orientieren sollten. Und das müssen natürlich nicht unbedingt die sein, die die Nutzer selbst ausgewählt hätten.
So ermutigt der britische Staat beispielsweise junge Leute dazu, sich bei der Entscheidung für ein Studienfach an den Einkommen zu orientieren, die Absolventen des jeweiligen Fachs nach dem Studium typischerweise erzielen (mehr dazu im folgenden Kapitel). Sie sollen ihren Bildungsweg also vor allem in Hinblick auf seine möglichen finanziellen Folgen betrachten – und nicht unter dem Aspekt ihrer intellektuellen Interessen oder des Vergnügens, das ihnen das Lernen in einem Fach bereitet. Daß Politiker ein solches Ziel verfolgen, ist nicht an sich verwerflich. Daß sie sich dazu jedoch suggestiver Methoden bedienen, paßt nicht recht zur vielbeschworenen »Wahlfreiheit« des Konsumenten, der seine Entscheidungen dank solcher Indikatoren angeblich frei von staatlichem Einfluß treffen kann. Tatsächlich ändert sich lediglich der Stil der politischen Einflußnahme: Sie bedient sich einer Technik subtiler und verdeckter »Anstöße«, die zwar weniger autoritär daherkommen, aber gerade dadurch auch schwerer zu durchschauen und also kritisch zu hinterfragen sind.
Als »Schubser« (der englische Begriff lautet »nudge«) bezeichnet man Verfahren, mit denen Unternehmen, Behörden und andere mächtige Akteure uns, möglichst ohne daß wir es merken, zu einem von ihnen gewünschten Verhalten anzuregen versuchen. Ein klassisches Beispiel ist die Anordnung der Waren in einem Supermarkt, insbesondere in Kassennähe. Die Übertragung solcher kommerziellen Techniken auf das Gebiet der Politik geht auf die Überlegungen zweier amerikanischer, mit den Methoden der Verhaltensökonomie arbeitender Wissenschaftler namens Richard Thaler und Cass Sunstein (2009) zurück, von denen einer, Sunstein, von der Regierung Obama zum Leiter des »Office of Information and Regulatory Affairs« berufen wurde. Die konservativ-liberale Koalition in London wiederum installierte etwa zur gleichen Zeit das »British Behavioural Insights Team« innerhalb des dem Premierminister unterstellten »Cabinet Office«. Diese »Nudge Unit«, wie sie in der Öffentlichkeit heißt, hat die Aufgabe, zu untersuchen, inwieweit sich die Ideen von Thaler und Sunstein in Großbritannien umsetzen lassen.[1]
Mit den Verfahren des »Anschubsens« will man Bürger dazu bringen, sich wie von der Politik gewünscht zu verhalten, ohne dies durch Gesetze und Verordnungen regeln und kontrollieren zu müssen. Befürworter des politischen Gebrauchs von »Anstößen« verweisen gern auf deren Bedeutung in der Gesundheitserziehung, mit der sich Thaler und Sunstein vorrangig befaßten. Einer ihrer diesbezüglichen Vorschläge lautete, daß man überprüfen solle, ob sich die Techniken, mit denen Nahrungsmittelhersteller Menschen zum Verzehr ungesunder Lebensmittel verführen, nicht auch für das entgegengesetzte Ziel verwenden ließen. Zweifellos ein durch und durch gut gemeinter Ansatz. Allerdings ist nicht schwer zu sehen, daß er sich ohne weiteres auch für weniger wohltätige und unmittelbar egoistische Zwecke verwenden läßt, da er es ermöglicht, anderen Menschen bestimmte Verhaltensweisen nahezulegen, ohne daß es ihnen überhaupt bewußt wird.
Ein zweites Problem solcher an Indikatoren orientierten Verfahren liegt darin, daß durch sie einer kleinen Anzahl – zumeist politisch relevant erscheinender – Aspekte einer Dienstleistung eine überragende Bedeutung beigemessen wird, während andere zwangsläufig in den Hintergrund treten. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird dadurch die tatsächliche Qualität der jeweiligen Dienstleistung ebenso verzerrt wie ihre Bedeutung für den Klienten. Diese Verfälschung überträgt sich dann auf die Beschäftigten der betreffenden Anbieter, die nachdrücklich aufgefordert werden, ihre Bemühungen auf die vom Indikator erfaßten Aspekte zu konzentrieren – was natürlich nur auf Kosten anderer Arbeitsbereiche möglich ist. Würden die zuständigen Behörden jeweils genau die richtigen Zielvorgaben machen und nur zweifellos untergeordnete Aspekte aus der Leistungsmessung ausschließen, könnte das dennoch ein nutzbringendes Verfahren sein. Häufig wird jedoch genau das nicht der Fall sein.
Dazu ein anderes Beispiel. Seit es in den neunziger Jahren zu einer großen Debatte über zu lange Wartezeiten in Krankenhäusern kam, legen britische Gesundheitspolitiker Wert darauf, daß jeder Patient möglichst schnell einen Termin bei seinem Hausarzt bekommt. Daher besteht heute für praktische Ärzte ein Anreiz, der Erstuntersuchung von Patienten Priorität vor anderen Elementen der Gesundheitsfürsorge, etwa vorbeugenden Maßnahmen, einzuräumen. Grundlage dafür ist offenbar die Annahme, daß die Meinung der Politiker auf Grund ihrer demokratischen Legitimierung höher zu bewerten sei als eine möglicherweise andere Auffassung der betroffenen Hausärzte – und möglicherweise ihrer Patienten.
Und damit stoßen wir auf die profunde Frage nach dem Verhältnis zwischen der Meinung demokratisch gewählter Politiker, dem Urteil von Fachleuten und den Wünschen der Menschen, mit der ich mich im letzten Kapitel ausführlicher befassen werde. Können wir darauf vertrauen, daß die Politiker bei der Auswahl von Leistungsindikatoren stets die wichtigsten Aspekte in den Vordergrund stellen? Oder besteht nicht die Gefahr, daß sie Dingen eine ungebührende Relevanz zukommen lassen, die etwa in den Medien eine herausragende Rolle spielen?
Hinzu kommt, daß öffentliche Dienstleister oft in Bereichen tätig sind, die für unser Leben eine wichtige Rolle spielen, in denen wir selbst jedoch nicht über genügend Kenntnisse verfügen, um ohne weiteres beurteilen zu können, welche die jeweils beste Lösung wäre. Die Advokaten des Marktes schmeicheln uns gern mit der Versicherung, wir seien hinreichend kompetent, um diesbezügliche Entscheidungen selbst zu treffen, sofern uns nur ein einfacher Indikator, etwas einem Preis Vergleichbares, zur Verfügung stehe. Aber können wir wirklich davon ausgehen, immer genau zu wissen, welche Elemente einer Gesundheitsdienstleistung für unser Wohlbefinden am wichtigsten sind, ohne über eine medizinische Ausbildung zu verfügen?
Lassen wir das vorerst dahingestellt. Fraglos verwenden staatliche Stellen Rankingsysteme häufig dazu, den Nutzer auf Grund ihrer Eigeninteressen in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen, was dem gern beschworenen Topos der Konsumentensouveränität eine leicht verlogene Note verleiht. Doch gibt es wirklich keine andere Möglichkeit, als uns entweder auf unsere relative Unwissenheit oder auf die von staatlichen Stellen vorgegebenen, politisch motivierten Indikatoren zu stützen? Sollten wir nicht vielleicht lieber doch ein offenes Ohr für die Leute haben, die bei öffentlichen Dienstleistungsanbietern beschäftigt sind und deren Beruf es ist, sich in ihrem Bereich umfassende Kenntnisse zu verschaffen und sie in qualitativ hochwertige Leistungen umzusetzen? Dürfen wir ihnen mehr Vertrauen schenken als den Politikern?
Die neoliberale Theorie behauptet, daß jeder Mensch in erster Linie durch Eigeninteressen motiviert werde. Folglich glaubt sie auch, daß Fachkräfte ihre überlegenen Kenntnisse systematisch dazu nutzen würden, uns zu hintergehen und überhöhte Preise zu verlangen, weil sie sich wie Geschäftsleute verhalten und verhindern wollen, daß wir das auch tun. Deshalb verdiene allein der Markt unser Vertrauen, der kein Mensch ist und daher auch keine eigenen Interessen verfolgt. Das ist die Denkweise, die den britischen NHS auf die Idee kommen ließ, Hausärzte mit einer Prämie zu belohnen, wenn sie bei einem ihrer Patienten Demenz diagnostizieren.
Der Markt als Produzent von Wissen
Ein Verfechter ungebremster Marktwirtschaft würde an dieser Stelle einwenden, daß die in meinen Beispielen behandelten Dienstleistungen gar nicht auf marktwirtschaftliche Weise betrieben würden, sondern von vornherein durch staatliches Eingreifen verzerrt seien. In einer wirklich freien Marktwirtschaft würden auch Schulen, Krankenhäuser und andere heute von der öffentlichen Hand angebotene Dienstleistungen von Privatunternehmen betrieben. Niemand würde Zielvorgaben machen, niemand Rankings erstellen oder den Kunden Orientierungshilfen aufdrängen (abgesehen von der Werbung natürlich).
Aus Sicht wahrer Marktgläubiger stellen selbst Vorschriften wie die zur Nahrungsmittelkennzeichnung einen unerlaubten Eingriff der Politik in die Freiheit des Konsumenten dar. Unter der Voraussetzung, daß sich hinreichend viele Anbieter und Nachfrager auf dem Markt tummeln, so argumentieren sie, könnten letztere ihre Wünsche, Bedürfnisse und Präferenzen umsetzen, indem sie einfach jene Produkte erwerben, die am besten dazu passen.
Wenn es also ein überwältigendes Verlangen nach kurzen Wartezeiten in Krankenhäusern gäbe, würden alle Krankenhäuser, die dem keine Priorität einräumten, Kunden verlieren; in der Folge würden sie entweder ihr Gebaren der Nachfrage anpassen oder eben vom Markt verschwinden. Wenn hingegen manche Kunden im Gesundheitsbereich Wert auf kurze Wartezeiten legten, anderen jedoch die Sauberkeit in den Einrichtungen wichtiger wäre, dann würden alle Krankenhäuser, die das eine oder das andere gewährleisten, florieren, weil sie unterschiedliche Kundengruppen anzögen. Probleme entstehen demnach allein dadurch, daß der Staat sozusagen Übergangseinrichtungen schafft, die nur in Ansätzen marktwirtschaftlich organisiert sind.
Daraus folgt eine überaus bedeutsame Behauptung, die zum Kernbereich der neoliberalen Theorie gehört; die Auseinandersetzung mit ihr wird eines der Hauptbestreben dieses Buches sein: Alles Wissen, dessen ein Käufer bedarf, um eine ihn zufriedenstellende Auswahl zu treffen, wird ihm vom Markt selbst zur Verfügung gestellt. Informationen, die nicht aus dem Marktgeschehen selbst hervorgehen, sondern von Anbietern, anderen Konsumenten oder vom Staat stammen, sind daher unnötig.
Aus der Summe der auf dem Markt realisierten Wünsche, Bedürfnisse und Vorlieben ergibt sich demnach eine grundlegende Information bezüglich unserer Prioritäten, die den Vorzug habe, dem Zugriff aller berufsständischen und politischen Eliten entzogen zu sein, die uns gerne erklären würden, was gut für uns ist. Das Wissen solcher Eliten sei immer einseitig, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens sei es unvermeidlich unzureichend, weil kein Mensch allwissend ist; zweitens verfolgten diese Eliten stets auch eigene Interessen, aus deren Perspektive sie ihr Wissen interpretierten.
Ein Lehrer werde immer die Meinung vertreten, daß kleine Klassen besser seien, weil kleine Klassen die Nachfrage nach Lehrern und damit auch deren Einkommen erhöhen. Vertreter der Polizei würden in jedem Fall die steigende Komplexität krimineller Aktivitäten betonen, um den steigenden Bedarf an Polizisten zu begründen. Gesundheitspolitiker versicherten stets, sie wüßten genau, welche Prioritäten im Gesundheitswesen zu setzen seien, weil ihnen das unseren Respekt einträgt und uns dazu verleitet, für sie zu stimmen.
Nur der Markt allein stehe außerhalb dieses Durcheinanders einseitiger Informationen und eigennütziger Befangenheiten. Der Markt versammle alle Wünsche auf Konsumentenseite, alle Versprechen, diese Wünsche zu erfüllen, von seiten der Produzenten und gleiche beide vermittels des Mechanismus der Preisbildung unter völliger Vermeidung jedes menschlichen Eingriffs miteinander ab. Dadurch werde eine Konzentration von Wissen erreicht, die höher sei, als sie irgendeine Gruppe von Menschen herstellen könne; zudem sei dieses Wissen – solange der Markt nicht von kleinen Produzenten- oder Konsumentengruppen dominiert werde – vollkommen frei von menschlichen Voreingenommenheiten.
Damit erscheint der Einsatz von Zielvorgaben und Leistungsindikatoren bei öffentlichen Einrichtungen aus der Perspektive strikter Marktwirtschaftler, obgleich Teil eines von ihnen betriebenen Reformprozesses zur Einführung marktanaloger Praktiken im öffentlichen Dienst, als unbefriedigender Kompromiß, der mehr Probleme aufwirft, als er löst. Allein eine vollständige Privatisierung solcher Betriebe – die es den Konsumenten ermögliche, Dienstleistungen auch in Bereichen wie Bildung, medizinische Versorgung, Pflege und Betreuung, Sicherheit und so weiter nach eigenem Gutdünken auf einem Markt zu erwerben – werde es uns erlauben, unsere Kaufentscheidungen auf Grund bestmöglichen Wissens zu treffen, welches eben allein der Markt hervorbringen könne.
Diese These wirft einige Fragen auf, die bereits andernorts diskutiert wurden: Was würde unter solchen Umständen aus den Bürgerrechten, was aus Gemeingütern? Blieben lebensnotwendige Dienste auch weiterhin für finanzschwache Nutzer erschwinglich? Da es uns hier in erster Linie um Probleme im Bereich des Wissens, der Information und spezialisierter Kenntnisse geht, werden wir uns jedoch vor allem mit einem weiteren Aspekt befassen, nämlich dem, was daraus für meine anfängliche Behauptung folgt, der Bereich des Wissens nehme durch die Ausweitung des Marktes schweren Schaden. Im Augenblick scheint es doch vielmehr, als wäre das genaue Gegenteil der Fall und der Markt der einzige zuverlässige Freund des Wissens und verläßlicher Informationen.
Um diese Rätsel zu lösen, müssen wir uns die Überlegungen der Theoretiker der Marktwirtschaft ein wenig genauer ansehen, die diese Behauptung über den Markt aufgestellt haben. Am sachkundigsten hat das Philip Mirowski (2013) in seiner Untersuchung der neoliberalen Ideologie unternommen. Er befaßt sich darin mit den Schriften Friedrich von Hayeks, eines österreichischen Ökonomen und Gesellschaftsphilosophen, der infolge seiner Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem sowjetischen Kommunismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts dazu kam, Eingriffe des Staates in die Wirtschaft grundsätzlich abzulehnen; statt dessen plädierte er dafür, so viele Lebensbereiche wie möglich dem Markt zu überlassen, um die Menschen vor staatlichem Zugriff zu schützen.
Von Hayek war alles andere als eine unbedeutende Figur, und es empfiehlt sich, in ihm nicht bloß irgendeinen, sondern den Vertreter der neoliberalen Ideologie zu sehen. 1974 wurde ihm der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften zugesprochen. Bereits 1947 gründete er die Mont Pelerin Society, den wohl bedeutendsten Zusammenschluß von Ökonomen und anderen Wissenschaftlern (darunter weiteren Wirtschaftsnobelpreisträgern) unter der Fahne entschiedener Gegnerschaft gegen Verstaatlichung, Planwirtschaft, den Wohlfahrtsstaat und andere staatliche Eingriffe in den Markt. In ihrem Bestreben, die im 20. Jahrhundert erkämpften sozialen Kompromisse in Großbritannien durch einen robusten Neoliberalismus abzulösen, orientierte sich Margaret Thatcher an ihm als intellektuellem Leitstern. Der Einfluß von Hayeks und seiner erlauchten Kollegen auf das, was Mirowski als »Neoliberales Denkkollektiv« bezeichnet, zeigt sich in zahlreichen Aspekten der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik: von der umfassenden Reduzierung der steuerlichen Belastung Wohlhabender bis zur Deregulierung der globalen Finanzmärkte.
Es war von Hayek (1944, 1948, 1960), der die Idee formulierte, daß der Markt eine überlegene Form des Wissens generiere, weshalb alle Versuche, seine Entwicklung durch Experten vorhersagen zu lassen, notwendig unzureichend seien. Auf den ersten Blick wird der Markt dadurch keineswegs zu einem Feind des Wissens an sich, er empfiehlt sich vielmehr als Produzent der einzigen Form von Wissen, auf die es letztlich ankommt – einer demokratischen, antielitären Form zudem.
Ein Beispiel: Weder Ärzte noch Patienten wissen zweifelsfrei, welche Behandlung für einen bestimmten Patienten die beste ist; ihre Einschätzung wird sich überdies im Lauf der Zeit verändern. Wenn jedoch in einem rein marktwirtschaftlich strukturierten Gesundheitswesen viele Patienten bei vielen Ärzten für eine bestimmte Behandlung optieren, entsteht von Hayek zufolge allein auf Grund der großen Menge der Transaktionen eine zuverlässige Wissensgrundlage. Das auf diese Weise durch den Markt generierte Wissen könne von niemandem gesteuert werden, und es gehöre auch niemandem; wir alle trügen dazu bei und könnten gleichermaßen davon profitieren. Dieses marktgenerierte Wissen mit jenen Informationen zu vergleichen, die Experten und Institutionen hervorbringen, sei etwa so, als würde man die Evolutionstheorie mit dem Kreationismus vergleichen – eine Bemerkung, die angesichts der Tatsache, daß ein erheblicher Teil der Marktwirtschaftsgläubigen in den USA tatsächlich Anhänger des Kreationismus sind, während die sozialistischen Marktskeptiker in der Regel der Evolutionstheorie zuneigen, seltsam genug ist. Und eine weitere Ironie liegt darin, daß die Neoliberalen den Markt mit dieser Argumentation zu einer Art öffentlichem Gut erhöhen, während sie die Idee öffentlicher Güter sonst doch bei jeder Gelegenheit anzugreifen pflegen.
Anzumerken ist, daß sich von Hayeks Ansatz nicht prinzipiell gegen Menschen als Inhaber von Wissen, Kenntnissen und Informationen richtet, sondern lediglich gegen deren Versuch, ihr exklusives Wissen zur Grundlage autoritativer politischer Entscheidungen zu machen, also eine Art höheres Wissen für sich zu reklamieren. Von Hayek ist keineswegs der Auffassung, es gäbe so etwas wie medizinisches Fachwissen nicht, er glaubt keineswegs, daß Mediziner nicht mehr von ihrer Arbeit verstünden als Menschen ohne entsprechende Ausbildung. Tatsächlich vertritt er sogar einen in vieler Hinsicht wissenschaftsfreundlichen Ansatz, da zu den Grundvoraussetzungen wissenschaftlichen Denkens die Überzeugung gehört, daß der aktuelle Wissensstand stets verbesserbar ist und ein Zustand abschließender umfassender Kenntnis nur in Ausnahmefällen erreichbar. Die ständigen winzigen Anpassungsbewegungen des Marktes entsprechen von Hayek zufolge der dynamischen, veränderlichen Natur unseres Wissens weit besser als alle Versuche der Institutionalisierung erprobter Lösungen und Praktiken. Folglich mißtraut er jeglichem Versuch, Systeme wie etwa das Gesundheitswesen auf der Grundlage nicht dem Markt entnommener Informationen zu organisieren und mit entsprechenden Prioritäten zu versehen – insbesondere, wenn solche Versuche von staatlichen Stellen oder Verbänden von Fachleuten ausgehen. Ersteren unterstellt er, auf diese Weise eine sozialistische Diktatur errichten zu wollen, letzteren, die Erbringung von Dienstleistungen nach Art von Gewerkschaften mit ihren Eigeninteressen zu vermischen.
So verlockend sie klingen mag, weist von Hayeks Theorie jedoch zwei zentrale Defizite auf. Das eine betrifft die Funktionsweise des Marktes selbst, auch wenn er ein vollkommen »freier«, unregulierter Markt wäre; das andere resultiert aus den praktischen Hindernissen, die die Installation eines solchen Marktes regelmäßig unmöglich machen. Zusammen bewirken diese Mängel, daß von Hayeks Theorie de facto zu einem Feind des Wissens (oder zumindest seiner Verbreitung in der Allgemeinheit) wird. Zugleich erweist sie sich als Freund jener Interessengruppen, die Informationen zu manipulieren bestrebt sind, und als Feind jener Institutionen, die ersteren entgegentreten könnten.
Probleme der Wissensproduktion auf Märkten
Betrachten wir zunächst einige Probleme im Umgang mit Informationen, die auch gut funktionierende Märkte unvermeidlich hervorbringen. Später werden wir uns im Zusammenhang mit den Punkten 3 und 4 meiner obigen Liste einem weiteren Aspekt zuwenden.
Ökonomen unterstellen in der Regel, daß alle Marktakteure über umfassende Informationen verfügen: zum einen hinsichtlich ihrer eigenen Wünsche und Bedürfnisse, zum anderen hinsichtlich der Eigenschaften der zur Befriedigung dieser Wünsche angebotenen Waren und Dienstleistungen. Zwar spielen sie zuweilen auch durch, was auf Märkten mit unvollkommen informierten Akteuren geschieht; doch damit der Markt als der Wissensspeicher fungieren kann, den von Hayeks Theorie postuliert, müssen systematische Unzulänglichkeiten dieser Art ausgeschlossen sein. Sollte es doch Informationsdefizite geben, werden diese demnach von außerhalb in den Markt hineingetragen – nur unter dieser Voraussetzung ist der Markt in der Lage, sie durch die hohe Zahl der auf ihm getätigten Transaktionen bedeutungslos zu machen. Diese hohe Zahl unkoordinierter Transaktionen ist nämlich genau das, was den Markt in die Lage versetzt, alle relevanten Informationen zu akkumulieren. Die Theorie unterstellt ebenfalls, daß ein »reiner« Markt keinem seiner Akteure einen Anreiz gebe, ihm zugängliche Informationen zu ignorieren oder gar zu verfälschen.
Ein Problem liegt nun darin, daß dieses Maß an Informiertheit in der Realität auf praktisch keinem Markt (mit Ausnahme vielleicht derer für simple Standardprodukte) je erreicht wird. Je komplexer die Produkte werden, desto weniger vermag der Markt den hohen Anforderungen zu genügen, die die Theorie ihm auferlegt. Und es gehört nun einmal zu den Merkmalen des modernen Lebens, daß die Komplexität der Produkte in fortgeschrittenen Gesellschaften stetig zunimmt.
Nehmen wir das Beispiel des Finanzmarkts vor der Krise der Jahre 2007/2008. Er galt als der vollkommenste aller Märkte. Vor der Krise stützten sich die Gegner der Einführung marktanaloger Regeln in andere Lebensbereichen zumeist auf die Behauptung, die Idee, sich nur an einem einzigen Erfolgsindikator, dem Preis, zu orientieren, funktioniere zwar auf dem Finanzmarkt, lasse sich aber auf Grund der Gegebenheiten nicht auf Bereiche wie die Medizin, die Bildung, die Polizei und so weiter übertragen. Die Krise machte dann klar, daß diese Idee selbst auf ihrem höchsteigenen Gebiet ziemlich problematisch ist.
Dem Handel mit Aktien liegt die sogenannte Effizienzmarkthypothese zugrunde. Diese postuliert, daß für jeden potentiellen Investor ein rationaler Anreiz besteht, sich alle relevanten Informationen über ein Unternehmen zu verschaffen, in das er sein Geld zu stecken erwägt. Der Preis für die Aktien dieses Unternehmens sei aber das Ergebnis der Einschätzungen vieler Investoren und enthalte daher alle Informationen bezüglich dessen Leistungsfähigkeit, die ein Investor berücksichtigen muß. Folglich ist es für ihn nicht nötig, sich selbst Informationen über zentrale Leistungskennziffern zu beschaffen. Wichtig ist allein der Preis, den die Aktien auf dem Markt erzielen.
Diese Hypothese fügt sich bruchlos in von Hayeks Modell des vom Markt erzeugten überlegenen Wissens. Sie ermöglichte die Entwicklung von Derivaten und sekundären Märkten, die nach 1990 für einen immensen Geschwindigkeitszuwachs im Aktienhandel sorgten. Der Preis, zu dem Aktien und Obligationen gehandelt wurden, wurde zur einzigen Grundlage der Bestimmung ihres Werts. Um sie zu erwerben, benötigte Händler A lediglich einen Grund zu der Annahme, daß er sie an Händler B losschlagen könne, weil Händler B überzeugt war, sie sofort an Händler C weiterveräußern zu können, der wiederum glaubte, Händler D werde sie ihm unverzüglich aus den zitternden Fingern reißen …