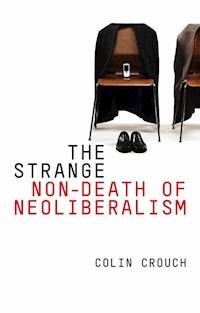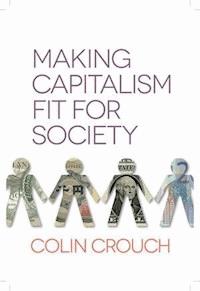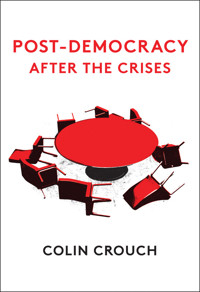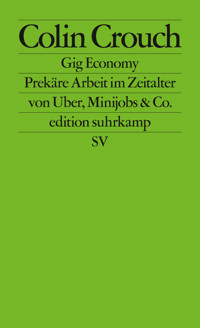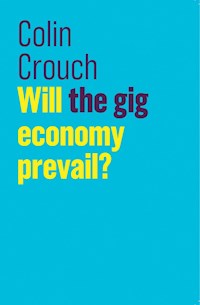19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit seinem Buch Postdemokratie sorgte Colin Crouch 2008 in Deutschland für Furore. In seiner so pointierten wie scharfsinnigen Analyse konstatiert er, dass die Demokratie in den westlichen Gesellschaften im Begriff sei, zur bloßen Hülle zu werden: demokratische Wahlen und Institutionen würden zwar aufrechterhalten, politische Entscheidungen jedoch de facto in den Chefetagen der Wirtschaft getroffen. Das Buch wurde zum Überraschungserfolg. Colin Crouch hatte eine Debatte um den Verfall der repräsentativen Demokratie losgetreten und ihr mit ›Postdemokratie‹ einen Namen gegeben.
Jetzt legt Crouch eine Bestandsaufnahme seiner Thesen vor: Wie gut haben verschiedene Demokratien die Corona-Pandemie bewältigt? Wie hat der Aufstieg des Rechtspopulismus demokratische Erosionsprozesse beeinflusst? Und welche Rolle spielen feministische Forderungen im Kampf gegen die Postdemokratie?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Colin Crouch
Postdemokratie revisited
Aus dem Englischen von Frank Jakubzik
Suhrkamp
Widmung
Dem Gedenken Alessandro Pizzornos (1. Januar 1924 – 4. April 2019), der mir 1973 auf dem Gebiet der internationalen vergleichenden Arbeitsbeziehungen den Einstieg in die akademische Laufbahn eröffnete, mich 1995 nach Florenz und an das dortige Europäische Hochschulinstitut einlud und im Jahr 2002 Guiseppe Laterza auf meine von der Fabian Society als Broschüre veröffentlichte Streitschrift Coping with Post-Democracy aufmerksam machte, was dazu führte, dass ich 2003 Postdemokratie schrieb.
Übersicht
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Widmung
Inhalt
Vorwort
1. Was heißt »Postdemokratie«?
Der Augenblick der Demokratie
Die Schwächung der Demokratie
Verschiedene Formen der Demokratie
2. Ungleichheit und Korruption
Ungleichheit und Demokratie
Von der Lobbyarbeit zur Meinungsmanipulation
Neue Formen der Korruption
Unvollkommener Wettbewerb und konzernfreundlicher Neoliberalismus
New Public Management
Das Outsourcing öffentlicher Dienstleistungen
Fazit
3. Die Finanzkrise 2008
Die Deregulierung der Finanzmärkte
Was können wir aus der Krise über die Postdemokratie lernen?
Hätten stärkere Demokratien die Krise besser bewältigt?
Fazit
4. Die europäische Schuldenkrise
Der Umgang mit der Eurokrise und die Postdemokratie
Das postdemokratische Europa
5. Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben: Die Politik des nostalgischen Pessimismus
Was ist nostalgischer Pessimismus?
USA
Mittel- und Osteuropa
Westeuropa
Großbritannien und der Brexit
Fazit: Die nichtdemokratischen Stützen der Demokratie
6. Die politischen Implikationen der Corona-Pandemie
Das Coronavirus und die Demokratie
Die Politik in der Pandemie
Bewertung des politischen Umgangs mit der Krise durch die Öffentlichkeit
Das Virus und die Zivilgesellschaft
7. Politische Bindungen im 20. Jahrhundert – und was aus ihnen wurde
Die schwindende Bindung an Klasse und Religion
Kulturelle und wirtschaftliche Aspekte
8. Zur Zukunft der Postdemokratie
Warum die Demokratie nichtdemokratische Institutionen braucht
Demokratische Alternativen wiederbeleben
Die politischen Abläufe verändern
Die wiedererstarkte Umweltschutzbewegung
Die Möglichkeiten der Genderpolitik
Dank
Bibliografie
Abkürzungsverzeichnis
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Vorwort
Die zentrale These meines 2003 erschienenen Buchs Postdemokratie lautete, dass sich die Demokratie in vielen Ländern des Westens auf einen Zustand zubewege, in dem sie nur noch ein Schatten ihrer selbst sei. Zwar würden ihre Institutionen und Verfahren nicht angetastet – Wahlkämpfe und Wahlen abgehalten, Regierungen nach wie vor auf friedlichem Wege abgelöst und auch politische Debatten geführt –, doch verliere die Demokratie zunehmend an Lebendigkeit und Verve, da Parteien und Regierungen kaum noch auf von Bürgern aus eigenem Antrieb vorgebrachte Anliegen reagierten, sondern lieber ihre eigenen Themen auf die Agenda setzten und die öffentliche Meinung manipulierten. Die Macht konzentriere sich mittlerweile in den Händen einer kleinen Elite, die dafür sorge, dass die Politik zunehmend den Interessen mächtiger Konzerne diene. Allerdings trage niemand, auch nicht die, die davon profitierten, die »Schuld« an dieser Entwicklung, da ihre beiden Hauptursachen sich dem Zugriff der Akteure weitgehend entzögen. Zum einen würden wichtige Wirtschaftsentscheidungen infolge der Globalisierung nunmehr auf Ebenen gefällt, die eine auf den Rahmen des Nationalstaats begrenzte Demokratie nicht mehr erreichen könne, so dass weite Bereiche der wirtschaftspolitischen Debatte gegenstandslos würden. Zum anderen habe die Klassen- oder Religionszugehörigkeit, der einst die Mehrzahl der Bürger ihre politische Identität verdankte, stark an Bedeutung verloren. Deshalb falle es uns auch immer schwerer, die Frage nach unserem politischen Standpunkt zu beantworten. Sofern wir aber diesen Standpunkt nicht bestimmen könnten, seien wir kaum in der Lage, uns aktiv in demokratische Prozesse einzubringen.
Beide Entwicklungen hatten meines Erachtens dazu geführt, dass sich Politik und Alltagsleben zunehmend voneinander entfremdeten. Politiker bedienten sich immer öfter artifizieller Formen der Kommunikation mit ihren Wählern und setzten verstärkt auf einseitige Interaktion per Werbung und Meinungsforschung. Die Wähler würden gleichsam zu Marionetten, die an den Fäden derer hingen, die die öffentliche Meinung manipulierten, ohne Möglichkeit, ihre eigenen Sorgen und Ansichten zu artikulieren. Damit erhöhe sich der Abstraktionsgrad der demokratischen Prozesse – was ein weiterer Schritt in Richtung Postdemokratie sei.
Ich habe damals nicht behauptet, dass wir bereits in einer Postdemokratie lebten – in den meisten etablierten Demokratien waren nach wie vor viele Bürger in der Lage, Forderungen zu äußern und sich den Manipulateuren entgegenzustellen –, doch befanden wir uns meiner Ansicht nach auf dem Weg dorthin.
In drei Punkten habe ich mich damals geirrt. Erstens habe ich mich zu sehr auf die von mir so genannten »Augenblicke der Demokratie« konzentriert, in denen es engagierten Bürgergruppen gelingt, die professionelle Politik zur Beschäftigung mit ihren Anliegen zu veranlassen, und dafür die Institutionen vernachlässigt, die die Demokratie jenseits dieser Momente schützen und bewahren. Zweitens habe ich den xenophoben Populismus – auch wenn ich ihn als eine der Bewegungen benannt habe, die eine Herausforderung für die Postdemokratie zu werden schienen – unterschätzt und nicht vorausgesehen, dass er nur in zweiter Linie eine Gegenbewegung zu postdemokratischen Tendenzen darstellt, in erster Linie aber zu deren Verschärfung führt. Drittens habe ich zwar festgestellt, dass es den mittleren und unteren Klassen in postindustriellen Gesellschaften nicht gelungen ist, eine eigene politische Agenda und Strategie zu entwickeln, und dass dem Feminismus eine wichtige Funktion bei der Bekämpfung postdemokratischer Zustände zukommt, habe dabei aber übersehen, dass manche Elemente des Feminismus eben jene eigene politische Agenda dieser Klassen darstellen.
Zwischen diesen drei Irrtümern besteht ein Zusammenhang. Zu Anfang des 21. Jahrhunderts konnte man wie selbstverständlich von der Vitalität der verfassungsmäßigen Ordnung ausgehen, die die Demokratie schützt – und zugleich die postdemokratischen Verhältnisse als demokratische erscheinen lässt. Inzwischen jedoch haben die in Europa, den USA und anderswo zu einiger Prominenz gelangten fremdenfeindlichen Bewegungen deutlich gemacht, dass sie die Unabhängigkeit von Institutionen wie Justiz, Rechtsstaat und Parlament keineswegs für unantastbar halten. Da diese Bewegungen hauptsächlich der politischen Rechten angehören, sind es jetzt eher die Parteien der Mitte und der Linken, die diese Institutionen verteidigen. Mit Blick auf die Vergangenheit mag verwundern, dass die Linke die Verfassung gegen eine Rechte in Schutz nimmt, die diese Rolle stets für sich beanspruchte; auch das ein Zeichen dafür, wie sehr sich die Politik verändert hat. Zudem vertreten xenophobe Bewegungen nicht nur die Angst vor und den Hass gegenüber Fremden, sondern auch einen von Pessimismus und Nostalgie getriebenen umfassenden Kulturkonservatismus, der die Entwicklungen etwa auf dem Gebiet der Emanzipation ablehnt. Infolgedessen werden Bewegungen, die zumindest teilweise feministische Ideen vertreten, auch über Emanzipationsfragen hinaus zu ihren Hauptgegnern. Ich hoffe, diese Fehleinschätzungen im Verlauf des vorliegenden Buches korrigieren zu können.
In anderer Hinsicht erscheint Postdemokratie heute weniger fehlerbehaftet als veraltet. Das Buch beginnt mit einer Darstellung der Selbstzufriedenheit der Demokraten, die zur Zeit der Niederschrift in vielen Teilen der Welt herrschte. Damals bestimmte noch immer Francis Fukuyamas Bestseller Das Ende der Geschichte (1992) das Denken, in dem der Autor die liberale kapitalistische Demokratie als Gipfel menschlicher institutioneller Errungenschaften pries. Erst viele Jahre später warnte Peter Mair in The Hollowing of Western Democracy (2013) vor einer »Aushöhlung« der westlichen Demokratie, bevor es 2018 zu einer regelrechten Flut entsprechender Veröffentlichungen kam: How Democracy Ends von David Runciman (dt. So endet die Demokratie, 2020), How Democracies Die von Steven Levitsky und Daniel Ziblatt (dt. Wie Demokratien sterben, 2018), Robert Kuttners Can Democracy Survive Global Capitalism? (Kann die Demokratie den globalen Kapitalismus überleben?) und Nancy MacLeans Democracy in Chains (Demokratie in Ketten). Dem von der Economist Intelligence Unit der Wochenzeitung The Economist erstellten jährlichen »Demokratieindex« zufolge lebten 2006, als dieser Index erstmals erschien, rund 13 Prozent der Weltbevölkerung in »uneingeschränkt funktionierenden Demokratien«. 2017 waren es nur noch 4,5 Prozent (Economist Intelligence Unit 2006ff.).
Zudem schrieb ich das Buch vor der Finanzkrise 2008, die eines meiner zentralen Argumente belegte: dass infolge der Lobbytätigkeit globaler Konzerne eine deregulierte Wirtschaft entstanden war, die es sich leisten konnte, die Interessen aller anderen Gesellschaftsgruppen zu ignorieren. Allerdings hatte ich den ganz besonderen Platz, den der Finanzsektor innerhalb der kapitalistischen Interessenlage einnimmt, und die besonderen Herausforderungen, die sich daraus für die Demokratie ergeben, noch nicht ausreichend würdigen können.
Zwei Jahre später lieferte die Eurokrise eindrucksvolle Beispiele für eine Postdemokratie in Aktion, als man die Parlamente Griechenlands und Italiens vor die Wahl stellte, entweder vom Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission und einem inoffiziellen Komitee führender Banken vorgegebene Ministerpräsidenten zu ernennen oder bei der Bewältigung der Krise auf sich allein gestellt zu bleiben. Die äußere Hülle eines demokratischen Vorgangs blieb gewahrt: Die neuen Ministerpräsidenten (beide ehemalige Angestellte von Goldman Sachs, einer der für die Krise verantwortlichen Banken) wurden nicht einfach eingesetzt, sondern mussten vom jeweiligen Parlament gewählt werden. Ein solches Vorgehen ist typisch für eine Postdemokratie. Allerdings darf man darüber nicht vergessen, dass auch die demokratische Glaubwürdigkeit der vorhergehenden Regierungen beider Länder nicht über alle Zweifel erhaben war.
Im Jahr 2020 brach mit der Corona-Pandemie eine weitere globale Krise herein. Millionen Menschen auf der ganzen Welt steckten sich mit dem neuartigen Virus an, viele erkrankten ernsthaft und für längere Zeit, nicht wenige verloren ihr Leben. In der Annahme, schnell und entschieden gegen die Ausbreitung des Virus vorgehen zu müssen, nutzten Regierungen ihre exekutiven Befugnisse, um die Bewegungsfreiheit der Bürger bis hin zu mehrwöchigen Ausgangssperren einzuschränken, und brachten die Parlamente dazu, auf ihre diesbezüglichen Kontrollfunktionen zu verzichten. Viele Beobachter sahen darin einen weiteren Beleg für den Niedergang der Demokratie. Darüber kann man verschiedener Meinung sein; diskutiert werden muss die Sache aber in jedem Fall. Sie als Indiz für postdemokratische Verhältnisse zu werten, ist indes nicht zuletzt deshalb problematisch, weil sich dieser Begriff eigentlich auf subtilere Phänomene als die direkte Entmachtung von Parlamenten bezieht. Außerdem könnte die Corona-Pandemie auf unerwartete Weise die Abwehrkräfte gegen die Postdemokratie gestärkt haben – ein Aspekt, mit dem wir uns noch beschäftigen werden.
Und schließlich haben in den Jahren seit der Niederschrift von Postdemokratie die sozialen Medien einen beispiellosen Aufstieg erlebt und sind zu einem bevorzugten Werkzeug der politischen Mobilisierung geworden. Damals habe ich begrüßt, dass das aufkommende Internet zivilgesellschaftlichen Gruppen Möglichkeiten eröffnete, sich besser zu organisieren, breitere Debatten anzustoßen und damit eine Gegenkraft zu Konzernen und Medienkonglomeraten zu bilden. Wie wir heute wissen, war das naiv. Inzwischen hat die Internetwirtschaft ihrerseits gigantische Konzerne hervorgebracht und damit den Reichen und Mächtigen des Kapitalismus noch mehr politischen Einfluss verschafft. Zudem hat das Internet die Verbreitung beispielloser Formen der Hassrede und der Volksverhetzung ermöglicht, den Qualitätsverlust von Debatten befördert und die Reichweite von Falschinformationen vergrößert. Oft stehen diese Phänomene mit dem Aufstieg neuer xenophober Bewegungen der äußersten Rechten, die sich selbst als »Alt-Right« beziehungsweise »alternative Rechte« bezeichnen, in Zusammenhang. So haben sich die Neuen Rechten auch an Kampagnen von Impfgegnern und Vertretern diverser Verschwörungsmythen angehängt. Was nur logisch ist: Da sie glauben (oder zumindest andere glauben machen wollen), dass die Welt von Eliten und Experten regiert wird, die der breiten Bevölkerung übelwollen und sie mit Mitteln des Staates zu unterdrücken suchen, wird die medizinische Versorgung zu einem naheliegenden Angriffspunkt. Und folglich mischten sich die Neurechten begeistert unter die Coronaleugner.
Zwar bieten soziale Medien zivilgesellschaftlichen Gruppen und Einzelpersonen nach wie vor die Möglichkeit, ihren politischen Ansichten mehr Gehör zu verschaffen, doch haben die Besitzer großer Reichtümer Technologien und Kenntnisse eingekauft, mit denen sie sich private Daten von Millionen Bürgern verschaffen und ihnen zielgenau manipulative Botschaften zukommen lassen können, die den Eindruck erwecken, die Meinung einer Mehrheit widerzuspiegeln und von sehr vielen Menschen geteilt zu werden, während sie tatsächlich einer einzigen Quelle entspringen. Eine besser auf postdemokratische Verhältnisse zugeschnittene Form von Politik, die den Anschein eines Meinungsstreits erweckt, tatsächlich aber von einigen wenigen verborgenen Quellen aus inszeniert wird, lässt sich kaum vorstellen. Was zunächst als befreiende, demokratiefördernde Technologie erschien, ist zum bevorzugten Werkzeug einer Handvoll extrem wohlhabender Individuen und Gruppen geworden – die die Unverfrorenheit haben, sich als Gegner der »Eliten« auszugeben. Daher muss über das Verhältnis der sozialen Medien zu Demokratie und Postdemokratie neu nachgedacht werden.
Zugleich lässt sich nicht leugnen, dass sich die beschriebene Mobilisierung durch technologische Manipulation häufig auf tiefempfundene Sentimente und Zugehörigkeitsgefühle stützen kann, die in erheblichen Teilen der Bevölkerung vorkommen und die ich im fünften Kapitel als nostalgischen Pessimismus analysieren werde. Doch werden sie von anderen Teilen der Bevölkerung aus ebenso tief empfundener Überzeugung abgelehnt, wie die US-Präsidentschaftswahlen vom November 2020 zeigten, in denen mit dem Amtsinhaber Donald Trump ein Held der Neuen Rechten einem liberalen Herausforderer, Joe Biden, gegenüberstand. Während die Wahlbeteiligung bei US-Präsidentschaftswahlen früher kaum über 50 Prozent und damit, gemessen an europäischen Verhältnissen, ziemlich niedrig lag, stieg sie im Zuge der zunehmenden Spannungen zwischen ethnischen und anderen Identitäten seit Anfang dieses Jahrhunderts an und erreichte 2016 bereits fast 60 Prozent. 2020 kletterte sie sogar auf nahezu 70 Prozent, wobei Biden rund sieben Millionen Wählerstimmen mehr erhielt als Trump. Deutet sich darin ein Wendepunkt für zumindest einige postdemokratische Trends an?
Die genannten Entwicklungen machen eine Revision, eine Aktualisierung und Neujustierung meiner in Postdemokratie vertretenen Argumentation unabdingbar. Im ersten Kapitel des vorliegenden Buchs rekapituliere ich, was ich damals unter dem Begriff verstanden habe und warum es mir wichtig war, darüber zu schreiben. Die Kapitel 2 bis 7 befassen sich dann mit Entwicklungen, die den Trend zur Postdemokratie zu befördern scheinen: die Korruption der Politik durch Reichtum und Lobbyarbeit; die Finanzkrise und die zu ihrer Beendigung ergriffenen Maßnahmen; die Eurokrise und die entsprechenden Gegenmaßnahmen; der Aufstieg des xenophoben Populismus; die politischen Implikationen der Corona-Krise; sowie die schwindende Verankerung der Demokratie in der Bevölkerung.
Postdemokratie war eine Warnung, sozusagen eine negative Utopie: In diese Richtung geht die Entwicklung, und das ist schlecht. Wer als Autor*in einer solchen Dystopie blanken Pessimismus vermeiden will, muss dem Leser aber auch sagen: Wenn dir diese Entwicklung nicht gefällt, können wir etwas dagegen tun. Wie in Postdemokratie versuche ich auch diesmal, die Frage, wie es weitergehen soll, am Schluss zu beantworten. Allerdings in anderer Stimmung und mit anderen Ideen als damals.
Ausgangspunkt für Postdemokratie war eine Streitschrift, die ich im Jahr 2000 für die Fabian Society geschrieben hatte und die den Titel Coping with Post-Democracy trug. Die Veröffentlichungen der Fabian Society richten sich in der Regel an politische Entscheider und machen Vorschläge zur Lösung eines bestimmten Problems. Allerdings waren die politischen Entscheider selbst ein erheblicher Teil des Problems, das ich aufzeigen wollte. Darum wandte ich mich an die gewöhnlichen Bürger, die kaum eine Möglichkeit hatten, etwas gegen die großen sozialen, politischen und ökonomischen Kräfte zu unternehmen, die hinter der Entwicklung standen. Sie konnten jedoch Ideen entwickeln, wie man mit dieser Entwicklung umgehen und ihre Auswirkungen auf unser aller Leben abmildern könnte.
In meinen Augen war der Trend zur Postdemokratie ein enttäuschendes und besorgniserregendes Phänomen, aber nichts unmittelbar Beängstigendes, mit dem man nicht hätte »klarkommen« können. Heute ist die Situation eine andere. Nicht nur werden mit dem Internet, der Informationstechnologie und den sozialen Medien die wichtigsten neuen Werkzeuge der Zivilgesellschaft gegen diese gewendet, wir sehen uns in den etablierten Demokratien der Welt auch noch mit erheblichen Herausforderungen der verfassungsmäßigen Ordnung und einem Wiederaufleben der Fremdenfeindlichkeit konfrontiert, die praktisch ausnahmslos von der äußersten Rechten ausgehen. Auch wenn diese sich nicht so extrem gebärdet wie die faschistischen und nationalsozialistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts, gehört sie doch derselben politischen Familie an und muss jedem von der rechten Mitte bis zur Linken erhebliches Kopfzerbrechen bereiten – nur der extremen Linken nicht, die die Rhetorik der Rechten teilweise aufgegriffen hat.
Wenn uns die Entwicklung hin zur Postdemokratie an diesen Punkt geführt hat, dann ist die Vorstellung, wir könnten mit ihr »klarkommen«, pure Selbstgefälligkeit. Vielmehr müssen wir ihr entschlossen entgegentreten.
1. Was heißt »Postdemokratie«?
Das, was ich unter Postdemokratie verstehe, ist in den britischen Wahlkämpfen der letzten Jahre zu einem ikonischen Bild geronnen, das mehr sagt als viele Worte und das vermutlich auch in anderen entwickelten Demokratien zu besichtigen ist. Es begegnet in zahlreichen Fernsehnachrichtensendungen und zeigt einen Politiker, der eine Rede hält und dabei von einer alle Altersstufen, Ethnien und beide Geschlechter in ausgewogener Mischung repräsentierenden Schar begeisterter Anhänger umringt ist, die Schilder mit Slogans seiner Partei schwenken: Wir sehen einen Politiker in der Mitte des Volkes, das seine spontane Begeisterung äußert. Allerdings haben die Anhänger ihre Schilder nicht selbst angefertigt, sondern sie kurz zuvor von Parteimitarbeitern in die Hand gedrückt bekommen. Und manchmal, wenn eine unbotmäßige Kamera den Blick weitet, wird sichtbar, dass der Politiker lediglich vor einer Handvoll Unterstützer spricht, die man in der Ecke einer großen leeren Lagerhalle zusammengeschoben hat. Weder ist da ein großes Publikum, noch findet eine echte Volksversammlung statt.
Derartige Veranstaltungen werden in vielen Städten abgehalten – die Politiker nehmen weite Wege auf sich, um zu beweisen, dass sie in ihrer Bereitschaft zum Gespräch mit gewöhnlichen Bürgern keinen Winkel des Landes auszulassen gewillt sind. Doch die Hallen stehen fast immer am äußersten Stadtrand, in der Nähe der Autobahnringe und -zubringer, wo sich freiwillig niemand hin verirrt. Aus Gründen der Sicherheit, zur Vermeidung von Staus und aus Angst vor dem Kontakt mit feindseligen Gruppen werden diese Wahlkundgebungen so abgehalten, dass sie kaum größere Teile der Bevölkerung erreichen. Dabei scheinen alle Erfordernisse einer demokratischen Debatte erfüllt: Sämtliche Landesteile werden besucht, der Redner steht nicht abgehoben auf einer Bühne, sondern inmitten einer die gesellschaftliche Vielfalt repräsentierenden Menschengruppe, er äußert entschiedene und emotionale Appelle. Tatsächlich aber sind diese Veranstaltungen so bar jeder ernsthaften Begegnung und inhaltlichen Auseinandersetzung wie die Hallen, in denen sie stattfinden.
Die Vorsilbe »post« wird heute häufig gebraucht: Man spricht von der postindustriellen Gesellschaft, der Postmoderne, von postliberalen oder postironischen Erscheinungen. Dieser Wortgebrauch erscheint kennzeichnend für eine Gesellschaft, die zwar weiß, woher sie kommt und was sie bald nicht mehr sein wird – nicht aber, wohin sie sich entwickelt. Dabei hat die Vorsilbe eigentlich eine präzise Bedeutung. Essenziell für ein mit »post-« bezeichnetes Phänomen ist die Vorstellung, dass es eine Parabel durchlaufen habe.
Abbildung 1 gibt einen Eindruck von dieser Idee. Nach seinem ersten Auftreten gewinnt das Phänomen an Relevanz, bis diese einen Gipfelpunkt erreicht und wieder abzunehmen beginnt – um schließlich etwa auf denselben Wert zurückzufallen wie zu Beginn. Allerdings verschwindet die Geltung, die es im Lauf der Zeit erworben hat, nicht völlig. Es hat Spuren im Gedächtnis der Zeitgenossen hinterlassen und, noch wichtiger, auf seinem Höhepunkt zur Schaffung von Institutionen geführt, die wenigstens für einen gewissen Zeitraum weiterbestehen. Deshalb ist die Welt, sagen wir, 70 Jahre nach dem Aufkommen der Sache auch nicht mehr dieselbe wie im Jahr 0.
Nehmen wir als Beispiel die Eigenschaft »postindustriell«. Sie lässt sich ziemlich genau messen, etwa am Anteil der entsprechenden Arbeitsplätze am Arbeitsmarkt oder als Anteil industrieller Produktion am Bruttoinlandsprodukt. Letzterer stieg von einem sehr niedrigem Niveau zu Beginn der Industrialisierung kontinuierlich an, erreichte einen Höchstwert (der in den meisten westlichen Ökonomien in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts lag) und sank dann wieder. Heute liegt er auf einem ähnlichen Niveau wie in der Frühphase der Industrialisierung. Das bedeutet aber nicht, dass wir in »vorindustrielle« oder »nichtindustrielle« Gesellschaften zurückfallen. Die Zuwächse des Industriezeitalters und seine Auswirkungen auf unser Leben sind nach wie vor präsent; daher leben wir in einer »postindustriellen« Welt.
Abbildung 1: Vom Prä- zum Post-: parabelförmige Bedeutungsentwicklung eines Phänomens
Ähnliches gilt für die Demokratie. Die Tatsache, dass, wie ich unten ausführen werde, die Demokratie in den vergangenen Jahrzehnten an Kraft verloren hat, bedeutet nicht, dass wir in vor- oder nichtdemokratischen Gesellschaften leben. Von den Errungenschaften der demokratischen Epoche ist ein umfangreiches Vermächtnis an Praktiken, Haltungen, Werten und Institutionen geblieben. Das gibt Anlass zu Optimismus, erklärt aber auch eine wichtige Eigenschaft postdemokratischer Zustände: Da die demokratischen Institutionen und Haltungen weiterhin existieren, merken wir nicht, dass die Demokratie geschwächt und die Macht innerhalb des politischen Systems auf eine kleine Elite aus Politikern und Konzernen übergegangen ist, die eine Politik nach den Wünschen Letzterer betreiben.
In seiner Auseinandersetzung mit meinen Überlegungen vertritt Stephen Welch in seinem Buch Hyperdemocracy (2013) die Auffassung, dass wir heute nicht etwa einen Verfall der Demokratie erleben, sondern sie im Gegenteil zu stark auszuweiten versuchen, indem wir Dinge in die politische Debatte hineinziehen, die sich dafür nicht eignen. Allerdings handelt es sich lediglich um zwei Seiten derselben Medaille. Im Grunde laufen unsere Diagnosen auf dasselbe hinaus, denn gerade dann, wenn sich die politische Diskussion um nichts mehr dreht, versucht sie sich auf alles auszuweiten. In Ermangelung eines echten Richtungsstreits (eines der wesentlichen Merkmale einer Demokratie) beginnen Politiker, alle möglichen Nebenfelder zu beackern, um vermeintliche Unterschiede zwischen sich und ihren Gegnern herauszuarbeiten, etwa in Hinsicht auf ihre persönliche Moral oder ihre Meinung zu einem bestimmten medizinischen Verfahren oder die beste Methode, Kindern Lesen und Schreiben beizubringen. Damit dringt die Politik – ob demokratisch oder nicht – in Gebiete vor, deren Problemlagen einer Lösung mit politischen Mitteln nicht zugänglich sind.
Um mein Argument zu untermauern, dass sich gewisse Veränderungen in unserem politischen Leben als Schritte auf dem Weg zu einer Postdemokratie beschreiben lassen, muss ich zweierlei belegen: dass es in nicht allzu ferner Vergangenheit eine Zeit gegeben hat, von der man sagen könnte, die Demokratie sei in ihr stark gewesen; und dass sich diese seither im Niedergang befindet. Untersuchen wir daher zunächst, was einen »Augenblick der Demokratie« ausmacht.
Der Augenblick der Demokratie
Eine Demokratie gedeiht, wenn die Mehrzahl der gewöhnlichen Bürger über hinreichende Möglichkeiten verfügt, die Tagesordnung öffentlicher Debatten mitzubestimmen, sei es über Diskussionen oder eigenständige Organisationen, und wenn sie diese Möglichkeiten auch aktiv nutzt. Das ist ein hoher Anspruch, ein idealtypisches Modell, das sich nie vollkommen verwirklichen lässt; aber es zeigt, wie alle unerreichbaren Ideale, eine Richtung an. Es eignet sich sehr gut, um zu bestimmen, an welchem Punkt unsere Demokratien stehen und welche Fortschritte von dort aus möglich sind. Dabei kommt es entscheidend darauf an, einen hohen Maßstab anzulegen, anstatt vom Ideal, wie oft üblich, so umfangreiche Abstriche zu machen, dass es schlicht dem faktisch Erreichten entspricht. Auf diese Weise fördert man nur Selbstzufriedenheit, Eigenlob und einen Mangel an Aufmerksamkeit für Entwicklungen, die die Demokratie schwächen.
Jenem hohen Anspruch kommt eine Gesellschaft wahrscheinlich in den ersten Jahren nach Einführung der Demokratie oder nach einer großen Staatskrise am nächsten – wenn sich viele Bürger in den demokratischen Verfahren engagieren und intensiv am politischen Geschehen Anteil nehmen, weil sie merken, dass es ihr Leben unmittelbar betrifft; wenn viele verschiedenartige Gruppen und Organisationen gewöhnlicher Bürger sich an der Aufgabe beteiligen, eine politische Agenda zu bestimmen, in der sich ihre Sorgen und Wünsche widerspiegeln; wenn sich die Mächtigen, die ihre Interessen in undemokratischen Gesellschaften einfach durchsetzen, unerwarteter Gegenwehr gegenübersehen und in die Defensive gedrängt werden; und wenn das politische System noch nicht herausgefunden hat, wie es die neuerdings an es gerichteten Forderungen unterdrücken und manipulieren kann. Diese Elemente vor allem machen einen Augenblick der Demokratie, wie er mir vorschwebt, aus.
Die meisten Teile Westeuropas und Nordamerika erlebten zwischen den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts (in den USA und Skandinavien) und den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg (in den anderen Ländern) einen solchen Augenblick der Demokratie. Zuvor hatte es nur an wenigen Orten längere Perioden gegeben, in denen zumindest die erwachsenen Männer über volles Wahlrecht verfügten, und in noch weniger Ländern hatten Frauen politische Rechte genossen. Nun aber begriffen Millionen gewöhnliche Bürger, dass sie in politischen Fragen mitreden konnten, und schlossen sich Parteien und Organisationen an, um ihre Interessen zu vertreten. Schon zuvor war eine Art demokratisches Rumoren zu vernehmen gewesen, vor allem um die Jahrhundertwende und während des Ersten Weltkriegs. Doch in vielen europäischen Ländern hielten die Eliten, die es gewohnt waren, dass die Politik allein ihren Interessen diente, das Vordringen des Plebs in ihre privilegierten Bereiche für unannehmbar. Angesichts dessen schlugen sich viele von ihnen samt ihren Einflussmöglichkeiten auf die Seite faschistischer und nationalsozialistischer Parteien, die, ihrer populistischen Rhetorik und Massenbasis zum Trotz, der Demokratie zutiefst feindselig gegenüberstanden und sie, einmal an die Macht gelangt, mit rücksichtsloser Gewalt unterdrückten. Erst die Niederlagen Hitlers, Mussolinis und anderer faschistischer »Führer« und die Verwüstung ihrer Länder im Zweiten Weltkrieg brachten diese Eliten dazu, freie Wahlen und die Teilnahme nicht aus ihren Reihen rekrutierter Gruppen an der politischen Auseinandersetzung zu akzeptieren.
Am deutlichsten wird dies an den Themen, die die sozialdemokratische und sozialistische Linke bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts auf die Tagesordnung zu setzen versucht hatte: Arbeitnehmerrechte, Sozialstaat, kostenlose beziehungsweise stark subventionierte Bildung und Gesundheitsfürsorge, Umverteilung durch Steuern. Und nicht nur die Linke bekannte sich zu diesen Forderungen. Die Demokratisierung wirkte sich beispielsweise auch auf die Katholischen Kirche aus. Seit der Französischen Revolution hatte sie sich gegen jede Einschränkung der Herrschaft aristokratischer und anderer Eliten gewandt und im 20. Jahrhundert die Unterdrückung junger Demokratien durch Faschisten in Italien, Portugal und Spanien unterstützt. Allerdings gab es in der katholischen Politik auch einen christdemokratischen Flügel, der den vorherrschenden Autoritarismus ablehnte. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs ließ sich diese Gruppe nicht mehr von den katholischen Eliten marginalisieren, die Christdemokratie wurde zur bestimmenden Form christlicher Politik und bildete über Jahrzehnte hinweg die erfolgreichste Parteiengruppe im westlichen Europa. All diese Erscheinungen und Entwicklungen ermöglichten einen Augenblick der Demokratie.
Die Schwächung der Demokratie
Ein solch hoher Demokratisierungsgrad konnte natürlich nicht auf Dauer erhalten bleiben, mit einem gewissen Maß an Entropie war zu rechnen. Zudem haben zwei Faktoren, die ihrerseits einen dritten hervorbrachten, diesen Prozess beschleunigt: die Globalisierung der Wirtschaft und die damit verbundene Entstehung von Megakonzernen; die Veränderung der Klassenstruktur und (in Westeuropa, aber nicht in den USA) der schwindende Einfluss der Kirchen, die zusammen mehr oder weniger unvermeidlich eine Schwächung der wichtigsten Kräfte herbeiführten, die gewöhnliche Bürger ins politische Leben eingebunden haben; sowie die aus diesen Entwicklungen resultierende Tendenz, dass sich Politiker zunehmend von ihrer Basis in der Bevölkerung entfernen und stattdessen die Nähe globaler Wirtschaftseliten suchen.
Die Globalisierung bewirkt in zweierlei Hinsicht eine Schwächung der Demokratie. Zum einen wird durch sie der Einflussbereich nationalstaatlicher Regierungen beschnitten. Wenn die wichtigsten Wirtschaftsentscheidungen auf globaler Ebene getroffen werden, während die Demokratie auf den Rahmen des Nationalstaats beschränkt bleibt, müssen demokratische Beschlüsse in vielen Hinsichten gegenstandslos erscheinen. Zum anderen haben transnationale Unternehmen, die über Politik und Jurisdiktion des einzelnen Nationalstaats hinausgewachsen sind, stärker als alle anderen Institutionen von der Globalisierung profitiert. Wenn ihnen das Steuersystem oder die Vorschriften und Gesetze in einem Land nicht gefallen, können sie jederzeit damit drohen, in ein anderes zu wechseln – weshalb immer mehr Staaten darum wetteifern, ihnen günstigere Bedingungen und Steuersätze anzutragen, da sie auf die Investitionen angewiesen sind. Die Demokratie hat schlicht und einfach nicht Schritt halten können mit der globalen Ausbreitung des Kapitalismus. Das Höchste, das sie erreicht hat, sind Zusammenschlüsse von Staaten, aber selbst die mit Abstand wichtigste Vereinigung, die Europäische Union (EU), ist verglichen mit den gewandten Konzernriesen ein tapsiger Zwerg und überdies zwar bei weitem demokratischer als andere Staatenbünde, aber für sich genommen auch nicht besonders demokratisch.
Der Neoliberalismus, die gegenwärtig vorherrschende politisch-ökonomische Ideologie, hat sich die unvermeidlich mit der Globalisierung einhergehende Schwächung des Nationalstaats zunutze gemacht. Wenn man glaubt, dass Regierungen grundsätzlich inkompetent sind und Konzerne stets effizient agieren, erscheint es sinnvoll, Ersteren so wenig Macht wie möglich und Letzteren jede nur denkbare Freiheit vor staatlichen Eingriffen zu gewähren. In den letzten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sind viele Politiker und Akteure aus allen Bereichen des politischen Spektrums zu genau dieser Überzeugung gelangt. Das hatte fast zwangsläufig einen Bedeutungsverlust der Demokratie zur Folge.
Mit dem zweiten Faktor verhält es sich ein wenig anders. Klassen- beziehungsweise Religionszugehörigkeit sorgten dafür, dass unpolitische Bürger überhaupt ein politisches Bewusstsein entwickelten. Wie ich im sechsten Kapitel ausführlicher darlegen werde, stellten diese sich in den Auseinandersetzungen um den Zugang zu fundamentalen Bürgerrechten wie dem Wahlrecht auf eine bestimmte Seite: Aufgrund meiner Klassen- beziehungsweise Religionszugehörigkeit weiß ich, welche Partei sich für »meinesgleichen« einsetzt, und kann bei Wahlen entsprechend abstimmen. Mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts hörten diese Kämpfe auf, Teil der unmittelbaren Erfahrung zu sein, und wurden zu etwas, von dem einem Eltern und Großeltern erzählen. Den Angehörigen der neuen Klassen, die im Zuge der Entwicklung einer postindustriellen Gesellschaft entstanden, machte niemand ihre Bürgerrechte streitig, weshalb ihnen ein wichtiger Anhaltspunkt dafür fehlte, wo ihre politische Heimat war. Infolge der Säkularisierung der europäischen Gesellschaften und der Abkehr führender Kirchenvertreter von konservativen Standpunkten lässt sich aus der Religionszugehörigkeit ebenfalls keine eindeutige politische Verortung mehr ableiten.
Quelle: Berechnungen des Autors auf Basis von Zahlen von Wikipedia
Abbildung 2: Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen in westeuropäischen Ländern, Mitte der 1980er Jahre (dunkelgrau) und Ende der 2010er Jahre (hellgrau)
Die meisten Bürger gehen bis heute wählen, auch wenn die Wahlbeteiligung fast überall zurückgegangen ist und die Stimmabgabe den meisten nicht mehr viel bedeutet. Abbildung 2 zeigt die Veränderung der Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen in den wichtigsten westeuropäischen Ländern zwischen der Mitte der achtziger Jahre und den jüngsten Wahlen (bis Mitte 2019). Dabei werden naturgemäß weder die Schwankungen zwischen diesen Zeitpunkten noch besondere Faktoren berücksichtigt, die in einzelnen Ländern eine Rolle gespielt haben mögen. Gleichwohl ist zu erkennen, dass die Wahlbeteiligung – mit Ausnahme der Schweiz (wo sie schon immer niedrig war) und Spaniens (wo sie minimal zugenommen hat) – überall zurückgegangen ist. In manchen Fällen nur geringfügig, in anderen deutlich. In zwei Ländern, Belgien und Italien, wurde die Wahlpflicht in dieser Zeit abgeschafft, was aber kaum Auswirkungen auf den allgemeinen Trend gehabt zu haben scheint.
Quelle: Berechnungen des Autors auf Basis von Zahlen von Wikipedia
Abbildung 3: Wahlbeteiligung bei Parlamentswahlen in mitteleuropäischen EU-Mitgliedsländern, frühe 1990er Jahre (dunkelgrau) und Ende der 2010er Jahre (hellgrau)
Außer in Slowenien reagierten die Bevölkerungen der mittel- und osteuropäischen Länder nicht übermäßig begeistert auf die ihnen nach dem Sturz des Kommunismus eröffnete Möglichkeit freier Wahlen. Schon bei den ersten Wahlen in den neunziger Jahren lag die Beteiligung dort typischerweise niedriger als in den meisten Ländern Westeuropas heute. Seither hat es, wie Abbildung 3 zeigt, unterschiedliche Entwicklungen gegeben, wobei ein Sinken der Beteiligung dominiert.
Zudem haben viele Parteien ihre Massenbasis verloren, und ihre weniger gewordenen Aktivisten verkörpern zwar auf symbolische Weise nach wie vor die Zugehörigkeit zu den Klassen oder Bekenntnissen, aus denen die Partei einst hervorging, gewinnen aber keine neuen Wählerschichten hinzu. Die Parteiführungen schlossen daraus, dass die Form der Volkspartei nicht mehr taugte, um große Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Da ihre Kernwählerschaft schrumpfte, gelangten sie zunehmend zu der Überzeugung, eine solche nicht mehr zu brauchen. Vielmehr gingen sie davon aus, dass ihnen diese Wähler, da sie nirgendwo anders eine politische Heimat finden könnten, ohnehin sicher seien – was den Parteien die Freiheit ließ, über ein möglichst breites Meinungsspektrum hinweg nach Stimmen zu fischen. Das zog notwendig einen Profilverlust der Parteien nach sich und schwächte ihre noch verbliebenen Bindungen in die Bevölkerung abermals.
Sie versuchten nun zunehmend, über die Mittel der Marktforschung und der Werbung mit den Wählern in Kontakt zu treten. Damit wurden ihre politischen Ideen und ihr Image zu einer Art Ware, die auf einem Markt für Massenkonsumenten angeboten wird, ohne dass die Anbieter besonders viel über ihre potenziellen Kunden wissen, die sie nur durch Umfragen, Sozialforschung und Marketingkampagnen bestimmen können. Immer weniger repräsentierten die Politiker nun eine Gesellschaftsgruppe, der sie selber angehörten oder zu der sie engen Kontakt hielten, immer mehr agierten sie als Angehörige einer separaten politischen Klasse, die ihre Wähler zuvörderst aus professionell erhobenen Marketingdaten über ihre Kund- beziehungsweise Anhängerschaft »kannten«. Sie suchten lieber die Gesellschaft der Chefs globaler Konzerne, deren Investitionen sie in ihr Land locken wollten und auf deren Unterstützung sie zur Finanzierung ihrer immer kostspieligeren Wahlkampagnen angewiesen waren.
Zusammengenommen erzeugten diese Entwicklungen eine Spirale wachsender Entfremdung zwischen führenden Politikern und Wählern. Der Inbegriff dieses Wandels ist der italienische Unternehmer und Politiker Silvio Berlusconi. Anfang der neunziger Jahre waren die großen Mitte-links- und Mitte-rechts-Parteien Italiens unter einer Welle von Korruptionsskandalen, die einen kurzen demokratischen Augenblick des Zorns verursachten, in die Knie gegangen. Die damals eher moderate Kommunistische Partei blieb als einzige große politische Kraft im Land unbeschadet.
Berlusconi war der reichste Entrepreneur Italiens. Ihm gehörten Unternehmen aus dem gesamten postindustriellen Spektrum: von Fußballclubs über Finanzdienstleister und Fernsehsender bis hin zu Supermarktketten (Mancini 2011). Politisch hatte er der 1994 im Zuge der Skandale aufgelösten Sozialistischen Partei nahegestanden, außerdem sah er sich selbst einer ganzen Reihe von Gerichtsverfahren wegen Korruption gegenüber. Trotz seiner engen Verbindungen mit dem alten Regime betrat er die politische Bühne als Außenseiter, der versprach, das System aufzuräumen und, vor allem, eine Alternative zur Kommunistischen Partei zu bieten, die viele Italiener nach wie vor fürchteten.
Innerhalb kürzester Zeit gründete er eine landesweit erfolgreiche Partei namens Forza Italia (»Vorwärts Italien!« – eine Phrase ohne politische Bedeutung, abgeleitet vom Schlachtruf der Fans der italienischen Fußballnationalmannschaft), wobei er sich nicht auf eine breite Mitgliederschaft, sondern auf die finanziellen und personellen Ressourcen seiner Unternehmen sowie seine Möglichkeiten als Eigentümer reichweitenstarker Fernsehsender und Pressenetzwerke stützte. Man sprach daher von einer partito impresa, einer »Unternehmens-Partei«.
Im Laufe einiger Jahre baute die Forza Italia eine Mitgliederbasis auf und wurde einer herkömmlichen Partei immer ähnlicher, bis sie wie andere etablierte Parteien in den zehner Jahren unter einer neuen Welle des Populismus zusammenbrach. Die Eigenschaften jedoch, die sie bei ihrer Gründung auszeichneten, entsprachen einem postdemokratischen Modell: kaum Verbindung zu Wählern und keinerlei historische Wurzeln.
Als ich 2003 an Postdemokratie arbeitete, ging es mir nicht darum zu behaupten, wir hätten im Westen einen postdemokratischen Zustand erreicht. Aus meiner damaligen Sicht würde dieser erst dann eintreten, wenn es in den Gesellschaften, in denen wir lebten, unmöglich würde, dass spontane Bewegungen aus der Mitte der Bevölkerung entstehen und das politische System in Aufruhr versetzen. Das war damals nicht der Fall. Insbesondere drei Bewegungen bewiesen das, indem sie Themen auf die Tagesordnung der Politik setzten, auf deren Behandlung die etablierten Eliten gerne verzichtet hätten: den Feminismus, den Umweltschutz und die Fremdenfeindlichkeit. Die Entwicklungen, die ich damals identifizierte, hatten uns auf den Weg zu einer Postdemokratie geführt – dort angekommen waren wir jedoch noch nicht.
Verschiedene Formen der Demokratie
In meiner Argumentation habe ich stillschweigend vorausgesetzt, dass wir über eine repräsentative liberale Demokratie sprechen. Es gibt auch andere Formen, etwa die direkte Demokratie, in der nicht Repräsentanten, sondern alle Bürger die Entscheidungen treffen. Möglich ist dies, wenn kleine Gruppen in Fragen entscheiden, die ohne weiteres verständlich sind; Beispiele dafür finden sich überall auf der Welt. Werden Verfahren direkter Demokratie unter Beteiligung größerer Bevölkerungen angewendet, dann in Form von Volksbegehren oder Volksentscheiden. Dabei müssen die zur Abstimmung stehenden Angelegenheiten, wie komplex sie auch sein mögen, auf eine simple Ja-oder-Nein-Entscheidung heruntergebrochen werden: Man stimmt entweder für oder gegen einen bestimmten Vorschlag.
Wenn die Fragestellung hinreichend präzise ist und man davon ausgehen kann, dass die Wähler mit dem Thema einigermaßen vertraut sind, kann dies sehr gut funktionieren und den Bürgern erhebliche Einflussmöglichkeiten auf ihre Lebensumstände eröffnen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, besteht die Gefahr, dass die Wähler das Referendum nutzen, um ihrer allgemeinen Unzufriedenheit Luft zu machen, und in Wahrheit über eine ganz andere Sache abstimmen. Als der damalige italienische Ministerpräsident Matteo Renzi im Dezember 2016 zu einer Volksabstimmung über einige spezifische und recht komplexe Verfassungsänderungen aufrief, musste er zu seiner Überraschung feststellen, dass seine politischen Gegner die Abstimmung in eine auf ihn, Renzi, bezogene Vertrauensfrage umwandelten – weshalb er, nachdem die Reformen abgelehnt worden waren, zurücktrat. Als die Bürger Großbritanniens im selben Jahr über den Verbleib ihres Landes in der Europäischen Union entscheiden konnten, fanden Meinungsforscher heraus, dass viele für den EU-Austritt stimmten, um ihrem Protest gegen diverse Missstände Ausdruck zu verleihen, mit denen die EU nur zum Teil etwas zu tun hatte.
Ein besseres System als die repräsentative Demokratie, in der wir Mitglieder eines Parlaments oder einer anderen deliberativen Versammlung wählen, die eine aus ihren Reihen gebildete Regierung unterstützen beziehungsweise bekämpfen und Tag für Tag Themen beraten, Entscheidungen treffen und Gesetze beschließen, ist nicht leicht zu finden. Dabei ist sie alles andere als eine perfekte Lösung. Wie kann man jemanden zu seinem »Vertreter« ernennen, den man, wie in einer Massengesellschaft unvermeidlich, in aller Regel nicht persönlich kennt? In der Praxis wurde diese Frage durch die Zugehörigkeit des Kandidaten zu einer Partei beantwortet, von deren allgemeiner politischer Ausrichtung der Wähler einige Kenntnis haben konnte.
Damit ist noch nicht das oben erwähnte Problem gelöst, das ich im siebenten Kapitel ausführlicher diskutieren werde: Woran liegt es, dass bestimmte Wähler sich von bestimmten Parteien repräsentiert fühlen? Auf diese Frage gibt es keine befriedigende allgemeine theoretische Antwort, sondern immer nur eine historisch oder soziologisch bedingte. Da die Interaktion zwischen Parteien und Bürgern in aller Regel einseitig verläuft, lässt sich nicht sicher bestimmen, ob eine repräsentative Demokratie »funktioniert«, was die politischen Beobachter öfter mal einräumen sollten.
Die Idee der liberalen Demokratie hängt mit dem Konzept der Repräsentation zusammen, ist aber keineswegs dasselbe. Unter Liberalismus versteht man im weitesten Sinne die Einsicht, dass unser Wissen immer beschränkt ist und sich auch feste Überzeugungen als falsch erweisen können. Deshalb toleriert der Liberalismus Vielfalt und Diversität sowie Meinungen, die dem Liberalen selbst eher unsympathisch sind, denn er kann nie mit Sicherheit wissen, dass sich die Dinge nicht ändern. Was Liberale nicht tolerieren, sind allenfalls Intoleranz und unhinterfragte Glaubenssätze. Auch wenn sie selber religiösen oder politischen Überzeugungen anhängen, werden sie diesen nie eine absolute Gültigkeit zuschreiben, aus der sich das Recht ableiten ließe, die Vertreter anderer Meinungen zu unterdrücken. Was die Ökonomie angeht, so ziehen sie die Markt- in aller Regel der Planwirtschaft vor, da Erstere mehr Möglichkeiten für Flexibilität und Anpassung bietet. Auch die Wissenschaften sind insofern »liberal« – oder sollten es zumindest sein –, als ihre Erkenntnisse zwar anerkannt und genutzt werden, aber stets im Wissen darum, dass eben noch anerkannte Wahrheiten jederzeit widerlegt oder zumindest als unzureichend erkannt werden können. Der Liberalismus lehnt blinde Unterwerfung unter von oben vorgegebene Regeln ab, er hält Meinungsstreit und die Freiheit, Autoritäten in Frage zu stellen, für unverzichtbar. Natürlich müssen ab und zu Entscheidungen getroffen werden, die nicht rückgängig zu machen sind, auch auf die Gefahr hin, dass sie sich als schlecht oder falsch erweisen. Deshalb muss stets so viel Raum wie möglich für Korrekturen und neue Auffassungen sein. Wenn man beispielsweise beschlossen hat, eine neue Autobahn zu bauen, muss der weitere Ausbau der Infrastruktur immer wieder aufs Neue diskutiert werden. Aus Sicht des Liberalismus darf keine Regierung dauerhaft an der Macht sein. Diskussionen müssen jederzeit möglich sein, Wahlen regelmäßig stattfinden. Die Minderheitsmeinung von heute muss die Chance haben, morgen die Mehrheit zu gewinnen. Eine Partei, die heute in der Regierung sitzt, muss wissen, dass sie diesen Platz morgen verlieren kann, und deshalb schon aus Eigeninteresse für einen parteiübergreifenden Wertekonsens zugunsten eines offenen und fairen Wettbewerbs eintreten.
Zudem muss es – darauf hat Adrian Pabst (2016) in seiner Auseinandersetzung mit dem Konzept der Postdemokratie hingewiesen – Institutionen geben, die außerhalb des unmittelbaren Zugriffs der Demokratie stehen und deshalb in der Lage sind, einer gewählten Regierung gegebenenfalls Machtmissbrauch vorzuhalten. Darin spiegelt sich die liberale Auffassung wider, dass Führungspersonen, auch wenn sie demokratisch gewählt wurden, für diverse Formen der Korruption anfällig sind, insbesondere wenn es um die Meh