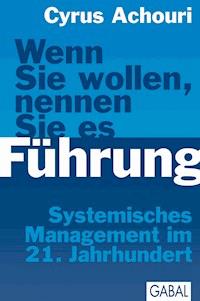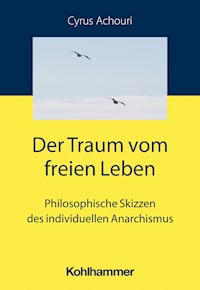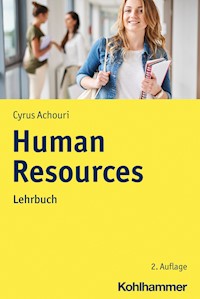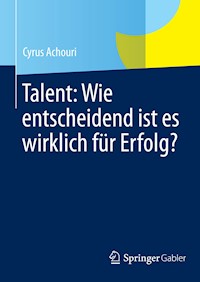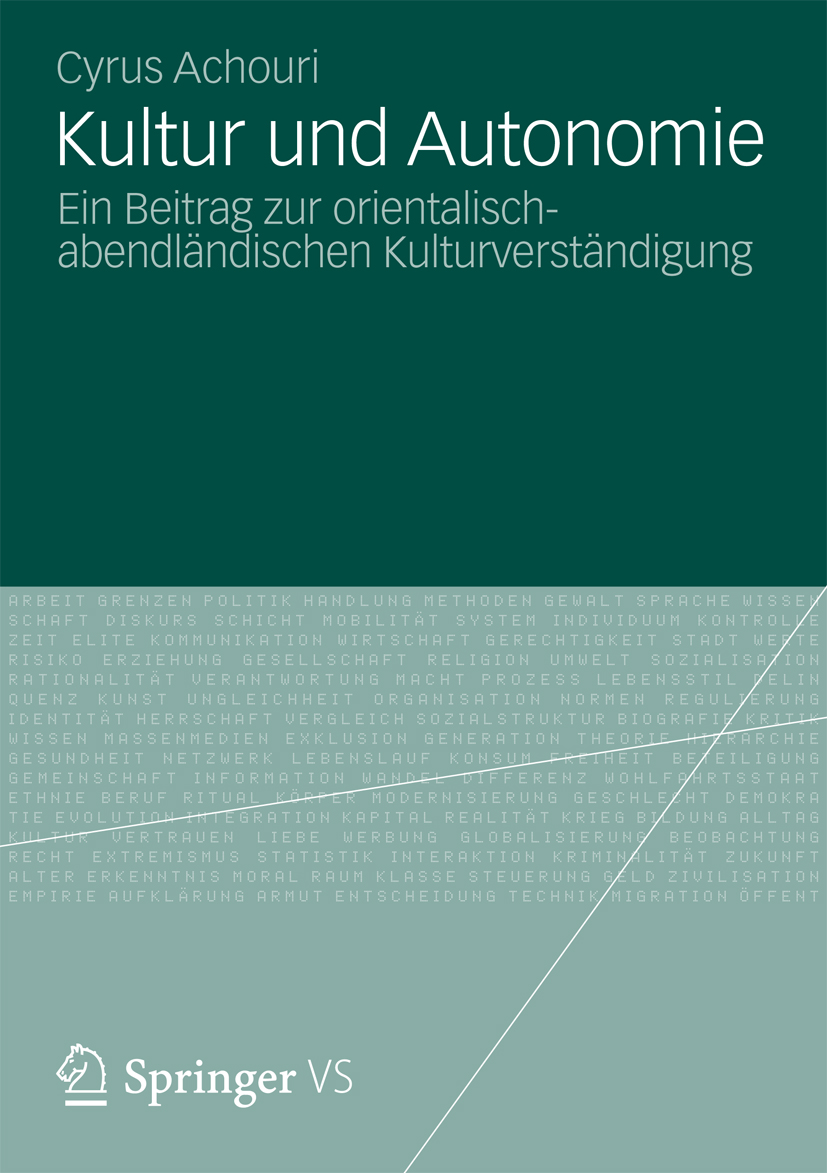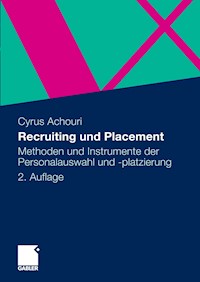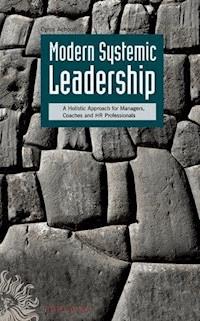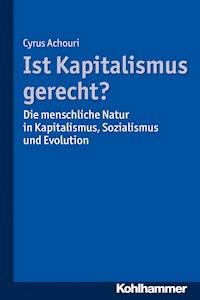
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was ist gerecht? Eine Gesellschaft, die alle gleichstellt? Eine Gesellschaft, die gerade aufgrund der ungleichen natürlichen Voraussetzungen alle unterschiedlich behandelt? Sozialistische Theorien ebenso wie marktliberale Theorien geben hier unterschiedliche Antworten. Der Autor geht dem roten Faden der Argumente nach und räumt mit einigen Vorurteilen auf; unter anderem, dass die kapitalistische Ökonomie Konkurrenz erzeuge oder Ungerechtigkeit schaffe. Schließlich wird die Frage aufgeworfen, ob die freie Marktwirtschaft nicht gerade unserer menschlichen Natur entspricht, wenn man evolutionsbiologische Erkenntnisse zulässt und deren Argumentationslinien folgt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cyrus Achouri
Ist Kapitalismus gerecht?
Die menschliche Natur in Kapitalismus, Sozialismus und Evolution
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2017
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-033684-1
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-033685-8
epub: ISBN 978-3-17-033686-5
mobi: ISBN 978-3-17-033687-2
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Kritik am Kapitalismus beruft sich häufig auf marxistische Theorien wenn es um die Bekämpfung von Ungerechtigkeit, sozialer Ungleichheit, Armut oder Ausbeutung geht. Unklar bleibt dabei oft der entstehungsgeschichtliche Hintergrund dieser Theorien, sowohl anthropologisch als auch ökonomisch.
Um der Frage, ob Kapitalismus gerecht ist, nachzugehen, werden in diesem Band zentrale Aussagen paradigmatischer Gleichheits- und Gerechtigkeitstheorien untersucht, mit Naturtheorien der Evolutionsbiologie, Gesellschaftstheorien und Wirtschaftstheorien in Bezug gesetzt und auf ihre Stichhaltigkeit überprüft.
Der Band richtet sich an Studierende von VWL/BWL und Philosophie und an Interessierte an wirtschaftlichen, philosophischen und gesellschaftlichen Themen.
Prof. Dr. Cyrus Achouri, geb. in Paris, Frankreich, ist Philosoph und lehrt an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, Fakultät für Betriebswirtschaft und Internationale Finanzen. Arbeitsschwerpunkte sind Human Resources Management, Wirtschaftsphilosophie und Systemtheorie.
Inhalt
Was Sie zu Beginn wissen sollten
1. Gerechtigkeit ist normativ
1.1 Analyse und Kritik
2. Ist Gleichheit gerecht?
3. Gleichheitstheorien: Marxismus und Sozialismus
3.1 Der historische Materialismus
3.2 Bewusstsein und Sein
3.3 Die Entfremdung des Menschen
3.4 Wert
3.5 Arbeit
3.6 Produktivität
3.7 Gerechtigkeit
3.8 Natur und Kultur
3.9 Der Staat
3.10 Krisen im Kapitalismus
4. Das Milieutheorie-Dilemma
5. Gleichheits-, Gerechtigkeits- und Vernunftkonzepte
6. Ungleichheitstheorien: Kapitalismus und Evolution
7. Ist Gerechtigkeit unnatürlich?
Endnoten
Literatur
Was Sie zu Beginn wissen sollten
In den Sozialwissenschaften ist ein Passus gängig, der die soziale Ungleichheit aufs Korn nimmt, der sogenannte »Matthäus-Effekt«: Demnach wird dem gegeben, der eh schon hat. Das Leben scheint nicht gerecht zu sein, eine alte Weisheit, die in letzter Zeit beispielweise durch Statistiken des französischen Ökonomen Thomas Piketty gestützt wurde. Insbesondere seit der Finanzkrise gibt es eine neu erstarkte Kapitalismuskritik auch von jenen Fraktionen, die sich in der Vergangenheit durchaus positiv für eine freie Marktwirtschaft ausgesprochen haben. Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte gehen inzwischen auch manchen liberalen Marktgläubigen zu weit.
Und wie sieht der Durchschnittsbürger die soziale Frage? In Deutschland ist das obere Fünftel in der Einkommensverteilung zu 75 Prozent mit ihrer eigenen wirtschaftlichen Situation zufrieden. In der Mittelschicht sind es gerade noch 40 Prozent und in den unteren sozialen Schichten bewegt sich die Zufriedenheit nur noch knapp über 20 Prozent. So verwundert es nicht, wenn die Arbeiterschicht die sozialen Unterschiede in Deutschland gegenüber »Bürgertum« und »Großbürgertum« als überwiegend ungerecht empfindet. Insbesondere Letzteres findet die sozialen Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Leistung der Menschen größtenteils gerechtfertigt. So zeigt sich die Prägung durch die eigene soziale Herkunft in der Bevölkerung als ausschlaggebend bezüglich der grundlegenden sozialen Fragen.1
Im Rahmen der Kapitalismuskritik erfährt auch immer wieder der Marxismus Aufwind. Insbesondere junge Menschen flirten mit marxistischen Gedanken. Man sagt, wenn man in der Jugend nicht links sei, habe man kein Herz, wenn man im Alter nicht konservativ sei, fehle der Verstand. Jedenfalls ist es meist die ungestüme Emotionalität der jüngeren Generation, die die Welt verändern will, um die Ungerechtigkeiten, die in ihr vorkommen, auszumerzen. Der (Neo-)Marxismus ist für einige bis heute eine attraktive Theorie bzw. für manche sogar ein zu wünschendes Gesellschaftsmodell. Dabei ist oft unklar, welches Gesellschaftsmodell eigentlich genau propagiert wird. Meist sind es weder vergangene noch existierende sozialistische oder kommunistische Staatsformen, noch Karl Marx’ eigene Utopie. Oft werden nur Anleihen insbesondere am Marxismus genommen, um eine Argumentationsgrundlage für die Bekämpfung von Ungerechtigkeit, sozialer Ungleichheit, Armut oder Ausbeutung zu haben. Deshalb macht es durchaus Sinn, sich mit der ursprünglichen Theorie des Marxismus näher auseinanderzusetzen, um zu sehen, ob, bzw. welche Ideen und Aussagen ggf. auch heute noch innovatives Potenzial haben.
Ich möchte in diesem Buch die zentralen Aussagen verschiedener paradigmatischer Gleichheits- und Gerechtigkeitstheorien untersuchen, um die Frage zu klären, wie angemessen die jeweiligen Argumente sind. Dazu ziehe ich innerhalb der Naturtheorien die Evolutionsbiologie, innerhalb der Gesellschaftstheorien insbesondere Marxismus und Sozialismus heran. Einfach gesprochen: Mich interessiert, worauf die sozialistische Kapitalismuskritik fußt und inwieweit sie berechtigt ist. Steht der Kapitalismus wirklich der menschlichen Natur ausbeutend und entfremdend gegenüber? Worauf basieren diese Argumente? Sind sie überzeugend? Und von Naturrechts- und Evolutionstheorie aus gefragt: Ist der Kapitalismus wirklich eine der menschlichen Natur angemessene Ökonomieform? Welche Argumente gibt es dafür?
Wenn man die Kapitalismuskritik betrachtet, ist sie insbesondere aus sozialistischer und marxistischer Sicht teilweise zu einseitig vorgetragen worden. Schließlich gibt es nicht nur eine Spielart des Kapitalismus. Es hängt etwa davon ab, wie man Arbeitsmarkt, Finanzwesen, Unternehmensregeln, Sozialpolitik und rechtliche Regelungen miteinander in Einklang bringt. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten, deren jeweilige Realisierung völlig unterschiedliche gesellschaftspolitische Ausprägungen schafft.
Darüber hinaus sind die Einwände fast ausnahmslos kultureller Prägung, mit anderen Worten milieutheoretisch formuliert. Dagegen gibt es sehr starke evolutionsbiologische Argumente, die für den Kapitalismus zu sprechen scheinen, unter anderem, dass dieser der menschlichen Natur am besten entspreche. Und in der Tat hat der Kapitalismus gezeigt, dass er fähig ist, sich immer wieder neu zu erfinden und Krisen zu überwinden, eine sehr evolutionäre Fähigkeit. So werden möglicherweise Gesellschaften heute und in der Zukunft genau dann erfolgreich sein, wenn sie Spielräume für Experimente und Möglichkeiten zum Wachstum lassen und Veränderungen fördern, auch wenn sie sich als vorübergehende Irrwege erweisen sollten. Die Natur selbst verfährt auch auf diese Weise.
Wie Sie sehen werden, halte ich die meisten sozialistischen Argumente nicht für stichhaltig, insbesondere weil sie meines Erachtens die evolutionsbiologischen Fakten schlicht ignorieren (wie leider viele geisteswissenschaftliche Theorien), oder sich weigern, die notwendigen Schlüsse daraus zu ziehen. Dennoch liegt es mir fern, einem kapitalistischen Marktliberalismus zu huldigen oder die »Natur des Menschen«, worin diese auch immer nach unserem heutigen Wissensstand bestehen mag, zu verabsolutieren. Gerade aber wenn politisch-kulturelle Strategien gesellschaftlich und ökonomisch erfolgreich sein sollen, muss man die evolutionsbiologischen Voraussetzungen mit einbeziehen, sonst landet man unweigerlich in kulturellen Ideologien.
Es sei angemerkt, dass ich den Begriff »Kultur« im Weiteren nicht umgangssprachlich verwende, sondern in Abgrenzung zur Natur. Politik, Kunst, Recht, Ökonomie, Wissenschaft etc. sind in dieser Hinsicht kulturelle Güter, die von Menschen geschaffen sind; die menschliche Natur zählt (noch) nicht dazu, auch wenn wir mit der Gentechnik gerade dabei sind, unsere Geschichte einschneidend zu verändern. Mir ist mit diesem Buch nicht daran gelegen, eine historische Übersicht zu bieten, sondern daran, mehr oder weniger eklektisch die für den Themenzusammenhang relevanten Inhalte aufzusuchen und daraus systematische Folgerungen zu ziehen. In dieser Hinsicht und bezogen auf den gegebenen Umfang müssen Inhalte fragmentarisch bleiben. Manchmal setze ich auch Grundlegendes voraus. Dies scheint mir zugunsten einer kurz gehaltenen Diskussion des Themas ein tragbarer Nachteil zu sein.
1. Gerechtigkeit ist normativ
Die ersten Wirtschaftstheorien nannten sich »Politische Ökonomien«. Der Begriff geht zurück auf den griechischen Begriff »Oikonomia« (Haushalt) und wurde auf den Staat übertragen. Im 20. Jahrhundert wurde der Begriff dann durch »Wirtschaftswissenschaften« bzw. »Volkswirtschaftslehre« ersetzt. Heute wird der Begriff der Ökonomie bzw. ihr Gegenstand durchaus mehrdeutig verstanden: zum einen als das Bestreben, möglichst viel mit möglichst geringem Aufwand zu erlangen. Der Philosoph Richard Avenarius nannte das im 19. Jahrhundert das »Prinzip des kleinsten Kraftmaßes«. Wir würden das heute mit »Effizienz« übersetzen. Zum anderen verstehen nicht nur der Volksmund, sondern auch Definitionen in Lexika und Fachbüchern die Wirtschaft als Garant dafür, Entscheidungen zu treffen, die eine bestmögliche Bedürfnisbefriedigung der Menschen bei knappen Ressourcen erlangen. Man kann beide Desiderate durchaus kritisch betrachten, denn wir wirtschaften weder besonders effizient, noch »gerecht«.
Wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, sollten wir klären, was damit gemeint sein soll. Ich möchte folgende Bedeutungen unterscheiden: Gerechtigkeit im Sinne des geltenden Rechts, Gerechtigkeit als Gleichheit, immanente Gerechtigkeit (positivistisch, analytisch) und Metagerechtigkeit (normativ, kritisch). Ursprünglich bedeutet Gerechtigkeit die Übereinstimmung mit dem geltenden Recht. Gerechtigkeit heißt dann, dass vor dem Gesetz alle gleich sein sollen. Gleiche »Fälle« sind gleich zu behandeln, doch wann können wir überhaupt von gleichen Fällen sprechen? Die Lebenssituationen sind unterschiedlich, und die Menschen sind es auch. Die Anwendung setzt also per se schon eine Abstraktion voraus.
Man kann die Frage nach Gerechtigkeit auch mit der Begrenztheit unserer natürlichen Ressourcen in Verbindung setzen: »Wo ein Überfluss seitens der Natur herrscht, wird die Gerechtigkeit aber nur weitgehend, nicht vollständig arbeitslos.«2 Man kann diese Korrelation aber auch anzweifeln. Nicht umsonst werden überproduzierte Lebensmittel in den reichen Industriestaaten aus ökonomischen Gründen durchaus auch vernichtet, anstatt sie den Hungernden zuzuführen. Zudem muss Überfluss die soziale Ungleichheit nicht zwangsläufig aufheben, sondern kann diese auch verschärfen.
Gerechtigkeit gilt den meisten (Rechts-)Philosophen als die erste und wichtigste Kategorie des Zusammenlebens. Höffe etwa nennt die Gerechtigkeit die »geschuldete Sozialmoral« mit dem »Rang des elementar-höchsten Kriteriums allen Zusammenlebens«3. Und in der Tat: Wenn man sich Gedanken macht, wie gesellschaftliches Zusammenleben idealerweise erfolgen könnte, und dabei das Leben aller beteiligten Individuen als gleichwertig setzt, wäre die erste universelle soziale Norm die Gleichstellung aller Menschen.
Idealerweise deshalb, weil es zum einen voraussetzen würde, dass alle Beteiligten der Gleichstellung zustimmen, und diese Zustimmung zum anderen sehr wahrscheinlich davon abhinge, dass es zum Zeitpunkt der Gleichstellung noch keine ungleiche Verteilung von Ressourcen, Macht oder Herrschaft etc. gäbe. Dies einmal hypothetisch zugestanden, stellte sich die Frage des Maßstabs (Gerechtigkeit) damit gar nicht, denn Gerechtigkeit wäre gleichbedeutend mit Gleichheit. Alle unmenschlich zu behandeln, wäre demnach auch gerecht, wenn die Gerechtigkeit keinen Maßstab über oder neben der Gleichheit einnimmt. Nimmt sie aber auf einer Metaebene Platz, dann sollte gezeigt werden, woher der Maßstab der Gerechtigkeit kommt.
Auch gesellschaftspolitisch verweist die Gerechtigkeit auf Gleichheit bzw. auf das Maß an Ungleichheit, das zugelassen werden kann, bevor die gesellschaftliche Stabilität darunter leidet. So kann man feststellen, dass Gerechtigkeit in einer Gesellschaft soweit gesellschaftspolitisch verwirklicht wird, wie der soziale Druck der Bürger es fordert. Gerechtigkeit wird auf diese Weise nicht zu einer moralischen, sondern zu einer politischen Kategorie, die das Maß der Stabilität über die soziale Ungleichheit und das Maß der abgeleiteten Zufriedenheit des Volkes steuert.
Wenn man Gerechtigkeit gleichbedeutend mit dem geltenden Recht setzt, so verfährt man positivistisch. Gerecht ist dann immer das, was in einem geltenden Rechtssystem gilt. Überspitzt geht das nicht nur in einem sogenannten »Rechtsstaat«, denn im weiteren Sinne meint man mit »Rechtsystem« zunächst nur die geltenden Regeln. Der Vorteil dieser Gleichsetzung liegt in der praktischen Handhabung: Gerecht ist dann, wenn die bestehenden Rechte eingefordert werden. Der Nachteil liegt darin, dass wir dann den Maßstab verlieren, bestehende Verhältnisse moralisch oder kritisch zu beurteilen. Denn der Maßstab zur kritischen Beurteilung von etwas kann nicht aus der Analyse derselben erfolgen.
1.1 Analyse und Kritik
G. E. Moore hat den Sachverhalt, dass aus der Analyse keine Kritik abgleitet werden kann, mit dem Begriff »naturalistischer Fehlschluss« bezeichnet. Demnach kann man aus dem Sein kein Sollen ableiten, von der deskriptiven Ebene nicht einfach zur normativen Ebene wechseln. Tut man es dennoch, wird die Normativität von einem externen Maßstab begründet, welcher nicht aus der Analyse des Faktischen kommen kann. Aus der Analyse bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse, z. B. Ungleichheit, Kapitalismus etc. ergibt sich demnach noch keine Kritik derselben, denn der Maßstab zur Beurteilung muss von außen kommen.
Hinzu kommt, dass eine »reine« Analyse des Faktischen gar nicht möglich ist, weil man nicht »rein« objektiv analysieren kann. Von welchem Maßstab aus würde denn die Objektivität bemessen? So gesehen beinhaltet jede Analyse immer schon Kritik in sich. Thomas Kuhn4 hat dies für die Wissenschaftstheorie so formuliert: Die Zustimmung zu einem Paradigma ist nicht zwangsläufig selbst wissenschaftlicher Natur. Die Gründe zur Zustimmung zu einem wissenschaftlichen Paradigma liegen außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre, im Lebenslauf, in der Persönlichkeit, in der jeweiligen Peer-Group oder in anderen externen Umständen. Die Wahl eines Paradigmas hat nach diesem Verständnis also keine rationalen Gründe.
Für die Ökonomie hat etwa Thorstein Veblen bereits darauf hingewiesen, dass die Wirtschaftswissenschaft nicht als eigene Wissenschaft bestehen kann, sondern Soziologie und Anthropologie ebenso beinhalten müsse. Kuhn und Veblen verweisen auf die Notwendigkeit der Begründung von Normen von der Metaebene aus. Normen wie Gerechtigkeit oder die Kritik an bestehenden Verhältnissen lassen sich nicht aus diesen Verhältnissen selbst ableiten, sondern müssen transzendent begründet werden.* Analysiert man aktuelle, historisch konkrete gesellschaftliche Verhältnisse, so werden daraus keine historisch übergreifenden, anthropologischen Strukturen sichtbar. Mit anderen Worten: Aus der Analyse, wie die Menschen zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer gegebenen kulturellen Ausgestaltung beispielsweise die Verteilung von Ressourcen regeln, kann man nicht schließen, wie die Menschen generell den Umgang mit sozialer Ungleichheit bewerten sollten. Wenn man sich fragt, wie soziale Ungleichheit entsteht, so reicht es also nicht, beispielsweise eine ökonomische Analyse der bestehenden Verhältnisse durchzuführen, denn das könnte etwa heißen, Ungleichheit sei erst durch den Kapitalismus entstanden. Vielmehr haben es die »herrschenden Klassen« zu allen Zeiten geschafft, sich die gesellschaftliche Ordnung als Nutznießer zu gestalten. Wir finden dies in der Vorantike und Antike, im Feudalismus, im Kapitalismus und wahrscheinlich auch noch im Postkapitalismus.
Wenn man nur die aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse untersucht, dann sieht man die gerade geltende geschichtliche Ausprägung von Herrschaft, angewandter Ungleichheit oder Ungerechtigkeit. Um diese zu beurteilen, reicht keine historisch konkrete Analyse, sondern man muss möglichst zeit- und kulturübergreifend beurteilen. Setzt man also Gerechtigkeit weder mit geltendem Recht gleich, noch in dem Sinne, dass eben das gerecht sei, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Gesellschaft vorfindet, so muss man einen Maßstab jenseits dieses Positivismus finden. Die Frage ist, woher dieser Metamaßstab kommt. Ich will auf zwei Möglichkeiten eingehen.
Eine Möglichkeit ist es, den Maßstab ideell abzuleiten. In diesem Sinne sind Gerechtigkeitstheorien zu sehen, die kulturelle Möglichkeiten entwerfen. Diese kulturellen Güter können rein virtuell sein, also beispielsweise noch nie in der Wirklichkeit vorgefunden, oder auch praktisch verwirklicht worden sein. Hierzu zähle ich etwa sozialistische, neomarxistische und philosophische Theorien allgemein, sowie jede Art von Utopien oder gesellschaftliche Ideologien.
Eine andere Möglichkeit ist, den Maßstab nicht aus der Kultur, sondern aus der Natur abzuleiten. Der Maßstab von Gerechtigkeit würde demnach aus unseren biologischen Voraussetzungen abzuleiten sein. Gerecht wäre so ein Attribut, das unseren evolutionsbiologischen Voraussetzungen entspricht bzw. diesen zumindest nicht entgegenläuft. Also: Gerechtigkeit ist ein normativer Maßstab. Soll sie nicht auf geltendes Recht reduziert werden, braucht es einen Maßstab, der nicht aus den bestehenden Verhältnissen abgeleitet wird. Dieser Maßstab kann kulturell oder evolutionär begründet werden.
2. Ist Gleichheit gerecht?
Die Geschichte kennt viele Formen gesellschaftlicher Ungleichheit: religiöse, vom Glauben her legitimierte Ungleichheit, Ständegesellschaften, die Menschen im Feudalismus aufgrund von Geburt und Herkunft einordnen, Kastengesellschaften, usw. All diesen Formen ist gleich, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zugleich die Lebensweise und die Lebenschancen der jeweiligen Individuen mehr oder minder bestimmt. Im antiken Griechenland galt Ungleichheit noch als natürlich. Sklaverei und Herrschaftsverhältnisse wurden als nützlich angesehen. Aristoteles etwa begründet das mit der Natur des Menschen, welche schon immer auf soziale Ungleichheit angelegt sei.
In der abendländischen Geschichte vollzog sich eine Abkehr von diesen natur- oder »gottgegebenen« Merkmalen der Ungleichheit insbesondere durch den Wandel der Aufklärung und den weiteren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, beispielsweise durch die Industrialisierung. Mit diesem Wandel hat sich aber auch ein veränderter Blick auf Ungleichheit ergeben: Ungleichheit war zunehmend kein gottgegebener oder in der Natur des Menschen begründeter Umstand mehr, sondern wurde als durch die jeweilige Gesellschaft bestimmt verstanden. Ungleichheit wurde zu einem kulturellen Kriterium, das durch den Menschen geschaffen wurde, und deshalb auch wieder von ihm abgeschafft werden konnte.
Rousseau etwa sah den Ursprung der Ungerechtigkeit nicht in angeborenen Eigenschaften, sondern im Aufkommen von Eigentum bzw. in der gesellschaftlichen Legitimation des Ausschlusses mancher Menschen vom Eigentum der anderen. Diesen Gedanken werden später die Marxisten und Neomarxisten aufnehmen und zum grundlegenden Thema ihrer Kritik an der Klassengesellschaft machen: Eine Klasse ist nach dieser Diktion durch ihr Verhältnis zu den Produktionsmitteln bestimmt. Karl Marx sieht dementsprechend die Ursache sozialer Ungleichheit im Privateigentum an Produktionsmitteln.
Jedenfalls zeigt sich in dieser Debatte der Antike bis zur Aufklärung schon die grundsätzliche Kontroverse der Ungleichheitsdebatte: Ist soziale Ungleichheit natürlich? Ist soziale Ungleichheit kulturell gemacht? Muss soziale Ungleichheit überwunden werden? Oder ist sie vielleicht sogar notwendig für das gesellschaftliche Zusammenleben? Und schließlich: Ist soziale Ungleichheit gerecht?
Gerade die letzte Frage setzt voraus, dass wir mit »Gerechtigkeit« etwas anderes als »Gleichheit« verbinden, sonst könnten wir uns auf den Gebrauch der Gleich-, bzw. Ungleichheit beschränken. Der Begriff der Gerechtigkeit führt etwas Neues ein, nämlich einen Wert, ein Gut. Etwas, das gerecht ist, kann nämlich nur schwer als schlecht bewertet werden. Und wenn wir den Begriff »Ungerechtigkeit« benutzen, tun wir das immer mit der Konnotation von »schlecht«. »Gerecht« meint also immer etwas Gutes, »ungerecht« immer etwas Schlechtes. Fragt man, ob soziale Ungleichheit gerecht sei, so geht man davon aus, dass es auch gut sein könnte, dass eine Ungleichbehandlung stattfindet.
Bereits der amerikanische Soziologe Talcott Parsons5 fragte sich, ob soziale Ungleichheit nicht möglicherweise notwendig für unser gesellschaftliches Zusammenleben sei. Die Fragestellung bei seiner sogenannten »Funktionalistischen Schichtungstheorie« war also gar nicht, wie man Ungleichheit beseitigen könnte, sondern wofür sie nützlich sein könnte. Doch welche Argumente könnten für die Aufrechterhaltung von sozialer Ungleichheit sprechen? Die funktionalistische Theorie argumentiert, dass stabile soziale Systeme Normen, Regeln und Ordnung benötigen, welche die Beziehungen der Über- und Unterordnung bestimmen. Während man Parsons Gedankengang anhand der Überlegung nachvollziehen kann, dass es historisch in jeder Gesellschaftsform Hierarchie, Herrschaft und Ungleichheit gab, erschließt sich seine Erklärung hierfür auch rein kulturell: Die Bereitschaft der Menschen, die jeweilige soziale Ungleichheit zu akzeptieren, erklärt Parsons nicht nur mit den sonst stattfindenden Sanktionen, sondern, auch mit der jeweiligen Sozialisierung.6
In der weiteren Historie der funktionalen Schichtungstheorie gibt es durchaus auch soziologische Ansätze, die den kulturellen Erklärungsrahmen verlassen, so etwa die Arbeiten von K. Davis7, G. E. Moore oder R. K. Merton8. Demnach sei soziale Ungleichheit deshalb erwünscht, weil eine Gesellschaft damit sicherstelle, dass wichtige Positionen in ihr durch die fähigsten Individuen bekleidet würden. Diese (latent evolutionsbiologische) Begründung enthält stillschweigend die Behauptung, dass gesellschaftliche Fitness ein grundlegender Wert ist, dem sich andere Werte wie etwa Gleichheit unterzuordnen haben.
Ähnlich verfährt in der Folge Ralf Dahrendorf9, der der sozialen Ungleichheit grundsätzlich eine Nützlichkeit attestiert, weil die sozialen Strukturen somit in Bewegung bleiben. Auch hier wird Ungleichheit nicht von gesellschaftlichen Normen und Sanktionen her begründet, sondern anthropologisch, denn Fitnessmaximierung oder gesellschaftliche Dynamik sind keine kulturell immanenten Werte. Ihre Begründung erfolgt metakulturell.
Wenn man Gerechtigkeit schlicht mit Gleichheit gleichsetzt, dann wird sie zum formalen Kriterium. Gerecht könnte dann auch sein, dass alle gleich unfrei sind. Erst wenn man Gerechtigkeit und Gleichheit trennt, bekommt der Gerechtigkeitsbegriff eine inhaltliche Note. Man muss nun inhaltlich bestimmen, was ihn ausmachen soll. Sobald man die Gleichsetzung von Gerechtigkeit mit Gleichheit aufgibt, gibt man auch die Illusion eines absoluten, universellen Gerechtigkeitsprinzips auf. Gerechtigkeit ist dann immer relativ, interindividuell, intrasozial, oder intersozial bzw. global.
Will man Kriterien für einen universellen, absoluten Gerechtigkeitsbegriff finden, der auch dem Gleichheitsprinzip entspricht, hätte man die einzige Möglichkeit, zum formalen Prinzip der Gleichheit auch inhaltliche Kriterien zu formulieren. Die Frage ist, ob das möglich ist, bzw. welche das sein können, denn sie müssten universell, interkulturell und sogar historisch übergreifend gelten. Die Frage nach der zeitlichen Eingrenzung stellt sich hier ebenso (ab welcher Entwicklungsstufe – phylo- und ontogenetisch – sprechen wir vom »Menschen«?) wie die Frage nach der Abgrenzung zu anderen Lebewesen, denen diese Rechte nicht zugestanden werden.
Auch stellt sich die Frage, wer diese Rechte überhaupt verleihen könnte. Im Moment können nur Nationalstaaten Rechte vergeben und Gerechtigkeit garantieren. Sie tun dies aber relativ, auf ihre jeweilige Rechts- und Entwicklungssituation bezogen, und verfügen auch nur über die jeweiligen Sanktions- und Durchsetzungsinstrumente innerhalb bestimmter territorialer Grenzen. Auch Privateigentum wird traditionell von Nationalstaaten geschützt. Die hohen Kapitalvermögen, die nach dem 19. Jahrhundert angehäuft worden waren und dann aufgrund der Weltkriege erst wieder im 21. Jahrhundert wuchsen, ergaben sich sowohl aus geringem Bevölkerungswachstum, schwacher Produktionsentwicklung, sowie aus der politischen Förderung des Privatkapitals.10
Die Frage, ob eine Gesellschaft es für richtig erachtet, dass ihre Kapitalbesitzer höhere Renditen erhalten, als das mit Arbeitseinkommen möglich wäre, ohne jegliche Arbeitsleistung der Gesellschaft gegenüber zu erbringen, ist eine der zentralen Fragen sozialer Ungleichheit. Offensichtlich verstehen wir es heute nicht als ungerecht, dass Kapitalbesitzer ohne Beteiligung am Arbeitsmarkt bevorteilt werden. Dass dies möglich ist, ist eine der Eigenheiten des Kapitalismus, entspricht aber der Relativität gesellschaftlich kultureller Logik, ist also nicht per se ungerecht. Ungerechtigkeit kommt nicht durch die spezielle Form der kapitalistischen Ökonomie zustande. Sie ist ein metakulturelles Kriterium, das sich in unserer Zeit eben mit den kapitalistischen Mechanismen ökonomisch und sozial umsetzt. Würden wir also beispielsweise das Privateigentum abschaffen, wäre dies kein Garant für mehr (normativ überkulturelle) Gerechtigkeit oder Gleichheit, denn Ungleichheit ist auch ohne Privateigentum möglich. Also nochmal: Die inhaltliche Ausgestaltung der Gerechtigkeit kann nicht aus den gesellschaftlich konkreten Verhältnissen gewonnen werden.
Seit 1700 hat sich das Durchschnittseinkommen in Japan, Nordamerika und Westeuropa verzwanzigfacht, während sich die durchschnittliche Arbeitszeit nahezu halbiert hat.11 Das liegt auch an der gestiegenen Produktivität; sie ist aber nur ein notwendiges Kriterium hierfür, denn es wäre auch denkbar gewesen, dass sich die entwickelten Industriegesellschaften für eine Beibehaltung der Arbeitszeit ausgesprochen hätten. Sie haben aber beschlossen, die Arbeitszeit zugunsten der Freizeit sukzessive zu verringern. Während im 20. Jahrhundert Europa und Amerika noch einen technologischen Vorsprung durch die industrielle Revolution hatten, schwindet dieser nun zunehmend, da sich die Technologie global immer weiter angleicht.