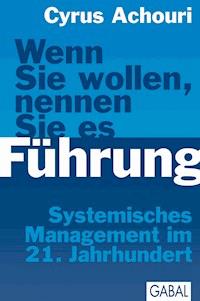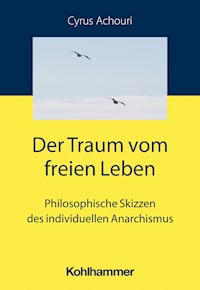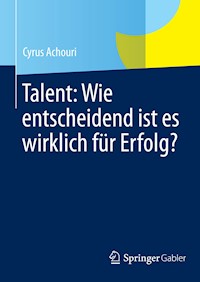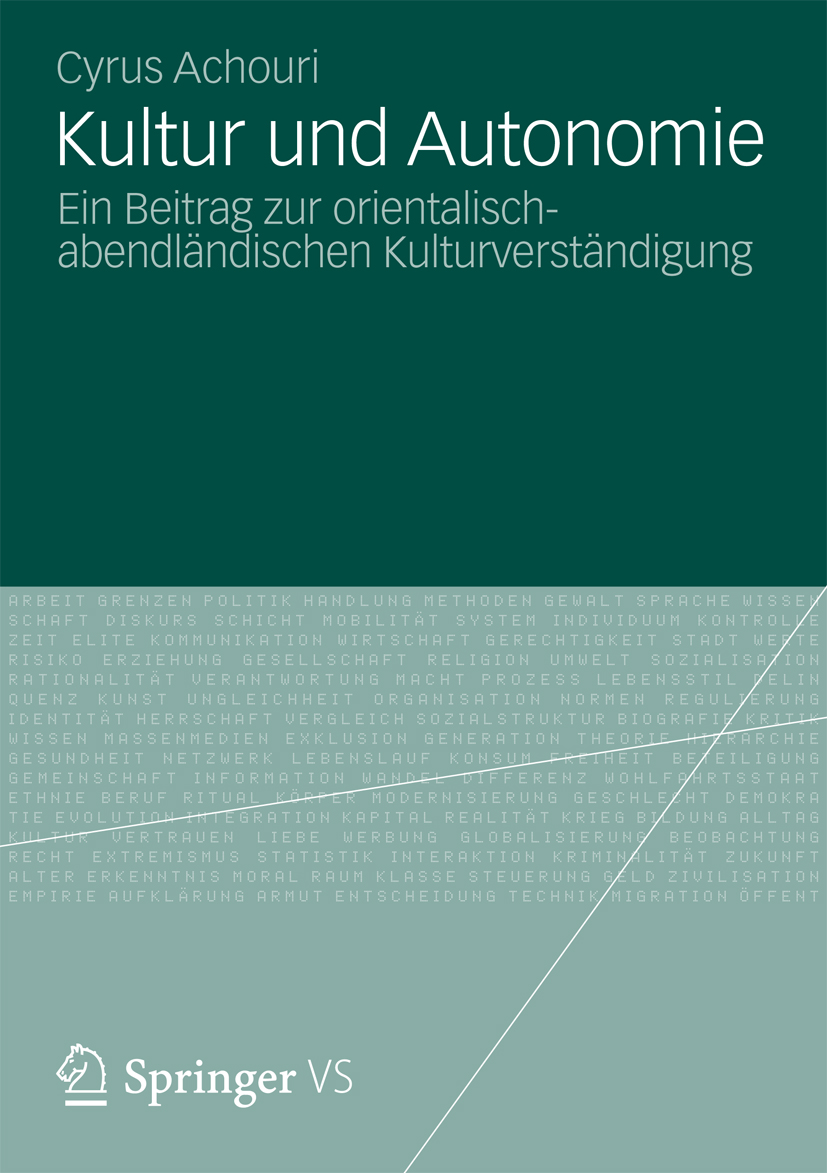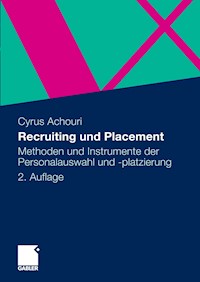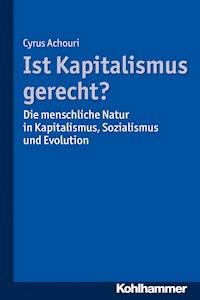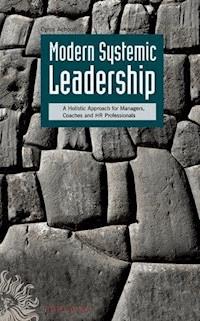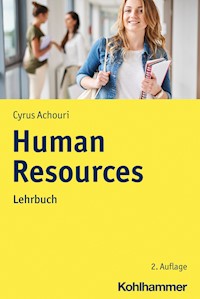
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Kampf um die Talente leistet das Human Resources Management einen entscheidenden Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg. Es erkennt Leistungspotenziale und plant den gezielten Einsatz von qualifizierten Arbeitskräften. Das Lehrbuch vermittelt einschlägiges Wissen zur Durchführung eines Assessment Centers, zeigt fundierte Methoden und Instrumente im Recruiting, Headhunting, Talent- und Karrieremanagement sowie wichtige Aspekte zu konfliktanfälligen Bereichen wie Outplacement, Ethik und dem Internationalen HR-Management. Für Bachelor- und Masterstudierende der BWL werden hierzu Fallbeispiele aus der Praxis, integrierte Lernziele, zahlreiche Visualisierungen und Übungsaufgaben angeboten. Das Buch wird dadurch zum idealen Begleiter für Vorlesung und Klausurvorbereitung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cyrus Achouri
Human Resources
Lehrbuch
2. Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
2. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-041344-3
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-041345-0
epub: ISBN 978-3-17-041346-7
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
1 Herausforderung Personalmanagement
Übungsfragen
Literatur
2 Recruiting
2.1 Attract, Select & Integrate
2.2 Recruiting mit dem AGG
Übungsfragen
Literatur
3 Methoden der Personalauswahl
3.1 Bewerbungsunterlagen
3.2 Anforderungsprofil
3.3 Bewerbungsgespräch
3.4 Vor dem Interview
3.5 Heikle Fragen im Interview – Wie reagieren Sie als Bewerber?
3.6 Strukturiertes Interview
3.6.1 Offene Fragetechniken nach dem Verhaltensdreieck
3.7 Stressinterview
3.8 Weitere Interviewrunden
3.9 Assessment-Center
3.9.1 Validität des Assessment-Centers
3.9.2 Konstruktion geeigneter Übungen
3.9.3 Zeitplan und Aufbau eines Assessment-Centers
3.9.4 Die Rolle des Moderators im AC
3.9.5 Die Beobachterschulung
3.9.6 Beobachtungsmaterialien
3.9.7 Interviewleitfaden im Assessment-Center
3.9.8 Wahrnehmungsschulung
3.9.9 Spielregeln im Assessment-Center
3.9.10 Verhaltensregeln beim Feedback
3.9.11 Feedback-Training
3.9.12 Qualitätskriterien im AC
Übungsfragen
Literatur
4 Headhunter-Management
4.1 Headhunter-Management als HR-Prozess
4.2 Bedarfsermittlung
4.3 Auswahl des richtigen Headhunters
4.4 Headhunter Briefing
4.5 Headhunter Controlling
Übungsfragen
Literatur
5 Einführung in die psychologische Eignungsdiagnostik
5.1 Objektivität
5.2 Reliabilität
5.3 Validität
5.4 Korrelationskoeffizient
5.5 Anwendungen
Übungsfragen
Literatur
6 Talent- und Karriere-Management
6.1 Von der Begabten- zur Expertise- Forschung
6.2 Begabung und Elternhaus
6.3 »Schüchterne« in der Arbeitswelt
6.4 Ist Talent angeboren oder erworben?
6.5 Intelligenz
6.5.1 Allgemeine und spezielle Intelligenz
6.6 Beruflicher Erfolg
Übungsfragen
Literatur
7 Placement
7.1 Bewerbungstraining im Placement
7.2 Einsatz von Persönlichkeitstests
7.3 Einführung in den MBTI
7.3.1 Konstruktionsgrundlagen
7.3.2 MBTI-Auswertung
7.3.3 Typendynamik
7.3.4 Auswirkung in Stresssituationen
7.3.5 MBTI in Teamentwicklung und Projektarbeit
7.3.6 MBTI in der Karriereberatung
7.3.7 Ethische Grundsätze und MBTI Best Practice
Übungsfragen
Literatur
8 Outplacement
Übungsfragen
Literatur
9 HR-Controlling
9.1 Humanvermögensrechnung
9.1.1 Humankapital aus volkswirtschaftlicher Sicht
9.1.2 Humankapital aus betriebswirtschaftlicher Sicht
9.1.3 Das Saarbrücker Modell
9.1.4 Offene Fragen im Saarbrücker Modell
9.1.5 Offene Fragen der Humanvermögensrechnung
9.2 Balanced Scorecard
9.2.1 Kennzahlen im Human Resources Management
Übungsfragen
Literatur
10 Personal- und Organisationsentwicklung
10.1 Performance Management
10.1.1 Mitarbeiterbeurteilung
10.1.2 Vorgesetztenbeurteilung und Teamentwicklung
10.1.3 Das 360-Grad-Feedback
10.1.4 Kommunikation
10.1.4.1 Feedback
10.1.4.2 Kommunikationsanalysemodelle
10.1.4.3 Kommunikationsregelmodell
Grenzen von Feedback
10.2 Coaching
10.2.1 Qualitätskriterien und Prozessphasen
10.2.2 Zertifizierungskriterien
10.2.3 Prozesskriterien
10.2.4 Evaluation
10.2.5 Beratungsansätze im Coaching
10.2.5.1 Psychotherapie
10.2.5.2 Psychoanalyse
10.2.5.3 Verhaltenstherapie
10.2.5.4 Transaktionsanalyse
10.2.5.5 Neurolinguistisches Programmieren (NLP)
10.2.5.6 Systemische Beratung
10.3 Merkmale von Organisationsentwicklung
10.3.1 Organisationskultur
Übungsfragen
Literatur
11 Wirtschaftsethik
11.1 Individuelle Werte
11.1.1 Religion, Ethik und Moral
11.2 Gesellschaftswerte
11.3 Unternehmenswerte
11.3.1 Corporate Social Responsibility (CSR)
11.4 Nachhaltigkeit
11.4.1 Ökologische Nachhaltigkeit
11.4.2 Soziale Nachhaltigkeit
11.4.3 Ökonomische Nachhaltigkeit
11.4.4 Nachhaltigkeit und systemisches Denken
11.4.5 Warum sich Veränderung und Nachhaltigkeit nicht widersprechen – Lernen von der Evolution
11.4.6 Nachhaltiges Human Resources Management
11.4.6.1 Die biologische Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter
Übungsfragen
Literatur
12 Personalführung
12.1 Mitarbeitermotivation
12.2 Menschenbilder
12.2.1 Taylor
12.2.2 Maslow
12.2.3 Douglas McGregor
12.2.4 Edgar Schein
12.3 Führungsstile
12.3.1 Max Weber
12.3.2 Robert House
12.3.3 Kurt Lewin – Iowa Studien
12.3.4 Robert Tannenbaum und Warren H. Schmidt
12.3.5 Edwin A. Fleishman – Ohio Studien
12.3.6 Robert Blake und Jane Mouton
12.3.7 Paul Hersey und Ken Blanchard
12.3.8 Bernard Bass – Transformationale Führung
12.3.9 Daniel Goleman – Emotionale Führung
12.4 Führungstechniken
Übungsfragen
Literatur
13 Systemisches Management
13.1 Kleine Geschichte der Systemtheorie
13.2 Systemtheorie in der Biologie
13.3 Systemtheorie in Mathematik, Physik und Chaosforschung
13.4 Systemtheorie in den Gesellschaftswissenschaften
13.5 Systemtheorie in Philosophie und Neurowissenschaften
13.5.1 Neuroleadership
13.6 Systemtheorie und Management
13.6.1 Selbstorganisation
13.6.2 Kooperation
13.6.3 Selbstorganisation und Empowerment
13.6.4 Die kooperative Organisation
13.6.5 Motivation
13.6.6 Konkurrenz und Leistungsdruck
13.6.7 Organisation
13.6.8 Führung
Übungsfragen
Literatur
14 Internationales Human Resources Management
14.1 Anthropologie
14.1.1 Bevölkerungsentwicklung
14.1.2 Hochkulturen
14.1.3 Bevölkerungsbiologie
14.1.4 Bevölkerungstrends
14.1.5 Ekmans neurokulturelle Theorie der Emotion
14.1.6 Kohlbergs interkulturelle Stufentheorie der Moralentwicklung
14.1.7 Boas Kulturrelativismus
14.2 Grundsätzliche Unterschiede in »Ost« und »West«
14.2.1 Individualismus versus Kollektivismus
14.2.2 Entwicklungspsychologie
14.2.3 Kommunikation
14.2.4 Kulturelle »Erkenntnistheorie«
14.2.5 Kulturelle Intelligenz
14.2.6 Menschenrechte
14.2.7 Business in Ost und West
14.2.8 Kulturprognosen
14.3 Interkulturelles Human Resources Management
14.3.1 Unternehmenskulturen
14.3.2 Kultur-, Entscheidungs- und Internationalisierungs- strategien
14.3.3 Delegation
14.3.4 Kulturtheorien
14.3.4.1 Geert Hofstede
14.3.4.2 Robert Levine
14.3.4.3 Edward Hall
14.3.4.4 Fons Trompenaars
14.3.4.5 Die Globe-Studie
Übungsfragen
Literatur
Abbildungsverzeichnis
1 Herausforderung Personalmanagement
Lernziel
Sie können skizzieren, wie sich die Personalarbeit in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat und einige aktuelle Herausforderungen schildern.
Abb. 1: Lisa
Lisa ist 23 Jahre alt und Hochschulabsolventin der Betriebswirtschaftslehre (Bachelor). An BWL findet Lisa besonders interessant, dass dieses Studium interdisziplinär ausgerichtet ist und etwa Disziplinen wie Mathematik, Recht oder Psychologie berücksichtigt. Insbesondere im Personalmanagement kommt es dabei auf soziale Fähigkeiten an. Lisa erinnert sich hierbei an das sogenannte Eisbergmodell, das sie in einer der Vorlesungen kennengelernt hat. Demnach sind für Erfolg nicht nur Fakten entscheidend, sondern auch die sogenannten »Soft Facts«.
Während im beruflichen Alltag an der Oberfläche meist nur die verwendeten Instrumente, Methoden und Prozesse im Personalmanagement sichtbar sind, kümmert sich das Personalwesen in Unternehmen ebenso um die unter der Oberfläche liegenden Gefühle und Werthaltungen. Die Arbeit unter der sichtbaren Ebene des Eisbergs erfordert Geschick und setzt sowohl psychologische als auch soziologische Kenntnisse voraus (Abb. 2). Das Eisbergmodell geht zurück auf die Theorie von Sigmund Freud, der die Bedeutung des Unbewussten (Soft Facts) gegenüber den bewussten Inhalten (Hard Facts) betont hat.
Abb. 2: Das Eisbergmodell des Personalmanagements
Studierende der Betriebswirtschaften, insbesondere mit Schwerpunkt Personalwesen, sollten sich also nicht scheuen, auch über ihren Tellerrand hinauszublicken und beispielsweise angrenzende geisteswissenschaftliche Disziplinen zu berücksichtigen. Schon Thorstein Veblen (Abb. 3), einer der Gründerväter der Wirtschaftswissenschaften, forderte, dass diese Anthropologie und Soziologie einbeziehen müssten und man kann sagen, dass die heutige BWL auch und gerade durch ihre interdisziplinären Inhalte theoretisch anspruchsvoll und praktisch aktuell bleibt.
Abb. 3: Thorstein Veblen
Abb. 1: Lisa
In ihrem Praktikum hat Lisa sowohl administrative als auch konzeptionelle Tätigkeiten kennengelernt. Ehrlich gesagt hat ihr die administrative Seite weniger Spaß gemacht. Sie hofft, dass die Prognose, die Personalarbeit werde in Zukunft im Wesentlichen strategisch sein, möglichst bald Wirklichkeit wird. In der Tat haben sich die Verantwortlichkeiten vonPersonalmitarbeitern ebenso wie von Führungskräften und Mitarbeitern in den letzten Jahren grundlegend verändert.
Nicht nur die Erkenntnis, dass die »weichen« Faktoren im Human Resources Management entscheidend sind, hat die Arbeit im Personalwesen verändert. So sind Aufgaben, aber auch Verantwortlichkeiten von der Personalabteilung auf die Führungskraft und im Weiteren auch auf die Mitarbeiter übergegangen. Moderne Personalmanager beraten Führungskräfte, diese coachen und beraten ihre Mitarbeiter, und die Mitarbeiter selbst haben viel an Handlungsspielräumen gewonnen (Abb. 4). Die Verantwortlichkeit für die eigene berufliche Entwicklung hat sich damit aber auch immer mehr auf den Mitarbeiter selbst verlagert. Modernes Personalmanagement versucht heute mehr und mehr, als strategischer Partner des Business wahrgenommen zu werden und sich von der Zuschreibung auf administrative Rollen zu lösen.
Abb. 4: Alte/moderne Ausrichtung von HR-Management
Insbesondere leistungsfähige IT-Verfahren erleichtern dies zunehmend. Wenngleich es keinen Königsweg für die organisatorische Allokation des Personalwesens in Unternehmen gibt, ist eine Trennung von operativer und strategischer Personalarbeit in jedem Fall sinnvoll. So findet man heutzutage die Personal- und Organisationsentwicklung oft als Stabsfunktion direkt an die Geschäftsführung angebunden. Den Stellenwert, den das Personalwesens im Unternehmen genießt, kann man auch anhand der organisatorischen Einbindung bei der Bedarfsbestimmung ersehen. In einem »sukzessiven« Verständnis reagiert die Strategie der Personalbedarfsbestimmung nur auf die Produkt- bzw. Marktstrategie, bei einem »integrierten« Verständnis wird die Personalstrategie als Teil der Unternehmensstrategie verstanden.
Bei der Prognose der Leistungsfähigkeit von zukünftigen Mitarbeitern sind ungeachtet des demografischen Wandels für die meisten Tätigkeiten schon heute keine physischen Kriterien mehr entscheidend. Dagegen werden sozio-emotionale Belastungsfaktoren aufgrund von psychischem Druck und Stress weiter in den Vordergrund rücken. Bezogen auf Auswahlverfahren heißt das etwa, dass die Lern- und Veränderungsfähigkeit als Schlüsselqualifikation an Bedeutung zunehmen wird. Aber auch die Motivation für lebenslanges Lernen wird in den Vordergrund treten.
Eine Sonderrolle bei den Fähigkeiten spielt der sogenannte »Habitus«. Schon Aristoteles bezeichnet das Auftreten oder die Umgangsformen einer Person, ihre Vorlieben, Gewohnheiten und das Sozialverhalten als »Hexis«, lateinisch Habitus (habere »haben«). Der Begriff Habitus wurde von dem Soziologen Pierre Bourdieu (1930-2002) dann in die Soziologie eingeführt (1987). Als Habitus ist demnach das gesamte Auftreten einer Person, vom Lebensstil über Sprache, Kleidung bis hin zum Geschmack zu bezeichnen. In der soziologischen Ungleichheitsforschung ist damit auch die klassenspezifisch erworbene, unbewusste Angepasstheit der Dispositionen, Verhaltensmuster und Einstellungen einer Person an das jeweilige soziale Umfeld gemeint. Am Habitus einer Person lässt sich der Status einer Person in der Gesellschaft ablesen. Grob unterscheidet Bourdieu vier Kapitalsorten: Ökonomisches Kapital (Vermögen, Unternehmen, Grund, Aktien, Geld, Schmuck, Kunstwerke), Kulturelles Kapital (Bildung, Wissen, Titel), Soziales Kapital (Familie, Freunde, Bekannte, Kontakte) und Symbolisches Kapital (Prestige, Reputation, Auszeichnung). In seiner gesellschaftlichen Kritik zeigt Bourdieu, dass ökonomisches Kapital sich in alle anderen Kapitalsorten relativ einfach verwandeln lässt, während das umgekehrt nicht gilt. Distinguierte soziale Gesellschaftsschichten erkennen sich schon aufgrund des Habitus‹, ohne den richtigen »Stallgeruch« ist ein Aufstieg in die gesellschaftliche Elite selten möglich.
Das Personalmanagement steht vor einem Umbruch, was den demografischen Wandel der deutschen Bevölkerung angeht. So werden für die kommenden Jahre wahrscheinlich nicht mehr genügend hochqualifizierte Arbeitskräfte in Deutschland zur Verfügung stehen. Daran ändern auch kurz- oder mittelfristige konjunkturelle Schwankungen und Krisen nichts Grundlegendes. Dabei steigt nicht nur die Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften weiter, auch werden viele Hochqualifizierte aus den geburtenstarken Jahrgängen den Arbeitsmarkt verlassen. Frührente bzw. Berufsaustritt unter dem 60. Lebensjahr sind volkswirtschaftlich schwer zu finanzieren und stehen zudem einer steigenden Lebenserwartung gegenüber. Die Schlussfolgerungen daraus reichen von politischen Entscheidungen im Bildungswesen über die vermehrte Einbeziehung von Teilzeitarbeit, insbesondere der Möglichkeit für hochqualifizierte Frauen, Beruf und Familie verbinden zu können, bis hin zur Konzeption von Personalentwicklungsmodellen, welche einen längeren Lebensarbeitszyklus berücksichtigen.
Für manche deutet deshalb alles darauf hin, dass den Unternehmen ein »War for Talents« bevorstehen könnte, auch wenn Variablen wie Konjunktur, Einwanderung oder Rationalisierung, resp. zunehmende Digitalisierung keine präzisen Prognosen zulassen. Durch die starke Nachfrage seitens der Unternehmer und das geringe Angebot auf der Arbeitnehmerseite werden die Unternehmen schon heute mehr und mehr gezwungen, Arbeitnehmer mit attraktiven Konditionen zu werben. Hierbei werden ältere Mitarbeiter nicht benachteiligt sein, in mancher Hinsicht lassen sich durch den reichhaltigen Erfahrungsschatz beruflicher und persönlicher Kompetenzen u. U. sogar Vorteile ableiten. In Zukunft wird das Recruiting deshalb vermehrt Ältere als Zielgruppe zu berücksichtigen haben.
Auch wenn man vermuten könnte, dass die Personalauswahl mit der demografischen Entwicklung an Bedeutung verliert, weil sich die Unternehmen nicht mehr leisten können, allzu wählerisch zu sein, wird wohl genau das Gegenteil der Fall sein. Gerade weil die Fluktuationsrate von Mitarbeitern auch davon abhängen wird, wie zufrieden Mitarbeiter in Unternehmen sind, ergibt sich das Erfordernis, die Passung bereits möglichst schon bei der Auswahl zu prognostizieren.
Abb. 1: Lisa
Lisa fragt sich schon heute, wie sie Beruf und Familie in Einklang bringen wird, denn ihr ist klar, dass sie später eine Familie gründen will. Zugleich hat sie an ihrer eigenen Mutter gesehen, dass es sehr schwierig sein kann, Familienleben und Beruf oder sogar Karriere in Einklang zu bringen. Auf der anderen Seite weiß Lisa, dass die Arbeitswelt heute, anders als zu den Zeiten ihrer Mutter, eine Flexibilisierung erfahren hat und sie hofft, dass diese noch weitergehen wird.
Es hat bereits heute eine zunehmende Flexibilisierung (quantitativ, qualitativ, zeitlich, örtlich) in der Personaleinsatzplanung stattgefunden mit Vor- und Nachteilen sowohl für Mitarbeiter als auch für Unternehmen: Für Unternehmen ist die höhere Motivation der Mitarbeiter und die dadurch erwartungsgemäß höhere Produktivität ein Vorteil. Man kann die Beschäftigungsreserven auf dem Markt besser nutzen, und nicht zuletzt sorgt eine flexible Personaleinsatzplanung für eine höhere Kundenorientierung. Mitarbeiter genießen eine bessere Work-Life-Balance und können ihre Arbeit gemäß ihren individuellen Aktivitätszyklen und Biorhythmen gestalten. Dies kann zu höherer Motivation und höherer Produktivität führen
Doch es gibt auch Nachteile. Auf Unternehmensseite heißt höhere Flexibilisierung zunächst auch geringere Kontrolle. Das kann aber durch adäquate Administration und dementsprechende Steuerungsinstrumente im Performance- und Wissensmanagement ausgeglichen werden. Für die Mitarbeiter kann eine hohe Personaleinsatzflexibilisierung bedeuten, dass die Arbeit »gefühlt« nie aufhört. Dies zieht Überforderung durch Leistungsdruck nach sich, und Mitarbeiter müssen deshalb heute anders als früher selbst ein gutes Zeitmanagement mitbringen, um nicht in die Burnout-Falle zu laufen.
Moderne Flexibilisierungsinstrumente ermöglichen sowohl eine strukturell als auch eine konjunkturell höhere Anpassungsfähigkeit. Hierbei können Unternehmen aus einer Vielfalt von personalpolitischen Methoden auswählen, um sowohl unternehmensinterne (strukturelle) als auch marktbezogene (konjunkturelle) Krisen zu bewältigen. Während konjunkturelle Krisen eher temporär sind, erfordern strukturelle Krisen oft einen erheblichen Umbau des Unternehmens. Dementsprechend kann auf konjunkturelle Krisen mit personalpolitischen Maßnahmen wie Kündigung von 40-Stunden-Verträgen, Teilzeitoffensiven, Sabbaticals, einem Abbau von Resturlaub oder auch Kurzarbeit reagiert werden. Auch der Abbau von Gleitzeitguthaben oder ein Inhouse-Placement kann die Zeit überbrücken, bis die Konjunktur wieder anzieht. Konjunkturelle Krisen haben externe Gründe, die sich normalerweise wieder legen. Deshalb wollen Unternehmen in solchen Zeiten meist nicht Personal abbauen, das nach Beendigung der Krise wieder teuer eingekauft werden muss.
Anders verhält es sich bei strukturellen Krisen. Hier reicht das personalpolitische Repertoire vom Nichtersatz von Fluktuationen, Altersteilzeitmodellen, vorzeitiger Beendigung über Outsourcing bis hin zu Standortschließungen und betriebsbedingten Kündigungen. Diese Maßnahmen machen Sinn, wenn die Zukunft veränderte strukturelle Anforderungen an Unternehmen stellt und bestimmte Kompetenzen oder Funktionen nicht mehr oder zukünftig in anderer Weise oder Anzahl benötigt werden. Die genannten Instrumente zur Bewältigung von Krisen sind vornehmlich quantitativ ausgerichtet. Qualitative Flexibilität bieten personalwirtschaftliche Instrumente wie Job Rotation, Job Enlargement, Job Enrichment, Projekteinsätze oder Inhouse-Placement. Wie Inhouse-Placement funktionieren kann, soll anhand des Beispiels der Recruiting-Abteilung eines großen Konzerns verdeutlicht werden.
Praxisbeispiel:
Als in einer konjunkturellen Krise nur noch wenige Mitarbeiter eingestellt werden sollten, und zugleich der Ruf nach sozialverträglichen Outplacement-Maßnahmen laut wurde, entschloss sich das Unternehmen, eine eigene Outplacement-Abteilung aufzubauen. Dabei erfolgte kein Personalaufbau, sondern die vorhandenen Recruiter wurden von externen Dienstleistungsfirmen, die aktuell im Unternehmen mit Outplacement beauftragt waren, zu Outplacement-Beratern ausgebildet (eine Vertragsklausel, die das Unternehmen vorausschauend zur Bedingung der Beauftragung gemacht hatte). Dies ermöglichte es dem Konzern, bei konjunkturellen Schwankungen Personalmitarbeiter vom Recruiting ins Outplacement (bei abnehmendem Personalbedarf) zu verlagern und umgekehrt (bei zunehmendem Mitarbeiterbedarf). Diese Strategie war nicht nur als Job Enrichment im Sinne einer Personalentwicklung zu sehen, sondern steigerte zugleich auch die individuelle Employability der Recruiter.
Unsere Arbeitswelt verändert sich rasant und wenn man einmal einen mittel- und langfristigen Blick in die Zukunft wagt, könnten die Veränderungen drastisch sein, wenn man den Prognosen von Trend- und Zukunftsforschern glauben kann. Schon die letzten Jahre haben viele Änderungen für unsere Arbeitswelt gebracht. Wir haben eine Flexibilisierung nicht nur der Organisationsstrukturen, sondern auch der individuellen Arbeitswelten erlebt, mit einer Entflechtung von Arbeitszeit und Arbeitsort, auch bereits vor der Corona-Pandemie. Freiheit und Selbstverantwortung sind insbesondere bei Akademikern in der Arbeitswelt gestiegen ebenso die Anforderungen und zugleich scheinen sich sowohl das Arbeits- als auch das Lebenstempo ständig zu beschleunigen.
Eigentlich sollte die Technisierung des Industriezeitalters bewirken, dass Produkte günstiger, schneller und effizienter gestaltet werden können, aber auch dass Tätigkeiten, die der Mensch sonst selbst machen müsste, von Maschinen übernommen werden können. Das hat nicht nur zur Entlastung des Menschen geführt. Vielmehr sehen wir uns heute in vielen Bereichen gerade durch die Technisierung gezwungen, mit der Leistung und der Geschwindigkeit beispielsweise von Computern mitzuhalten. Inzwischen zwingen uns die maschinellen Produktionsbedingungen ihr Tempo auf.
Eine weitere Veränderung betrifft unsere Lebenserwartung. Schon bis zum Jahr 2050 könnte mithilfe von Stammzellentherapie und Genreparaturen die Verlangsamung des Altersprozesses gelungen sein. Für die Kohorte der jetzt Studierenden hieße das eine Verlängerung des Lebens bis zu 150 Lebensjahren, so die Prognosen mancher Forscher. Man muss nicht darauf hinweisen, was das für das Renteneintrittsalter bedeuten würde. Wie werden sich die Jobs dadurch verändern? Wenn das Lebenserwerbsalter zunimmt, wird es wahrscheinlich, dass wir nicht nur eine Ausbildung und eine Berufsrichtung einschlagen können – Polyerwerbsbiographien mit zwei oder sogar drei ganz unterschiedlichen Karrieren könnten der Normalfall werden. Wahrscheinlich werden diejenigen Arbeitnehmer Gewinner sein, die nichtrepetitive und kreative Aufgaben erfüllen, weil Computer diese Dinge nur schlecht können. Also beispielsweise Künstler, Softwareingenieure, Führungskräfte oder auch Wissenschaftler. Dagegen wird es zunehmend einfacher werden, einfache Tätigkeiten durch elektronische Algorithmen zu ersetzen.
Zunehmende Globalisierung, erhöhte Geschwindigkeit auf den Märkten und das Erfordernis ständiger Erreichbarkeit sind nur einige Faktoren, welche in den virtuellen Arbeitsmärkten der Zukunft die Anforderung nach Mobilität vergangener Tage ersetzen. Das 21. Jahrhundert wird möglicherweise maßgeblich durch die Ausbildung virtueller Strukturen gekennzeichnet sein und auch die Arbeit im Personalmanagement revolutionieren. Digitalisierung bis hin zu künstlicher Intelligenz wird uns Menschen aber selbst in hochqualifizierten Tätigkeiten keine Konkurrenz machen. Maschinen und Roboter bleiben von uns programmiert, und selbst wenn sie höhere Kognitionsniveaus erreichen, bleiben sie Mittel zu dem Zweck, den der Mensch ihnen gibt. Die Zwecksetzung selbst bleibt das Vorrecht von uns Menschen, denn nur wir können definieren, wie wir leben wollen. Im Personalbereich kommt hinzu, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen, unsere Gefühle und Motivation wesentlicher Bestandteil auch unserer beruflichen Tätigkeiten sind. Für Human Resources Management bedeutet dies, dass Kompetenzen, die sich auf das Wissen vom Menschen, der professionellen Kommunikation und des produktiven Umgangs miteinander beziehen, nicht veralten werden. Die Arbeit im Personalmanagement hat Zukunft! Eine gute Nachricht für Lisa.
Übungsfragen
• Der BWL- Student Tim interessiert sich für die Arbeit im Personalwesen und kann sich vorstellen, später dort zu arbeiten. Allerdings fragt er sich, was die Arbeit einer modernen HRM-Abteilung heute im Gegensatz zu früher ausmacht, und wie diese sich in der Zukunft aufgrund der schon heute absehbaren gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen verändert. Bitte geben Sie ihm auf seine Fragen eine Antwort.
• Nennen Sie mindestens drei Variablen, welche einen »War for Talents« aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland abschwächen könnten.
• Erläutern Sie das »Eisbergmodell«, insbesondere in seiner Relevanz für das Personalmanagement.
• Nennen Sie fünf personalpolitische Instrumente zur Beantwortung konjunkturbedingter Krisen. Welche personalpolitischen Instrumente können Sie zur Bewältigung struktureller Krisen einsetzen?
Literatur
Becker, M., Personalwirtschaft. Lehrbuch für Studium und Praxis. Schäffer-Poeschel, Stuttgart (2010)
Böhmer, N. et al., Fallstudien im Personalmanagement. Entscheidungen treffen, Konzepte entwickeln, Strategien aufbauen. Pearson, München (2012)
Bourdieu, P., Die feinen Unterschiede, Suhrkamp, Frankfurt a. M. (1987)
Brinkmann, R., Angewandte Wirtschaftspsychologie. Pearson, Hallbergmoos (2018)
Bühl. A., Die virtuelle Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Sozialer Wandel im digitalen Zeitalter. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden (2000)
Büssing, A., & Konradt, U., Telearbeit. In B. Zimolong, & U. Konradt (Hrsg.), Ingenieurpsychologie. Enzyklopädie der Psychologie (Bd. D/III/2, S. 234–278). Hogrefe, Göttingen (2006).
Corsten, H., Unternehmungsnetzwerke. Formen unternehmensübergreifender Zusammenarbeit. Oldenbourg, München (2001)
Konradt, U., & Hertel, G., Management virtueller Teams – von der Telearbeit zum virtuellen Unternehmen. Beltz, Weinheim (2002)
Kurland, N. B., & Bailey, D. E., Telework: The advantages and challenges of working here, there, anywhere, and anytime. Organizational Dynamics, 46(3), S. 53–67 (1999)
Märtin, D., Habitus. Sind Sie bereit für den Sprung nach ganz oben? Campus, Frankfurt a. M. (2019)
Moser, K., Wirtschaftspsychologie. Springer, Heidelberg (2015)
Nerdinger, F.W. et al., Arbeits- und Organisationspsychologie. Springer, Heidelberg (2019)
Picot, A., Reichwald, R., & Wigand, R., Die Grenzenlose Unternehmung. Gabler, Wiesbaden (2003)
Pribilla, P., Reichwald, R., & Goecke, R., Telekommunikation im Management. Schäffer-Poeschel, Stuttgart (1996)
Reichwald, R., Möslein, K., Telearbeit und Telekooperation. In H. J. Bullinger, & H. J. Warnecke (Hrsg.), Neue Organisationsformen im Unternehmen. Ein Handbuch für das moderne Management (S. 691–708). Springer, Berlin (1996)
Reichwald, R., Möslein, K., Organisation: Struktur und Gestaltung. In C. G. Hoyos, & D. Frey (Hrsg.), Arbeits- und Organisationspsychologie (S. 29–49). Beltz, Weinheim (1999)
Reichwald, R., Möslein, K., & Oldenburg, S., Telearbeit, Telekooperation und die Virtuelle Unternehmung. Luchterhand, Neuwied (1996)
Rimser, M., Generation Resource Management. Nachhaltige HR-Konzepte im demografischen Wandel. Rosenberger, Leonberg (2006)
Scholz, C., Grundzüge des Personalmanagements. Vahlen, München (2019)
Schuler, H., Kanning, U.P. (Hrsg.), Lehrbuch der Personalpsychologie. Hogrefe, Göttingen (2014)
Veblen, T., Theorie der feinen Leute. Eine ökonomische Untersuchung der Institutionen. Fischer, Frankfurt a. M. (2015).
2 Recruiting
Lernziel
• Sie wissen, was Kompetenzen sind und wie sie in der Personalauswahl berücksichtigt werden.
• Sie können Arbeitsfelder und Instrumente der Personalbeschaffung benennen und verstehen, wie und wann sie eingesetzt werden.
• Sie wissen, was Sie hinsichtlich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im Recruiting zu beachten haben und können die rechtlichen Kriterien auf Praxisbeispiele anwenden.
Abb. 1: Lisa
Für Lisa ist klar: Sie möchte als Personalmanagerin in einem internationalen Unternehmen arbeiten. Deswegen hat sie bereits ein Praktikum im Personalwesen absolviert, und auchihre Vertiefungsrichtung im Studium war thematisch auf Human Resources ausgerichtet. Da Lisa ahnt, dass ein Direkteinstieg in das Personalmanagement eines internationalen Unternehmens direkt nach der Hochschule schwer zu realisieren ist, hat sie vor, sich zunächst bei einer renommierten Personalberatung zu bewerben. So kann sie Erfahrung sammeln und möglicherweise später zu einem Unternehmen ihrer Wahl wechseln. Lisas Plan geht auf. Eine ihrer Bewerbungen ist erfolgreich. Die Personalberatung ist spezialisiert auf Personalauswahlverfahren. Sie berät kleinere und mittlere Unternehmen, indem sie an den Kunden angepasste Auswahlmethoden konzipiert oder gleich den gesamten Bewerbungsprozess begleitet. Dies bietet Lisa die praktische Möglichkeit, Expertin für Auswahlinstrumente und deren Anwendung zu werden.
Wir finden heute kein Auswahlinstrument, das nicht die Leistungsbereitschaft eines potenziellen Mitarbeiters ebenso bewertet wie vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen. Für die Weiterbildung der Mitarbeiter sowie für Auswahlverfahren bedeutet dies langfristig insbesondere im Dienstleistungssektor eine Verschiebung hin zu höherwertigen Tätigkeiten. Für das Personalmanagement selbst heißt das, Mitarbeiter können ihre »Employability« umso stärker gewährleisten, je weniger sie durch elektronische Verfahren ersetzt werden können. Letzteres betrifft im qualifizierten Bereich algorithmische Tätigkeiten, Berechnungsverfahren im Allgemeinen sowie administrative Arbeiten. Zukunftsweisend werden dagegen mehr und mehr qualitativ anspruchsvolle Tätigkeiten wie Beratung, Coaching, Strategie und kreatives Denken. Im Sinne einer sich immer schneller verändernden Wissensgesellschaft werden immer weniger bereits erworbene Kenntnisse eine Rolle spielen, vielmehr die Fähigkeit eines potenziellen Mitarbeiters, sich neue Kenntnisse anzueignen, also im Sinne der Selbstorganisation zu lernen, wie man ein Leben lang lernfähig bleibt.
Im Recruiting bedeutet das, dass sich die Auswahlkriterien weg von reinen Kenntnissen und Erfahrungen hin zu vorhandenen Fähigkeiten entwickeln. Unter »Kenntnissen« sind dabei reine Fachkenntnisse wie IT-, Englisch- oder auch Berufs-Know-how zu verstehen. Der Begriff »Erfahrungen« bezieht sich auf die Berufserfahrung, also Projekterfahrung, Führungserfahrung etc. »Fähigkeiten« schließlich bezeichnen die »weichen« Faktoren, wie beispielsweise Kommunikations-, Team- oder auch Konfliktfähigkeit.
Abb. 5: Kompetenzpyramide
Kompetenzen können also unterteilt werden in Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten einer Person. Der Charakter zählt nicht dazu, denn er ist am wenigsten veränderbar. Unternehmen fokussieren sich vor allem auf veränderbare Kompetenzen bei Mitarbeitern, da diese im Rahmen von vertretbaren Zeiträumen entwicklungsfähig sind. Die geringe Veränderungsdynamik von Charaktereigenschaften vermittelt die Geschichte von Schildkröte und Skorpion (Abb. 6).
Fähigkeiten gewinnen für das Arbeitsleben zunehmend an Bedeutung. Man bezeichnet sie deshalb inzwischen auch häufig als sogenannte Schlüsselqualifikationen und Unternehmen legen zunehmend mehr Wert auf diese positions- und tätigkeitsübergreifenden Merkmale im Arbeitsprozess, gerade in Hinsicht auf die Qualifizierung für zukünftige Aufgaben. Hierbei sollte man aber unter Schlüsselqualifikationen keine grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale oder grundlegende Werthaltungen wie ethisch-religiöse Überzeugungen erwarten, die für den Arbeitsprozess keine unmittelbare Relevanz besitzen und zudem in die Privatsphäre der Person eingreifen.
Auch eine Überbewertung von Schlüsselqualifikationen als universelle eignungsdiagnostische Merkmale für sozusagen jede beliebige Anforderung würde verkennen, dass Kenntnisse, Berufserfahrung oder kognitive Fähigkeiten immer ebenso wesentlich für beruflichen Erfolg bleiben werden. Dennoch sind in der
Abb. 6: Schildkröte und Skorpion
Personalauswahl Fähigkeiten wie Initiative, Verantwortungsbereitschaft, Motivation, Teamfähigkeit etc. für den beruflichen Erfolg als gleichwertig mit den fachlichen Kompetenzen zu werten. Nicht nur hinsichtlich der zu besetzenden Tätigkeit, auch hinsichtlich der vorherrschenden Firmenkultur ist es notwendig, die Personalauswahl auf die bestehenden Verhältnisse in der Unternehmenskultur abzugleichen. So hat jedes Unternehmen unterschiedliche Leitsätze, die sich in der Definition gewünschter Fähigkeiten niederschlagen.
Dabei ist erfolgskritisch, welche Fähigkeiten durch Weiterbildung in adäquatem Zeit- und Geldaufwand verbesserbar sind. Während Kenntnisse und Fertigkeiten sich durch Training relativ schnell verbessern lassen, ist bei Fähigkeiten, aufgrund ihrer Nähe zu allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen, mit höherer Stabilität zu rechnen. Auch dies ist ein Grund, warum sich Auswahlverfahren zunehmend bemühen, Fähigkeiten zu diagnostizieren. Denn was in der Personalauswahl versäumt wird, lässt sich mit erfahrungsgemäß mit Personalentwicklungsmaßnahmen nur unzureichend korrigieren.
In der Vergangenheit wurden größtenteils in der Organisation eines Unternehmens operative und strategische Bereiche getrennt. Demnach fand sich etwa klassisches Recruiting im operativen Personalwesen, Personal- und Organisationsentwicklung jedoch meist im Stabsbereich wieder. Diese Trennung beruhte nicht nur auf praktischen Erwägungen, sie ging bis auf humanistische Grundüberzeugungen zurück. Heute ist man bezogen auf die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeiter nicht mehr so euphorisch, was auch an einem Wechsel vom milieutheoretischen Paradigma, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1990er Jahre verbreitet war, hin zu einer mehr evolutionsbiologisch geprägten, hereditären Sichtweise liegt. Die heute verbreitete Annahme, Versäumnisse in der Personalauswahl ließen sich durch Personalentwicklungsmaßnahmen nur schwer korrigieren, hat dabei mehrere Facetten.
Zum einen spielt die Berücksichtigung von Folgekosten eine Rolle. So werden beispielsweise bei einem höheren Verantwortungsbereich einer Führungskraft auch Fehlentscheidungen von größerer Tragweite sein. Das kann sich auf die Geschäftsstrategie eines Unternehmens ebenso beziehen wie auf die Motivation der geführten Mitarbeiter. Falsche Personalentscheidungen beinhalten nicht nur verschwendete Werbungs-, Auswahl- oder Fluktuationskosten. Im Falle von Führungskräften betrifft das u. U. auch demotivierte Mitarbeiter und damit Produktivitätsverluste ganzer Abteilungen. Zum anderen bleibt strittig, ob Versäumnisse in der Personalauswahl durch entsprechende Entwicklungsmaßnahmen, sei es durch Training oder Coaching, überhaupt aufgefangen oder sogar korrigiert werden können.
Kenntnisse, also etwa Sprach- oder EDV-Kenntnisse sowie die erforderliche Berufserfahrung für eine Position lassen sich ohne Schwierigkeiten aus dem Lebenslauf eines Bewerbers ersehen. Sollten hier Kenntnisse fehlen oder sich mit der Zeit als unzureichend erweisen, lassen sie sich sehr gut mit klassischem Training oder Weiterbildung auffrischen bzw. erwerben. Was sich aus dem Lebenslauf nicht ergibt, sind die Fähigkeiten, die ein Mensch mitbringt. Die geforderten Fähigkeiten können für verschiedene Tätigkeiten sehr unterschiedlich sein. So braucht ein Vertriebsmitarbeiter u. U. ein gewisses Maß an Extrovertiertheit, Freude am Kontaktknüpfen mit Menschen, sowie eine gewisse Eloquenz. Das Anlegen dieser Kriterien bei der Auswahl eines Softwareprogrammierers würde hingegen nicht sinnvoll sein, da sie keine Relevanz für seine berufliche Tätigkeit haben. Es mag möglich sein, beispielsweise einen introvertierten Programmierer zu einem erfolgreichen Verkäufer zu trainieren. Die vorhandene Anzahl an angebotenen Verkaufstrainings spricht Bände und es spielt dabei sicher eine Rolle, dass ein großer Teil der Weiterbildungslandschaft von Pädagogen besetzt ist, und historisch damit ein Fokus auf milieutheoretische Ansätze nicht überraschen muss. Unabhängig davon, ob jemand, der introvertiert ist, an einer Verkaufstätigkeit oder an einer öffentlichkeitswirksamen Position überhaupt Freude hätte, werden die angeborenen Dispositionen nicht nur viel Training benötigen, sondern sie stecken auch den Rahmen der beruflich erreichbaren Exzellenz. Insofern gilt der Erfahrungswert im Personalwesen: Was in der Personalauswahl versäumt wird, lässt sich mit Personalentwicklungsmaßnahmen nur schwer korrigieren. Unternehmen sind deshalb zunehmend daran interessiert gerade den Kompetenzbereich der vorhandenen Fähigkeiten zu evaluieren.
2.1 Attract, Select & Integrate
Recruiting kann grob in drei Aufgabenteile gegliedert werden: »Attract« (Personalmarketing), »Select« (Personalauswahl) und »Integrate« (Personalintegration). Die Integrationsphase geht nach überstandener Probezeit unmittelbar in die Bindungsphase (Retention) über und ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr das Recruiting, sondern die interne Personalentwicklung für die weitere Karriere der Mitarbeiter zuständig.
Auf der Ebene von Attract müssen sich Unternehmen in der Zukunft mehr und mehr bemühen, »Employer of Choice« zu werden, eine Aufgabe insbesondere für das Personalmarketing. Stipendien und duale Ausbildungswege machen Unternehmen zu attraktiven Arbeitgebern. Es ist immer wichtiger geworden, schon potenziell qualifizierte Arbeitnehmer für Unternehmen zu interessieren und früh eine Bindung zu schaffen. Ein Beispiel hierfür sind Girls‹ und Boys‹ Days gegen Rollenklichees bei der Berufswahl. Aber auch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter durch eigene Mitarbeiter ist ein gutes Beispiel für Personalmarketing. Unabhängig von der nachweislichen Qualität solcher Empfehlungen (weil unwahre Aussagen auf die empfehlenden Mitarbeiter zurückfielen) und ihren Nutzen für Select, stärken solche Aktionen auch die Firmenverbundenheit der rekrutierenden Mitarbeiter. Schließlich möchte jeder Mitarbeiter auf sein eigenes Unternehmen stolz sein. Aber auch Work-Life-Balance-Programme sowie generell die Möglichkeit, in Zukunft durch »Empowerment« der Mitarbeiter mehr Firmenverbundenheit und Sinnerfüllung in der Arbeit zu ermöglichen, werden wesentliche Komponenten sein, um sich im »War for Talents« als Unternehmen behaupten zu können.
Dabei bleiben die wesentlichen Differenzierungsstrategien im Personalmarketing erhalten. Wie sich wahlweise etwa mit »Idealpunkt«- oder »Präferenzmodellen« darstellen lässt, ziehen Unternehmen gezielt durchaus verschiedene potenzielle Bewerbergruppen mit ihren Personalimage-Portfolios an. Das Personalmarketing eines Unternehmens arbeitet mit seinen Methoden sehr gezielt daran, das gewünschte Arbeitgeberbild (z. B. Sicherheit des Arbeitsplatzes, Internationalität, moderne Organisationsstrukturen) zur Zielgruppe zu transportieren (Abb. 7).
Abb. 7: Personalimage-Portfolio (modifiziert nach Scholz 2000)
Die Aufgaben des Personalmarketings enden nicht mit dem Bewerbungsprozess. Über die Integration neuer Mitarbeiter bis hin zur Personalfreisetzung achtet das Personalmarketing auf ein vorteilhaftes Unternehmensimage intern und extern und sorgt für positive Kommunikationsprozesse. Dazu wird es in der Zukunft für die Unternehmen immer wichtiger werden zu definieren, was sie unter »Talenten« überhaupt verstehen. Wenn man nicht weiß, wen man sucht, kann man die Person auch mit den besten Auswahlinstrumenten nicht finden. Die Auswahlinstrumente müssen den bestmöglichen professionellen Ansprüchen genügen, und die bei der Auswahl beteiligten Führungskräfte müssen sorgfältig geschult werden.
Für Bewerber ist ein Interviewpartner eines Unternehmens immer auch Unternehmensrepräsentant und als solcher Imageträger. Personalauswahlsituationen sind deshalb auch Marketing-Events. Unternehmen müssen sich verdeutlichen, dass verprellte Bewerber immer auch verprellte »Kunden« sein können und zudem hervorragende, aber eben auch katastrophale Multiplikatoren im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. Ist das Image einmal ruiniert, dauert es oft Jahre, bis ein Unternehmen im Employer-Ranking wieder nach oben klettert.
Sind genügend qualifizierte Bewerber vom Unternehmen angezogen und auch ausgewählt worden, geht es darum, diese möglichst schnell produktiv einsetzen zu können, zu integrieren und Fluktuation, insbesondere in den ersten Monaten und Jahren, zu verhindern. Schließlich wurde bereits in jeden neuen Mitarbeiter investiert. Dazu können beispielsweise Mentoren-Programme initiiert werden. Integrationsveranstaltungen sorgen darüber hinaus für die Bildung von Netzwerken unter den neuen Mitarbeitern. Mittel- und langfristig wird so Integration zu Retention. Hier beginnt die Arbeit der internen Personalentwicklung.
Eine der aktuellen Erfordernisse im Recruiting ist es, sowohl ältere Bewerber zu berücksichtigen als auch die Gruppe der hochqualifizierten Frauen zu gewinnen. Um sie zu gewinnen und zu halten, werden die Unternehmen flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance-Programme, Kinderbetreuungsmöglichkeiten etc. noch stärker ausbauen müssen. Unternehmen müssen sich in einem arbeitnehmerorientierten Arbeitsmarkt, wie er zunehmend durch die Demografie entsteht, verstärkt um die Bedürfnisse der Arbeitnehmer kümmern. War es früher vor allem geboten, dass sich Mitarbeiter an eine bestehende Unternehmenskultur anpassten, passen sich Unternehmen zunehmend an die pluralen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter-»Welten« an, um nicht die besten Bewerber an die Wettbewerber zu verlieren. Sehen wir uns im Folgenden einmal ausgewählte Methoden im »Recruitingzyklus« näher an (Abb. 8).
Nachdem der Personalbedarf quantitativ und qualitativ bestimmt ist, helfen Personalreferenten den Fach-Führungskräften in der Regel, ein Anforderungsprofil zu definieren, das im Einklang mit den Erfordernissen des Kompetenzmanagements eines Unternehmens steht. Danach wird die Vakanz zusätzlich zur internen Pflichtausschreibung in Zeitungen, Internet und zielgruppenrelevanten Zeitschriften veröffentlicht. Alternativ gibt ein Unternehmen den Auftrag an externe Headhunter, etwa aufgrund mangelnder interner Ressourcen oder aufgrund mangeln-
Abb. 8: Recruiting-Cycle: Attract – Select – Integrate
der Resonanz einer Ausschreibung. Der erste relevante Auswahlschritt ist die Selektion der eingehenden Bewerbungsunterlagen. Gegebenenfalls kann man Online-Auswahlverfahren oder digitale Kommunikationsformen wie Recruiting-Chatbots zur Vorselektion nutzen. Danach schließen sich persönliche Auswahlverfahren wie Interview oder Assessment-Center an. Die Verwendung eines Video-/Telefoninterviews ist beispielsweise sinnvoll, wenn es offene Fragen zu Bewerbungsunterlagen gibt oder hohe Anreisekosten des Bewerbers anfallen würden. Kommt es danach nicht zur Besetzung, wiederholen sich die Schritte ganz oder teilweise.
2.2 Recruiting mit dem AGG
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) trat als Durchsetzung von EU-Recht im August 2006 auch in Deutschland in Kraft und hat den Bewerbungsprozess verändert. Das AGG versucht, Diskriminierung anhand von acht Merkmalen zu verhindern (Abb. 9). Die Kriterien sind ethnische Herkunft und Rasse, Weltanschauung und Religion, Geschlecht, sexuelle Identität, Behinderung und Alter. Dabei ist zu beachten, dass Diskriminierung nicht nur unmittelbar, sondern auch mittelbar erfolgen kann. Werden beispielsweise Teilzeitkräfte diskriminiert, so lässt sich damit aufgrund des hohen Prozentsatzes teilzeitbeschäftigter Frauen auch mittelbar eine Diskriminierung nach Geschlecht unterstellen. Es gibt drei Ausnahmen, bei denen die acht Merkmale nicht gelten, nämlich
1. wenn bestimmte berufliche Anforderungen vorliegen,
2. wenn Maßnahmen, die gerade zur Verhinderung von Benachteiligung ins Leben gerufen wurden, dagegensprechen, sowie
3. wenn spezielle Rechtfertigungsgründe vorliegen.
Abb. 9: Diskriminierungsmerkmale nach dem AGG
Das AGG hat insbesondere auf die Personalbeschaffung große Auswirkungen. Es beginnt mit der Forderung, diskriminierungsfrei auszuschreiben sowie der Empfehlung, mindestens zwei Interviewer zu beteiligen und ein strukturiertes Interview durchzuführen. Die Interviewer können im Klagefall jedoch nur dann als Zeugen auftreten, wenn sie selbst nicht zugleich Unternehmer sind. Ein »strukturiertes Interview« mit vorgegebenem Inhalt, das für alle Bewerber gleich verwendet wird, bietet den Vorteil, dass fachliche Absagegründe belegt werden können und so Diskriminierungsvorwürfen vorgebeugt werden kann.
In der Ausschreibung der Stelle muss darauf geachtet werden, dass sowohl direkte als auch indirekte Diskriminierungsformulierungen vermieden werden. Selbst wenn man gern junge Mitarbeiter einstellen würde, weil diese am besten in das vorhandene Team passen, ist diese Formulierung verfänglich. Es wird zwar kein junger Mitarbeiter gesucht, aber indirekt lässt sich darauf schließen. Auch wenn hier ein Grenzfall vorliegt, lautet ein Richtwert, bei Ausschreibungen mehr die Anforderungen der Stelle zu beschreiben (Funktion) als die gewünschte Qualifikation des Bewerbers (Person).
Das bedeutet beispielsweise keinen »mobilen Mitarbeiter« (personenbezogen) zu suchen, sondern darauf hinzuweisen, dass mit der Stelle Reisetätigkeiten verbunden sind (funktionsbezogen). Ausnahmen können zugelassen werden, wenn sie einen der drei oben erwähnten Ausnahmegründe betreffen. Etwa eine Schauspielrolle als »Jugendlicher Liebhaber für Theateraufführung gesucht« auszuschreiben, wäre unverfänglich, weil die Kriterien Alter und Geschlecht für die speziellen beruflichen Anforderungen unabdinglich sind.
Es ist für Unternehmen notwendig, alle den Bewerber betreffenden Unterlagen so lange nach erfolgtem Absageschreiben aufzubewahren, wie eine mögliche Klagefrist läuft. Eine grundsätzliche Empfehlung für Unternehmen seit Eintreten des AGG lautet, den Bewerbern keine Absagegründe mehr zu nennen. Hintergrund ist die Angst, von Bewerbern beklagt zu werden, sollte eine unmittelbare bzw. mittelbare Diskriminierung nach den Kriterien des AGGs vorliegen. Dies betrifft nicht nur externe Bewerber, sondern oft auch Bewerber, die sich innerhalb des Unternehmens bewerben. So empfehlenswert dies arbeitsrechtlich sein mag, so wenig kundenfreundlich gestaltet sich dieses Vorgehen, weil Bewerber kein Stärken- bzw. Schwächen-Feedback mehr erhalten. Um dieses Feedback zu ermöglichen, ist es sinnvoll, Absagen von Mitarbeitern durchführen zu lassen, die im AGG bewandert sind, wie z. B. Personalmitarbeiter. Auch nach den Richtlinien des AGG ist es weiterhin möglich, detaillierte Absagegründe zu nennen, solange man dies professionell tut, also die Absage streng an Merkmalen der fehlenden Qualifikation ausrichtet.
Zum einen ist es kundenfreundlich, dem Bewerber ein detailliertes Stärken- und Schwächen-Feedback zu geben. Es zeigt, dass sich ein Unternehmen mit dem Bewerber auseinandergesetzt hat, und die Absage aufgrund von präzisen, wohlüberlegten und fachlichen Gründen erfolgt. Ein solches qualifiziertes Feedback, das sich an der beobachteten Leistung orientiert, läuft nicht Gefahr, in Hinsicht auf das AGG kritisiert zu werden. Zum anderen bleiben auch mit dem AGG immer noch Differenzierungsgründe gegeben, z. B. hinsichtlich Kriterien beruflicher Anforderung.
Auch Feedback innerhalb bzw. im Nachgang eines Auswahlverfahrens kann so weiterhin gegeben werden und ist aufgrund der starken Strukturierung beispielsweise eines Assessment-Centers noch unverfänglicher als nach einem Interview. Denn das Feedback richtet sich in der Begründung der beobachteten Stärken und Schwächen streng nach den wahrgenommenen und dokumentierten Kompetenzen, die mehrere Beobachter im Konsens festgestellt haben. Das AGG ist ein Gesetz zur Verhinderung von Diskriminierung. Hierbei sollte nicht vergessen werden, dass eine Gleichstellung im Sinne eines Benachteilungsverbots gemeint ist. Es ist kein Anspruch auf Besserstellung damit verbunden (Abb. 10).
Religiöse Gruppen, die beispielsweise wollen, dass ihre jeweiligen Feiertage anerkannt werden, können dies mit dem AGG nicht begründen. Auch ist zu beachten, dass das AGG auf arbeitsbezogene Gleichstellung abzielt und nicht auf private Bereiche zutrifft. Lädt ein Arbeitgeber beispielsweise nur ausgewählte Mitarbeiter zu einer Privatfeier zu sich nach Hause ein, so könnten beispielsweise nicht eingeladene Mitarbeiter, die »zufällig« einer bestimmten geschützten Gruppe angehören, keinen Einspruch erheben. Schwierig wird es freilich dort, wo Arbeit und Privates zusammenfallen oder sich in einer Grauzone vermischen, z. B. auf Dienstreisen. Hier kann ein Hinweis in den jeweiligen Unternehmensrichtlinien bzw. im Arbeitsvertrag helfen, inwieweit beispielsweise Dienstreisen als Arbeitszeit abgerechnet werden können, inwieweit oder ob sie überhaupt als Arbeitszeit gelten.
Abb. 10: »Vielen Dank für die Gleichbehandlung, Chef!«
Grundsätzlich gilt mit dem AGG bezüglich der Entgeltpolitik der Grundsatz: »Gleiche Vergütung für gleiche Arbeit«. Dies gilt auch für alle Vergütungsbestandteile wie Grundentgelt, Zulagen, Prämien, Erfolgsbeteiligungen oder auch Sachbezüge. Je stärker ein Unternehmen die Vergütung an objektive Faktoren wie Qualifikation, Führungsverantwortung, Leistung, Erfolg oder auch besondere Arbeitsbelastungen knüpft, umso unverfänglicher lässt sich eine in der Praxis erfolgende Vergütungsdifferenzierung begründen.
Eine Staffelung des Entgelts nach Berufsjahren beispielsweise kann deshalb dann nicht als mittelbare Diskriminierung aufgrund des Alters bezeichnet werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass mit den Berufsjahren die erforderliche Qualifikation zugenommen hat und somit ein objektives Kriterium, nämlich das erhöhter Leistungserbringung, vorliegt. Sucht ein Unternehmen Mitarbeiter mit »mindestens drei Jahren Berufserfahrung« so liegt auch hier keine Diskriminierung von Hochschulabsolventen und damit eine mittelbare Diskriminierung von Jüngeren vor, wenn die Ausschreibung beispielsweise den Zusatz enthält »in der IT-Branche«. Damit wird die Berufserfahrung an notwendige Qualifikationen geknüpft. Eine Objektivierung der Anforderungen sollte, wo es möglich ist, bereits in bestehende Anforderungsprofile Eingang finden und damit auch als Grundlage für die darauffolgende Personalauswahl dienen.
Wenn die Einführung des AGG auch zu einem größeren bürokratischen Aufwand für die Unternehmen geführt hat, hat sich für die Bewerber die Qualität der Auswahlverfahren durchschnittlich wohl durchaus erhöht und damit die Gefahr einer möglichen Diskriminierung weiter verringert.
Übungsfragen
• Nennen Sie mehrere Variablen, die einem demographisch bedingten »War for Talents« in Deutschland entgegenlaufen könnten.
• Erklären Sie, was man unter »Kompetenzen« im HR-Management versteht. Schildern Sie zwei Modelle und wägen Sie die Anwendbarkeit ab.
• Wie ist die »Kompetenzpyramide« aufgebaut und welche Aspekte daraus sind für die Weiterbildung in Unternehmen vor allem relevant? Bitte begründen Sie.
• Schildern Sie alle Ihnen bekannten Recruiting-Schritte, die einer Einstellung neuer Mitarbeiter vorangehen können.
• Wie viele Verstöße nach dem AGG enthält der folgende Anzeigentext: »Bildhübsche, dynamische Anwältinnen zwischen 25 und 35 Jahren mit akzentfreiem Englisch gesucht«? Bitte begründen Sie.
• Warum ist es für Unternehmen aufgrund des AGG schwieriger geworden, Bewerbern Absagegründe zu nennen? Wie ist dies dennoch möglich?
• Ein unverheirateter Mitarbeiter möchte ebenfalls wie sein frisch verheirateter Kollege einen Tag bezahlten Sonderurlaub haben. Müssen Sie als Arbeitgeber zustimmen, um nicht zu diskriminieren? Begründen Sie Ihre Antwort.
Literatur
Adomeit, K., Mohr, J., Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG): Kommentar zum AGG und zu den anderen Diskriminierungsverboten. Boorberg, Stuttgart (2011).
ADS, Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Zusammenfassung ausgewählter EuGH-Entscheidungen zum Antidiskriminierungsgesetz ab dem Jahr 2000, Berlin 2021. Link: https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Publikationen/publikationen_node.html (Abruf: 29. 06.2021).
Bolles, R.N., What Color is your parachute? A practical manual for job-hunters and career-changers. Random House, New York (2020)
Hesse, J., Schrader, H.C., Das große Hesse/Schrader Bewerbungshandbuch: Alles was Sie für ein erfolgreiches Berufsleben wissen müssen. Stark, München (2015).
Pabilonia, S. W., Vernon, V., Telework and Time Use in the United States (May 12, 2020). https://ssrn.com/abstract=3601959 (Abruf: 29.06.2021).
Scholz, C., Personalmanagement. Informationsorientierte und verhaltenstheoretische Grundlagen. München, Vahlen (2000).
3 Methoden der Personalauswahl
Lernziel
• Sie verstehen, wie man Personalauswahlmethoden kategoriell einordnen kann.
• Sie wissen, welche Kompetenzen man aus den jeweiligen Auswahlmethoden analysieren kann.
• Sie können berufliche Anforderungsprofile erstellen.
• Sie wissen, wie man Bewerbungsgespräche professionell durchführt, und wie Sie sich erfolgreich darauf vorbereiten.
• Sie sind in der Lage, ein Assessment-Center (AC) zu konstruieren und wissen, wie Sie sich selbst in einem AC erfolgreich präsentieren.
• Sie wissen, wie man in Unternehmen professionell kommuniziert und Konflikte löst.
Schon Aristoteles wies darauf hin, dass Schönheit ein besserer Fürsprecher als jedes Empfehlungsschreiben sei. Wer nun denkt, das sei in unserer modernen Welt überholt, irrt. Die Attraktivität der Bewerber spielt neben der fachlichen Qualifikation durchaus eine große Rolle für die Einstellungschancen, wie etwa Schuler & Berger (1979) zeigen konnten. Um sachlich fundierte Einstellungsempfehlungen aussprechen zu können, empfehlt es sich deshalb umso mehr, die vorhandenen professionellen Personalauswahlmethoden zu kennen, und man muss fähig sein, sie anzuwenden. Der Psychologe Heinz Schuler (2014) schlägt vor, in der Personalauswahl drei eignungsdiagnostische Ansätze kategoriell zu unterscheiden, den biografischen Ansatz, den Simulationsansatz und schließlich den Eigenschaftsansatz (Abb. 11).
Während sich im Interview zwar Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten ermitteln lassen, ist dies doch mit einer geringeren Validität als in Simulationsverfahren wie einem Assessment-Center möglich. Der Grund hierfür liegt darin, dass die Wirklichkeitsebene im Interview immer hypothetisch oder biografisch bleibt, und Ereignisse aus der Vergangenheit oder mögliche Zukunftsszenarien auf einer verbalen Metaebene beschrieben werden.
Simulationsverfahren müssen sich mit dieser Metaebene nicht begnügen, sondern können sich das Verhalten aus »erster Wirklichkeit« erschließen. Eine Ana-
Abb. 11: Trimodaler Ansatz der Berufseignungsdiagnostik
Biographischer AnsatzSimulationsansatzEigenschaftsansatz
logie aus der Welt der Piloten kann dies gut verdeutlichen. Um zu erfahren, wie ein Pilot in einer gefährlichen Situation reagieren würde, kann man ihn einfach fragen, was er machen würde (Interview). Es leuchtet aber unmittelbar ein, dass die Aussagekraft, ob ein Pilot beispielsweise bei einem Triebwerksbrand besonnen reagiert, drastisch steigt, wenn man ihn in einen Flugsimulator setzt (Assessment-Center) und sein Verhalten beobachtet. Wir befinden uns dann nicht mehr auf der Metaebene der Beschreibung, wo wir über Verhalten hypothetisch sprechen, sondern in der ersten Ebene der Wirklichkeit. Eignungsdiagnostisch schreibt man dieser Ebene mehr Validität zu, weil sich Verhalten schwerer manipulieren lässt, als verbale Kommunikation. Persönlichkeitsorientierte und kognitive Testverfahren haben das gemeinsame Manko, dass sie introspektiv und damit leicht manipulierbar sind. Und in der Tat kann man zeigen, dass etwa soziale Kompetenzen positiv in der Validierung von Persönlichkeitsfragebögen zu Buche schlagen, wie Ones & Viswesvaran (2001) zeigten.
Das persönliche Bewerbungsgespräch (Interview) wird heute nur noch selten frei geführt, sondern findet meist in strukturierter Form und mit Verhaltensfragen statt. Auch Assessment-Center und Persönlichkeitstests gehören zu den gebräuchlichen Personalauswahlinstrumenten. Traut man sich die Personalauswahl selbst nicht zu, oder kann man sich aufgrund von unregelmäßigen Rekrutierungsphasen keine große Personalabteilung leisten, kann der Auswahlprozess in Teilen oder komplett an externe Personalberater, sogenannte Headhunter, vergeben werden. Obwohl die Validität biografischer Fragebögen hoch (hier werden die Profile der Bewerber mit erfolgreichen Mitarbeitern verglichen) und zugleich der Aufwand gering und kostengünstig ist, haben sie einen Nachteil: Man weiß nicht, ob vergangene Profilmerkmale auch für die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich sein werden.
3.1 Bewerbungsunterlagen
Methodische Personalauswahl beginnt schon mit einer professionellen Analyse der Bewerbungsunterlagen. Bei Kandidaten, bei denen Fragen während der Unterlagenanalyse aufgetaucht sind oder auch bei Kandidaten, bei denen hohe Reisekosten anfallen würden, lohnt es sich, den Nutzen eines Video-/Telefoninterviews abzuwägen. Manchmal wird das Telefoninterview auch einem persönlichen Interview vorgeschaltet, wenn beispielsweise Fragen zu Mobilität, Wechselmobilität oder Vergütung zu klären sind.
Die Analyse der Bewerbungsunterlagen ist hinsichtlich der Evaluation von Kenntnissen und Erfahrungen durchaus aussagekräftig, da Hard Facts immer auch anhand der Zeugnisdaten verifiziert werden können. Soft Facts, also Schlüsselqualifikationen bzw. Fähigkeiten, sind aus den Unterlagen nicht zu erkennen. Die Selbstaussage von Bewerbern kann zwar hinsichtlich überprüfbarer Referenzen und Tätigkeiten in den Zeugnissen durchaus Gehör finden, letztlich aussagekräftig ist sie aber nicht. So können Bewerber ihr soziales Engagement oder ihre soziale Kompetenz beispielsweise durch entsprechende ehrenamtliche Nachweise oder die Arbeit mit Jugendgruppen untermauern. Die Aussagekraft der Zeugnisse geht wegen der wohlwollenden Formulierung jedoch über den reinen Nachweis der Tätigkeiten meist nicht hinaus. Der Evaluation von Fähigkeiten kommt so im Interview und Assessment-Center eine besondere Bedeutung zu.
3.2 Anforderungsprofil
Wenngleich das Anforderungsprofil kein Auswahlinstrument ist, stellt es doch die grundlegende Basis für jede Auswahl dar. Wenn man nicht weiß, wen man sucht, kann man die Person auch nicht finden. Bevor wir zu den Auswahlverfahren kommen, sollten wir zunächst klären, wie ein sinnvolles Anforderungsprofil aussehen sollte. Zunächst gilt hier, wie überhaupt in der beruflichen Eignungsdiagnostik, die grobe Einteilung der gesuchten Kompetenzen in Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten vorzunehmen.
Dabei ist es unumgänglich, das Kompetenzmanagement eines Unternehmens und damit den größeren Zusammenhang, in dem ein Anforderungsprofil steht, zu berücksichtigen. Hier werden die Jobprofile in Jobfamilien gebündelt und verschiedene Entwicklungslinien horizontal und vertikal skizziert. Dies bietet den Mitarbeitern den Vorteil, mögliche »Entwicklungslandkarten« innerhalb der eigenen Jobfamilie zu erkennen und zukünftige Karriereschritte anhand eines Personalentwicklungsplanes anzugehen. Ein Anforderungsprofil sollte demnach, abgestimmt auf das Kompetenzmanagementsystem des Unternehmens, die jeweils relevanten Kriterien ausweisen. Zur Erstellung eines Anforderungsprofiles kann man arbeitsplatzanalytische Verfahren wie die Critical Incident Technique (CIT), die der US-Psychologe John C. Flanagan (1906-1996) entwickelt hat (Flanagan 1954), verwenden (Abb. 12). Damit werden Inhaber der Zielposition zu spezifischen Berufssituationen befragt, ihr jeweiliges Verhalten und die sich daraus ergebenden Folgen werden analysiert und skizziert. Die damit erhobenen Fragestellungen lassen sich sehr gut und ohne großen Transfer als Bausteine im Auswahlverfahren verwenden, z. B. als verhaltensbezogene Interviewfragen.
Abb. 12: CIT – Methode zur Erstellung eines Anforderungsprofils
Im Planstellenantrag eines Unternehmens sind zusätzlich zum einfachen Anforderungsprofil noch administrative und organisatorische Daten beschrieben wie beispielsweise die Vergütungsstufe, Berichtswege, eine Aufteilung in Aufgabenbeschreibung (in Prozent nach Teilaufgabengewichtung), erforderliche Ausbildung etc. Je detaillierter ein Anforderungsprofil ist, umso besser kann es direkt in die Erstellung einer Planstellenanforderung bzw. einer Stellenausschreibung einfließen. Die Vorarbeit zahlt sich somit in jedem Fall aus.
Andererseits werden ungenaue Beschreibungen zu Problemen im Recruiting führen. Wird im Planstellenantrag beispielsweise nur die Anforderung eines Hochschulabschlusses erwähnt, so fallen darunter schon mindestens fünf Ausbildungsarten: Bachelor im dualen Ausbildungsgang, Bachelor (HAW), Bachelor (Uni), Master (HAW), Master (Uni). So unterschiedlich diese Ausbildungsarten und -zeiten sind, so unterschiedlich sollten Qualifikationsanforderungen und Vergütung im Planstellenantrag formuliert werden.
3.3 Bewerbungsgespräch
Das Bewerbungsgespräch, oft auch einfach nur Interview genannt, ist sicher das am häufigsten angewandte Auswahlverfahren, was nicht nur an der Wertschätzung der Interviewer, sondern auch an der Akzeptanz der Bewerber liegt. Nach wie vor gilt das strukturierte Interview als die beste Methode und ist zugleich die am häufigsten eingesetzte. Das liegt daran, dass sie flexibel und zugleich ökonomisch ist, zudem eignungsdiagnostisch fundiert, leicht erlernbar, schnell multiplizierbar und bei Bewerbern und Führungskräften gleichermaßen als beliebtestes Instrument anerkannt ist.
Es zeigt sich, dass Bewerber vor strukturierten Interviews meist mehr Respekt haben als vor einem freien Gespräch, und Bewerber sind dann auch oft beeindruckt von der Vorbereitung der Interviewer. Das Interview ist günstiger als ein Assessment-Center, denn man benötigt normalerweise nur eine Stunde Zeitaufwand und meistens werden auch nicht mehr als zwei Interviewer auf Unternehmensseite notwendig sein. Zudem bekommt man über die Bewerbungsunterlagen hinaus einen fundierten Einblick in die vorhandenen Fähigkeiten eines Bewerbers.
Der Inhalt des Bewerbungsgesprächs unterscheidet sich nicht nur von Unternehmen zu Unternehmen, sondern auch innerhalb ein und desselben Unternehmens. Jeder Bewerber kennt aus eigener Erfahrung die Bandbreite von Gesprächen, die von gemütlicher Unterhaltung bis zum strukturierten Stressgespräch reichen können. Hier muss sich ein Unternehmen darüber im Klaren sein, dass Sinn und Zweck des Interviews nicht nur sein muss, möglichst viel über einen Bewerber zu erfahren, sondern auch das Unternehmen wird auf Grundlage dessen, was im Interview geschieht, vom Bewerber auf den Prüfstand gestellt.
Schließlich sieht ein Bewerber die anwesenden Interviewer als Firmenvertreter und die von ihnen präsentierte Kultur wird mit der gesamten Firma gleichgesetzt und fällt auf das Image des Unternehmens zurück. Nur wenn bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden, wird ein Interviewer die Informationen, die er von einem potenziellen späteren Mitarbeiter erhalten will, auch valide erhalten. Deshalb sollten sich Firmenvertreter immer sehr gut auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten.
3.4 Vor dem Interview
Bereits bevor sich Bewerber und Unternehmensvertreter zum ersten Mal persönlich begegnen, sind in der Regel schon einige Kontakte erfolgt, die nicht nur auf das Gespräch selbst Auswirkungen haben können. Unerfreuliche Kontakte im Vorfeld lassen u. U. das Bewerbungsgespräch sogar platzen. Sofern ein Bewerber nach Eingang seiner Bewerbung einen Eingangsbescheid erhalten hat und ein ebenso professionelles Einladungsschreiben zu einem persönlichen Gespräch, werden manche Bewerber für einen ersten persönlichen Eindruck nicht auf das Interview warten, sondern bereits im Vorfeld versuchen, Kontakt aufzunehmen. Auch wenn für den Firmenvertreter der Kontakt ungelegen kommen mag, sollte er sich Zeit nehmen, um bereits einen ersten Eindruck vom Bewerber bekommen.
Einige Unternehmen gehen dazu über, einem Bewerbungsgespräch ein Video-/Telefoninterview vorauszuschicken. Hierbei sollte man sicherstellen, dass das Telefoninterview am Schluss eine Beurteilung enthält. Schließlich liegt der Sinn in der Verwendung eines zusätzlichen, vorgeschalteten Auswahlinstrumentes darin, die Auswahl objektiver und valider zu machen. Wie bei allen Auswahlinstrumenten gebieten es auch hier sowohl Fairness als auch gute Firmenkultur, das Telefoninterview vorher anzukündigen. Wenn ein Unternehmen generell Telefoninterviews vorschaltet, sollte dies dem Bewerber vorher schriftlich mitgeteilt werden. Ebenso sollte ein Termin vereinbart werden, so dass sich Bewerber vorbereiten können und nicht vom Gespräch überrascht werden.
Bewerber sollten sich immer auf ein Interview vorbereiten. Dabei gibt es konkrete Situationen, die sich unabhängig von Firma und Aufgabe nahezu wiederholen und nur schlecht vorbereitete Bewerber werden in Interviews überrascht. Die üblichen Fragetechniken im Interview sollten von jedem Bewerber beherrscht werden, so dass Verhaltensfragen ohne Weiteres beantwortet werden können. Auch inhaltlich sollte kein Bewerber überrascht sein, wenn Fragen nach Teamfähigkeit, Verantwortung, Konfliktfähigkeit oder dergleichen gestellt werden. Eine professionelle Vorbereitung wird niemals unauthentisch wirken, und auf jede Frage sollte ein Bewerber mindestens zwei Beispiele zur Stützung seiner Fähigkeiten nennen können. Im Folgenden sprechen wir einige typische, oft als heikel empfundene Fragen im Interview an. Die richtige Antwort gibt es dabei nicht, da diese situativ und auf den jeweiligen Interviewer bezogen variiert, aber wir können eine Art Best Practice für die meisten Situationen diskutieren.
3.5 Heikle Fragen im Interview – Wie reagieren Sie als Bewerber?
Praxisbeispiel
»Erzählen Sie etwas über sich selbst«Eine tolle Chance für Sie: Beginnen Sie mit dem Interessantesten und Wichtigsten. Dieser Teil des Interviews kommt immer wieder. Zeigen Sie sich hier nicht erstaunt oder unvorbereitet im Sinne: »Ja, wo soll ich denn da anfangen?« Legen Sie sich einen Selbstmarketing-Text (im Sinne des »Zwei-Minuten-Spots«, (Abb. 13) zurecht, in dem Sie mit einem Spannungsbogen Ihre Stärken anhand Ihrer Biografie darstellen.
»Was sind Ihre Stärken?«Sie sollten in der Lage sein, drei oder vier Stärken aufzuzählen (unterstützt durch biografische Beispiele), die in engem Bezug zu den Anforderungen des Unternehmens stehen.
»Wo sehen Sie Ihre Grenzen?«Beantworten Sie diese Frage beispielsweise mit der Nennung einer Ihrer Stärken, die, wenn sie zu stark ausgeprägt ist, sich als hinderlich erweist und in eine Schwäche umschlagen kann. So könnten Sie z. B. sagen: »Mein Ehrgeiz, eine Sache fertigzustellen, drückt sich manchmal in etwas überzogenen Anforderungen an meine Organisation aus. Aber ich bin mir dessen bewusst.«
»Wie müsste für Sie das ideale Arbeitsumfeld aussehen?«Hier können Sie einige Ihrer Vorlieben und beruflichen Wunschvorstellungen anbringen. Schildern Sie diese Punkte praxisnah und realistisch. Achtung: Matchen Sie Wunsch und unternehmerische Wirklichkeit!
»Arbeiten Sie lieber mit Zahlen oder Worten?«Die Antwort muss natürlich zum Tätigkeitsfeld passen, z. B. Controlling oder Rechtsabteilung.
»Wie verhalten Sie sich unter Termindruck?«Schildern Sie ein Beispiel, das zeigt, dass Sie mit terminlichem Druck umgehen können, also bei Bedarf auch schnell arbeiten können und nicht vom Druck »gelähmt« werden.
»Beschreiben Sie eine Situation, in der Ihre Arbeit kritisiert wurde.«Seien Sie kurz und präzise. Vermeiden Sie, emotional oder defensiv zu antworten. Bleiben Sie bei der Wahrheit, betonen Sie einen positiven Ausgang. Wichtig ist, dass Sie Lern- und Kritikfähigkeit demonstrieren.
»Was können Sie uns bieten?«Da Sie vor Ihrem Gespräch etwas über die Art der vorgesehenen Tätigkeit in Erfahrung gebracht haben, können Sie einige Ihrer früheren Erfolge aufzählen, bei denen es Ihnen gelungen ist, Probleme zu lösen, die denen Ihres zukünftigen Arbeitgebers gleichen. Jetzt ist auch der Zeitpunkt, Ihre USP (ihr Alleinstellungsmerkmal) hervorzuheben. Was können Sie im Vergleich zu anderen besonders gut?
»Was wissen Sie über unser Unternehmen?«Wenn Sie gute Vorarbeit geleistet haben, haben Sie das gesamte öffentlich verfügbare Informationsmaterial gelesen, die Website des Unternehmens studiert und können am besten Ihr Interesse mit einigen daraus entsprungenen Fragen dokumentieren.
»Warum möchten Sie für uns arbeiten?«Hier möchte kein Arbeitgeber hören, dass er eine unter vielen gleichwertigen Möglichkeiten ist. Überlegen Sie, was Sie speziell an dieser Firma motiviert, und was auch die USP der Firma und dementsprechend Ihr Selbstverständnis ausmacht.
»Was ist für Sie der interessanteste Aspekt der hier besprochenen Position? Und welcher Aspekt interessiert Sie am wenigsten?«Erwähnen Sie drei oder vier interessante Punkte und höchstens ein oder zwei unerhebliche Dinge, die Sie weniger interessieren. Dabei ist Vorsicht geboten, vielleicht hat sich aufgrund personeller Veränderungen das Anforderungsprofil verschoben und ein vermeintlich unwichtiger Aufgabenaspekt gewinnt an Bedeutung. Am besten schließen Sie nichts kategorisch aus.
»Welches Gehalt, glauben Sie, ist angemessen für die anstehende Position?«Eine wirklich heikle Frage. Wenn Sie nicht Bescheid wissen, sollten Sie sich in unverfängliche Formulierungen retten wie »Ich bin sicher, Sie bezahlen der Position angemessen.« Stellen Sie Ihre Motivation für die Firma und die Aufgabe in den Vordergrund, nicht die Vergütung. Dagegen entscheiden können Sie sich immer noch, sobald Ihnen das Vertragsangebot vorliegt. Bei großen Konzernen mit Manteltarifverträgen ist der Spielraum meist nicht sehr groß. Bereits bei der schriftlichen Bewerbung Ihre Gehaltsforderung anzugeben, verschlechtert u. U. Ihre Position, auch wenn dies ausdrücklich in der Ausschreibung gewünscht wird. Sie können stattdessen diplomatisch Ihr letztes Gehalt nennen.
»Wie sehen Ihre Ambitionen für die Zukunft aus?«Verweisen Sie darauf, dass es Ihnen zunächst darum geht, sich auf die unmittelbaren Anforderungen der Tätigkeit zu konzentrieren und sie gut zu erfüllen. Deuten Sie an, dass Sie aber durchaus am persönlichen Vorwärtskommen interessiert sind. Vermeiden Sie es, beim Gegenüber den Eindruck zu erwecken, dass Sie, einmal eingestellt, an seinem/ihrem Stuhl sägen könnten.
»Wie sehen Ihre langfristigen Ziele aus?«Statt einer allgemeinen Schilderung beziehen Sie Ihre Antwort auf das Unternehmen, bei dem Sie das Vorstellungsgespräch führen. Antworten Sie so präzise wie möglich, d. h. seien Sie sich im Klaren darüber, was Sie wollen, wie die Position konkret benannt wird (Jobprofil), dass die Position im Unternehmen auch vorhanden ist und was sie noch lernen müssen, um den Anforderungen gerecht zu werden.
»Wie sieht Ihr Führungsstil aus?«Wenn die angestrebte Position Führungsaufgaben beinhaltet, sollten Sie darlegen, wie Sie Ziele setzen und motivieren. Am besten unterstützen Sie diese Aussagen durch dokumentierte Performances wie 360-Grad-Beurteilungen, Vorgesetztenbeurteilungen etc.
»Warum wollen Sie Ihre jetzige Position verlassen?«Seien Sie ehrlich. Wenn es sich um eine erzwungene Einsparungsmaßnahme handelt, dann machen Sie dies auch deutlich. Falls dies möglich ist, erwähnen Sie, dass Ihre Entlassung Teil einer größeren Bewegung war. Vermeiden Sie, Reibungspunkte mit Ihrem Vorgesetzten zu analysieren.
»Wie denken Sie über Ihren früheren Vorgesetzten bzw. Ihren früheren Arbeitgeber?«Versuchen Sie, die Frage so positiv wie möglich zu beantworten, und vermeiden Sie, zu tief in das Thema einzusteigen. Dies ist eine Fangfrage, weil ein streitsüchtig oder schwierig erscheinender Mitarbeiter die meisten Vorgesetzten abschreckt. Durch unsere Erfahrung neigen wir dazu, Konflikte allen Beteiligten zuzuschreiben. Selbst wenn Sie also übel gemobbt wurden und auch denken, dies eindeutig zu Ihren Gunsten darstellen zu können, wird Ihnen Ihr Gegenüber wahrscheinlich nicht voll zustimmen können. Versuchen Sie die positiven Aspekte Ihres früheren Arbeitgebers bzw. Ihrer Führungskraft herauszustellen. Wenn Ihnen das nicht authentisch möglich ist, wechseln Sie zügig das Thema.
Abb. 13: 2-Minuten-Spot
SenderEmpfänger
Jeder Bewerber, der schon mehrere Interviews überstanden hat, weiß, dass die aufgeführten Fragen gar nicht so heikel sind, wie die Praxis wirklich werden kann. Dennoch zeigen sich viele Bewerber schon anhand der skizzierten Anforderungen als unvorbereitet und überrascht. Dabei gehören diese noch zum normalen Interviewrepertoire einer seriösen Firma. Bewerber sollten sich ein dickes Fell zulegen, denn es gibt auch Firmen, die Fragen stellen, welche durchaus unprofessionell und provozierend sind, und dabei bleibt ihr eignungsdiagnostischer Wert fraglich. Sollten Sie also mit minutenlangem Schweigen verunsichert werden oder der Interviewpartner Ihre Antwort gar mit »Das glaube ich Ihnen nicht« kommentieren: Bleiben Sie ruhig und sachlich. Sie können sich später immer noch überlegen, ob Sie in einer solchen Firmenkultur arbeiten wollen. Lassen Sie sich vor Ort jedenfalls nicht aus der Ruhe bringen, denn das ist bei solchen Provokationen meist die Intention. Es kann aber auch einfach sein, dass Ihr Gegenüber keine Ahnung hat, wie man Interviews führt.
3.6 Strukturiertes Interview
Es ist soweit, der Bewerber besucht das Unternehmen. Idealerweise kennt der Bewerber bereits aus der schriftlichen Einladung die teilnehmenden Gesprächsteilnehmer namentlich. Aufgrund des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sollte ein Unternehmen einem Bewerber immer mit mindestens zwei Firmenvertretern begegnen, um im Klagefall zwei firmenseitige Zeugen zu haben. Auch bevor dies arbeitsrechtlich geboten war, gab es qualitative Gründe, einen Bewerber mit mindestens zwei Interviewern zu befragen. Je mehr Firmenvertreter anwesend sind, desto weniger Fehlentscheidungen sind wahrscheinlich und desto valider lässt sich die Leistung eines Bewerbers beurteilen, insbesondere wenn die Interviewer strukturiert vorgehen und einen Vergleichsmaßstab für die Beurteilung haben. Es lässt sich nachweisen, dass sich der Einsatz strukturierter Interviews auszahlt.
Wie gehen Interviewer nun »strukturiert« vor, und welcher Aufbau empfiehlt sich für ein Bewerbungsgespräch? Meistens haben Bewerbungsgespräche in etwa den folgenden Aufbau: Begrüßungs- und Aufwärmphase, Firmenvorstellung, Bewerbervorstellung, Fokussierung der neuen Aufgabe, schließlich Klärung offener Fragen und Abschluss bzw. für die Interviewer die Beurteilung.
In der Begrüßungsphase sollten die Firmenvertreter den Bewerber zunächst nach seinem Befinden fragen, nach der Anreise, ob alles gut gefunden wurde etc. Die Begrüßung bietet zum einen die Gelegenheit, sich auf den anderen einzustimmen, und zum anderen dem Bewerber die Möglichkeit, nicht nur physisch, sondern auch psychisch anzukommen. Nachdem Getränke etc. angeboten wurden, sollten sich die Vertreter des Unternehmens vorstellen und noch einmal kurz erläutern, wie lange das Gespräch dauern wird, ob es ggf. Folgegespräche geben wird etc. Außerdem wird es hier einige Worte zum Unternehmen generell geben, auch Kurzvideopräsentationen können sinnvoll sein. Beispielsweise bei emotionalen Produkten kann ein Video viel mehr vermitteln, als es eine Unternehmenspräsentation über Folien könnte.
Als Nächstes sollte der Bewerber aufgefordert werden, seinen Lebenslauf darzustellen. Manche Interviewer fragen gezielt nach Stationen oder etwa »Knicken« im Lebenslauf, andere lassen den Bewerber selbst wählen, was für ihn die wichtigsten Stationen seines Lebens bzw. seiner Qualifikationen waren. Welche Philosophie die Interviewer auch wählen, entscheidend ist, den Redeanteil des Bewerbers möglichst hoch zu halten. Schließlich wollen die Interviewer etwas über den Bewerber erfahren und das geht nur, wenn dieser auch die Möglichkeit dazu hat. Das heißt aber nicht, dass der Bewerber ungebremst reden sollte. Gerade eloquente und geübte Bewerber werden die Zeit so zu ihren Gunsten zu nutzen wissen. Vielmehr geht es darum, den Bewerber mit gezielten Fragen dazu zu bringen, das zu erzählen, was die Interviewer wissen wollen. Hier gilt: Wer fragt, führt. Wie man diese Fragen am besten formuliert, werden wir gleich erläutern. Damit im strukturierten Interview der rote Faden nicht verloren geht, ist es sinnvoll, dass die Interviewer bereits am Anfang des Gesprächs darauf hinweisen, dass der Bewerber am Ende des Gesprächs noch Zeit hat, seine Fragen zu stellen. Wenn zwei Interviewer eingesetzt werden, können sie sich die Fragen so aufteilen, dass sich je ein Interviewer voll und ganz auf den Bewerber konzentriert und Fragen stellt, während der andere seine Notizen ergänzt und auf die eigenen Fragen vorbereitet.