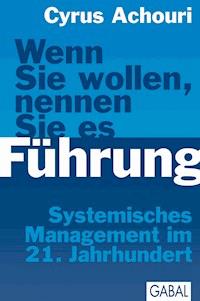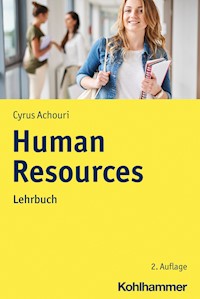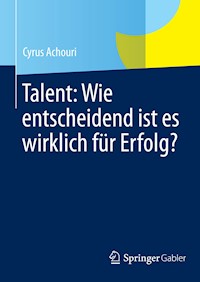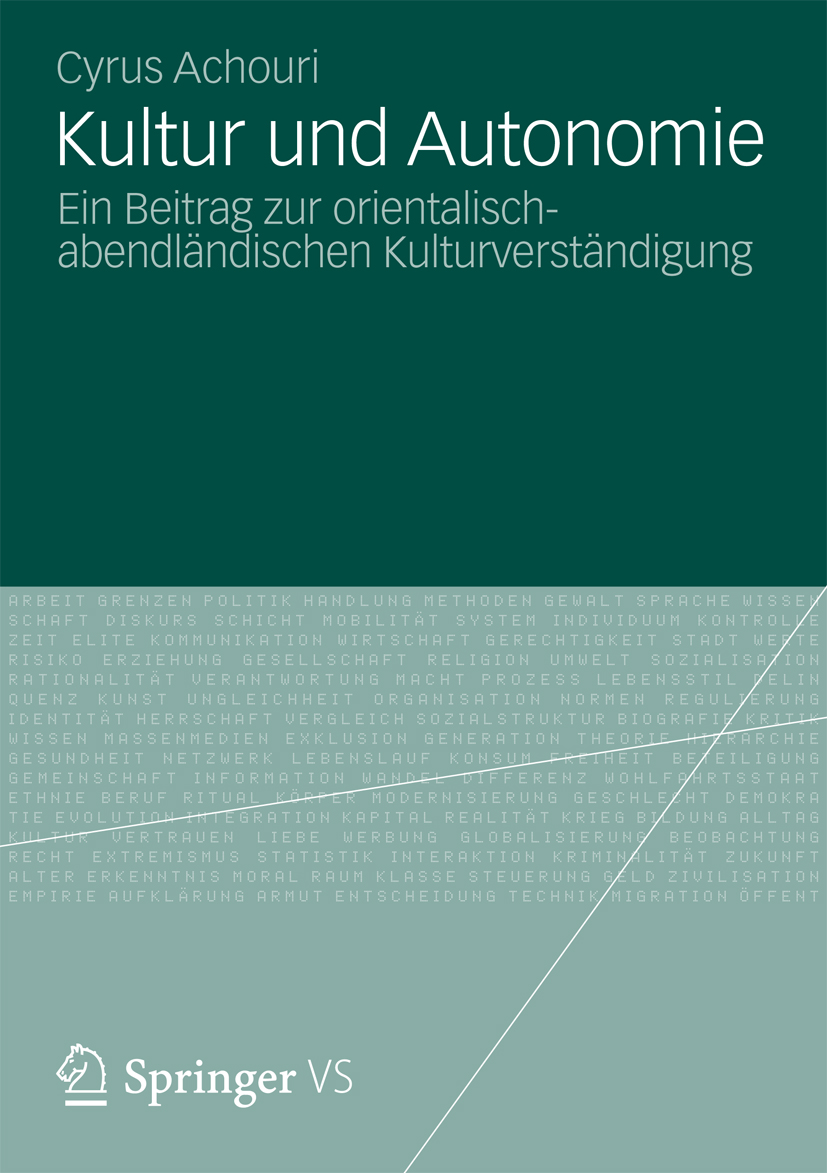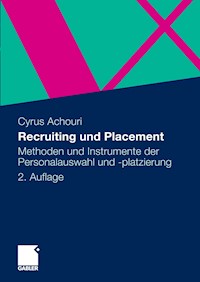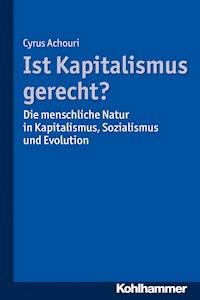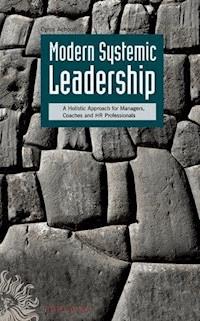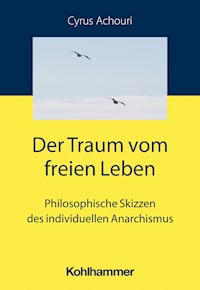
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Idee der Freiheit wirkt integral in alle Lebensbereiche, insbesondere in die Ökonomie: Ob als Grundlage moderner Wirtschafts-, Arbeits- und Organisationsformen, ob als Konsumentensouveränität, ob als Gestaltungsproblem bei der (Selbst-)Organisation, der "Traum vom freien Leben" bewegt die Menschen. Bedingungs- und grenzenlose Freiheit ist dabei höchst umstritten, wobei stets auch die Furcht vor Chaos und Gewalt, vor anarchischen Zuständen mitschwingt. Zugleich leben wir auch in liberalen Gesellschaften reglementiert, haben gesellschaftliche und staatsbürgerliche Pflichten aller Art und auch die Zwänge der globalen Wirtschaft diktieren den Alltag. Die vor diesem Hintergrund propagierten Alternativkonzepte kann nur verstehen und bewerten, wer sie im Hinblick auf ihren Entstehungskontext, ihre philosophischen Grundlagen und Vordenker einzuordnen vermag. Dieser anspruchsvollen Aufgabe widmet sich der Autor in seiner dennoch gut verständlichen Darstellung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cyrus Achouri
Der Traum vom freien Leben
Philosophische Skizzen des individuellen Anarchismus
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Elias und Charlotte,Charlotte und Elias,in Liebe gewidmet
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print: ISBN 978-3-17-043743-2
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-043744-9epub: ISBN 978-3-17-043745-6
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhalt
Vorwort
Einführung
Was ist Anarchie?
Freiheit
Chaos und Gewalt
Herrschaft
Staat
Individualismus
Kapitalismuskritik
Anarchismus als Philosophie
Die Auseinandersetzung mit Kollektivismus, Marxismus und Sozialismus
Von der abendländischen Antike bis zum Postanarchismus
Postanarchismus und Ökologie/Veganismus
Laotse
Diogenes von Sinope
Epikur
De la Boétie
William Godwin
Gustav Landauer
Johann Gottlieb Fichte
Max Stirner
Friedrich Nietzsche
Pierre Proudhon
Michail Bakunin
John Henry Mackay
Benjamin Tucker
Herbert Read
Emma Goldman
Mahatma Gandhi
Albert Camus und Jean-Paul Sartre
Noam Chomsky
David Graeber
Peter Singer
Literatur
Vorwort
Ein freies Leben: Gibt es das überhaupt? Oder muss es notwendigerweise Utopie oder Traum bleiben? Dass dieser Traum die Menschheit seit Anbeginn umtreibt, ist jedenfalls anerkennend zur Kenntnis zu nehmen, selbst wenn man an eine mögliche gesellschaftliche Umsetzung nicht glauben mag oder sogar fundierte Argumente gegen die Realisierbarkeit ins Feld führt.
Aber ab wann ist ein Leben überhaupt „frei“ zu nennen? Wenn wir selbstbestimmt denken und handeln? Wenn wir das auch andern zugestehen? Und soll diese Freiheit dann nur für bestimmte Menschen gelten, beispielsweise Erwachsene, Menschen eines bestimmten Kulturkreises, gesunde Menschen etc.? Oder müsste die Freiheit nicht nur auf alle Menschen, sondern alle Lebewesen ausgedehnt werden, vielleicht sogar auf die gesamte Natur?
Bedingungslose, grenzenlose Freiheit wurde und wird nicht immer von allen als Wert gesehen. Verständlicherweise haben herrschaftliche Institutionen und Gemeinschaften kein Interesse daran. Noch interessanter wird es aber, wenn man sich den Argumenten derjenigen zuwendet, die Freiheit auch individuell nur bedingt zulassen wollen, u. a. mit diesen Einwänden: Menschen sind nicht fähig, mit zu viel Freiheit umzugehen; Menschen werden ohne Zwänge faul; lenkt man die Lebenszeit des Menschen nicht durch Pflichten und Arbeit, so richtet er seine Energie gegen sich selbst und andere, denn der Mensch ist von Natur aus aggressiv und zerstörerisch; nur die wenigsten Menschen sind fähig, mit Freiheit umzugehen, etc.
Ob diejenigen, die solche Argumente vortragen, selbst daran glauben oder nicht – vielleicht spielt hier auch die Angst eine Rolle; Angst vor Chaos, Unordnung, Gewalt, … Anarchie eben! Und das kann es doch nicht sein, nachdem wir so viele Jahrhunderte unsere Zivilisation mühevoll aufgebaut haben, um genau das zu verhindern.
Betrachtet man unsere Zivilisation unter dem Gesichtspunkt der individuellen Freiheit, so kann man durchaus in Zweifel ziehen, ob wir im Laufe der Zeit freier geworden sind. Wir haben gesellschaftliche Pflichten, Schulpflichten, Arbeitspflichten, Staatspflichten und die Übernahme der maschinellen Produktion hat uns auch nicht freier von den alltäglichen Mühen des Lebens gemacht – im Gegenteil: Nun diktieren die Produktionsverhältnisse unseren Alltag.
All dies betrachtet der Anarchismus kritisch – und damit nicht genug: Er entwirft ein Gegenbild, das uns ein höheres Menschsein vor Augen führt; höher, weil selbstbestimmt, gleichberechtigt und gewaltfrei, eben frei. Er macht hinsichtlich seiner Forderung nach Freiheit keinen Halt bei Geschlechtern, ethnischer Herkunft oder sozialen Schichten und dehnt diese Forderung auch auf Tiere und sogar die ganze Erde aus.
Man mag an der praktischen Realisierbarkeit einer anarchischen Gesellschaft zweifeln, man mag einzelne Argumente anders sehen – man kommt aber nicht darum herum, die Schönheit und Erhabenheit der Gedanken anzuerkennen: Ein Lebewesen, das sich selbst und allen anderen Lebewesen die größtmöglichen Denk- und Handlungsspielräume ermöglichen will, um sich selbst und andere möglichst weit zu entwickeln. Für ein Leben, das im Anblick seiner kurzen Endlichkeit selbstbestimmt, friedlich und frei geführt werden kann. Vielleicht macht uns ja allein schon die Anerkennung dieser Gedanken erhabener.
„Die sogenannten Paradoxien des Autors, an welchen ein Leser Anstoß nimmt, stehen häufig gar nicht im Buche des Autors, sondern im Kopfe des Lesers.“ (Friedrich Nietzsche)1
Nietzsche 1988, Bd 2, 163
Einführung
Was ist Anarchie?
Der Historiker Max Nettlau findet in einem von Diderots Gedanken das Wesen der Anarchie treffend beschrieben, wenn dieser formuliert: Je ne veux ni donner ni recevoir des lois (Ich will weder Gesetze geben noch Gesetze empfangen, d. h. weder Gesetzgeber noch dem Gesetz Unterworfener, weder Herr noch Knecht sein – Worte, welche das Wesen der Anarchie enthalten.“2
Das Wort „Anarchie“ bedeutet in seinem ursprünglichen Sinn „Herrschaftslosigkeit“ und leitet sich aus dem altgriechischen „anarchia“ ab. Die Freiheit von Herrschaft, die im griechischen Begriff Anarchie zum Ausdruck kommt, ist nahezu bedeutungsgleich mit dem unbekannteren Wort „akratie“. Wenn man von anarchistischen Ideen spricht, werden diese oft auch als „libertär“ bezeichnet, ein Begriff der aus dem Französischen kommend auf die Freiheit verweist. Die Adjektive „anarchistisch“ und „libertär“ werden bis heute häufig verwendet, dabei hat der Begriff „libertär“ mit dem politischen Begriff „liberal“ nichts gemein; obwohl mit liberalen Ideen meist der frei gesteuerte Markt gemeint ist, ist dieser Freiheitsbegriff eher kontradiktisch zu anarchistischen Ideen, da der freie Markt nicht auf gleich mächtige Individuen wirkt und somit soziale Ungleichheit eher fördert als aufhebt.3. Man kann den Unterschied hierbei in der Ablehnung von Teilfreiheiten, wie in etwa die Freiheit des Handelns (Liberale) oder der Freiheit des Geistes (Aufklärung) sehen.4
Anarchismus und Sozialismus mögen sich hinsichtlich des Gleichheitspostulats ähneln, allerdings ordnet der Sozialismus marxistischer Prägung wiederum die Menschen herrschaftlich dem Gleichheitspostulat unter. Auch das aufklärerische Ideal der Vernunft ist ein Gleichmacher: Suggeriert es doch, es gäbe eine einheitliche, universelle Vernunft und deren Folgerungen, die allen, die vernünftig sind, einsehbar sind, vergleichbar maschinellem Denken. Was passiert aber mit denen, die zu dieser Einsicht nicht fähig sind oder schlicht zu anderen Ergebnissen im Denken gelangen, fragt der Anarchist? Auch eine Unterordnung des Einzelnen unter die ‚Vernunft‘ wäre in diesem Sinne also ein Herrschaftsidiom.
Mit Anarchie ist im Gegensatz zum Alltagsvorurteil keine Unordnung, kein Chaos gemeint, sondern eine soziale Ordnung, die sich ohne Herrschaft bildet, praktisch von selbst, sozusagen selbstorganisatorisch. Während das Konzept der Autopoiese oder Selbstorganisation in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen heute Verbreitung gefunden hat, ist der Zusammenhang mit Selbstorganisation im sozialen Bereich eher aus politischen Gründen diskreditiert. Während man zugesteht, dass sogar auf der Ebene der Nervenzellen selbstorganisatorische Prozesse stattfinden, hört die Akzeptanz und der unvoreingenommene Blick oft auf, wenn es um anarchistische, libertäre5, also Selbstorganisationsprozesse und -projekte im sozialen Bereich geht. Beispielweise schwebt manchen Anarchisten vor, die Gesellschaft sich selbst organisieren und reglementieren zu lassen, ganz praktisch etwa über Ratsversammlungen, freie Übereinkünfte und funktionale Entscheidungen bezüglich der Organisation. Föderale Kollektive und kleine Kommunen, Genossenschaften, die basisdemokratisch organisiert sind, ersetzen dann staatliche Makroorganisationsformen.
Anarchie bedeutet also gerade nicht Anomie, also die Abwesenheit von Ordnung in einem chaotischen Sinne, sondern das Vertrauen auf die Selbstorganisation, die Ordnung in Freiheit und Freiwilligkeit entstehen lässt. In diesem Sinne ist auch der Gedanke der Auflösung des Staates nicht als Auflösung von Ordnung zu verstehen, sondern als Aufhebung einer aufgezwungenen Staatsordnung in eine selbstgegebene Ordnung der Individuen. So werden auch häufig anarchistische Konzepte diskutiert, die durchaus eine Art institutionalisierter Abwehr von aufkommenden Herrschaftsstrukturen favorisieren. Allerdings ist damit keine Gewaltausübung gemeint, denn auch Gewalt ist Zwang und widerspricht damit der Freiheit und einer auf Freiheit gründenden Gesellschaft. Anarchisten lehnen nicht nur Gewaltausübung des Staates und Militarismus ab, sondern jede Art normativer Institutionen, beispielsweise auch religiöse. Dem gewöhnlichen Verständnis einer (gewaltsamen) Revolution setzen viele Anarchisten heute den Gedanken einer Evolution entgegen, welche nicht abrupt, aber auch nicht gewaltsam erfolgt und damit einen beständigen Wandel bringen soll.
Obwohl der Begriff „Anarchie“ als politisches Statement gegenüber Monarchie und Demokratie im 19. Jahrhundert geprägt wurde, gibt es bereits sowohl im morgenländischen als auch abendländischen Altertum anarchistische Konzepte. Während Diogenes im Abendland und Laotse im Morgenland den größten Bekanntheitsgrad bei Anarchisten erwirkt haben, scheint die vielfältige Verwendung des Begriffs ‚Anarchia‘ darauf hinzudeuten, dass immer Menschen existiert haben, die sich gegen die herrschende Ordnung gewandt haben, und deshalb als Rebellen bekämpft und abgelehnt wurden.
Schon Homer benutzte die Bezeichnung Anarchia im 8. Jahrhundert v. Chr. für „Soldaten ohne Anführer“, Euripides benutzt im 5. Jahrhundert v. Chr. den Begriff für „Seeleute ohne Leitung“ und Aristoteles benutzt die Bezeichnung im 4. Jahrhundert v. Chr. für „Sklaven ohne Herren“. Machiavelli wird die Anarchie im Mittelalter noch als Degenerationserscheinung bewerten aber schon im 18. Jahrhundert wird der Aufklärer Immanuel Kant Anarchie als Gesetz und Freiheit ohne Gewalt klassifizieren. Erst Pierre Proudhon, der im 19. Jahrhundert mit seinem Postulat „Eigentum ist Diebstahl“ auftritt, wird sich selbst als „Anarchisten“ bezeichnen.
Und so kennt der Anarchismus heute viele unterschiedliche Strömungen, die sich teilweise klassifizieren lassen, was aber nicht unbedingt zweckdienlich ist; denn die Abgrenzung bleibt durchaus schwierig. Während Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Selbstverwirklichung und Selbstverwaltung immer im Mittelpunkt stehen, differieren Ausprägungen und zum Teil auch Ansichten hinsichtlich eines herbeizuführenden gesellschaftlichen Wandels, dem richtigen Zeitpunkt und der Mittel dafür. In diesem Sinne werden auch in diesem Buch die Differenzierungen bewusst weder trennscharf gezogen noch ein Fokus auf die historische Aufarbeitung praktischer Versuche der politischen Umsetzung gelegt. Vielmehr sollen die gemeinsamen inhaltlichen Bezüge verschiedener anarchistischer Philosophien über die Zeit gesucht werden, anstatt die Differenzen zu kultivieren. Ob man die aufgeführten Denker also einwandfrei zur Strömung des individuellen Anarchismus zurechnen kann und will oder eine strikte Abgrenzung zum Kollektivismus bevorzugt, das darf der „Zwanghaftigkeit“ des geneigten Lesers überlassen bleiben. Jedenfalls kann man in der Literatur eine Vernachlässigung der Strömung des individualistischen Anarchismus feststellen, obwohl diese Denkrichtung für den Anarchismus grundlegend ist; schließlich startet und endet im Anarchismus alles mit dem Individuum, seinem Willen und seinem Freiheitsanspruch.
Das Zerrbild des Anarchismus wie er im umgangssprachlichen Gebrauch zirkuliert, hat Horst Stowasser sarkastisch treffend formuliert: „Was ein Anarchist ist, weiß jeder: ein gewaltiger Mensch, ein Terrorist zumeist, außerdem schmuddelig, die Unordnung liebend, Chaos verbreitend wo er geht und steht. Seine Lieblingsbeschäftigung besteht im Werfen von Bomben, die er üblicherweise unter einem wallenden, schwarzen Umhang verbirgt, das Gesicht von einem aus der Mode gekommenen Schlapphut verdeckt. Notfalls greift er auch zu Dolch oder Revolver – Hauptsache, er kann seinen Blutdurst stillen… Sie ahnen schon, all dies ist Unsinn, und Sie ahnen richtig. Das macht die Sache allerdings nicht einfacher, denn eine korrekte Definition ist schon deshalb schwierig, weil Anarchismus keine einheitliche Bewegung ist, sondern eine vielfältige und damit auch widersprüchliche. Das liegt in ihrem Wesen, denn ihr Wesen ist Freiheit, und Freiheit ist nicht uniform.“6
In diesem Sinne verbietet es sich fast, von Anarchismus als gesellschaftlicher Bewegung zu sprechen, außer man ist an historischen Bezügen interessiert. Die Gedanken selbst sind notwendigerweise, wie es auch in der Philosophie Gepflogenheit ist, von jedem Individuum selbst zu durchdenken. Nur indem man selbst an den Gedanken reift, wird man zu jener rücksichtslosen und bedingungslosen Freiheit fähig, die der Anarchismus letztendlich verlangt. Anarchismus ist dann als Philosophie individuell zu betrachten, an den einzelnen Denkern selbst, letztlich an den einzelnen Gedankengängen. Und obwohl die Richtung des individuellen Anarchismus nur als eine Spielart innerhalb der vielen anarchistischen Strömungen gilt, scheint sie doch eine wichtige, vielleicht die wichtigste, vielleicht sogar die einzige Art zu sein, wie sich Anarchismus denken und leben lässt: Selbst, allein, autonom und geistig unabhängig. Erst dann wird man zur anarchistischen Gemeinschaft fähig. In diesem Sinne betrachten wir in diesem Buch den ‚individualistischen‘ Anarchismus, wenn es ihn überhaupt gibt, nicht als marginale Besonderheit innerhalb der vielen historischen Strömungen, sondern durchaus mit der Gewichtung, die ihm zukommt: Als Keimzelle des Anarchismus schlechthin.
Die Tatsache, dass der individuelle Anarchismus einbezieht, dass Menschen sehr unterschiedlich sind, macht ihn zu einer einzigartigen Gesellschaftstheorie.7 Vielfach werden anarchistische Ideen in ihrem sozialen Gehalt als unbezahlbar und moralisch fragwürdig bewertet. In diesem Sinne würde ein Gesellschaftssystem, das es den Einzelnen offenlässt, wie weit und wie viel sie sich gesellschaftlich beteiligen, schon deswegen nicht funktionieren, weil man zu viele Schmarotzer hätte, die man mit „durchfüttern“ müsste. Unabhängig von der logistischen Seite der Frage, die sich bezogen auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse, das notwendige Maß an Arbeitszeit oder die Rationalisierung durch technische Automation beantworten lässt, ist die moralische Seite dieser Vorhaltung gewagt, wenn man sich vor Augen hält, wie ungleich der Anteil an der gesellschaftlichen Wertproduktion auch etwa in einer sozialen Marktwirtschaft ist. Ob man in der Einschätzung soweit gehen muss wie Stowasser, kann dahingestellt bleiben: „Wir ernähren heute – was gerne vergessen wird – hunderttausende von Schmarotzern mit, die nicht nur nichts herstellen, sondern überdies auch noch stehlen und superreich sind: die Kapitaleigner mit ihrem arbeitslosen Einkommen. Trotzdem geht unser System daran nicht zugrunde.“8
So wie das Vorurteil, der Anarchismus würde Schmarotzer produzieren, gibt es viele unhaltbare Vorurteile wie der Vorwurf der Rückwärtsgewandtheit der Bewegung. Viele dieser grundlosen Behauptungen rühren vielleicht daher, dass der Anarchismus eine Gefahr für den gesellschaftlichen Status quo darstellt; denn er prangert schonungslos gesellschaftliche Missstände an und formuliert zugleich eine zukunftsorientierte, lebenswerte Utopie: „Die anarchistische Bewegung… war, wie ihre Geschichte in allen Ländern zeigt, stets darauf eingestellt, politische und wirtschaftliche Missstände, unter denen Gruppen, Klassen oder das ganze Volk zu leiden hatten, durch direktes Eingreifen zu bekämpfen und für freiere und menschenwürdigere Verhältnisse einzutreten, einerlei ob es sich um eine Agrar- oder eine Industriegesellschaft handelte. Anarchisten waren es, die an der Spitze der Arbeiterschaft von Chicago 1886 zum ersten Mal zu einer Demonstration am 1. Mai für den Achtstundentag aufriefen und damit zu Vorkämpfern sowohl für den Weltfeiertag der Arbeit als auch der Achtstunden-Bewegung wurden. Fünf Anarchisten sind als Organisatoren der Bewegung und Redner auf der Kundgebung zum Tode durch den Strang verurteilt, vier von ihnen hingerichtet worden, weil es bei der Manifestation zu Unruhen kam, wobei es einige Tote gab. 9 In diesem Sinne kann man die Anarchisten auch als Begründer diverser Gewerkschaftsbewegungen sehen, etwa „in Frankreich, Italien und Spanien, in Brasilien, Uruguay, Mexiko und vor allem in Argentinien. In Spanien lag das Kraftzentrum der anarchistischen Bewegung bei den Industriearbeiter-Gewerkschaften von Barcelona. Als Realisten, die sie waren, bemühten sich die spanischen Anarchisten auch um die Organisierung der Kleinbauern und vor allem der Landarbeiter bis hinunter nach Andalusien. Und schließlich waren die deutschen Anarchosyndikalisten, deren Organisation FAUD in den 20er Jahren gegen 80000 Mitglieder hatte, ebenso wenig vorindustriell eingestellt wie die heute noch 20 000 Mitglieder zählende Organisation der schwedischen Syndikalisten. Ich möchte auch an die wertvollen Impulse erinnern, die die Genossenschaftsbewegung den Anarchisten zu verdanken hat. Während Karl Marx und seine Anhänger, einschließlich der Sozialdemokratischen Parteien, bis Anfang unseres Jahrhunderts in den Genossenschaften bürgerliche Palliative erblickten, die nach ihrer Meinung nur dazu beitragen könnten, die kapitalistische Gesellschaftsordnung zu verewigen, sahen die Anarchisten bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts in den Konsum- und Produktionsgenossenschaften der Arbeiter und den Verkaufs- und Kreditgenossenschaften der Bauern authentische Volksbewegungen und geeignete Mittel zur sozialen Emanzipation der Arbeit.10 In diesen Zusammenhang können auch die israelischen Kibbuze gesehen werden, „die abgesehen vom egalitären Lebensstil ihrer Mitglieder, zu den industriell und produktionstechnisch höchstentwickelten Landwirtschaftsunternehmungen der Welt gehören. Konklusion: Der Anarchismus war nie eine rückwärtsgewandte Utopie. Er setzte sich immer und überall für den sozialen Fortschritt und für die Erringung und Sicherung der politischen Freiheiten ein.“11
Der Freiheitsgedanke im Anarchismus ist einer, der allen und in freiwilliger Weise zugutekommt; er schließt damit marxistisch-leninistischen Staatskommunismus genauso aus, wie die unsichtbare Hand der Marktliberalen, die gesellschaftliche Ungleichheit nicht nur in Kauf nimmt, sondern auch rechtfertigt. Dieses allen Menschen innewohnendes Freiheitsideal ist es, worauf sich der Anarchismus gründet und der amerikanische Philosoph Peter Marshall gibt eine relative umfangreiche Formulierung für das Wesen des Anarchismus: „Whatever its future success as a historical movement, anarchism will remain a fundamental part of human experience, for the drive for freedom is one of our deepest needs and the vision of a free society is one of our oldest dreams. Neither can ever be fully repressed; both will outlive all rulers and their States12 Marshall begründet das unter anderem mit der menschlichen Individuation: “From the beginning, anarchy has denoted both the negative sense of unruliness which leads to disorder and chaos, and the positive sense of a free society in which rule is no longer necessary… If you dive into an anarchist philosophy, you generally find a particular view of human nature, a critique of the existing order, a vision of free society, and a way to achieve it all… anarchists reject the legitimacy of external government and of the State, and condemn imposed political authority, hierarchy and domination. They seek to establish the condition of anarchy, that is to say, a decentralized and self-regulating society consisting of a federation of voluntary association of free and equal individuals. The ultimate goal of anarchy is to create a free society which allows all human beings to realize their full potenzial.”13
Legt man diese Auffassung zugrunde, verbietet es sich, den Anarchismus mit Chaos und Unordnung gleichzusetzen. Es geht also nicht darum, die bestehende Ordnung abzulösen, sondern eine neue Ordnung dafür zu setzen, die den individuellen Entwicklungsgedanken zur Aufgabe hat. Genau genommen könnte man jetzt darüber streiten, ob dann Freiheit wirklich noch das oberste Primat zukommen kann; es geht dann ja nicht darum, nur frei von Ordnung, Fremdbestimmung etc. zu sein, sondern vielmehr darum, eine Freiheit zu einer selbstbestimmten Ordnung zu ermöglichen, die die Selbstwerdung des Menschen, also die Individuation beinhaltet. Dieser vitiöse Zirkel ergibt sich aber nur dann, wenn man missachtet, dass die Individuation immer individuell ist, und es damit keinen Sinn macht, Freiheit durch die Forderung nach Individuation zu ersetzen: Dies könnte nur wieder Zwang und damit Unfreiheit bedeuten. Sollte ein Individuum für sich beschließen, dass seine Freiheit nur in der Abwesenheit von Zwang bestehen solle, ohne jedes Verlangen nach Selbstverwirklichung und -entwicklung, so ist das im Anarchismus ebenso legitim.
Der Begriff Anarchismus ist in der Geschichte der politischen, sozialen und auch wissenschaftlichen Bewegungen sehr unterschiedlich und auch zum Teil widersprüchlich, in jedem Fall aber sehr weit gefasst verwendet worden: „Anarchismus ist ein Sammelbegriff einer Reihe sozialer und politischer Auffassungen (individualistische, kollektivistische, kommunistische, syndikalistische, autonome, feministische, kommunalistische, regionalistische, revolutionäre, reformistische, attributlose, pragmatische, religiöse, gewaltfreie, zivilistische, radikaldemokratische usw.), die ihren jeweiligen Anhängerinnen und Anhänger einen nach ihrem Verständnis von Herrschaftslosigkeit optimalen Rahmen für die größtmögliche individuelle Freiheit, bei größtmöglicher Gleichheit und Gerechtigkeit bieten.“14
Nimmt man diese Aussage und fragt, wie eine gesellschaftliche Umsetzung demgemäß aussehen könnte, kommt man ungeachtet der jeweiligen Ausgestaltung zum Beispiel auch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, der den kleinstmöglichen Konsens aller (sofern überhaupt dieser zu finden wäre) zum Inhalt hätte. Man darf und muss dann fragen, ob dieser kleinste Konsens nicht das erstgenannte Attribut größtmöglicher Freiheit wieder nivellieren würde. Zudem will der Anarchismus nicht gegen seine eigenen Kriterien der relativen Wahrheit und der skeptischen Perspektivhaftigkeit verstoßen, kann er auch seinerseits keinen Wahrheitsanspruch vertreten und das aus gutem Grund: „Eine Ideologie, d. h. ein komplettes, in sich geschlossenes ‚Lehrgebäude‘, das wie eine alles erklärende Weltformel fungiert, ist eine Sache fundamentalistischer Heilslehren und ihrer Ayatollas.“15
Dass die Handlungsmacht, aber auch das Aktionserfordernis nicht auf Seiten der Institutionen oder politischer Handlungsakteure besteht, sondern auf Seiten der Menschen selbst und zwar in der Verantwortung jedes Einzelnen, das scheinen die unterschiedlichsten Strömungen des Anarchismus zu teilen: „Gute Ideen scheinen sich auch dadurch auszuzeichnen, dass sich ihre Realisierbarkeit irgendwann einmal erweist. Wer also in einer Kommune leben will, kommt nicht daran vorbei, die Realisierung praktisch zu versuchen. Wer ‚alternativ‘ produzieren möchte, muss es irgendwann einmal versuchen. Wer oder was sollte ihn oder sie daran hindern? Kein Geld? Die schlechten Verhältnisse? Die bösen Anderen? Trägheit und Widerspenstigkeit der Verhältnisse müssen akzeptiert und überwunden werden. Keimfreie soziale Laborbedingungen wird es niemals geben, sie existieren höchstens in der Theorie.“16
Soweit die Begriffe ‚Anarchie‘ und auch der mehr wissenschaftliche Terminus ‚Anarchismus‘ auch gefasst sein mögen: Der politisch inkorrekte Beigeschmack, der beiden beigemischt ist, täuscht über die vielen Gewürznoten hinweg, die die anarchistische Bewegung in der Gesellschaft hinterlassen hat: „Im Zuge einer sich Anfang der 1970er Jahre entwickelnden „undogmatischen Linken“ schleusten engagierte Anarchisten und Anarchistinnen anarchistische Elemente in den Wertekontext der ‚Neuen Sozialen Bewegungen‘ (z. B. Ökologie-, Friedens-, Bürgerinitiativ-, Alternativbewegung) ein. Diese punktuelle Aneignung anarchistischer Prämissen (z. B. Dezentralität, Föderalität, Hierarchiekritik, Selbstverwaltung, gewaltfreier Widerstand, Rotationsprinzip) bildete ein verbindendes Ferment im heterogenen Spektrum dieser Bewegungen.“17
Und mit einem Augenzwinkern findet man viele quasi-anarchistische Inhalte auch im Alltag, denkt man nur an den Kreisverkehr: „Unser Straßenverkehrsrecht funktioniert nur in einer geordneten Anarchie.“18 Wie gut die chaotische Selbstorganisation funktioniert, sieht man sogar in der nichtmenschlichen Natur, wo sich viele Beispiele von selbstorganisierten, emergenten Eigenschaften finden lassen, die beispielsweise im Bereich der Schwarmintelligenz spontane Ordnungen erzeugen; weitere Beispiele finden sich sogar in der nichtbelebten Natur, denkt man an Mandelbrotsche Mengen mit ihren Attraktoren, Lichtquanten usw. Wie generell Ordnung im sogenannten Chaos zu finden ist, ist seit langem insbesondere in der Physik und der Chaosforschung bekannt.19
Viele Gedanken, die im anarchistischen Umfeld formuliert werden, scheinen also durchaus Resonanz in der Gesellschaft zu finden, wenngleich die letzten Konsequenzen im sozialen Bereich den meisten Menschen dann doch Angst machen und zu weit gehen. Dabei können manche etwa gemäßigte libertäre Thesen von angeblich „staatsfressenden“ Anarchisten auch in etablierten politischen Strömungen wie der FDP gefunden werden, auch wenn der Anarchismus nicht mit einer vulgärliberalistischen Enthemmung des Kapitalismus verglichen werden sollte: „Der den traditionellen Anarchismus beherrschende Hauptwiderspruch Gesellschaft-Staat ist insofern zu relativieren, dass anerkannt wird, dass der Staat inzwischen auch gesellschaftlich notwendige Schutz- und Sozialfunktionen innehat. Statt destruktiver ‚Alles-oder-nichts-Parolen‘ sind konstruktive Lösungen anzustreben, etwa im Sinne Gustav Landauers: Staat als zwischenmenschliches Beziehungsprinzip. Das heißt, es werden konkrete Ansprüche an das Verantwortungsbewusstsein und Emanzipationsvermögen des Individuums gestellt. Dieses Prinzip besagt auch, dass alle Angelegenheiten, die die Individuen nicht in der Lage sind, gesellschaftlich autonom zu lösen, notwendigerweise immer an eine allgemeine Instanz delegiert werden müssen. Diese allgemeine Instanz muss also – im Falle eigener Unfähigkeit und mangelnder Alternativen – auch von Libertären anerkannt werden, ob diese nun als Staat oder anders bezeichnet wird.“ 20 Bei einer solchen „anzustrebenden größtmöglichen gesellschaftlichen und individuellen Autonomie, ist der Staat nichts anderes als das noch notwendige und immer neu auszuhandelnde Mindestmaß an regulierenden rechtlichen Rahmenbedingungen.“21
Einerseits scheint der individuelle Anarchismus also Gemeinsamkeiten mit dem klassischen Liberalismus zu haben: „Individualist anarchism comes closest to classical liberalism, sharing its concepts of private property and economic exchange, as well as its definitions of freedom as the absence of restraint, and justice as the reward of merit. Indeed, the individualist develops the liberal concept of the sovereignty of the individual to such an extent that it becomes incompatible with any form of Government or State. Each person is considered to have an inviolable sphere which embraces both his body and his property. Any interference with this private sphere is deemed an invasion: the State with its coercive apparatus of taxation, conscription, and law is the supreme invader. Individuals may thus be said to encounter each other as sovereign on their own territory, regulating their affairs through voluntary contracts.”22
Andererseits findet „libertäres“ Gedankengut gerade in den USA heute eine gegensätzliche, rechtspolitisch-konservative Verwendung: „The problem with the term ‚libertarian‘ is that it is now also used by the Right. Extreme liberals inspired by J. S. Mill who are concerned with civil liberties like to call themselves libertarians. They tend to be individualists who trust in a society formed on the basis of voluntary agencies. They reject a strong centralized State and believe that social order, in the sense of the security of persons and property, can best be achieved through private firms competing freely in the market-place. In its moderate form, right libertarianism embraces laissez-faire liberals… who call for a minimal State, and in its extreme form, anarcho-capitalists… who entirely repudiate the role of the State and look to the market as a means of ensuring social order. 23 Ein solch libertäres Verständnis kann aber nicht im Sinne des Anarchismus sein, weil bestehende Ungleichheiten so nur verstärkt würden: „While undoubtedly related to liberalism and socialism, true anarchism goes beyond both political tendencies. It maintains that liberty without equality means the liberty of the rich and powerful to exploit (as in capitalist States), and equality without liberty means that all are slaves together (as in communist States). Anarchism leaves Left and Right libertarianism behind since it finds no role for the State and Government, however minimal. Its roots may entwine and its concerns overlap, but ultimately anarchism forms a separate ideology and doctrine, with its own recognizable tradition.”24
Nicht zuletzt durch die Aufweichung nahezu jedes Lebensstils durch marktwirtschaftliche Konsumidentitäten sind auch potenziell gesellschaftskritische Haltungen von Anarchismus bis Punk zu Stilattitüden geworden, was für ursprünglich staats- und verfassungsfeindliche Orientierungen durchaus bemerkenswert ist: „Anarchismus als Begriff wird zwar immer noch gerne im Sinne von Chaos, gar universalisierter Gewalttätigkeit, in den Massenmedien verwandt. Es gibt aber auch im Feuilleton und in bestimmten Szenen eine ebenso unreflektierte, ästhetische Bejahung des Anarchismus, bisweilen gar des gleichen ‚chaotischen‘. Wer vor 25 Jahren bei dem Wort die Hausdurchsuchung fürchten musste, kann heute entspannt seine Identität ‚als Anarchist‘ pflegen, ohne deshalb zu irgendwas verpflichtet zu sein, sogar als offener Ausweis, sich auf aber auch gar nichts festzulegen. Vielleicht sollte das nicht als ‚Abweichung‘ und ‚Verfall‘ interpretiert werden, sondern als nur ein weiteres Symptom der verallgemeinerten Identitätssuche.“25
Doch wird der Anarchismus dennoch in der Gesellschaft kaum als ein ernstzunehmendes Gesellschaftskonzept gesehen, sondern mehr als ein vorübergehender Zustand: „Anarchie wird in der gängigen Literatur und in den Medien lediglich als eine temporäre Erscheinung diskutiert, als einem Zustand, der die Zeit des Übergangs zwischen der Auflösung überkommener Herrschaft und der Herausbildung neuer Herrschaftsformen kennzeichnet.“26 Dabei ist schnell der mediale Blick bei gewaltbereiten „Autonomen“ und anderen gesellschaftskritischen Gruppen, die publikumswirksam einerseits vermummt und andererseits nicht selten mit anarchistischen Symbolen das Öffentlichkeitsbild beherrschen und das zu Unrecht: „Gewalt als ultima ratio von totalitärer Autorität müssen wir als Anarchisten ablehnen und uns von ihrer Praktizierung möglichst fernhalten. Gewalt fördert auf der psychologischen Ebene das anti-libertäre Element im Menschen.“27 Dies bezeichnet einen fundamentalen Punkt, der auch sozialistische, kommunistische aber auch alle anderen revolutionsbereiten Theorien betrifft und diese vom individuellen Anarchismus trennt, denn: Wie will man die Gewalt, die zur Abschaffung bestehender Verhältnisse eingesetzt wird, wieder loswerden?
Eine Reform oder sogar Abschaffung des Staates ereignet sich im anarchistischen Verständnis deshalb nicht durch eine gewaltsame Revolution, sondern dadurch, dass die Menschen durch ihre individuell vollzogene Entwicklung ihn nicht mehr nötig haben; die Regierung erledigt sich damit quasi von selbst, „wenn wir sie nicht mehr in Anspruch nehmen. Ein Feuer, das keine Nahrung mehr erhält, erlischt von selbst.“28 Das ist ein wesentliches Unterscheidungskriterium des Anarchismus zum Marxismus und jeder anderen politisch wie auch immer gefärbten gewaltsamen Revolution. Der Anarchismus steht hier in der Tradition des gewaltlosen Widerstandes; nur so kann man sich von herrschaftlichen Gewaltstrukturen zu befreien, ohne neue zu begründen. Schließlich ist der Anarchismus angetreten, um Gewalt und Herrschaft loszuwerden. Dabei kann man sich grundsätzlich fragen: „Warum ertragen Menschen seit Jahrhunderten Ausbeutung, Erniedrigung, Sklaverei, und zwar in einer Weise, dass sie solches nicht nur für die anderen wollen, sondern auch für sich selbst?“29
Selbst wenn man diese Frage anthropologisch different beantworten mag, wird die Frage nach einer praktisch möglichen Individuation zur Kernfrage jedes individuellen Anarchismus, möglicherweise aber auch für jede andere kollektivistische, kommunistische, ja wie auch immer geartete Gesellschaftsutopie. Die Antworten darauf können historisch in den geistesgeschichtlichen Bewegungen des Kynismus (Zynismus), Skeptizismus, Individualismus oder Subjektivismus zurückverfolgt werden, in der neueren wissenschaftlichen Entwicklung spielt hier auch die Selbstorganisation eine Rolle. Der Anarchismus sucht nach einer idealen Vergesellschaftung von Individuen in einer Gemeinschaft, die vom Verständnis der Selbstorganisation aller Lebewesen ausgeht. Auswirkungen des Selbstorganisationsparadigmas sind heute in der Pädagogik (Jean Piaget/Maria Montessori) über die Psychologie (Konstruktivismus, systemische Therapie und Organisationsberatung) bis hin zum Management (Systemische Führung, Empowerment) verbreitet und auch anerkannt. Selbst wenn man heute noch einen milieufokussierten Gesellschaftsblick einnehmen möchte, lässt sich doch auch in der Pädagogik eine Richtungsmodifikation nicht leugnen: „Für libertäre Pädagogik heißt dies, dass sie als ein Versuch zu werten ist, Erziehung und Bildung als einen Prozess der Selbstbestimmung und Selbstorganisation zu definieren und Fremdbestimmung sowie Fremdsteuerung im Umgang der Generationen miteinander zu minimieren.“30 Sollte das gesellschaftlich greifen, könnten zumindest langfristig Weichen für eine zunehmende Individuation gestellt werden, die es zukünftigen Generationen einfacher machen würde, zumindest in Realisierungsnähe einer freieren Gesellschaft zu gelangen.
Man kann dem Anarchismus bis heute zwar aus historisch pessimistischer Sicht ein Scheitern diagnostizieren: „Der Anarchismus als gesellschaftspolitische Perspektive ist bei uns an seinem Ende angekommen. Viel hat er von seinem libertären Gehalt verloren. Auch ist er zur Spielwiese von ‚Gescheiterten‘ geworden. Anarchismus ist fast nur noch ein historisches Relikt. Er ist nicht mehr Lebensentwurf und Haltung, nicht mehr selbständiges konzeptionelles Denken und Verwirklichen… Die ‚anarchistische Bewegung‘ ist nur noch ein Mythos.“31
Auf der anderen Seite sind die Forderungen eines gemäßigten Anarchismus längst in der Gesellschaft angekommen: „Die sozialen Kämpfe der Gegenwart und Zukunft müssen geführt werden unter der Erkenntnis: Freiheit statt Herrschaft! Der Weg vom unmündigen zum mündigen Bürger ist vielleicht ein schwieriger Weg, aber er ist möglich, er ist denkbar, er ist um der wirklichen Demokratie willen notwendig.“32 Auf diesem Weg wirken auch Visionen von der „Auflösung des Staates in freie Gemeinschaften, autonome Rechts- und Sozialgemeinschaften“33 nicht mehr befremdlich, wenn man sie in die Gedankenwelt eines ‚richtig‘ verstandenen Anarchismus einzuordnen weiß. Um die Gedanken des Anarchismus in seiner eigentlichen Bedeutung zu verstehen, muss man sie eben auch aus ihrer temporär gesellschaftlichen Verkleidung im autonomen, kommunistischen oder (links) radikalen Gewand lösen und die originären Gehalte suchen: „Der Schulterschluss der Anarchisten mit dem ‚Linksradikalismus‘ und damit dessen politischen – aber meist alternativlosen – Betätigungsfeldern, ist deren Selbstbeschränkung auf ein politisches Spektrum. Die Anarchisten inszenieren damit permanent selbst ihren Ausschluss aus der Gesellschaft. Diese Ghettoattitüde ist nicht nur masochistisch: sie kommt den vorgeblich bekämpften ‚Herrschenden‘ wegen ihrer Passivität nur zupass. Der Anarchismus als individualistisch-soziale-sozialistische Bewegung beschneidet sich hier selbst seiner intellektuellen Potenzen.“34
In diesem Sinne sollte sich der Anarchismus auf seine Quellen zurückbesinnen: „Der Anarchismus – will er in Zukunft gesellschaftlich gestalterisch wirken – muss bis aufs Skelett freigelegt werden: Individualismus (Emanzipation des Individuums als Emanzipation der Gesellschaft); Antistaatlichkeit (Ziel der Emanzipationsbewegung, staatliche Herrschaftsstrukturen zu beseitigen, das positive an ihnen zu transformieren in von gesellschaftlichen Gruppen und Verbänden getragene Institutionen); Ökonomie (Realisierung individueller Interessen in Übereinstimmung mit kollektiven Interessen in der Wirtschaft ohne Monopolbildungsmöglichkeit); Toleranzprinzip (Absage an jegliche Ansprüche, gesamtgesellschaftlich dominierend zu werden [totalitäres Prinzip, d. Verf.], sondern Kooperation mit anderen gesellschaftlichen Emanzipationsbewegungen); Freiheitsprinzip (Rosa Luxemburg: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden – und das ohne Abstriche).“35
Dabei steht der Anarchismus unter anderem vor der Herausforderung: „Wie kann anarchistischer Kollektivismus als freiwilliger Zusammenschluss individualisierter Individuen abgesetzt werden vom realsozialsozialistischen Zwangs-Kollektivismus?“36 Zumindest in der linguistischen Fassung eines „individuellen Anarchismus“ wird die Absicht dieser Abgrenzung deutlich; damit sind allerdings die vielen Schwierigkeiten, insbesondere ob und wenn ja, wie, ein Konsens vielfach individualisierter Menschen in zumindest zeitlich ungefähr gleicher Individuationsstufe möglich sein kann.
Der kollektivistisch konzipierte Sozialismus sowie der Marxismus setzen auf das Primat des Verstandes und die intersubjektive Möglichkeit rationaler Verständigung. Hat man die Effizienz und die Effektivität einer zentralen Planwirtschaft einmal eingesehen, geht man davon aus, dass dieser Konsens die Umsetzung im Sinne aller gewährleistet. Individualität hebt sich damit in dem Maße auf, als alle Individuen notwendigerweise das Gleiche wollen, zumindest bezogen auf ihre Grundbedürfnisse, eben weil diese rational zu bestimmen sind. Nicht selten ist dabei in der Kritik das Bild einer Gemeinschaft von gleichgeschalteten „Robotern“ bemüht worden, das der menschlichen Individualität nicht genügen könne. In jedem Fall bleibt in einer solchen Utopie zu erklären, wie eine derartige gemeinsame Rationalität einsetzen sollte, noch dazu relativ zeitgleich in den individuellen Entwicklungen der Menschen in einer Gesellschaft. Es setzt voraus, dass man letztlich nur zu einer richtigen Schlussfolgerung kommen kann, wenn man die Frage der gesellschaftlichen Kooperation zu Ende denkt. Rationalität ist aber nie nur objektiv und absolut, es gibt nicht nur eine Wahrheit.
Setzt man dagegen wie es etwa individualistische und vitalistische Philosophiekonzepte tun, den Willen, die Natur, die Irrationalität und die Evolution als Primat, so ist gewährleistet, dass die jeweilig individuelle Identität jedes Menschen Beachtung findet. Nimmt man die Freiwilligkeit gemeinschaftlicher Beschlüsse hinzu, wie es der individuelle Anarchismus in seiner gewaltlosen Konzeption tut, so kommt man zu einem Gemeinwesen, das die individuelle Willensbildung und die individuelle Freiheit wahrt. Hier ergibt sich nun ein anderes Problem als beim Kollektivismus: Wie kann, auch in suggerierten kleineren Gemeinschaftsverbänden der notwendige zwangfreie Konsens gedacht werden? Ist es denkbar, dass sich Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung zur Autonomie zum gleichen Zeitpunkt über gemeinschaftliche Ziele verständigen, was voraussetzt, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine vergleichbare Individuation hinter sich haben? Während der Kollektivismus Gefahr läuft, die individuelle Freiheit des Individuums aufzugeben, stellt sich beim Individualismus die Frage, wie sich gemeinschaftliche Ziele finden lassen, ohne die jeweilige Freiheit schmerzhaft einzuschränken.
Bezüge zum Anarchismus finden sich explizit, implizit, gewollt und ungewollt, aber vor allem ebenso treffend wie unzutreffend heutzutage in den verschiedensten theoretischen und praktischen Formen. So kann man jede Art von Protestbewegung, politische Aufstände vom arabischen Frühling über Protestbewegungen von Studenten bis hin zur westlichen Occupy-Bewegung dazu zählen, ebenso die Aktionen von Tierschützern bis hin zu globalen Klimaschutzprotesten wie Fridays for Future. Hier wird der Begriff der Herrschaft auf alle Lebewesen und die Natur zugleich angewandt und eine „Befreiung“ von Herrschaftsverhältnissen gefordert.
Auch das Internet hat anarchistische Züge und viele Vertreter der offenen Informationstechnologien kann man durchaus als moderne Anarchisten sehen. Denkt man nur an Wikipedia, so kann man die Nützlichkeit anarchischer Aktion in den letzten Jahrzehnten auch ganz praktisch nachvollziehen: „Many anarchists… have enthusiastically embraced the Internet and its libertarian potential, especially with its borderless and ownerless structure. They plan in cyberspace, creating horizontal and decentralized networks of communication throughout the world. They are involved in alternative organizations… they reject censorship and notions of intellectual property and copyright. They practice the gift relationship rather than capitalist exchange, sharing software, music and text. Their credo is that information is free and should be freely available for all. A few engage in criminal activity, hacking into major corporations and government departments in order to hinder their work and reveal their exploitative and coercive nature. But most are active in the free software and open-source movement. Moreover, the anti-capital and anti-globalization movements which they help co-ordinate mirror the organic and decentralized pathways of the internet.”37
Was die praktischen politischen Aktionen oft nicht miteinbeziehen, ist der mühsame Versuch, ein Konzept der Freiheit auch näher zu begründen als „Freiheit wozu“ und nicht nur „Freiheit wovon“. Auch wenn der Mensch überhaupt nicht in die Natur eingreifen würde, stellte diese dennoch auch ein Herrschaftsverhältnis ihm selbst gegenüber dar. Demnach gibt es eine große inhaltliche Spannbreite von der Forderung, sich die Natur und die Lebewesen nicht untertan zu machen, aber anderseits auch nicht der Natur unterworfen und ausgeliefert zu sein. Herrschaftsfreiheit und auch Freiheit beinhalten dann ein Verantwortungsmoment, das in anarchistischen Termini frei von Religion und Moral zunächst gefunden und definiert werden muss, um anschließend den gesellschaftlichen Konsens zu überprüfen.
In diesem Sinne ist grundlegend, wie ein Begriff von Freiheit schon allein theoretisch gemeint sein kann. Der philosophische Anarchismus diskutiert diese Frage bereits seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden. Dabei gab es immer schon zahlreiche Einwände und das nicht nur im Sinne ignoranter Vorurteile, sondern auch hinsichtlich der dafür notwendigen menschlichen Voraussetzungen für eine praktische gesellschaftliche Realisierbarkeit. Es könnte sein, dass in einer Zukunft, in der vor allem die technologischen Voraussetzungen für weitgehende individuelle Autarkie geschaffen ist, auch relative Autonomie möglich wird oder wie die Anarchisten sagen: Ein freies Leben.
Freiheit
Freiheit wird allgemein als Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen und sich entscheiden zu können. Voraussetzung dafür ist Autonomie, also die Selbstbestimmungsmöglichkeit eines Individuums. Eng damit verbunden ist der persönliche Wille, sofern der Wille frei ist, also weder durch äußeren Zwang noch durch etwa krankhafte Beeinträchtigung von innen beeinträchtigt ist. Darüber hinaus gibt es die philosophische Frage, ob es einen freien Willen überhaupt geben kann, wenn der Wille naturgesetzlich determiniert ist (Genesis), auch wenn das Individuum denkt, aus freien Stücken handeln zu können (Geltung). An die Frage des freien Willens knüpft sich auch die (rechtliche) Frage der Verantwortlichkeit bzw. Zurechenbarkeit von Handlungen. In unserem Kontext sind diese Fragen insoweit nicht relevant, weil der Anarchismus von der Geltung des freien Willens prinzipiell ausgeht; unabhängig von deterministischen (fatalistischen) Überzeugungen wird der Mensch damit als fähig gesehen, autonom Entscheidungen zu treffen und das befähigt ihn letztlich auch zur Freiheit.
Eine wichtige Differenzierung im Anarchismus betrifft die Frage nach Freiheit wovon und Freiheit wozu. Während sich politisches Ressentiment in seinen verschiedenen Erscheinungsformen im Wesentlichen als Ablehnung bestehender politischer Gesellschaftsstrukturen versteht, bedeutet die Negation im Anarchismus zunächst nichts, denn eine Revolution bestehender Zustände hat keinen Wert, wenn sie nicht von einer Revolution des Geistes mitgetragen wird. Das betrifft auch die angewandten Mittel zur Revolution, denn das Ziel muss in den Mitteln immer mitgedacht werden. Es wäre demnach sinnlos, etwa durch gewaltsame Revolution friedliche Zustände herstellen zu wollen.
Freiheit im anarchistischen Sinne unterscheidet sich von der Freiheit im Sinne der Aufklärung. Der Freiheitsbegriff der Aufklärung verbindet sich beispielsweise bei Immanuel Kant mit der Vernunft. Durch die Vernunft ist der Mensch in der Lage, das Gute zu erkennen und seine Pflicht danach auszurichten. Freiheit und Pflicht werden hier zusammengedacht und widersprechen damit dem anarchistischen Verständnis von freiem Denken. Der Grundtenor der aufklärerischen Philosophie, ebenso wie der von Ideologien (beispielweise der marxistischen) unterscheidet sich vom herrschaftslosen Freiheitsverständnis des Anarchismus. In ihm kann es keinen Zwang zur Vernunftentscheidung geben, ebenso widerstrebt dem individualistischen Denken des Anarchismus die Annahme einer universellen, von allen einsehbaren Vernunft. Dieses Verständnis ideologisiert letztendlich die Vernunft und damit auch die freie Entscheidung, denn welchen Grund könnte man angeben, vernunftlos handeln zu wollen? Die Vernunft wird ebenso wie das Gefühl im Anarchismus als individueller Maßstab gesehen; ein Konsens ist zwar sozialpraktisch zu begrüßen, kann aber nicht erzwungen werden und Andersdenkende dürfen in dieser Hinsicht nicht diskriminiert und stigmatisiert werden.
Grenzenlose individualistisch unbedingte Freiheit wird auch im philosophischen Existentialismus konzipiert und es verwundert deshalb nicht, dass es einige Existentialisten gibt, die auch im Rahmen anarchistischer Philosophie genannt werden. Wirtschaftliche Freiheit wird beispielsweise in den liberalen Konzepten der freien Marktwirtschaft propagiert. Hier geht es aber nicht um die Individuen, sondern um das (auch von staatlichen Kräften) freie Spiel von Angebot und Nachfrage gesteuert durch den Preis, wie wir bereits anhand der Diskussion libertärer Ansichten gesehen haben. Gesellschaftspolitisch spricht man von Freiheit, die in Form der Grundrechte gilt. Diese werden durch die Gesetzgebung definiert und staatlich gewährleistet bzw. auch beschränkt. Bürgerrechte und Menschenrechte sollen demnach in Demokratien gewährleisten, dass hier der Staat in geltende Freiheitsrechte wie etwa Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit etc. nicht eingreifen darf. Hierzu gehört auch die Freiheit zur politischen Mitbestimmung in freien Wahlen. Wieviel Freiheit ermöglicht wird und wieviel Einschränkung anderer Freiheitsrechte gesellschaftlich in Kauf genommen wird, hängt nicht nur von den politischen Gesellschaftssystemen ab, sondern auch von kulturellen Entwicklungen. Hier unterscheiden sich international beispielsweise eher kollektivistisch von eher individualistisch orientierten Kulturen.
Eine Frage, die sich durch die gesamte anarchistische Literatur hindurch zieht, ist die, ob der Mensch zur Freiheit überhaupt fähig ist. Horst Stowasser38 weist darauf hin, dass das Leiden unter einer wie auch immer gearteten Herrschaft noch nicht bedeute, dass man gleich zum Anarchismus gehöre. Die Freiheit „wovon“ müsse durch die Freiheit „wozu“ ergänzt werden und die gibt es nicht kostenlos: sie hat den Preis der Selbstwerdung. Und deswegen meint Freiheit im anarchistischen Sinne immer eine individuelle, erst zu konstituierende Freiheit, es ist keine Freiheit der Nachahmung und auch keine Freiheit, die in einer Gruppe, Sekte oder Vereinigung gefunden werden kann.
In diesem Sinne taugt der Anarchismus zu einem nicht: „zum blinden Nacheifern. Ideologie, Dogmatik und Fanatismus widersprechen sozusagen dem Wesensgehalt der Anarchie. Denn er besteht, salopp ausgedrückt, aus Freiheit pur.“39 Deshalb ist es auch nicht zielführend, einer anarchistischen Utopie konkrete Ausformungen zu verschreiben: „Es gibt viele Gründe, weshalb Anarchisten es immer vermieden haben, verbindliche Programme für eine zukünftige Gesellschaft aufzustellen; der Mangel an Ideen gehört mit Sicherheit nicht dazu. Eher das Gegenteil: die Überzeugung, dass eine an-archische Gesellschaft sich aus vielen unterschiedlichen Gesellschaften, Formen und sozialen Organismen zusammensetzen wird, hat sie seit jeher davon abgehalten, die Utopie von morgen bereits heute in das Korsett programmatischer Vorschriften zu zwängen… Daher braucht der Anarchismus weniger Programme und Regeln einer künftigen Gesellschaft als vielmehr ein allgemeines Modell wandelbarer Strukturen.“40
Der Anarchismus als intellektuelle Philosophie ist als Vertreter prozesshafter Netzwerktheorien wie der Systemtheorie zu sehen, die ebenfalls die individualistische Forderung nach Freiheit im Rahmen der Selbstorganisationstheorie teilt. Im Anarchismus kann aufgrund des Gedankens der unbeschränkten Freiheit aber die Gesellschaftsform der Demokratie nicht verlockend sein, denn Demokratie meint in diesem Sinne „die Herrschaft aller über alle“41 und zwar durch Mehrheitsentscheidungen. Hierbei fallen notwendigerweise die Meinungen Einzelner unter den Tisch. Um das zu vermeiden tendiert der Anarchismus in seiner politisch-gesellschaftlichen Organisation zu dezentralen kleinen Gruppen, Gemeinden und föderalen Strukturen.
Auch hier zeigt sich wieder der Anklang an die Systemtheorie: „Die anarchistische Gesellschaft ist das Zusammenspiel kleiner Einheiten. Es gibt keinen Machtapparat, kein bürokratisches Eigenleben, keine Eliten über ihnen. Stattdessen gäbe es ein System der Selbstbestimmung, Selbstorganisation und Selbstverwaltung, getragen von der Verbindung, Zusammenarbeit und Konsensfähigkeit vieler solcher kleinen Einheiten. Eine solche Verbindung nennen wir Netzwerk.“42
Anarchismus als Gesellschaftsideal beginnt aber nicht praktischerweise mit fertigen Anarchisten, sondern lässt die prozesshafte, evolutionäre Entwicklung zu: „Anarchie als Gesellschaftsstruktur besteht im Grunde nur darin, dem Zusammenleben eine andere Grammatik zu geben. Das setzt nicht voraus, dass die Menschen in ihr Anarchisten sind! Das setzt nur voraus, dass die geänderten Spielregeln allgemein akzeptiert werden. Der Grundkonsens einer libertären Gesellschaft besteht also nicht in Überzeugung, Anschauung, Lebensentwurf, persönlicher Konsequenz oder Ideologie, sondern in libertären Essentials. Und die sagen nichts weiter aus, als dass die Menschen selbst entscheiden, sich horizontal vernetzen und dezentral organisieren. Eine anarchische Gesellschaft existiert von dem Moment an, wo Menschen beginnen, ihr Leben in großem Maßstab so zu organisieren.“43 In diesem Sinne ist es also auch denkbar, dass sich anarchistische Zustände wieder ändern, wenn die Menschen diese Sozialstruktur als untauglich ersehen.
Freiheit im anarchistischen Sinne bedeutet nicht zwangsläufig generelle Gleichheit, abgesehen von der Forderung nach rechtlicher Gleichstellung. Darauf wies bereits im 19. Jahrhundert der französische Publizist Alexis de Toqueville hin, obwohl er gar nicht als Anarchist gilt: Wenn er zwischen Freiheit und Gleichheit wählen müsse, so Toqueville, so wähle er die Freiheit. Im Grundsatz geht die Frage darum: Die Menschen sind, wenn sie völlig frei sind, nicht notwendigerweise gleich und umgekehrt: Trotz völliger Gleichheit müssen die Menschen nicht notwendigerweise frei sein. Die mögliche Beeinträchtigung der Freiheit wiegt für Toqueville schwerer als ein mögliches Chaos durch Anarchie. Sie führt für ihn notwendigerweise zur Knechtschaft. Diese Gleichmacherei komme zum einen sowohl der Masse der Bürger entgegen als auch dem Staatsinteresse. Setzt man also in kommunistischer Weise das Prinzip der Gleichheit über die Freiheit, so führt das letztlich zu einem staatlichen Zentralorgan, das die Menschen nicht nur verwaltet, sondern auch beherrscht. Überträgt der Einzelne seine Selbstverantwortung auf den Staat, rutscht die Gesellschaft nach Toqueville in die Unfreiheit wegen des übergeordneten Ziels der Gleichheit. Der Bürger wird dann notfalls gegen seinen Willen ‚glücklich‘ gemacht. Durchaus in anarchistischer Tradition findet sich bei Toqueville das Ideal föderaler Bürgergesellschaften mit autonomen Gemeinden.44
Chaos und Gewalt
Das Wort „Chaos“ bezeichnet umgangssprachlich einen Zustand von Unordnung, Verwirrung und Unstrukturiertheit und Planlosigkeit. Als „Chaot“ wird in der Regel ein Mensch abwertend bezeichnet, der unordentlich, unorganisiert und planlos auftritt oder agiert. Bei sozialen Gruppen wird das Wort zur Kennzeichnung von Aufständen, Ausschreitungen und gewaltsamen Zusammenkünften verwendet. Hooligans, Skinheads, Autonome, Punks und auch Anarchisten werden oft in einen Topf geworfen, um politisch chaotische Zustände zu charakterisieren. Gerade auch weil Teile dieser Gruppierungen diese Attribute als wünschenswert sehen, kommt es in der Bevölkerung zu geringer Differenzierung in Bezug auf die politischen Inhalte und Motive. Man kann sagen, dass der Anarchismus in letzter Zeit, wenn überhaupt, nur mit den oben genannten Konnotationen anders motivierter politsicher Gruppierungen im Massenbewusstsein auftritt und dies dann häufig mit der Wahrnehmung gewaltsamer Aufstände. Dabei entsprechen diese Zuschreibungen nicht dem Kern des Anarchismus, der vielmehr dem Credo der Gewaltlosigkeit folgt.
Die im Anarchismus vertretene Gewaltlosigkeit findet kulturhistorische Entsprechungen sowohl in pazifistischen Bewegungen als auch in Arbeiterbewegungen, linkstheoretischen und sozialrevolutionären Vereinigungen, die sich insbesondere nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges gebildet und verstärkt haben. Aber ihre anthropologische Wurzel ist noch viel älter und findet sich bereits in der Entstehung vieler Religionen wie dem Christentum oder dem Buddhismus wieder und ihre Ausprägung ist nicht nur prominent etwa durch Gandhi oder Martin Luther King vertreten, sondern alle friedlichen Demonstrationen gehören ebenso dazu: Ob es um die Aufhebung von Rassentrennung, Diskriminierung, Proteste gegen Atomwaffen oder die Fridays for Future – Bewegung gegen die Zerstörung der Umwelt geht – alle eint: Sie werden meist friedlich und gewaltlos durchgeführt. Solche gewaltfreien Aktionen entsprechen dem Kern anarchistischen Denkens, das anders als in der öffentlichen Wahrnehmung vorkommend oder suggeriert, immer Gewaltfreiheit im Denken und Handeln als Grundsatz hat.
Das Argument, dass Revolution im anarchistischen Sinne nur gewaltfrei zu realisieren sei, basiert letztlich auf dem Glauben, dass man gute Zwecke nur mit guten Zielen erreichen könne, ein Credo, das sich nicht nur bei Gandhis gewaltlosem Widerstand findet, sondern auch in der belletristischen Literatur etwa bei Aldous Huxley: „Violence always produces the results of violance. The result in the victim is either resentful hostility, leading ultimately to counter-violence, or abject subjection. In the penetrator, it encourages a habit of brutality and a readiness to resort to further violance. A violent revolution is therefore unlikely to bring about any fundamental change in human relations.”45
Aber selbst wenn man die wenigen gewalttätigen Beispiele anarchistischer politischer Praxis über die Geschichte verfolgt, so sind sie zu relativieren anhand der Gewalt, die geschichtlich vorherrscht, wie der Historiker Peter Marshall betont: „In fact, anarchists have contributed far less to the sum of human violence than nationalists, monarchists, republicans, socialists, fascists and conservatives, not to mention the Mafia, organized crime, and banditry. They have never organized the indiscriminative slaughter that is war or practised genocide as governments have. They have never coolly contemplated the complete nuclear annihilation of the earth as nuclear scientists, generals and presidents have.”46
Daraus wird deutlich, dass das martialische Bild, das den Begriff der Anarchie verfolgt, völlig unsachgemäß wirkt. Warum werden Anarchisten dann in diesem Lichte dargestellt? Für Marshall liegt das daran, dass der Anarchismus den größten Feind des Staatswesens darstellt, indem er Funktion und Nutzen des Staates selbst in Frage stellt: „It is easy to see why those who control the State should fear the anarchists for they have most to lose from their success. The myth that anarchists are the most violent of all no doubt stems from the fact that they question the need for the State with its coercive apparatus.”47
Die Gleichsetzung von Anarchismus und Gewalt kann man demnach als historisch punktuell und überzeichnet bewerten: „Die Frage der Gewalt ist für den Anarchismus weder typisch noch prägend.“48 Gewaltbereite Anarchisten sind als Ausnahmen zu sehen und handeln der eigentlichen Auffassung zuwider, wonach sich Veränderung nur von selbst in den Menschen vollzieht oder eben nicht. Sie kann jedenfalls nicht von außen und schon gar nicht durch Gewalt erwirkt werden, denn das Ziel ist in den Mitteln immer mit zu bedenken. Abgesehen davon ist die Zuschreibung von Gewalt dem Anarchismus gegenüber diffamierend, denn Gewalt ist nicht, wie etwa im nationalstaatlichen Denken, ein notwendiges und strukturiertes Phänomen, denkt man beispielsweise an nationalstaatliche Interessensausübung, Polizei, Militär, Krieg und dergleichen.