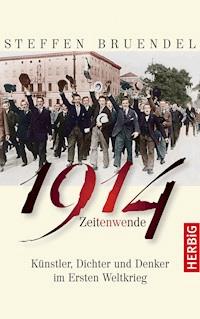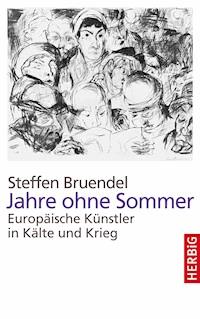
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wann und wie entsteht große Kunst? Dichter und Maler aus ganz Europa setzten sich ausführlich mit dem Ersten Weltkrieg auseinander – zum Teil bejahend, zum Teil kritisch. In der enormen Diskrepanz zwischen anfänglicher Euphorie und späterer Depression liegt bis heute die kulturgeschichtliche Faszination. Besonders das Jahr 1916 war aufgrund der klimatischen Rahmenbedingungen außergewöhnlich. Ein Vulkanausbruch wenige Jahre zuvor veränderte die Atmosphäre und führte zu einem besonders kalten Sommer. Viele Künstler nutzten dies, um sich verstärkt ihrem Schaffen und der Verarbeitung des Krieges zu widmen. So wurde das Jahr 1916 zum Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Werken. Steffen Bruendel zeigt, wie die Schlachten von den intellektuellen Frontkämpfern erfahren, gedeutet und verarbeitet wurden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook:
2016 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel
Umschlagmotiv: Radierung von Max Beckmann »Die Kriegserklärung«, akg-images, Berlin © VG Bild-Kunst, Bonn 2016
Übersichtskarten: Karthografie Theiss Heidolph, Dachau
eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7766-8243-4
Inhalt
Prolog
1. Sturm über Gallipoli
Für immer England · Der schöne Rupert Brooke · Siegfried Sassoon ist eifersüchtig · Wilfred Owen hadert mit sich · Winston Churchill macht ein Angebot · Männer, die hinaus marschieren · Besessen vom Nachruhm · Edward Thomas ist genervt · Richtig oder falsch? · Franz Marc malt Wölfe · Von Berlin nach Bagdad · Ein folgenreicher Fehler · Wege zum Ruhm · Die Ägyptische Mücke · Sterben auf Befehl · Siege und Niederlagen
2. Eisenregen auf Verdun
Erich von Falkenhayn will es wissen · Die Festung · Edward Thomas hat die Wahl · Wilfred Owen meldet sich · Auf nach Frankreich · Blaukreuz und Blauer Reiter · Das jüdische Bekenntnis · Schöne neue Welt · Franz Marc malt Kandinsky · Die Kraft der Elemente · Ein Amerikaner in Paris · Alan Seeger lebt auf · Marsden Hartley malt seinen Offizier · Raymond Poincaré bleibt hart · Henri Barbusse ist Feuer und Flamme · Eisenregen · Das Feuer breitet sich aus · Die Hölle ist das Wasser · Das Ende des Feindes · Umerziehung vor Verdun · Arnold Zweig zählt Juden · Tote Männer
3. Stahlgewitter an der Somme
Douglas Haig stürmt los · Am Fluss · Siegfried Sassoon liebt und leidet · Die Ziege des Regiments · Auf dem Feld der Ehre · Ernst Jünger in der Fastnacht der Hölle · Es regnet · Edward Thomas ist am Ziel · Lichter aus · Verdun fehlt uns · Alan Seeger hat ein Rendezvous · Siegfried Sassoon verabschiedet sich · Wilfred Owen ist beeindruckt · Die Erbärmlichkeit des Krieges · Paul Nash malt gefrorene Wüsten · Hunger · Wilhelm Lehmbruck stürzt · Der weinende Engel · Erich Ludendorff sieht schwarz
4. Auf stürmischer See
Herbert Kitchener geht unter · Die Nordsee · Jeffery Day kämpft und dichtet · Joachim Ringelnatz langweilt sich · Seeschlacht ist not! · Reinhard Scheer wagt es · Gorch Fock wird nicht seekrank · Die Schranken fallen · Woodrow Wilsons Kriegsbotschaft · Zerstört diesen wahnsinnigen Unmenschen! · Der Kaiserliche Aal · Ringelnattern in Cuxhaven · Friedensglocken
Epilog
Personen- und Sachregister
Prolog
1916 war ein kaltes und verregnetes Jahr. Jedenfalls war der Sommer deutlich kälter und nasser als gewöhnlich. Bisweilen gilt der eisige Winter zur Jahreswende 1916/17 sogar als »der kälteste seit Menschengedenken«.[1] Die deutliche Temperaturabkühlung ist auf einen Vulkanausbruch in Alaska vier Jahre zuvor zurückzuführen, der als Novarupta-Katmai-Eruption bekannt ist und als die größte Vulkanexplosion des 20. Jahrhunderts gilt.[2] Anfang Juni 1912, zwei Monate nach dem Untergang der Titanic, war der nordamerikanische Vulkan Novarupta ausgebrochen, was ab 1913 zu einer Trübung der Atmosphäre führte, die sich in den USA und in Mitteleuropa auf das Wetter auswirkte.[3]
Die klimatischen Folgen dieser Eruption waren 1916 am stärksten zu spüren. Auch wenn sie nicht ganz so verheerend waren, wie man im Rückblick vermuten könnte, erschwerte die Abkühlung auf der Nordhalbkugel die allgemeine Versorgungslage erheblich und stellte eine zusätzliche Belastung für die Krieg führenden Nationen dar. Heute weiß man, dass extreme Kälte für die Menschen weitaus gefährlicher ist als große Hitze.[4] Als sommerloses Jahr steht 1916 in einem scharfen Kontrast zum Jahr des Kriegsausbruchs, denn 1914 zeichnete sich durch einen langen, heißen Sommer aus. Das Jahr 1916 war allerdings nicht das einzige Jahr ohne Sommer, und der Winter 1916/17 war in der Tat nicht der kälteste ›seit Menschengedenken‹.
Ein Jahrhundert zuvor erlebten Europa und Nordamerika schon einmal einen außergewöhnlichen Kälteeinbruch. Auch damals war ein Vulkanausbruch die Ursache. Die Eruption des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815 war eine der stärksten seit Tausenden von Jahren. Sie machte 1816 zum kältesten Jahr des 19. Jahrhunderts und führte zu einer Klimakatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Die emporgeschleuderte Asche verminderte die Sonneneinstrahlung auf der Erde so dramatisch, dass sich die Temperatur in Mitteleuropa und den USA für mehrere Jahre erheblich abkühlte. Heute sind die globalen Zusammenhänge des Weltklimas erforscht, aber vor 200 Jahren waren sie unbekannt, sodass sie erst Jahrzehnte später als solche identifiziert wurden.[5]
1816 trafen die unwirtlichen Wetterbedingungen die europäischen Nationen besonders hart, weil sie noch an den Nachwirkungen der napoleonischen Kriege (1804–1912) und an den Folgen des europäischen Befreiungskampfes gegen die Franzosen (1813–1915) litten. Die »Schrecken des Krieges«, die Europa wenige Jahre zuvor heimgesucht hatten, überlieferte der spanische Maler Francisco de Goya in seinem gleichnamigen, zwischen 1810 und 1820 geschaffenen Zyklus über die französische Invasion Spaniens (1807–1914). Er stellte geschundene Körper, zerstückelte Leichen, Berge von Toten und Halbtoten schonungslos dar, zeigte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gestalt von Zerstörungen, Vergewaltigungen, Erschießungen und Massakern. Wer dieses irrationale Grauen überlebt hatte, den suchte 1816 die Klimakatastrophe heim: Überschwemmungen, eisige Kälte und Schneefall im Sommer zerstörten die Ernten und führten zu Hungersnöten und Verelendung.[6]
Hundert Jahre später, 1916, waren die Rahmenbedingungen des Katastrophenszenarios ähnlich. Während jedoch 1816 der Krieg schon vorbei war, als die Klimakatastrophe Europa ins Elend stürzte, tobte 1916 noch ein Krieg, der als industrialisierter Krieg die Schrecken der napoleonischen Kriege weit übertreffen sollte: der Erste Weltkrieg, der 1914 begann und bis 1918 andauerte.[7] Gerade die Schlachten des Jahres 1916 verwüsteten ganze Landstriche und forderten Millionen Tote. Hunderttausende starben bis Ende Januar 1916 auf der türkischen Halbinsel Gallipoli und noch viele mehr an der Westfront: nahe der französischen Stadt Verdun (Februar bis Dezember 1916) und auf den Schlachtfeldern an der Somme (Juli bis November 1916). Außerdem fand von Mai bis Juni 1916 die verlustreichste Seeschlacht dieses Krieges statt: in der Nordsee, am Skagerrak.[8]
Wiederum fast einhundert Jahre später beeinträchtigte erneut ein Vulkanausbruch das Leben auf der Nordhalbkugel. Die Eruption des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull im Frühjahr 2010 führte zu einer bis dahin beispiellosen Behinderung des gesamten Luftverkehrs in Europa. Wegen der ausgespienen Vulkanasche musste der Flugverkehr in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas für mehrere Tage eingestellt und über Wochen stark eingeschränkt werden. Glücklicherweise reichten weder die vulkanischen Gase noch die Höhe der Eruptionssäule aus, um das Klima langfristig und über Ländergrenzen hinweg zu beeinträchtigen, da Asche und andere Partikel nur in begrenzten Mengen in die Stratosphäre gelangten. Gleichwohl verursachte der Vulkanausbruch die größte Störung des Luftverkehrs seit den Terroranschlägen in New York vom 11. September 2001.[9] Diese wiederum zogen den globalen, von den USA geführten ›Krieg gegen den Terror‹ nach sich, der bis heute andauert. Er brachte bisher unermessliches Leid für Zivilisten und Soldaten, führte zur Gründung neuer Terrororganisationen im Nahen und Mittleren Osten und löste Migrationsströme ungeahnten Ausmaßes aus, die gerade Europa vor enorme Herausforderungen stellen.
Ohne den Zusammenhang zwischen dem Vulkanausbruch und dem ›Krieg gegen den Terror‹ überstrapazieren zu wollen, ist es doch bemerkenswert, dass in Abständen von etwa einhundert Jahren – 1816, 1916 und 2010 – große Naturkatastrophen bzw. deren Folgen mit beispiellosen militärischen Auseinandersetzungen einhergingen. In allen drei Fällen wurden die dramatischen Folgen zu Themen der Literatur und der bildenden Kunst.[10]Somit lässt sich konstatieren, dass ein durch Kriege und Naturkatastrophen potenzierter Schrecken kulturell besonders intensiv verarbeitet wird.
Das Kriegs- und Schreckensjahr 1916 begünstigte die Entstehung literarischer und künstlerischer Werke ebenso wie das Jahr ohne Sommer hundert Jahre zuvor. Während aber 1816 der Dichter Lord Byron, sein literarisch ambitionierter Reisebegleiter John William Polidori und die Schriftstellerin Mary Godwin (später Shelley) den schrecklich-kalten Sommer jenes Jahres in den Schweizer Bergen verbrachten und dort in aller Abgeschiedenheit Weltliteratur produzierten – Byrons Gedicht »Finsternis«, Polidoris Kurzgeschichte »Der Vampyr« und Mary Shelleys Roman »Frankenstein«[11] –, befanden sich die Vertreter der literarischen und künstlerischen Avantgarden 1916 in den Schützengräben der europäischen Kriegsschauplätze, also mitten im Geschehen. Sie schilderten ihre Erlebnisse in Tagebüchern und Briefen, konnten sie künstlerisch aber nur in Gefechtspausen oder nach ihrer Entlassung aus dem Heeresdienst bzw. nach Kriegsende verarbeiten.
Die Namen bedeutender Künstler und Dichter sind mit den Schlachten des Jahres 1916 verbunden. Der britische Dichter Rupert Brooke verstarb auf dem Weg in den Kampf um die türkische Halbinsel Gallipoli. Vor Verdun kämpften der deutsche Maler Franz Marc, der dort im März 1916 fiel, der deutsche Schriftsteller Arnold Zweig und der französische Romancier Henri Barbusse, der sein literarisches Kriegstagebuch 1916 im Feldlazarett vollendete. Die Schlacht an der Somme erlebten der britische Dichter Siegfried Sassoon, der nachmalige deutsche Schriftsteller Ernst Jünger sowie der amerikanische Dichter Alan Seeger. Schließlich dienten die deutschen Schriftsteller Johann Wilhelm Kinau alias Gorch Fock sowie Hans Bötticher alias Joachim Ringelnatz bei der Kaiserlichen Marine, wobei Ersterer 1916 am Skagerrak den Tod fand.
Ihre Briefe und persönlichen Auszeichnungen zeigen uns heute, was sie fühlten und dachten, was sie antrieb oder resignieren ließ. Ihre im Krieg oder kurz danach geschaffenen Werke gehören mittlerweile zum europäischen Bildungskanon. Berühmt sind die Gedichte Siegfried Sassoons und Wilfred Owens sowie die autobiografisch geprägten Schriften von Henri Barbusse (»Das Feuer«, 1916) und Ernst Jünger (»In Stahlgewittern«, 1920). Nicht wenige Kriegsromane zählen zur Weltliteratur, wie beispielsweise Erich Maria Remarques 1929 erschienener Roman »Im Westen nichts Neues«. Andere sind heute vergessen wie Arnold Zweigs erst 1935 im Exil publizierter Roman »Erziehung vor Verdun«. Auch die bildende Kunst reagierte auf den Krieg. Exemplarisch seien die Maler Paul Nash und Franz Marc sowie der Bildhauer Wilhelm Lehmbruck genannt, deren Feldpostbriefe und Werke anschaulich vermitteln, was sie erlebten. Gemeinsam ist vielen Kriegsgedichten und -romanen sowie zahlreichen Gemälden und Skulpturen, dass sie den Krieg als technisierte militärische Auseinandersetzung erfassen, welche den einzelnen Soldaten zu bloßem Menschenmaterial herabstufte.
Viele der Künstler und Dichter, die 1916 an den Kriegsschauplätzen kämpften, hatten sich 1914 freiwillig gemeldet oder waren ihrer Einberufung mit Begeisterung gefolgt. Dies ist ein besonderes Phänomen des Ersten Weltkrieges, der schon den Zeitgenossen als Kulturkrieg bzw. als »Krieg der Geister«[12] – also als Auseinandersetzung der intellektuellen Eliten – erschien und gerade die künstlerischen Avantgarden mobilisierte. Oft lag Patriotismus jener Mobilisierungseuphorie zugrunde. Besonders ausgeprägt war dies bei Henri Barbusse. Zwar projizierte er seine Kriegsbegeisterung auf vorgeblich höhere Werte, folgte aber gerade darin der französischen Propaganda, ohne dies zu reflektieren.
Patriotismus allein erklärt allerdings nicht alles, denn Ernst Jünger hatte beispielsweise noch kurz vor Kriegsbeginn bei der französischen Fremdenlegion angeheuert, und Alan Seeger diente dort im Krieg als amerikanischer Staatsbürger. Abenteuerlust ist deshalb ein mindestens ebenso wichtiger Motivationsfaktor für den Kriegseinsatz. Brooke, Jünger, Seeger – alle sehnten sich nach einem Erlebnis, das sie von den Zwängen des Alltags befreien möge – und von persönlichen Krisen erlösen. Unsicherheiten etwa hinsichtlich der eigenen (homo)sexuellen Orientierung wie bei Brooke oder Sassoon begünstigten eine freiwillige Meldung ebenso wie Frustrationen bezüglich der künstlerischen Entwicklung wie bei Edward Thomas. Schließlich ist Eitelkeit zu nennen, denn ein Heldentod in jungen Jahren versprach Unsterblichkeit auch jenseits der Qualität des dichterischen Schaffens. Rupert Brooke und Alan Seeger hatten darauf spekuliert und werden heute eben auch deshalb erinnert, weil sie jung fielen.
Wer überlebte, fragte zunehmend nach dem Sinn des Krieges. Die geistige und künstlerische Auseinandersetzung der europäischen Dichter und Künstler mit dem Krieg, ob affirmativ oder kritisch, ist auch nach über hundert Jahren noch spannend. Hierin liegt die bis heute anhaltende kulturgeschichtliche Faszination des Ersten Weltkrieges. Obwohl sie sich aufeinander bezogen und teilweise persönlich kannten, wurde erstaunlich selten eine transnational vergleichende Perspektive auf die Kulturschaffenden Europa geworfen.[13]Erst im Gedenkjahr 2014 widmeten sich große Ausstellungen und einige Monografien der Kunst im Krieg in vergleichender Perspektive.[14]
Von wenigen Ausnahmen abgesehen[15], sind Gedichtanthologien bis heute meist den Nationalliteraturen verhaftet.[16] Das ist insofern verständlich, weil der Erste Weltkrieg mehr als andere Kriege durch die Dichter bestimmt und gedeutet wurde, die in ihm kämpften.[17] Da er in Großbritannien bis heute weitaus stärker erinnert wird als in anderen Ländern, lässt sich aus britischer Perspektive mit einigem Recht konstatieren: »Wir kennen den Krieg durch ihre Gedichte.«[18] Die Verse von Edward Thomas, Charles Sorley, Siegfried Sassoon und Wilfred Owen bestimmen noch heute die Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs und insbesondere der Westfront. Ihr Werk spiegelt die Emotionen der Generationen, für die das Jahr 1916 eine Zäsur darstellte, weil es den Beginn einer tiefgreifenden Desillusionierung markierte.[19]
1816 und 1916 waren zwei Jahre ohne Sommer. Gigantische Katastrophen gaben jeweils den Anstoß für innovative künstlerische und literarische Entwicklungen. Die klima- und kriegsbedingt schrecklichen Sommer jähren sich 2016 zum 100. bzw. 200. Mal. Die kunst- und literaturgeschichtlichen Aspekte des sommerlosen Jahres 1916 machen es lohnenswert, einen Blick auf diese Zusammenhänge zu werfen. Insofern ist hier keine Kriegs- oder Schlachtengeschichte beabsichtigt, sondern vielmehr das Nachspüren der Kriegspfade, auf die sich die erwähnten Künstler und Dichter im Ersten Weltkrieg begaben. Im Folgenden werden dreizehn europäische Vertreter des literarischen und künstlerischen Feldes näher vorgestellt, für die das Jahr 1916 eine Zäsur markierte, persönlich und in Bezug auf ihr künstlerisches Schaffen. Hinzu kommen zwei Amerikaner, die allerdings ganz in ihrem jeweiligen Gastland aufgingen. Der nasskalte Sommer 1916 sollte das Leben dieser Künstler prägen, denn »kein Artilleriefeuer [vermochte] die Widerstandskraft des Menschen so gründlich zu brechen […] wie Nässe und Kälte«.[20]
Eingebettet in ein Panorama der Zeit vor 100 Jahren wird nachgezeichnet, wie die großen Weltkriegsschlachten von den intellektuellen Frontkämpfern erfahren, gedeutet und ästhetisch verarbeitet wurden. Ausgehend von den Biografien der fünfzehn ausgewählten Kulturschaffenden sowie den von ihnen aufbereiteten eigenen Kriegserlebnissen, werden Verlauf, Ausgang und Wirkung der wichtigen Schlachten des Jahres 1916 entfaltet. Im Fokus stehen aber die Kulturschaffenden selbst, ihre Werke und ihre Selbstwahrnehmung, ihre Ideenwelten, Eitelkeiten und Begierden. Es geht um ihre Perspektiven, durch die wir das klimatisch und militärisch extreme Kriegsjahr 1916, das ›Jahr ohne Sommer‹, wahrnehmen.
Anmerkungen
[1] Egremont, Max: Siegfried Sassoon. A Biography. London 2013, S. 126 (»the coldest in living memory«). Vgl. auch Clements, Kate: Podcast 25: The Winter 1916-17, in: http://www.iwm.org.uk/history/podcasts/voices-of-the-first-world-war/podcast-25-winter-1916-17 (25.8.2015).
[2] Hildreth, Wes/Fierstein, Judy: The Novarupta-Katmai Eruption of 1912 – Largest Eruption of the Twentieth Century: Centennial Perspectives, in: USGS Professional Paper 1791, Online: http://pubs.usgs.gov/pp/1791/pp1791.pdf (27.7.2015).
[3] Bissolli, P./Göring, L./Lefebvre, Ch.: Extreme Wetter- und Witterungsereignisse im 20. Jahrhundert, in: Deutscher Wetter-Dienst: Klimastatusbericht 2001, S. 20–31; Drummond, A. J.: Cold Winters at Kew Observatory, 1783–1942, in: Quarterly Journal of Royal Meteorological Society, Nr. 69 (1943), S. 17–32; Wagner, A. James: The Record-Breaking Winter of 1976-77, in: Weatherwise, 30 (1977) Nr. 2, S. 65–69; Fauvell, D./Simpson, I.: The History of British Winters, in: http://www.netweather.tv/index.cgi?action=winter-history;sess= (25.8.2015); Winter 1916/17, in: http://www.wetterzentrale.de/cgi-bin/wetterchronik/home.pl?read=944&jump1=topic&jump2=17 (9.10.2015).
[4] Gasparrini, Antonio u. a.: Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study, in: The Lancet, Bd. 386, 25.7.2015, S. 369–375, online: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2814%2962114-0.pdf (30.7.2015); Dear, Keith/Wang, Zhan: Climate and health: mortality attributable to heat and cold, in: ebd., S. 320–322, online: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2960897-2.pdf (30.7.2015).
[5] Behringer, Wolfgang: Tambora und das Jahr ohne Sommer. Wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte. München 2015.
[6] D’Arcy Wood, Gillen: Vulkanwinter 1816, die Welt im Schatten des Tambora. Darmstadt 2015; Klingaman, William; Klingaman, Nicholas: The Year Without Summer: 1816 and the Volcano that Darkened the World and Changed History. New York 2013; Gerste, Ronald D.: Alle redeten vom Wetter, in: Die Zeit, 5.4.2015, online: http://www.zeit.de/2015/12/vulkanausbruch-tambora-indonesien-klimawandel/komplettansicht (27.7.2015).
[7] Der Tod als Maschinist. Der industrialisierte Krieg 1914–1918 [Ausstellungskatalog Museum Industriekultur Osnabrück], Bramsche 1998.
[8] Vgl. die entsprechenden Einträge in der Enzyklopädie Erster Weltkrieg, hg. von Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich und Irina Renz. Paderborn u. a. 22012.
[9] Gudmundsson, M. T./Pedersen, R./Vogfjörd, K./Thorbjarnardóttir, B./Jakobsdóttir, S./Roberts, M. J.: 2010. Eruptions of Eyjafjallajökull Volcano, Iceland, in: Eos – Transactions of the American Geophysical Union (AGU), Bd. 91, S. 190–191; Global Volcanism Program, 2011. Report on Eyjafjallajokull (Iceland), in: Wunderman, R (Hg.): Bulletin of the Global Volcanism Network, 36:4. Smithsonian Institution. http://dx.doi.org/10.5479/si.GVP.BGVN201104-372020 (10.10.2015).
[10] Vgl. u. a. Frayling, Christopher (Hrsg.): Vampyres. Lord Byron to Count Dracula. London 1992; Les désastres de la guerre 1800–2014 [Ausstellungskatalog Musée du Louvre-Lens]. Paris 2014; Schubert, Dietrich: Künstler im Trommelfeuer des Krieges 1914-18. Heidelberg 2013; Cohen, Allen/Matson, Clive (Hg.): An Eye for an Eye Makes the Whole World Blind: Poets on 9/11. Oakland/CA 2002; Witte, George: Deniability. Alexandria/VA 2009.
[11] Byron, Lord: Sämtliche Werke, Bd. 2: Don Juan, Gedichte. Berlin 1996; Polidori, John: Der Vampyr: Eine Erzählung (Kabinett der Phantasten). Hannover 2015; Shelley, Mary: Frankenstein oder Der moderne Prometheus: Die Urfassung. München 2013.
[12] Vgl. Hermann Kellermann: Der Krieg der Geister. Eine Auslese deutscher und ausländischer Stimmen zum Weltkriege. Dresden 1915.
[13] Vgl. bspw. Eksteins, Modris: Tanz über den Gräben. Die Geburt der Moderne und der Erste Weltkrieg. Reinbek 1990; Fischer, Jens Malte: Anthologie zur Spiegelung des Ersten Weltkriegs in Lyrik, Prosa und Autobiographie, in: Die letzten Tage der Menschheit. Bilder des Ersten Weltkriegs [Ausstellungskatalog Deutsches Historisches Museum, Berlin]. Berlin 1994, S. 57–84; Papies, Hans Jürgen: »Ich habe diesen Krieg längst in mir gehabt«. Selbstzeugnisse bildender Künstler, in: ebd., 85–106; Cork, Richard: Das Elend des Krieges. Die Kunst der Avantgarde und der Erste Weltkrieg, in: ebd., S. 301–396.
[14] Vgl. bspw. 1914. Die Avantgarden im Kampf [Ausstellungskatalog Bundeskunsthalle, Bonn], Köln 2013; Das Menschenschlachthaus. Der Erste Weltkrieg in der französischen und deutschen Kunst [Ausstellungskatalog von-der-Heydt-Museum, Wuppertal], Bönen 2014; Bruendel, Steffen: Zeitenwende 1914. Künstler, Dichter und Denker im Ersten Weltkrieg. München 2014; Piper, Ernst: Nacht über Europa. Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs. Berlin 2014; Buelens, Geert: Europas Dichter und der Erste Weltkrieg. Berlin 2014; Lauinger, Horst: Über den Feldern. Der Erste Weltkrieg in großen Erzählungen der Weltliteratur. Zürich 2014.
[15] Vgl. Ohne Haß und Fahne/No Hatred and no Flag/Sans haine et sans drapeau. Hamburg 1959; Gedichte europäischer Soldaten. München u. a. 1939; Rubiner, Ludwig (Hg.): Kameraden der Menschheit. Dichtungen zur Weltrevolution. Eine Sammlung. Potsdam 1919.
[16] Vgl. bspw. Anz, Thomas/Vogl (Hg.): Die Dichter und der Krieg. Deutsche Lyrik 1914–1918. München u. a. 1882; Steinbach, Matthias: Mobilmachung 1914. Ein literarisches Echolot. Stuttgart 2014; Kendall, Tim (Hg.): Poetry of the First World War. An Anthology. Oxford 2014.
[17] Delany, Paul: Fatal Glamour. The Life of Rupert Brooke. Montreal u. a. 2015, S. 4 (Übers. d. Verf.).
[18] Egremont, Max: Some Desperate Glory. The First World War the Poets knew. London 2014, S. xi (Übers. d. Verf.).
[19] Barlow, Adrian: The Great War in British Literature. Cambridge 2000, S. 30.
[20] Ernst Jünger, zit. n. Eksteins, Tanz, S. 226f.
1. Sturm über Gallipoli
Für immer England
9. Januar 1916. Es regnete ununterbrochen. Wasser flutete die englischen Schützengräben auf der türkischen Halbinsel, die nach ihrer größten Stadt benannt ist: der Hafenstadt Gelibolu, von deren griechischer Benennung Kallipolis sich ihr im Ersten Weltkrieg bekannt gewordener Name Gallipoli ableitet. Mit rund 80 Kilometern Länge und teilweise bis zu 20 Kilometern Breite liegt diese Landzunge im europäischen Teil der Türkei und verläuft parallel zur Nordwestküste Kleinasiens. Gut 200 Kilometer von der osmanischen Hauptstadt Konstantinopel bzw. Istanbul entfernt, gehört Gallipoli heute zur nordwestanatolischen Provinz Tschanakkale (Çanakkale).[21]
Das Klima in dieser Region ist gemäßigt, und die Temperaturen schwanken etwa zwischen 30 Grad im Sommer und 5 Grad im Winter. Auf Gallipoli aber kann es im Winter extrem kalt werden, auch regnet es viel, friert und schneit. Die Flora der Landzunge ist von Buschwerk und Olivenbäumen geprägt sowie von Pinien, Zypressen und Platanen, die vor allem an den Hängen der auf bis zu 300 Meter ansteigenden Höhenkämme sowie auf den Hügeln wachsen. Die Halbinsel trennt die südliche, ›Dardanellen‹ oder ›Straße von Gallipoli‹ genannte Meerenge von der nördlich gelegenen Bucht von Saros im Thrakischen Meer. Durch die Dardanellen gelangen Schiffe von der Ägäis in das Marmarameer und von da aus durch eine weitere Meerenge, den Bosporus, in das Schwarze Meer. Da die gut 65 Kilometer langen Dardanellen streckenweise nur sechs Kilometer breit sind, kontrolliert die Durchfahrt zum Schwarzen Meer, wer im Besitz der Halbinsel Gallipoli ist.[22]
Wegen dieser strategischen Bedeutung wurden die Dardanellen nach dem Kriegseintritt der Türkei auf Seiten der Mittelmächte im November 1914 zum Ziel der Alliierten. Nach einer fehlgeschlagenen Marineoperation in den Dardanellen im Frühjahr 1915 entschieden die Briten auf Betreiben Winston Churchills, als »Erster Lord der Admiralität« eine Art Marineminister, zunächst Gallipoli zu besetzen, um die türkischen Verteidigungsstellungen zu zerstören, sodass die Kriegsschiffe bis Konstantinopel würden vorstoßen können.[23]
Der Hauptschlag des Landungsunternehmens war gegen Kap Helles am südlichen Ende gerichtet. Weiter nördlich sollten Truppen versuchen, die Landzunge zu überqueren, um so eine türkische Verstärkung Richtung Kap zu verhindern. Die alliierten Landungstruppen bestanden vor allem aus dem 1915 aus Kriegsfreiwilligen gebildeten australischen und neuseeländischen Armeekorps bzw. Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) unter britischem Oberbefehl, aber auch aus britischen Verbänden sowie dem französischen Orient-Expeditionskorps. Der Versuch, die Halbinsel zu erobern und dann zu Lande und zu Wasser auf die türkische Hauptstadt Istanbul vorzustoßen, wurde zu einem der größten Desaster der neueren Militärgeschichte.[24]
Sowohl die strategischen Voraussetzungen der Landung als auch ihre Erfolgsaussichten waren zweifelhaft, und ihre Durchführung war schlecht vorbereitet worden. So hatten die Briten nicht berücksichtigt, dass die geografischen Gegebenheiten, d.h. die teilweise hoch ansteigenden, zerklüfteten Felsen auf der Halbinsel für die Verteidigung ideal waren, den Angreifer aber vor große Herausforderungen stellten. Zudem wurden statt der ursprünglich eingeplanten 150 000 Soldaten nur rund 70 000 eingesetzt, sodass die Truppen mehrfach aufgestockt werden mussten. Schließlich erwies sich auch die Annahme, die Türken würden sich nicht übermäßig stark wehren, als Illusion. Sie wehrten sich sogar verbissen. Unter dem Befehl ihres Kommandeurs und späteren Schöpfers der modernen Türkei, Mustafa Kemal Pascha, der ab 1934 den Namenszusatz Atatürk, »Vater der Türken«, führen sollte, konnten die Verteidiger mit deutscher Hilfe alle Angriffe abwehren. Die Alliierten verloren insgesamt 180 000 Mann. Wenngleich die Türken doppelt so viele Verluste zu beklagen hatten, gelang ihnen nicht nur die erfolgreiche Verteidigung, sie schafften es auch, die Invasoren Anfang 1916 endgültig zurückzuschlagen.[25]
Die besonderen klimatischen Bedingungen des Jahres 1916 begünstigten die Verteidigung Gallipolis ebenfalls. Der Dezember ist zwar im Durchschnitt der niederschlagsreichste Monat des Winters, aber auch Anfang 1916 regnete es ungewöhnlich stark. Die Wassermassen erschwerten den am 7. Januar 1916 beschlossenen und zwei Tage später abgeschlossenen vollständigen Rückzug der alliierten Landungstruppen erheblich, denn die Türken und ihre deutschen Verbündeten hielten die Höhenkämme, sodass sich das Regenwasser von den Hängen in die alliierten Stellungen ergoss, ihre Ausrüstungsgegenstände fort-, aber dafür Leichen gefallener Osmanen anspülte. Plötzlich über Nacht einsetzender Frost ließ den Schlamm zu einer festen Masse erstarren und führte dazu, dass durchnässte Außenposten in ihren Schutzlöchern regelrecht erfroren. Gerade die ANZAC-Truppen, die Kälte nicht gewohnt waren, litten unter diesen Bedingungen, aber auch die Briten waren mangels Ortskenntnissen und ohne Winterausrüstung nicht auf das vorbereitet, was sie erwartete: heftige Regenschauer sowie durch Frost herbeigeführte Erfrierungen im Winter 1915/16, nachdem ihnen im heißen Sommer 1915 Millionen von Fliegen und Mücken sowie Durchfallerkrankungen das Leben schwer gemacht hatten.[26]
Die gescheiterte Landungsoperation stellte nicht nur eine ziemliche Schmach für die Briten dar, sondern hatte auch politische Folgen: Winston Churchill trat als Marineminister zurück, und die Regierung von Premierminister Herbert Asquith stürzte. Die Schlacht um Gallipoli war die größte, an der Australien und Neuseeland mitwirkten, und zugleich eine der blutigsten und brutalsten im Ersten Weltkrieg. Aufgrund der hohen Opferzahlen ist sie bis heute fest im kollektiven Gedächtnis beider ehemaligen britischen ›Dominions‹ verankert. Der Tourismus in jener türkischen Region profitiert bis heute davon, denn nicht nur in der Türkei ist die Schlacht von Gallipoli ein Mythos. Alljährlich besuchen Australier und Neuseeländer die Soldatengräber, die noch heute an die Kämpfe erinnern.[27]
Auch in der britischen Erinnerungskultur spielt Gallipoli eine besondere Rolle. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Name eines berühmten Kriegsdichters mit der türkischen Halbinsel verbunden ist. Mit 28 Jahren war er im April 1915 auf dem Weg zur Front verstorben und wurde auf der griechischen Insel Skyros begraben. Er hieß Rupert Brooke. Bis heute werden die Anfangszeilen seines im selben Jahr veröffentlichten Gedichts »Der Soldat« viel zitiert. Seit Kriegsende zieren sie auch seinen Grabstein: »Sollte ich sterben, denkt nur dies von mir: / Daß da ein Winkel ist auf fremdem Feld, / Der England ist für immer«.[28]
Der schöne Rupert Brooke
Rupert Chawner Brooke wurde 1887 in Rugby, einer Stadt in der mittelenglischen Grafschaft Warwickshire geboren. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt von einem regionalen Handelszentrum zu einem Industriezentrum der mittelenglischen ›Midlands‹, deren größte Stadt Birmingham ist. Neben der 1567 gegründeten Rugby School, einer Privatschule, nach der die dort 1823 erfundene Sportart benannt worden sein soll, zählt auch die im 13. Jahrhundert gegründete und im 19. Jahrhundert ausgebaute St. Andrew’s Church zu den lokalen Sehenswürdigkeiten.[29]
Rupert Brooke wuchs in einer menschlich schwierigen, aber wohlhabenden Akademikerfamilie auf. Seine Mutter war herrisch und oft missgelaunt. Sie hatte sich ein Mädchen gewünscht und verübelte dem jungen Rupert, dass er ein Junge war. Willensstark und dominant, suchte sie das Leben anderer – auch das ihrer Kinder – zu beeinflussen. Selbst ihr Ehemann und Vater ihrer drei Söhne stand unter ihrer Fuchtel. Er unterrichtete an der privaten Rugby School, an der auch Rupert 1901 eingeschult wurde. Als Angehöriger der oberen Mittelschicht war der Weg des talentierten, gut aussehenden und ambitionierten jungen Mannes geradezu vorgezeichnet. Er führte ihn 1906 an die Eliteuniversität Cambridge, wo er Altphilologie studierte, sich aber mehr für englische Literatur interessierte und mit Gedichten einige Preise gewann.[30]
Mit dem Tode König Eduards VII. im Frühjahr 1910 neigte sich die »Edwardische Ära« auch literarisch dem Ende zu. Die geistige Welt Englands befand sich im Umbruch. Unter dem Schlagwort der »Georgianischen Dichtung« (Georgian Poetry) – seit Mai 1910 regierte Georg V. – sammelten sich junge Lyriker, die nur die unmittelbare, aller rhetorischen Floskeln entledigte Erfahrung ausdrücken, mithin Kunst und Leben verbinden wollten. Die literaturinteressierte Öffentlichkeit stand dieser neuen Richtung, deren Galionsfiguren Rupert Brooke und der fast zehn Jahre ältere John Masefield waren, skeptisch gegenüber. Folglich wurde Brookes 1911 erschienener Gedichtband »Poems« als unanständig oder gar vulgär kritisiert. 1912 erschien unter dem Titel »Georgianische Dichtung« eine erste Anthologie mit Gedichten von Edmund Blunden, Rupert Brooke, Robert Graves, D. H. Lawrence, William Henry Davies, Walter de la Mare und Siegfried Sassoon.[31]
Rupert Brooke gehörte der Bloomsbury-Gruppe an, einer von Absolventen der Universität Cambridge und Gleichgesinnten gegründeten Gruppe von Künstlern, Dichtern und Denkern, die nicht nur intellektuelle Interessen teilten, sondern – da überwiegend bisexuell orientiert – auch ihre erotischen Leidenschaften. Zu Brookes Freunden aus diesem Kreis zählten der sieben Jahre ältere Schriftsteller Lytton Strachey sowie dessen Bruder James, der 1885 geborene schottische Maler Duncan Grant, der zeitweise eine Liebesbeziehung mit dem fast gleichaltrigen Ökonomen John Maynard Keynes unterhielt, sowie die fünf Jahre ältere Literaturkritikerin und spätere Schriftstellerin Virginia Woolf, die Männern wie Frauen zugetan war.[32]
Brooke bestach allein schon durch sein Äußeres: Hochgewachsen, schlank und blond, entsprach er dem damaligen Schönheitsideal. Der bekannte und vormals mit Oscar Wilde befreundete irische Dichter William Butler Yeats bezeichnete ihn als den »bestaussehenden Mann in England«. Charakteristisch für Brooke war eine Inkongruenz zwischen geschmeidigen, homoerotischen Freundschaften und turbulenten heterosexuellen Affären. Es gelang ihm nicht, beides in Einklang zu bringen. Daher kann seine Meldung zum Kriegsdienst im Jahre 1914 auch als Flucht vor sich selbst und einer Gesellschaft gedeutet werden, die Abweichungen von traditionellen Männlichkeitsbildern mit Verachtung begegnete und sie nur in kleinen, privaten Zirkeln duldete.[33]
Obwohl die Frage nach Brookes sexueller Orientierung naheliegt, wurde sie lange ausgeklammert. Als Symbol der englischen ›Jugend in Waffen‹ sollte nichts sein Andenken beschädigen. Homosexualität war in Großbritannien bis 1967 strafbar und noch länger gesellschaftlich geächtet. Niemand Geringerer als Winston Churchill, ein Bewunderer Brookes, hatte die Leser der Times 1915 pathetisch über den Tod des jungen Dichters informiert, der »fröhlich, furchtlos und vielseitig« gewesen sei. Churchill pries das »Vornehme unserer Jugend in Waffen« und erklärte, Brooke habe alles verkörpert, was die tapfere britische Jugend auszeichne.[34]Als Absolvent einer traditionsreichen Privatschule und einer der beiden Eliteuniversitäten eignete sich der junge Dichter besonders gut zur Heroisierung, weil die britische Gesellschaft sich in Brooke ihrer selbst versichern konnte. Die soziale Ordnung der starren britischen Klassengesellschaft wurde bestärkt durch das Image eines Privatschuljungen, der vom Spielfeld zum Schlachtfeld zog.[35]
Erst Ende der 1960er-Jahre zerstörten Biografen den Mythos des Patrioten und Frauenhelden und enthüllten Brookes dunkle Seiten: »Der als ›fröhlich, furchtlos und vielseitig‹ bekannte Dichter konnte zuweilen auch kalt, grausam, launisch und schwach sein, ein Poseur, Antisemit und Frauenfeind, paranoid und kindisch. Kurz: Er war ein Mensch voller Fehler und Makel.«[36]Zahlreiche Briefe von Brooke zeigen einen unsicheren jungen Mann, stets am Rande des Nervenzusammenbruchs, voller Vorurteile und Neurosen. Er war ausgesprochen charmant und hatte Liaisons mit Frauen und Männern, aber sein hübsches Antlitz, das Zeitgenossen wie spätere Generationen faszinierte, verbarg ein vom Hass auf Juden und Pazifisten sowie paradoxerweise auch auf Frauen und Homosexuelle entstelltes »Dorian-Gray-Gesicht«.[37]
Schon früh sorgte sich Rupert Brooke um sein Bild in der Nachwelt, und so schrieb er einer Geliebten noch vom Schiff auf dem Weg zur Gallipoli-Front: »Liebes Kind, ich vermute, Du gäbest eine gute Witwe ab. […] [D]u wirst meine Unterlagen bekommen. Man möchte vielleicht eine Biografie schreiben! […] Dass ich sterbe, ist eine gute Sache«.[38] Noch heute lebt der Mythos, aber das Widersprüchliche in Brookes Persönlichkeit ist inzwischen bekannt. Vielleicht liegt gerade hierin das, was ihn zu einer »überraschend modernen Figur« und damit gleichbleibend interessant macht.[39]Was aber bewog einen derart exzentrischen Menschen, bei Kriegsbeginn in die Armee einzutreten?
1913 war Rupert Brooke gesellschaftlich etabliert. Sein 1912 verfasstes Gedicht »Das alte Pfarrhaus, Grantchester« (»The Old Vicarage, Grantchester«), in dem er das nahe Cambridge gelegene Dorf Grantchester lyrisch als urenglisches Idyll verewigt hatte, galt als bestes Gedicht des Jahres.[40] Im Frühjahr zum Professor am King’s College der Universität Cambridge ernannt, bereiste Brooke kurz darauf die USA und Kanada und verbrachte mehrere Monate in der Südsee. Zwar war er bereits bekannt, aber auch sein Aussehen und sein Charme begünstigten, dass sich ihm Türen und Tore öffneten. Allerdings langweilte ihn das Bewundertwerden auch schnell, und voller Heimweh ersehnte er Anfang Juni 1914 seine Rückkehr nach England.[41]
Deutschland kannte er ein wenig, denn er hatte zu Beginn des Jahres 1911 drei Monate in München gelebt und den Dichter Stefan George mit seinem Kreis kennengelernt. Zudem war er gegen Ende des Jahres noch zwei Mal in Berlin gewesen. Sein Deutschlandaufenthalt rief gemischte Gefühle hervor. »Die Deutschen trinken Unmengen an Bier, aber werden nicht auf dieselbe Art betrunken wie englische Studenten«, schrieb er seiner Mutter aus München. Er genoss das reichhaltige Kulturleben der bayerischen Hauptstadt, fand die Deutschen aber dick und selbstgefällig und mokierte sich über ihre Naturliebe. Letztendlich bestärkte sein Aufenthalt ihn in seinen Vorurteilen gegenüber Deutschland und in seinem Glauben an die Überlegenheit seines eigenen Volkes. Selbst sein berühmtes Vorkriegsgedicht »Das alte Pfarrhaus« enthält einige antideutsche Spitzen in Gestalt geschickt eingefügter deutscher Wörter und Redewendungen.[42]
Siegfried Sassoon ist eifersüchtig
Über die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Frau am 28. Juni 1914 im bosnischen Sarajewo finden sich in Rupert Brookes Nachlass keine Notizen. Zu sehr war er damit beschäftigt, nach längerer Abwesenheit seine Freundschaften zu pflegen oder neue zu knüpfen. Letzteres gelang nicht immer. So traf er Anfang Juli auf Vermittlung seines Freundes Edward ›Eddie‹ Marsh, einer führenden Persönlichkeit im Kulturleben Londons und Privatsekretär Churchills, mit dem ein Jahr älteren Siegfried Sassoon zusammen, der wie Brooke Cambridge-Absolvent war und ebenfalls stolz auf erste literarische Erfolge verweisen konnte.[43]
Siegfried Lorraine Sassoon war 1886 als einer von drei Söhnen einer angesehenen und wohlhabenden Familie in der Grafschaft Kent geboren worden. Sein jüdischer Vater war wegen der Heirat mit Siegfrieds katholischer Mutter enterbt worden, arbeitete aber als Kaufmann selbst sehr erfolgreich. Siegfried wurde getauft und verdankte seinen deutschen Vornamen der Liebe seiner Mutter zur Musik Richard Wagners. Seine Eltern trennten sich, als er vier Jahre alt war. Nach dem Tode seines Vaters 1895 erhielt Siegfried eine Erbschaft, die es ihm ermöglichte, angenehm zu leben, ohne sich seinen Unterhalt eigens verdienen zu müssen.[44]
Nach seiner Schulzeit an der privaten Marlborough-Schule studierte er von 1905 bis 1907 Geschichte in Cambridge, machte aber keinen Abschluss, sondern lebte stattdessen das Leben eines englischen Landedelmannes mit Fuchsjagd und Kricket. Zu dieser Zeit verfasste Sassoon erste Verse, die er teilweise privat drucken ließ. Zwischen 1906 und 1912 erschienen neun kleine Bändchen mit seinen Gedichten.[45] Seiner Homosexualität wurde sich Sassoon früh bewusst. Das 1908 erschienene Buch »Das Mittelgeschlecht« des Schriftstellers und Frühsozialisten Edward Carpenter, Jahrgang 1844, der selbst mit einem Mann zusammenlebte, plädierte für eine Emanzipation der Homosexuellen und analysierte die Zwänge, denen sie ausgesetzt waren: entweder außerhalb der Gesellschaft zu stehen oder sich anzupassen und zu heiraten.[46]
Carpenters Buch öffnete Sassoon die Augen; es habe ihm alles gezeigt, wofür er bisher »blind« gewesen war. »Die Anziehung, die mein eigenes Geschlecht auf mich ausübte, war unbewusst und meine Antipathie gegenüber Frauen ein Mysterium für mich«, schrieb er dem Autor. Seine Vorstellungen von Homosexualität seien voller Vorurteile gewesen, aber Carpenters Buch habe ihm geholfen, sich von der gesellschaftlichen Intoleranz, die auch ihn geprägt habe, freizumachen. Es ermögliche ihm nun »ein neues Leben […] nach einer Zeit großer Unsicherheit und Freudlosigkeit« zu führen. Das heißt allerdings nicht, dass Sassoon seine Sexualität sogleich auslebte. Der Prozess der Selbsterkenntnis war das eine, die Frage, wie er mit seinem Verlangen umgehen sollte und konnte, das andere. Carpenter antwortete Sassoon freundlich, und so entspann sich ein reger intellektueller Austausch. Erleichtert registrierte der sportliche Sassoon, dass Carpenter das gängige Negativklischee ablehnte, wonach Homosexuelle effeminiert seien, freute sich zugleich aber über dessen Bestätigung der positiven Zuschreibung, der zufolge Homosexuelle häufig künstlerisch veranlagt seien. Beides half ihm, sich selbst zu akzeptieren. 1911 und 1912 verfasste und publizierte Sassoon einige homoerotisch konnotierte Werke.[47]
1913 lernte Sassoon den in der Londoner Kunstszene bestens vernetzten Eddie Marsh kennen. 1872 als Sohn eines bekannten Chirurgen und Cambridge-Dozenten in London geboren, besuchte Marsh die renommierte private Westminster-Schule seiner Geburtsstadt. Anschließend studierte er an der Universität Cambridge, wo er das literarische Zeitgeschehen in mehreren Aufsätzen kommentierte und sich dadurch in Literaturkreisen einen Namen machte. Nach Abschluss des Studiums trat er in den Staatsdienst ein und wurde 1905 der Privatsekretär Winston Churchills. Da Marshs Homosexualität bekannt war, wurde seine Berufung von Churchills Umfeld kritisch gesehen. Mit Unterbrechungen sollte Marsh insgesamt 23 Jahre für Churchill tätig sein.[48]
Wenngleich Homosexualität in Großbritannien offiziell geächtet war und mit Blick auf prominente Persönlichkeiten beschwiegen wurde, konnte man als Homosexueller dennoch Karriere machen. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf den seit der Viktorianischen Zeit unaufrichtig-widersprüchlichen Umgang mit diesem Thema in der britischen Öffentlichkeit. Robert von Ranke-Graves, Jahrgang 1895, Spross einer bürgerlichen deutsch-britischen Familie aus Wimbledon und ab 1914 einer der jüngsten englischen Kriegsdichter, war bezüglich seiner sexuellen Identität ähnlich unsicher wie Brooke. An der privaten Charterhouse-Schule hatte Graves früh homoerotische Erfahrungen gemacht, aber nach dem Krieg mit zwei Ehen und insgesamt acht Kindern ein dezidiert heterosexuelles Leben geführt. In seiner Autobiografie brachte er Homosexualität mit dem rein männlich geprägten englischen Privatschulwesen in Verbindung, das nicht nur romantische Liebschaften ermöglichte, sondern auch sexueller Ausbeutung durch Ältere oder Lehrer Vorschub leistete. Jene Passage illustriert Graves’ auch in späteren Jahren noch durchscheinende Unsicherheit, wegen derer er stets »am Rande des Abgrunds« lebte:[49]
»In der englischen Grund- und Internatsschule sind Liebesabenteuer notgedrungen gleichgeschlechtlich. Das andere Geschlecht wird verachtet und wie etwas Obszönes behandelt. Viele Jungen erholen sich niemals von dieser entstellten Sichtweise. Auf jeden mit homosexueller Anlage Geborenen kommen mindestens zehn, die durch das Internatssystem zu permanent Pseudo-Homosexuellen gemacht werden. Und neun von diesen zehn sind ebenso jungenhaft und empfindsam, wie ich es war.«[50]
Edward Marsh verehrte die aristokratische Welt, liebte Klatsch und hatte eine Schwäche für die Schönen Künste. Die Gesellschaft geistreicher und gut aussehender Literaten – insbesondere die Robert Brookes, in den er verliebt war – empfand der seit einer Mumpserkrankung in der Jugend impotente Feingeist nicht nur als intellektuell inspirierend, sondern auch als erotisch anregend. Gerne half er Künstlern und Dichtern und führte sie in die literarischen Zirkel Londons ein. Es war ihm deshalb auch eine Freude, den attraktiven Siegfried Sassoon mit verschiedenen Schriftstellern und Dichtern bekanntzumachen, darunter im Sommer 1914 auch Robert Brooke.[51]
Sassoon hegte gegenüber Brooke gemischte Gefühle. Eifersüchtig war er auf dessen Aufstieg als neuer Stern am Literaturhimmel. Dennoch, oder gerade deshalb, wollte er den jungen Dichterkollegen kennenlernen, den Männer wie Frauen auch wegen seiner Schönheit verehrten. Insofern freute er sich auf das von Eddie Marsh arrangierte gemeinsame Frühstück. Hin- und hergerissen zwischen Neid und Neugier stellte Siegfried Sassoon am 8. Juli 1914 fest, dass auch er den blonden und an dem Morgen sommerlich-elegant gekleideten Rupert Brooke höchst attraktiv fand. Nun suchte er ihn in eine Konversation zu verwickeln, die zu seinem Leidwesen jedoch zäh verlief. Brookes Antworten auf Sassoons Fragen nach seinen Reisen fielen einsilbig aus. Das Frühstück dauerte nur 30 Minuten. Obwohl sich Sassoon gedemütigt fühlte, schrieb er Marsh, er hoffe, den »entzückenden« Brooke wiederzusehen. »Ich war mir bewusst«, notierte Sassoon später ironisch, dass Brookes Tonlage »eher tolerant als kommunikativ« war. »Er mag auch schüchtern gewesen sein, aber ich fürchte, er war auch ein bisschen gelangweilt von mir«. Mit diesem resignierten Resümee endete das Treffen zweier Männer, die alsbald zu den bekanntesten Kriegsdichtern ihres Landes zählen sollten.[52]
Wilfred Owen hadert mit sich
Ein anderer späterer Kriegsdichter, dessen Ruhm den von Brooke und Sassoon heute weit überstrahlt, befand sich im Juli 1914 nicht in England: Es war Wilfred Edward Salter Owen, knapp zehn Jahre jünger als die beiden und als Dichter noch unbekannt. 1893 war Owen als erstes von vier Kindern in der englischen Grafschaft Shropshire geboren worden. Er entstammte einer englisch-walisischen Familie und wuchs in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Sein Vater war Stationsvorsteher in der nordwestenglischen Stadt Birkenhead, einem an der Irischen See sowie am Fluss Mersey gelegenen Ort ohne besondere Sehenswürdigkeiten, der heute zum Großraum Liverpool gehört. Die damals etwa 100 000 Einwohner lebten vor allem vom Schiffbau.[53]
Erzogen im Geist der anglikanischen Kirche, war Owen tief gläubig. Schon früh zeigte sich sein literarisches Interesse. Um 1911 entdeckte er die Werke des britischen Dichters John Keats für sich, der mit Lord Byron und Percy Bysshe Shelley zu den wichtigsten Vertretern der englischen Romantik gehört. Keats’ Werk, von den Themen Schönheit, Vergänglichkeit und Tod durchzogen, inspirierte Owen zu ersten lyrischen Versuchen. 1911 bestand Owen zwar die Aufnahmeprüfung für die Londoner Universität, aber nicht mit der für ein Stipendium nötigen Punktzahl. Er musste sich deshalb seinen Lebensunterhalt verdienen und nahm in der westlich von London gelegenen Stadt Reading eine Stelle als Hilfsvikar an. Das in dieser Stadt gelegene Zuchthaus ist durch Oscar Wilde, der dort von 1895 bis 1897 eingesessen hatte, literarisch verewigt worden: in der »Ballade vom Zuchthaus zu Reading«, seinem letzten Werk. Soweit es Owens Arbeitszeiten zuließen, studierte er am University College in Reading Botanik und Altenglisch.[54]
Die schwierigen Lebensumstände vieler Gemeindemitglieder, ihre Armut und die schlechte medizinische Versorgung ließen Wilfred Owen zunehmend an seinem Glauben zweifeln. Immer weniger vermochte er das Elend weiter Teile der Bevölkerung mit den christlichen Botschaften von Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und Gnade zu vereinen, wie aus vielen Briefen hervorgeht, die er seiner Mutter Harriet Susan Owen schrieb. Ihr fühlte er sich eng verbunden, ihr vertraute er sich an. Nach zwei Jahren als Assistent des Vikars zog er seiner Mutter gegenüber am 4. Januar 1913 folgendes Resümee: »Ich habe meinen falschen Glauben ermordet. Wenn es einen wahren Glauben gibt, werde ich ihn finden. Wenn nicht, dann adieu zu noch falscheren Weltanschauungen, die die Herzen beinahe aller meiner Mitmenschen umklammert halten.«[55]
Die Abwendung vom Christentum, sein ›Mord am Glauben‹, prägt Owens dichterisches Werk seit 1913. Religiöse Motive, Zitate und Fragen durchziehen es wie ein roter Faden und kennzeichnen auch seine späteren Kriegsgedichte. Sein Frühwerk ist aber vor allem »selbst- und keatsverliebt«. Diese Gedichte drücken eine ziellose Innerlichkeit des Heranwachsenden aus, gelten als wenig originell und folgen formal noch zu sehr den romantischen Vorbildern. Entsprechend einer kindlich anmutenden Vorbildverehrung suchte der 20-jährige Owen Ähnlichkeiten zwischen sich und dem berühmten Keats und meinte, aus der gleichartigen Handschrift der beiden eine Seelenverwandtschaft ableiten zu können.[56]
Zu den Unsicherheiten des jungen Owen gehörte auch dessen noch unklare sexuelle Orientierung. Vielen erschien er unschuldig-kindlich, sodass auch seine Hingezogenheit zu Jungs und Mädchen platonisch wirkte. Zu seiner Mutter hatte er ein ausgesprochen enges Verhältnis und vertraute ihr vieles, aber nicht alles an. Von ersten sexuellen Erfahrungen mit Männern oder Frauen ist nichts bekannt, aber eine starke homoerotische Veranlagung des angehenden Dichters wird heute allgemein angenommen und auch seine Abwendung vom Christentum damit in Verbindung gebracht. Allerdings blieb Owens sexuelle Orientierung lange im Dunkeln, weil sein Bruder nach Wilfreds Tod entsprechende Brief- und Tagebuchpassagen entfernte. Während Keats das literarische Vorbild des jungen Owen war, sollte Siegfried Sassoon im Laufe des Kriegs sein Mentor sowie seine emotionale Bezugsperson werden.[57]
Von all dem ahnte Wilfred Owen noch nichts, als er seine Stelle als Hilfsvikar aufgab und im Herbst 1913 nach Frankreich zog, um an der privaten Berlitz-Sprachschule in Bordeaux Englisch zu unterrichten. Aufgrund seiner guten Französischkenntnisse lebte er sich schnell ein und genoss das Leben in der Hafenstadt. Owens fromme Mutter fürchtete einen schlechten Einfluss der ihrer Meinung nach allzu freizügigen Französinnen auf ihren Sohn. Ihre Sorgen waren jedoch unbegründet, denn obwohl Wilfred einige junge Frauen kennenlernte, betonte er gegenüber seiner Schwester, dass er sich auf nichts einlasse, und schrieb seiner Mutter: »Ausnahmslos alle Frauen nerven mich.« Sein Herz gehöre der Poesie und insbesondere den Versen von Keats. Vielleicht verdrängte er mit dieser ostentativen Liebe zur Literatur auch seine sexuellen Gefühle.[58]
Die außenpolitische Krise des Sommers 1914 ließ Owen unbeeindruckt. Er kümmerte sich mehr um sich selbst und ergriff die Gelegenheit, sich beruflich umzuorientieren. Er verließ die Berlitz-Sprachschule, um eine Stelle als Tutor bei einer französischen Familie anzunehmen, die in einer Villa am Fuße der südfranzösischen Pyrenäen lebte. Durch sie lernte Wilfred Owen den anarchistischen und kirchenkritischen Dichter Laurent Tailhade kennen, einen prominenten Vertreter des ›Dekadentismus‹, einer literarischen Bewegung, die zwischen 1890 und 1914 den kulturellen Niedergang beschrieb – ein zur Jahrhundertwende verbreiteter Topos in ganz Europa. Tailhade machte Owen mit den Werken bedeutender französischer Schriftsteller bekannt, darunter Paul Verlaine und Gustave Flaubert. Der mit 60 Jahren deutlich ältere Franzose war nicht nur angetan von dem jungen Engländer, sondern regelrecht verliebt, was der mittlerweile viel selbstsicherere Owen sogar seiner Mutter mitteilte. Tailhade »empfing mich wie einen Liebhaber«, schrieb er ihr nach einem Treffen mit dem Dichter, dessen Zuneigung »nicht intellektuell« sei. Die europäische Krise vom Juli 1914 betrachtete Owen, der sich fernab von zu Hause aufhielt und als Brite keiner Wehrpflicht unterlag, mit innerer Distanz.[59]
Winston Churchill macht ein Angebot
Als sich die Julikrise zuspitzte, waren Rupert Brookes Gefühle gemischt. Am 30. Juli 1914 dinierte er mit dem Ehepaar Asquith, Winston Churchill, Edward Marsh sowie dem Schriftsteller D. H. Lawrence in der Downing Street Nr. 10, dem Londoner Wohnsitz des britischen Premiers. Die britische ›Upper Class‹ war traditionell sehr klein. Einigendes Element war nicht nur der typische Privatschulakzent, sondern auch ein gut funktionierendes Netzwerk, denn die auf den elitären Privatschulen sowie in Oxford und Cambridge geknüpften Bande wirkten auch jahrgangsübergreifend und öffneten Türen. Rupert Brooke war gesellschaftlich jedenfalls bestens vernetzt. So bot Churchill dem Dichter im Laufe des Abends an, ihm im Kriegsfalle eine Stellung als Offizier zu beschaffen.[60] Nach der deutschen Kriegserklärung an Russland am 1. August 1914 notierte Brooke:
»Jeder in den führenden Schichten scheint zu glauben, wir sollten uns im Krieg befinden. […] Ich möchte, dass Deutschland Russland in Stücke schlägt und dass dann Frankreich Deutschland stoppt. Statt dessen wird wohl Deutschland Frankreich zerschmettern und dann von Russland ausgelöscht werden. Frankreich und England sind die einzigen Länder, die Macht haben sollten. Preußen ist ein Teufel. Und Russland bedeutet das Ende Europas und jeden Anstands.«[61]
Diese ambivalente Einstellung war in der Tat typisch für Angehörige der englischen Oberschicht, insbesondere für diejenigen, die Kontakte nach Deutschland pflegten. Bereits Ende Juni hatten namhafte Professoren – unter ihnen W. B. Selbie, Gilbert Murray und C. H. Herford – gegen einen möglichen Kriegseintritt Großbritanniens protestiert und am 1. August öffentlich erklärt, ein Krieg gegen Deutschland im Interesse Serbiens und Russlands sei »eine Sünde gegen die Zivilisation«.[62] »Es schmerzt zu denken, dass Frankreich leiden könne«, schrieb Rupert seinem Freund Eddie, aber ebenso täte die Vorstellung weh, »dass Russland Deutschland Schaden zufügt.« Er hoffe, dass England rechtens handeln werde, denn alles andere wäre nicht auszuhalten.[63]
Männer wie Brooke stellte der mögliche Kriegseintritt Britanniens – so die heute im Vereinigten Königreich übliche Landesbezeichnung – vor spezielle Herausforderungen, denn ohne allgemeine Wehrpflicht war die englische Armee auf Kriegsfreiwillige angewiesen. Sollte es zum Krieg kommen, würde es kaum möglich sein, sich dem sozialen Druck zu entziehen. Entgegen seinem posthumen Image als kriegsbegeisterter Patriot war Rupert Brooke in Wirklichkeit tagelang unentschlossen, was er tun sollte. Nervös verfolgte er die sich von Ausgabe zu Ausgabe verschlechternden Meldungen der Zeitungen. Bezeichnenderweise verglich er seine angespannte Stimmung mit der Situation eines Brautwerbers, was verdeutlicht, dass er »nicht den Tod fürchtete, sondern die Heirat« und damit die Verpflichtung zu einem heterosexuellen Leben:[64]
»Man fühlt sich so deprimierend ruhelos wie in jener Zeitspanne von ein oder zwei Tagen, nachdem man den Heiratsantrag gemacht hat und auf die Antwort wartet. Was wird morgen passieren? Und was immer es ist, wird es nicht schrecklich sein?«[65]
Als Großbritannien dem Deutschen Reich am 4. August 1914 den Krieg erklärte, kämpfte es nicht nur an der Seite Frankreichs, sondern auch an der des autokratischen Zarenreiches. Das war eigentlich erstaunlich für ein Land, das sich so viel auf seine Demokratie zugutehielt. Was hatte den politischen Umschwung bewirkt? Zunächst hatte wenig auf diese Entwicklung hingedeutet, denn seit dem Frühjahr 1914 wurde die Aufmerksamkeit britischer Politiker ganz vom Irlandkonflikt absorbiert. Nachdem die Gesetzesvorlage zur Einführung der irischen Selbstverwaltung (»Home Rule«) vom Unterhaus, dem die gewählten Volksvertreter angehörten, verabschiedet, vom Oberhaus, der Adelsvertretung, aber abgelehnt worden war, hatte sich die Lage verschärft.[66]
Besonders heikel war die Frage, welche Grafschaften in der konfessionell gemischten Region Nordirland von der Selbstverwaltung ausgenommen werden und somit im Vereinigten Königreich verbleiben sollten. Es drohte ein gewaltsamer Konflikt zwischen einer Privatarmee der probritischen Protestanten Nordirlands und Freiwilligenverbänden der radikalen irischen Unabhängigkeitsbewegung. Die Regierung unter Henry Asquith, dem Vorsitzenden der Liberalen Partei, war auf die Stimmen der irischen Nationalisten angewiesen und plante, das Oberhaus mittels königlicher Zustimmung zum Gesetz – seit 1910 regierte Georg V., ein steifer Marineoffizierstyp »mit sehr begrenztem geistigen Horizont«[67] – zu umgehen. Die Konservativen, strikte Gegner jeder irischen Autonomie, tobten und beschrieben Ende Juni folgendes Schreckensszenario: Wenn die Regierung die Selbstverwaltung durchsetzen wolle, müsse sie die gesamte britische Armee nach Irland verlegen, um dort Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Dann sei sie jeder Möglichkeit beraubt, militärisch außerhalb Britanniens zu intervenieren. Mit Blick auf die durch die Ermordung des österreichischen Thronfolgers gerade erst ausgelöste Balkankrise war das keine wirklich angenehme Aussicht.[68]
In der sich entfaltenden Julikrise rückte die irische Frage in den Hintergrund. Der britische Außenminister Edward Grey verfolgte gegenüber den französischen, russischen, österreichischen und deutschen Botschaftern einen undurchsichtigen Plan, indem er feste Zusagen vermied, aber die Regierungen der jeweiligen Länder indirekt in ihren Annahmen über die britische Haltung – Intervention auf Seiten Frankreichs und Russlands oder Neutralität – bestärkte.[69] Ob aber eine deutlichere Festlegung Greys, Britannien würde im Konfliktfall nicht neutral bleiben, die riskante Politik der Mittelmächte, also Österreichs und Deutschlands, geändert hätte, ist unter Historikern umstritten.[70] In allen Hauptstädten der europäischen Großmächte begannen im Juli 1914 hektische Aktivitäten, um auszuloten, welche Vorteile man aus der Krise ziehen könne. Interessant ist, dass eine Verletzung der belgischen Neutralität durch das Deutsche Reich – die entsprechenden Pläne des deutschen Generalstabes waren seit Langem bekannt – von der britischen Regierung zwar als möglich eingeschätzt, aber zunächst keineswegs als zwangsläufiger Anlass für eine britische Intervention gesehen wurde. Selbst der grundsätzlich nicht zimperliche Churchill kommentierte: »Ich sehe nicht ein, warum wir einmarschieren sollten, wenn sie nur ein kleines Stück nach Belgien eindringen.«[71]
Britannien betrachtete die Entwicklung der Krise nicht nur aus der eigenen Perspektive als See- und Weltmacht, sondern auch unter Bündnisgesichtspunkten. Auf diese Weise trat der österreichisch-serbische Urkonflikt in den Hintergrund, und es zählte am Ende, dass Russland und Frankreich aktiv wurden, wodurch auch das Vereinigte Königreich unter Zugzwang geriet. Zwar wurde nicht nur Deutschland als machtpolitischer Konkurrent Englands angesehen, sondern auch Russland, aber eine britische Intervention auf Seiten der Entente bot die Möglichkeit, sowohl Russland zu schwächen als auch Deutschland einzuhegen. Hinzu kam, dass auch England handfeste Kriegsziele für den Fall eines Krieges hatte. Zum einen ging es um die wirtschaftliche Schwächung des Deutschen Reiches als stärkstem Handelskonkurrenten und zum anderen um die Sicherstellung der eigenen maritimen Überlegenheit durch die Ausschaltung der deutschen Kriegsmarine. Solche Überlegungen beherrschten keineswegs nur Militärs und konservative Politiker, sondern auch rechtsnationale Einflussgruppen. So forderte beispielsweise der Journalist Horatio Bottomley, Herausgeber des chauvinistischen Magazins John Bull, »›sich die Krise zunutze zu machen‹, um die deutsche Flotte zu ›vernichten‹«.[72]
Auch das konservative Leitmedium The Times plädierte explizit und mit Nachdruck für eine britische Intervention gegen Deutschland. Dennoch war es nicht nur die öffentliche Meinung, welche die britische Regierung zu einer Intervention im Falle eines Kontinentalkrieges drängte. Vielmehr setzten Winston Churchill und andere Kriegsbefürworter in der Regierung sowie die konservative Opposition alles daran, Britannien im Kriegsfalle auf eine Intervention zugunsten der Entente festzulegen. Die liberalen Interventionsgegner versäumten es, für ihren Standpunkt Mehrheiten zu finden. Zudem wollten sie unbedingt ein Zerbrechen des liberalen Kabinetts vermeiden, um eine Regierungsbeteiligung der Konservativen zu verhindern. Um das ›arme kleine Belgien‹, wie es später die britische Propaganda behauptete, ging es nicht. Gleichwohl sollte sich die Verletzung der belgischen Neutralität durch deutsche Truppen als der ideale formale Grund für einen Kriegseintritt erweisen. Am 2. August 1914 legte das Kabinett fest, dass eine »›substanzielle Verletzung‹ der belgischen Neutralität« Britannien »›zum Handeln zwingen würde‹«. Zwar war die Einschränkung »substanziell« auslegbar, aber schon seit dem 29. Juli hatte Churchill verschiedene Maßnahmen ergriffen, welche in der Mobilisierung der britischen Flotte am 1. August gipfelten.[73]