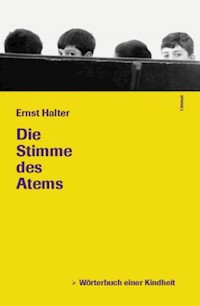11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Held in diesem figurenreichen Roman ist das 20. Jahrhundert. Was sich zu Beginn der Ära nur erahnen läßt, wird zu Gewißheit und Tatsachen. In erzählerischen Short cuts überblendet Ernst Halter Gemeinschaften und Orte, Schicksale, Menschen und ihr Handeln bis in die Träume hinab und verfolgt sie durch zehn Jahrzehnte. Schauplätze sind Deutschland, die ungarische Provinz, das kakanische Wien, die Ukraine, die Schweiz. Immer wieder überläßt der Autor seine Figuren ihren Geschicken, um den Stand der Epoche an ihnen abzulesen, wenn er zu ihnen zurückkehrt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Ähnliche
Ernst Halter
Jahrhundertschnee
Versuch einer Revision
FISCHER Digital
Inhalt
Für Silvia Haab
I Die Vorzeit
»Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.«
Jakob van Hoddis, »Weltende«
»Die Lage ist verzweifelt, aber nicht ernst.«
Kakanisch
Chiffre 1:
Die Flut
Wann immer ich dem Hochwasser begegnet war, füllte es nur das Flußbett und das Vorland bis auf Kronenhöhe der Seitendämme, die abgeschnittenen toten Arme, die Seitenkanäle und selbst die im weiten Wiesenplan ausgehobenen, sommersüber unsichtbaren, kapillaren Entwässerungsgräben. Es verwandelte die unter diffusem grauweißem Licht liegende Talebene; in Dellen und Sandkuhlen, wo im Juli die Hitze flimmert, glitzerte es durchs hohe Gras, und man hätte ohne die paar kleinen Holzbrücken nicht an den Fluß in der Talmitte vorzudringen vermocht. Hier wühlte das Wasser vorbei. Doch Angst, der bis knapp vor die Füße bespülte Damm, auf dem ich stand, könnte unter meinem Gewicht nachgeben und ich mitgerissen werden, hatte ich nicht.
Ich bewunderte die unaufhaltsam von rennenden Schlierren überformte, dahinschießende Masse – ein wildes Schuppentier, dessen Knurren und Tosen mich nicht bedrohte, da das Hochwasser bereits zurückging. Meinen Eindruck bestimmten die Kraft, Wucht und Ausdauer des Vorgangs. Ich empfand die Achtung, die uns ein ungeheuer großes Lebewesen abnötigt. Morgen oder übermorgen würde der Fluß wieder am Grund des Betts lautlos und durchsichtig dahinrieseln. Ich wandte mich ab, überquerte einen schwingenden Steg über einen Seitenkanal und ging ziellos ins Wasserland hinaus, für mich eine der schönsten Landschaften, die ich nie gesehen habe. Die langrechteckigen Weidegründe für halbwilde Pferde, die verstreuten Laubgehölze, Eichen, Eschen, Trauerweiden, schienen mir unberührt, als hätte noch kein Mensch sie in Besitz genommen und einer Nutzung unterworfen.
Der Distrikt zieht sich talauf und talaus, Kanäle und Gräben silbrig, die Weidestrecken hellgrün, als ob die Sonne durchbrechen wolle. Neugeschaffen. Doch jemand mußte in früherer Zeit diesen Raster aus schmalen, verwilderten Wegen angelegt haben, der die Ebene in sein Netz faßt. Ich ging in dieses lichte Land von Wasser, Wind, Gras und einer mächtigen Absenz hinaus, und es war nicht auszuschließen, daß es von meiner Anwesenheit allmählich erfüllt wurde, als ob ein Wunsch dieses Landstrichs herüberzutreten, gesehen, begangen, begriffen und geliebt zu werden, wahr geworden wäre. So streifte ich flußabwärts, wo die Talflanken immer weiter auseinandertreten, bis sie, mehr ahnbar als sichtbar, ähnlich einem wolkengrauen Hügelzug, mit einem querlaufenden Moränenriegel die Erfüllung dieses Wunsches oder Glücks fassen.
Gestern – ich war auf der Rückfahrt von Zürich – füllte die Flut das Tal. Niemand und nichts hatten mich vorgewarnt. Plötzlich sah ich sie, nein, sie riß vor mir Bäume und rittlings abgehobene Dächer vorbei. Vollbremsung, ich fuhr rückwärts und parkte an einem überschwemmungssicheren Ort. Ich stieg aus und hinunter, zuweilen wich ich zurück, um nicht von einer unversehens hochgepreßten Welle mitgerissen zu werden. Die Wassermasse brauste mit braungrauen, sich senkrecht gleich Mühlrädern drehenden Wirbeln das Tal hinaus, über dem nur noch unser Haus zu sehen war, mir genau gegenüber und somit unerreichbar. Ich wartete, das Herz im Hals, daß es ins Rutschen kommen und versinken würde. Dann fiel schwarzer Regen vom Himmel, eine kompakte Wand, ich sah nichts mehr, hörte nur noch das Toben der Flut.
Jakob Lanz 1:
Die Wahrheit
Als Junge hatte Lanz einmal gelesen, daß die Wahrheit sich hinter Schleiern verberge, und hatte die gesprenkelte Forelle vor sich gesehen, die, den Kopf gegen die Strömung, in der von winzigen Wellen überschauerten Bünz stand, hie und da mit den Bauchflossen fächelnd, und die ihm mit einem einzigen Schlag der Schwanzflosse entwischt war, als er sie zu packen versuchte. Die Forelle war die Wahrheit, denn sie war wirklich, und er hatte danebengegriffen, weil ihm ihr Abbild infolge der Lichtbrechung an der Wasseroberfläche am falschen Ort erschienen war. Heute, Jahrzehnte später, vermutete er, dieses Erlebnis habe ihn bewogen, Fotograf statt, wie sein Vater es gewünscht hätte, Lehrer zu werden.
Er hatte das Sichtbarwerden der Konturen, dann der Binnenzeichnung und endlich der Schattierungen der Gesichter im Entwicklerbad als Wegheben dieses Schleiers empfunden und jedesmal etwas wie Lampenfieber verspürt, einen leisen Zweifel, ob sich der Vorgang auch diesmal wiederholen würde. So hatte er jahrelang die Fotografie als wahres Abbild der Wirklichkeit betrieben.
Doch dann war diese Wahrheit ins Wanken geraten. Zum einen störte ihn plötzlich die Zweidimensionalität der Fotografie, obwohl diese ästhetisch ein Vorteil war, tat sie doch sozusagen den ersten Schritt in die Abstraktion. Immerhin blieb das unwiderlegbare Vorhandengewesensein einer Konstellation von Gegenständen oder Menschen, eines Lichteinfalls auf der Landschaft oder auf einer Maschine in einem irgendwo durch die Zeit sich entfernenden Moment. Doch genau aus dieser Augenblicksecke fielen ihn Zweifel an: Er, Lanz, war es ja, der den Moment, den Blickwinkel, den Lichteinfall wählte und die Stellungen vorgab.
Je besser er sein Metier beherrschte, je selbstverständlicher er mit Emulsionen, Glasplatten, Retuschierpinseln, Kameras, Stativen, Scheinwerfern, Requisiten, gemalten Hintergründen und Blumenarrangements hantierte, je sicherer er vorauswußte, daß das Bild im Sinne des Auftraggebers gut wurde, desto stärker war sein Eindruck, sich von der Wahrheit zu entfernen, eine Scheinwelt zu inszenieren und zu produzieren, zu lügen, desto hilfloser fühlte er sich dem Material ausgeliefert. Wie konnte er dem Hochzeitspaar Paula und Leonz Küng aus B., einem Kleinbauern und seiner angetrauten Kleinbauerntochter, deren Lebenslauf klar zwischen Saat und Ernte, Heuet und Emd, Stall und Garten, Kinder und Küche und Torfstich vorgezeichnet war, wie konnte er den jungen Leuten den heißen Wunsch verwehren, sich vor Eiger, Mönch und Jungfrau – einem seiner Staffageparavents – ablichten zu lassen? Ins Berner Oberland würden sie es ihr Leben lang nicht bringen. Lanz wäre lieber zu ihnen nach Hause gegangen und hätte sie unter der niedrigen Stalltür fotografiert, in deren Sturz der Erbauer die Buchstaben I+N+P&F&S + S (Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes) eingekerbt hatte.
Die schlimmste Enttäuschung hatte Lanz in der neuen Bally-Fabrik in Dottikon eingesteckt. Ein ehrenvoller Auftrag. Doch woraus bestand die Ehre? Daß er während mehrerer Schönwettersonntage die gewischten Säle, die blankgeputzten Maschinen, die leeren Stuhlreihen, Tischchen, Nähmaschinen, Körbe, Fließbänder und Pulte fotografieren durfte. Mit Ausnahme des in seiner Sonntagsruhe gestörten Abwarts, der ihm mürrisch aufschloß und das Fotoprogramm, eingezeichnet auf einem Plan der Fabrik, in die Hand drückte und ihn drei Stunden später mürrisch abholen kam, hatte er niemanden gesehen. Noch während er die Maschinen ins schönste Scheinwerferlicht rückte und erst recht während er zu Hause jedes störende Pünktchen mit dem Haarpinsel wegretuschierte, hatte er sich geschworen, einen derartigen Auftrag, und mochte er noch so hoch bezahlt sein, nie mehr anzunehmen, es sei denn, er selbst würde bestimmen, was aufs Bild kam. Solche Fotografiererei war ein schleichender Verrat an den Menschen, die den Maschinen zuliebe in den Sonntag, die Nichtexistenz, geschickt worden waren. Doch an ihnen hing die ganze Produktion. Dann lieber noch ein Musterbuch für einen Strohindustriellen zusammenstellen, auf schwarzem Samt fein ausgelegt die ganze Vielfalt der Plateaus, Spreuer, Uhrfedern, Knöpfchen, Schilten, Perlen, Birnen, Grelots, Bordüren, Spitzen, Dentelles, Hutfonds, Pferdehaarblonden, Ajourgeflechte, Ringe, Entredeux, Knüpf- und Strickarbeiten aus Stroh, Pferdehaar, Hanf oder Raffiabast.
Lanz hatte gut verdient, sein Geschäft hatte, vor allem in den späten Jahren, als Spitzenadresse gegolten; sein Kundenrayon reichte von Brugg über Lenzburg, Hochdorf, Muri bis Affoltern. Auch ein Sortiment Witze hatte er auf Lager, mit denen er die Leute zum Lachen brachte, er verfügte über Puppen, Kissen, Polsterstühlchen, dank deren Zuspruch und Kuscheligkeit die weinenden Kinder sich allmählich beruhigten, und er hatte sein sogenanntes Hinterzimmer für heikle Aufträge, einen Raum mit Oberlicht, das jede Einsicht verwehrte und zu dem er allein die Schlüssel besaß.
Dann hatte er verkauft, gut verkauft – die Gunst des Standorts, die Hand des Meisters, die Größe und Exklusivität der Kundschaft. Er hatte sich in sein kleines Haus unweit des Waldrands über W. zurückgezogen, entschlossen, nunmehr endlich die Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit, die hinter Schleiern verborgen war, Schleiern der Konvention und Prätention, Schleiern der Wünsche und Sehnsüchte, des selbstgefälligen Egoismus, der Lust, der Naivität oder seichten Nettigkeit, Schleiern des Lichts, der Einstellungen, der Requisiten und des Arrangements. Daß die Wahrheit nackt sei, hatte er nie gefunden; die nackte Wahrheit oder die Wahrheit in der Nacktheit war im Gegenteil die größte Lüge.
Die liebsten Aufträge waren ihm – weit vor Täuflingen, Erstkommunikanten und Konfirmanden, Hochzeiten, Fahnenweihen, Turn-, Schützen- und andern Vereinsfesten, Dorftheateraufführungen, Grundsteinlegungen, Un- und Brandfällen, Zeppelinlandungen, Truppendefilees, Offiziers- und Fritzenvereinen (er selbst hieß gottlob Jakob), Examensklassen, Fabrikbelegschaften auf der Freitreppe, Kinder- und Erwachsenenporträts –, er wagte es sich kaum einzugestehen: es waren die Toten gewesen, die verunfallten und wieder hergerichteten Männer und Buben, die vom Schlag Getroffenen, in hohem Alter Eingeschlafenen, die mit acht Jahren von der Diphtherie, mit zwanzig von Tuberkulose oder Typhus Dahingerafften, auf dem Totenbett umkränzt mit Kunstblumen, den Öldruck mit dem Guten Hirten oder Christus in Gethsemane an der Wand über sich, die zu ausgezehrten Fabrikmädchen verblühten, abgemagerten Bauerntöchter, denen man zum Abschied das weiße Jungfernkränzlein ins Haar gedrückt hatte, die von den Brauenbogen herabfallenden schweren Schatten auf den tiefliegenden, fest zugedrückten Lidern, die sich nie mehr öffnen würden, denen auf immer jeder Blick in die lebenserfüllte Welt erloschen war. Vielleicht hatte er hier Wahrheit ohne bestimmten Artikel abgelichtet.
Doch es mußte auch eine Wahrheit der Lebenden oder des Lebens geben, eine Wahrheit, die kein Regen verwischte und keine Sonne hinwegblendete, weil Regenstriemen und Sonnenglast und Nebel – der Hauptfeind des Architektur- und Landschaftsfotografen – dazugehörten. Und jetzt hatte er sich aufgemacht, sie zu suchen. Den Anspruch, Kunst zu machen, hatte er nie erhoben, er war ein gewissenhafter Handwerker. Er würde den Blick ändern müssen, das perfekte Bild konnte er vergessen, er mußte eine neue Lehre antreten, er mußte lernen, ein Bild schön zu finden, das von seinen ehemaligen Kunden und Kollegen als häßlich oder mißlungen abgelehnt würde. Er mußte das Kind werden, das er gewesen, als seine Mutter gestorben war und er durch sie und einen Tränenschleier hindurch das andere, sagen wir’s weniger pathetisch: etwas anderes zu erkennen geglaubt hatte. Er mußte mit fast sechzig Jahren erwachen zu dem Menschen, der er wohl auch war und den er oft hatte verleugnen müssen.
Und Jakob Lanz war, ihm selbst unbegreiflich, voller Zuversicht. Als erstes Bild nahm er sich das Armenhaus am staubigen Ende des Dorfs vor.
Die S.A. Thorwaldt-Gesellschaft 1:
Die Gründung
Zu Frühlingsbeginn auf den 21. März 1910 lud der Berliner Verlag Ullstein aus Anlaß des bevorstehenden Abschlusses der sechsbändigen Weltgeschichte unter Federführung von Professor Julius von Pflugk-Harttung die 28 Autoren sowie eine Anzahl Gäste zu einer kleinen Feier ins Hotel »Kaiserhof«. Immerhin hätten sich 19 Autoren, so die Professoren Karl Brandi, August Conrady, Ernst Haeckel und Felix von Luschan, eingefunden, stellte Louis Ullstein fest, was angesichts der weit zerstreuten Gelehrtengemeinde fast an ein Wunder grenze und womit die Meister das Werk lobten, um Sirachs geflügeltes Wort umzudrehen. Anschließend verlas der Herausgeber die von Professor Julius Beloch in Rom telegrafierten kollegialen Grüße und Glückwünsche der Abwesenden.
Nach Worten des Danks und Gedenkens für den verstorbenen Professor Wilhelm Oncken – mit seiner Allgemeinen Geschichte in Einzeldarstellungen einer der geistigen Väter des Werkes – begrüßte Herr Ullstein einige Gäste: so die Professoren Ernst Cassirer, Hans Delbrück, den Nobelpreisträger Rudolf Eucken, Max Scheler, Max Weber, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf sowie den rüstigen Felix Dahn, weiter einen Vertreter der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und den Herausgeber der Preußischen Jahrbücher.
Während eine Kleinigkeit gereicht wurde, betrat der umstrittene Schilderer sozialer Mißstände, Gerhart Hauptmann, vertieft ins Gespräch mit dem glutvollen Dichter Carl Dehmel und seiner Gattin Ida, den Dinner Salon; ihm folgte der Kirchenhistoriker und Theologe Adolf von Harnack mit seinem Freund, dem Kulturphilosophen Houston Stewart Chamberlain. Als letzter führte Arthur Moeller van den Bruck, der notorische Autor des Werkes Die Deutschen. Unsere Menschengeschichte, dessen 8. und letzter Band für den Herbst angekündigt war, den Privatgelehrten Dr. Oswald Spengler herein. Als gegen sieben Uhr abends noch der Staatssekretär im Reichsamt des Innern, Dr. Clemens Delbrück, und Friedrich Althoff vom preußischen Kultusministerium, ja sogar der Bankier Hans von Bleichröder eintraten und, aufs herzlichste empfangen, sich zu den Gesprächsrunden gesellten, die sich gebildet hatten, mußte auch Uneingeweihten klar sein, daß der Anlaß weiterreichende Gründe hatte. Als allerletzter betrat ein älterer Mann mit Kurzbart und starkem, nach hinten gekämmten Haupthaar den Saal. Louis Ullstein eilte ihm entgegen, schüttelte ihm herzlich die Hand und flüsterte einige Worte. Ein paar Gäste hatten sich, gelindes Erstaunen im Gesicht, umgedreht, doch auch von der Antwort des Ankömmlings war wenig zu verstehen: »… von Klara … Benz direkt von Radebeul … Totempfahl für Bärenfett … Tlingit … sattsam, sattsam … Freund und Kameraden im Abenteuer die Ehre … zweifelsohne dichthalten …« So blieb auch während des kleinen Dinners ein Geheimnis, welcher Art die Überraschung sein würde.
Endlich erhob der eigens aus Breslau angereiste Professor Dahn sein volles Champagnerglas zu einem Toast und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß er den Versammelten Ihrer Majestät des Kaisers allerhöchsten Gruß und Glückwunsch für ein neues, bedeutsames Unternehmen auszurichten befugt und zur Bekanntgabe des nächsten editorischen Wagestücks des Ullstein Verlags ermächtigt sei.
Im Schoße der nach Leibniz’ großartigem Plane gestifteten und im kommenden Jahr ihr zweihundertjähriges Bestehen feiernden Berliner Akademie der Wissenschaften sei ein neues Kind gewachsen, dessen Name und Statuten heute morgen Rechtskraft erlangt hätten: die S.A. Thorwaldt-Gesellschaft. Von namhafter Unterstützung aus der kaiserlichen Privatschatulle und durch das Bankhaus Bleichröder ermutigt, plane sie in Zusammenarbeit mit dem Ullstein Verlag die historisch-kritische Gesamtausgabe des Werkes von Siegbert Armin Thorwaldt (Hameln 1819 bis Detmold 1899), dessen Schriften, abgesehen von einigen Aufsätzen in den Preußischen Jahrbüchern und in kleineren wissenschaftlichen Publikationsorganen, als ungehobener Schatz noch immer in der Fürstlich Lippischen Bibliothek zu Detmold lagerten, woselbst Thorwaldt die letzten Jahre seines Lebens als Hüter der lippischen Bücherschätze und Freund des Fürsten Woldemar, nach dessen Ableben im Nachfolgestreit als Anwalt des Fürsten Adolf zu Schaumburg Lippe, verbracht und sich, wenn auch vergeblich, weil gegen die Stimmen sämtlicher Herzogtümer und Fürstentümer, um die Erhebung der Lippischen Lande in den Stand eines Herzogtums bemüht habe. Thorwaldts Forschungen auf den Wissensgebieten der Geschichte, Völkerpsychologie, Philosophie und Völkerkunde seien die Frucht jahrelanger Wanderschaft um den Globus und innerhalb des deutschen Vaterlandes, von Jahren des Wirkens als Kaufmann in Malabar und Nordaustralien – aus Thorwaldts Feder stamme die erste Darstellung des sogenannten »Kargo-Kultes« der eingeborenen Primitivstämme, publiziert in der Zeitschrift für Ethnologie – sowie als Generalkonsul in Kairo und Konstantinopel.
Noch könne, führte Professor Dahn aus, der Umfang wie auch die thematische Vielfalt des an verschiedensten Orten und unter oft widrigen Umständen Niedergeschriebenen nicht genau erfaßt werden. Die Scheu des deutschen Biedermannes habe Thorwaldt zeit seines Lebens daran gehindert, einen größeren Kreis mit dem Reichtum und der Erkenntnistiefe seiner Gedanken vertraut zu machen. Nur ein Dutzend Aufsätze seien ans Licht getreten. Sehe man ab von der Ethnographie, in welcher Thorwaldt dem unvergeßlichen Professor Rudolf Virchow Freund und Weggenosse gewesen, sei ihr Schwerpunkt grob gesagt die Lebens-, Wirtschafts- und Denkart des Deutschen Volkes aus der Sicht eines Weltkenners sowie Deutschlands zivilisatorische Rolle an fremden Küsten.
Nach Einsicht des designierten Herausgebers in der Fürstlich Lippischen Bibliothek zu Detmold dürfte das Gesamtwerk Thorwaldts um die vierzig gedruckte Bände beanspruchen. Der weite Horizont der Erfahrungen und die Originalität der Gedanken des Verfassers legten es nahe, von einer, ja, von einer älteren Version der Grundlagen des 19. Jahrhunderts zu sprechen, deren Autor sich glücklicherweise unter den Geladenen befinde. Es mute geradezu tragisch an, daß Thorwaldt das Erscheinen von Herrn Chamberlains epochalem Werk nicht mehr habe erleben dürfen. Gefragt sei also ein editorisches Vorgehen, welches sich an thematischen Kristallisationskernen orientiere und entsprechend kommentiere. Dadurch gewinne die »Thorwaldt-Gedenkausgabe« an Aktualität und Prägnanz in hohem Maße.
Als Fernziel nach Abschluß der Werkausgabe habe man bereits an eine Publikation der wichtigsten Briefwechsel Thorwaldts gedacht, unter denen der Korrespondenz mit Paul de Lagarde große Bedeutung zukomme. Von Kairo und Konstantinopel aus habe Thorwaldt oft fast wöchentlich Briefe mit Lagarde gewechselt; die Freunde hätten allerdings weniger Fragen der Orientalistik als die ethische und religiös-nationale Erneuerung des deutschen Volkes verhandelt.
Die Gründungsmitglieder der Gesellschaft und der Herausgeber, die sich in diesem Augenblick noch unerkannt unter den im »Kaiserhof« Anwesenden befänden, hätten sich nach Beratschlagung an Ort und Stelle entschlossen, den drängenden Forderungen der Zeit entsprechend in einer ersten Abteilung von vier bis fünf Bänden Thorwaldts Schriften über die kulturelle, moralische und wissenschaftliche Mission des Deutschtums in der Welt und im europäischen Osten herauszugeben. Hier wäre der Essay über »Deutsche Vorposten in Galizien, Wolhynien und an der Wolga« hervorzuheben. Beim heutigen Stand maschinenschriftlicher Texterfassung nach System Adler, meinte Professor Dahn, dürfte die Herausgabe dieser ersten Bände in rund sechs Jahren abgeschlossen sein. Der Fortgang der Edition und die Wahl der Themen richteten sich nach der Reaktion des kritischen Publikums und den Bedürfnissen der Zeit.
Zum Schluß gab Professor Dahn die Namen der Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sowie des Herausgebers bekannt. Es ist dies Dr. Oswald Spengler. Aus Blankenburg stammend und – durch den dunklen Harz und die eichenstarken Ith und Hils getrennt – fast ein Landsmann auf Distanz Thorwaldts, des in Hameln im Hause des Münster-Hauptpastors Geborenen, werfe Dr. Spengler alle wissenschaftlichen Voraussetzungen, gepaart mit einer besonnenen Verehrung für den bis heute verkannten Kulturphilosophen und Historiker, in die Waagschale. Thorwaldt habe sein Werk unter das nietzschesche Motto »Der Übermensch ist der Sinn der Erde« gestellt, womit dessen Wurzel in der Praxis aufs schönste ausgesprochen sei. Als epigraphischer Experte bei der Entzifferung von Thorwaldts schwer lesbarer Handschrift habe Gymnasialdirektor i.R. Dr. Thassilo Unmüßig aus Bayreuth gewonnen werden können. Die Gesellschaft werde, wann immer möglich, ihre Jahrestagung auf den Frühlingsanfang legen.
Somit, umsichtig vorbereitet und unter der Schirmherrschaft des Kaisers und der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, könne die Arbeit an der historisch-kritischen Ausgabe der Werke dieses deutschen Denkers und Praktikers schon Mitte Jahr aufgenommen werden, sobald Dr. Spengler seine Stelle in Hamburg verlassen habe. Ihm, dem Präsidenten, bleibe nur noch, dem Bergmann, welcher demnächst seine Stollen in dieses Gebirge deutschen Urgesteins – womit gleich ein Lieblingsbegriff Thorwaldts angesprochen sei –, deutschen Wesens, Seins und Denkens vortreibe und in dessen Kuxen die goldhaltigen Erzadern aufschließe, ein herzliches »Glück auf!« zuzurufen. Warmer Beifall verdankte die Ausführungen Professor Dahns, und eine lebhafte Diskussion über die Dringlichkeit des Vorhabens und die Notwendigkeit, deutschem Geist und deutscher Wissenschaft mehr Nachachtung zu verschaffen, bahnte sich unter den Gelehrten an.
Da klopfte Professor Wilamowitz, der Nestor der klassischen Philologie, vernehmlich an sein Glas, und Stille trat ein. Er sprach leise, doch um so hörbarer. Er habe den Eindruck, daß er entweder der einzige sei, der die publizierten Aufsätze wirklich gelesen habe, oder dann, was er nicht hoffe, ihm als einzigem unter den Geladenen vieles in Thorwaldts Geschichtskonstrukt und Gedankenwelt fremd sei, vor allem dessen deutsch-nationales Sendungsbewußtsein. Fern sei es ihm, Wilamowitz, dem Herausgeber oder dem wissenschaftlichen Beirat dreinzureden. Er möchte nur die ihn störende Tatsache anmahnen, daß Thorwaldt den Alldeutschen von Schönerers sowie der Deutschsozialen Reformpartei unheimlich nahe gestanden habe, und das von Treitschke in den Preußischen Jahrbüchern Publizierte zeuge von einer deprimierenden Vorurteilsbehaftetheit in der Rassenfrage. Ebenso von einer im Alter zunehmenden Einengung des Blickfeldes auf Kaiser, Reich und Vaterland, beides Krankheiten, die er in den letzten Jahren immer unheilbarer habe um sich fressen sehen. Ein Krebs, der ständig neue Metastasen bilde. Ihm, Wilamowitz, sei daran gelegen, daß zumindest ein Geladener hier und heute mit seiner freien Meinung nicht hinterm Berg gehalten habe.
Die Reaktion auf Wilamowitz’ Wortmeldung war geteilt, ein gewisses Mißfallen auf vielen Gesichtern unübersehbar. Professor Dahn dankte kurz und versicherte, daß der Herausgeber, so wie er ihn kenne, den Bedenken des Herrn Wilamowitz in den Kommentaren zweifellos Rechnung tragen werde. Spengler selbst verwahrte sich nicht ohne Heftigkeit gegen Wilamowitz’ »Unterstellungen«. Thorwaldts tragisches Geschichtsbild sei eines Nietzsche würdig. Hans Delbrück wiederum trat zu Wilamowitz und drückte ihm herzlich die Hand: Was der Mann an den Europäischen Geschichtskalender eingesandt, habe er ausnahmslos zurückweisen müssen, und was er, Delbrück, im Lippischen Arminius und im Braunschweiger Dankwart von Thorwaldt gelesen, sei um kein Haar besser gewesen. Auch die Herren Cassirer, Conrady, Eucken, Haeckel, Scheler und Weber hoben ihre Gläser auf die klaren Worte, und Eucken bemerkte, der Philosoph müsse in jedem Fall das Falsche vom Verschiedenen zu unterscheiden wissen. Herr Karl May versicherte, Thorwaldts Ehrenhaftigkeit und ethische Größe stünden über jedem Zweifel. Herr Dehmel wiederum gab der Hoffnung Ausdruck, daß der glühende Denker Thorwaldt sicher nur im gut vaterländischen Sinn und Geist habe irren können; er selbst habe allerdings kein Wort gelesen; dies wiederum entlockte Gerhart Hauptmann ein beifälliges Nicken und das Schiller-Zitat »Du sprichst ein großes Wort gelassen aus«. Geteilt in zwei lebhaft diskutierende Gruppen, verweilte man noch eine Weile und ging dann auseinander.
»Im Winkel«, 1. Stimme:
Paula
Haben Sie noch eine Schiefertafel gesehen? Auf der Vorderseite ist sie liniert, dort durften wir schreiben; drehten wir sie um, mußten wir uns durch die Häuschen rechnen. Der lange dünne Schiefergriffel ist mir beim ersten Nachspitzen zerbrochen, da ich ihn am Hinterende gehalten hatte, das ist mir eine kleine Lehre gewesen, dann der Schwamm und das Schwammtöpfchen. Zur Schule gehen dürfen, selbständig, die Tür hinter sich schließen, für einige Stunden nicht zu Hause: Mir war’s, ein Tor sei aufgestoßen, ich trat ins Helle, es gab so viel zu lernen und zu begreifen, Schönes und Schwieriges, und mir wurde geholfen dabei. Ich habe Herrn Winiger verehrt. Wie er gelacht hat, wenn wir Dummheiten machten. So haben wir sie ihm zuliebe bleibenlassen. Er hat spannend erzählt, und wir durften alles fragen. Manchmal sagte er: »Das weiß ich auch nicht, das muß ich zu Hause nachsehen, ich sag’s euch morgen. Merkt es euch: Kein Mensch weiß alles.« Ich malte Buchstaben, wischte sie weg, und wieder füllte sich die Tafel mit diesen runden und eckigen Tieren. Sie kratzten, doch jedes wußte seinen Laut. Das S war ein Sauschwänzchen, doch hörte ich sein Sausen in mir drin. Mein Staunen hat sich nie ganz verloren. Ich habe die Tafel am Holzrahmen festgehalten, damit sie nicht von der Kippschräge des Pults rutschte oder davonflog. War sie rauh gekratzt, so daß sie nur noch hustete, wenn sie etwas sagen wollte, der gespitzte Griffel in Kerben steckenblieb und die Buchstaben am falschen Ort Ecken ansetzten, bekamen wir eine neue. Herr Winiger hat nicht geknausert. Auch später, in der dritten Klasse, als wir wie die Großen in Hefte schrieben, ist’s mir gewesen, in den weißen Seiten versteckte Sätze tauchten an die Oberfläche und begännen zu reden. Ich schrieb fürs Leben gern.
»Paula wäre eine ausgezeichnete Lehrerin«, hat Herr Winiger zu meinem Vater gesagt, »sie sollte die Bezirksschule und das Seminar besuchen.« – »Und die Kosten?« Der Vater schüttelte den Kopf. Ich war traurig, und ich glaube, Herr Winiger nicht weniger. »Es gäbe doch Stipendien.« – »Stipendien? Ich will keine Almosen. – Rückzahlbar? Das wär mir das Rechte, wenn Paula mit Schulden anfinge.« Zu Hause hatten wir nur den Christlichen Hauskalender abonniert, und ich habe die kurzen Erzählungen fast auswendig gewußt, die Heiligenlegenden, die seltsamen Begebenheiten aus aller Welt und hie und da ein Gedicht, über die Kirschenlese vielleicht oder einen Bauern, der sich weigerte, den Stall sauber auszumisten. Einfältiges Zeug, doch da es geschrieben stand, war es mir heilig. Die Eltern haben mich machen lassen, weil ich meine Hauspflichten erledigte, und je mehr ihrer wurden, desto weniger Zeit hatte ich. In den letzten Schuljahren hat mich dies oft bedrückt. Wie gerne hätte ich mehr gelernt. Von Afrika, vom Nordpol oder von Kaiser Napoleon.
Als ich zu Leonz in den »Winkel« gezogen bin, hab ich mir von meinem Haushaltsgeld jedes Jahr so viel zurückgelegt, daß ich mir auf Weihnachten ein Buch kaufen konnte. Ich bin dann nach W. oder B. in die Papeterie gegangen, erst mit Leonz, der das Rad neben sich herschob, später in Begleitung eines größeren Kindes, das mir die Einkäufe tragen half, und habe mir die
Bücher in ihrem schmalen Gestell angeschaut. Was einen schön oder fremd klingenden Titel hatte, habe ich herausgezogen und angeblättert. Das meiste hat mir wenig gesagt, vielleicht hab ich’s nicht begriffen, oder dann war es mir zu fromm und langweilig. Das nächstemal bin ich in die andere Papeterie gegangen. So habe ich das Schatzkästlein von Hebel gekauft und herausgefunden, daß viele seiner Geschichten in unserem Kalender gestanden hatten, dann Erzählungen von Gottfried Keller, das Juramareili von Paul Haller.
S het einischt ame lange Summersundig
Am Himel no kes Stärndli vüre welle …
Als ich den Bauernspiegel von Gotthelf las, habe ich mich gefragt, wie Menschen so böse sein können. Johannes von Jakob Schaffner und Hesses Demian hat mir der Papeterist empfohlen. Auch Stücke von Gerhart Hauptmann habe ich mir gekauft. Dann wieder fielen Jahre, wo es nicht gereicht hat: die Kinder krank, neue Kleider und Schuhe, denn immer kann man nicht nachtragen, einmal lohnt das Flicken nicht mehr, oder die Kartoffeln verregnet, das Obst verhagelt. Die Hostert (Baumgarten), der Hühnerhof und der Garten sind meine Verantwortung gewesen. Oder die Zeitläufte waren nicht danach wie im Ersten Weltkrieg, da Leonz monatelang im Militärdienst gewesen ist und mir jede Woche geschrieben hat – die Postkarten habe ich noch – und ich mit den Kindern den Hof habe besorgen müssen.
Jetzt erzähle ich Ihnen etwas, das Sie mir vielleicht nicht glauben werden. Ich wollte nicht nur, daß meine Kinder hübsch angezogen und gesund waren; ich habe sie immer angehalten, ihre Zähne zu putzen, und habe ihnen daher alle Vierteljahre eine Zahnbürste gekauft. Sie müssen das wörtlich nehmen. Hans, Greti, Leni und Willi haben diese eine Zahnbürste miteinander benutzt, und Ende der Woche habe ich sie jeweils ausgekocht; statt der Zahnpasta haben wir Holzasche gebraucht. Am Samstagabend oft bis Mitternacht habe ich die Kleider für alle gerichtet, jedem seine Unterwäsche, Hemd, Socken, Taschentuch, ein kleiner Stapel. Am Sonntag bin ich ins Hochamt gegangen, und die beiden Mädchen haben das Mittagessen gekocht. Der Sonntagnachmittag hat mir gehört, ich habe eine oder zwei Stunden in der Stube oder im Garten gelesen. Verstanden hat dies niemand; Leonz hat es gutmütig auf sich beruhen lassen. Andre sagten: »Die will offenbar hoch hinaus, aber gereicht hat’s doch nicht. Was das kostet!« Ich habe mich um das Geschwätz nicht gekümmert. Schon den Samstag durch ist mir feierlich zumute gewesen auf den Moment, da ich mein Buch aufschlagen würde: Wie geht es weiter? Mit welcher Stimme spricht es? Und wenn etwas Unnötiges dazwischenkam, irgendein dummer Besuch hereingeschneit ist und losgeschnattert hat, bin ich richtig böse geworden.
Vielleicht denken Sie, wir hätten wenig vom Leben gehabt. Mir ist es nie so vorgekommen. Sicher habe ich mir dies und jenes gewünscht, zum Beispiel ins Theater zu gehen, Rose Bernd von Gerhart Hauptmann, aber ich hätte vielleicht geweint und die Leute gestört. Also ist es wohl besser unterblieben, auch hatte ich zuviel zu tun. Es war aber nicht nur eine Last. Wie soll ich es Ihnen klarmachen? Die Tage waren randvoll, und das war vielleicht gut. Den Schrecken vor den Gewittern hier im »Winkel« habe ich nie verloren.
Natürlich habe ich mir auch ganz andere Leben vorgestellt: daß ich Lehrerin geworden wäre oder als Fürstin von Stadt zu Stadt, von Schloß zu Schloß reisen würde wie im Märchen, in einer goldenen Kutsche mit Schellenpferden und nicht nur auf dem Ladewagen mit unserer »Fanny«; sie ist ein gutes Pferd gewesen, starkknochig, langsam, wie Gäule sein müssen. Als ich mit acht oder neun Jahren zum erstenmal in ein protestantisches Dorf gekommen bin und gehört habe, daß die Falschgläubigen – unser Pfarrer hat sie so genannt – genau gleich redeten wie unsereiner und die Nase wie wir mitten im Gesicht und keine Hörner hatten, ist mir auch das eine Lehre gewesen. Vielleicht gibt es Ihnen eine Vorstellung, wie ab dr Wält wir damals waren. – Gewiß, es gab viel Plackerei; an gewissen Abenden im Heuet, zur Ernte oder im Herbst, wenn die Rüben geputzt werden mußten, bin ich mir wie eine zerschlagene Puppe vorgekommen. Und doch denke ich, wir haben ein reiches Leben geführt. Ich meine: Der Ort im Waldwinkel, das Haus und die Felder, die Bäume, der Garten, die Tiere und das entfernte Dorf sind so etwas wie unser Eigen gewesen, erfüllt mit unserem Gehen und Kommen, unserer Arbeit und Sorge, den Gesprächen mit den Menschen, dem Meßgang, dem Turnverein. Am liebsten sind mir die Morgenfrühen im Frühling und Sommer gewesen, wenn es blau oder grau oder rötlich über den Wald hereindämmert und die Vögel erwachen, und es im Gras plötzlich blitzt und flimmert. Das hat mir geholfen, Mut zu haben und weiterzumachen. Ich denke, es ist wichtiger gewesen, als an irgendeinen Satz aus dem Katechismus zu glauben. Aber Leonz hat das Kreuz immer in der Ecke des Ackers gezogen, die Jerusalem am nächsten liegt.
Jakob Lanz 2:
Das Armenhaus
Noch immer hob, schob, rückte und schraubte Lanz am Stativ, das schwarze Tuch schlenkerte zwischen den drei Holzbeinen und erschlaffte. Irgend etwas stank herüber, über das blendend weiße Staubsträßchen und ein verunkrautetes Dreieck Garten hinter einem schief eingebrochenen Bretterzaun. Nun, es war Hochsommer, im August stanken die Dörfer immer, nach Mist, Gülle, nach in ranzigem Fett gewendeten Bratkartoffeln, nach Küchen- und, was das schlimmste war, Fleischabfällen, die einfachheitshalber hinter die Zäune und Hecken geworfen wurden, den Füchsen, Katzen und Krähen zum Fraß und dem Nachbarn zum Ärger.
Lanz schwitzte, nahm seinen Hut ab und hängte ihn an einen Knopf des Wamses, an dem auch die goldene Uhrkette befestigt war. »Ii au! Ii au!« – Für eine heiße ratlose Minute hatte er die Schar barfüßiger Jungen vergessen gehabt, die um ihn herum stöberte, fuchtelte, schrie, verschorfte Knie und Beine, nicht abzukratzende Schmutzkrusten, und eine Sekunde lang sank ihm der Mut, er sah den Dreck an Kinderbeinen und zwischen geschwollenen Zehen wandern bis in die fernste Zukunft. Alle, wohl ein Dutzend, wollten unter das schwarze Tuch, alle wollten aufs Bild. Einzig ein vielleicht zehnjähriges Mädchen in einer groben Schürze mit einem Hemdenmatz auf den Armen hielt sich still im Hintergrund, ihr verschmiertes, hilflos staunendes Gesicht, des Kleinen Rotznase.
Bereits hatten sich die meisten Fenster des dreistöckigen Strohdachhauses geöffnet, grauhaarige alte Frauen in Überwürfen aus verwaschener blauer Baumwolle, Männer in lumpig ausgebeulten Kitteln, einer hielt ein langes Messer gegen die Sonne, ein Blitz fiel ins Objektiv, eine jüngere Frau, deren roter Haarschopf wie Feuerflammen abstand, stillte ihr Kind. Bestes Nachmittagslicht, die Schatten der Pfosten, der Fensterstürze und der Dachschrägen fielen nicht zu lang; hart und genau gliederten sie das Haus, und Lanz dachte, in besserem Zustand wäre es ein vornehmer Bau. Das Weib beugte sich vor wie aus einem Weihnachtskalender, sie wäre Maria mit dem Jesuskind, denn zufällig schien die Giebelkammer ihr zugewiesen zu sein. Plötzlich hatte er den Eindruck, der Frau schon anderswo und vor nicht allzu langer Zeit begegnet zu sein; es war einer der letzten Aufträge fürs Oberlichtzimmer gewesen, kein Isler oder Bruggisser, sondern irgendein liebestoller Großbauer. Und jetzt stand sie dort. Das war rasch gegangen; er schüttelte den Kopf.
Lanz warf sich das schwarze Tuch über, das Atmen in der staubigen Hitze kam ihn schwer an, und beim letzten Richten und Rücken des Objektivs merkte er plötzlich, daß eine Senkrechte zu finden unmöglich war. Das Haus stand schief, das wußte er, doch war es derart zur Seite gesunken, eher nach allen Seiten am Auseinanderbersten, daß eine Senkrechte plötzlich als Beleidigung erschien. Fragt sich nur für wen, brummte er; eine Beleidigung oder eher eine Anklage. Er entschloß sich, die eine Sonnenblume im Unkrautgarten als Senkrechte zu wählen, mochten dann die Wände schief stehen. Dies war die Wahrheit, nach der er sein Fotografenleben lang unterwegs gewesen war, die er nie gefunden hatte und jetzt, mit sechzig, noch zu fassen hoffte.
In diesem Moment wußte er auch, was da vor sich hin stank, säuerlich-krautig, schal-faulig, feucht-gruftig, schimmlig und nach kaltem Ruß: es war die Armut; schließlich war dies das Armenhaus des großen Dorfes W., wo er sein Lebtag einen zweifenstrigen Laden geführt hatte, von dem er recht gut lebte, dank der Privatkundschaft, der Industrie, ihrer Herren und einem Hinterzimmer für heikle Aufträge. Er drückte ab und schob eine zweite Glasplatte nach. Da fuhr eine Kinderhand groß und unscharf ins Bild. Er wurde nicht mal wütend, er war wohl zu erschöpft; er sagte nur: »Bliib grad so schtoo, wie d’bisch«, drehte am Objektiv, bis die Hand scharf zeichnete – vier Warzen, dem Kleinfinger fehlte das vorderste Glied. Er drückte nochmals ab.
Die Fürstin 1:
Der Dobrotsch
Wien, 13. Jänner 1909
Nach Neujahr war ich am Ende meiner Nerven. Die Weihnachtstage hatte ich auf Max’ westungarischen Gütern auf Schloß Körmend verbracht und unter dem Porträt des 1849 erschossenen Lajos Batthyány mit den Armen gefeiert, etliche hundert Kinder und alte Leute. Der Geistliche sprach einige Worte, Weihnachtslieder auf Ungarisch, Deutsch und Kroatisch, dann ging ich herum und verschenkte Tücher, Unterröcke, Strümpfe, Schokolade (!), was weiß ich. Mein Cashmere-Schal hatte mehr gekostet. Sie küßten mir alle die Hand und segneten mich, anschließend stapften sie durch Nacht und Schnee nach Hause in ihre Hütten aus Strohlehm und Brettern, einige zwei Stunden weit. Max war zufrieden, ich schämte mich. Statt daß man ihnen fünf Joch eigenes Land überlassen und an jeder Ecke einen Apfel- und einen Birnbaum pflanzen würde! Max sieht das anders; er meint es nicht böse, doch er liebt die ausgetretenen Pfade. Ich hasse sie und habe das Gefühl, ich müsse ihn ›bessern‹. Daß er nichts dafür kann, vermindert das Stoßende nicht. Warum kann ich üser Lüt im Bernbiet nicht vergessen? Ich bin doch schon sechs Jahre verheiratet.
Und an Silvester war Kaiserdiner in Schönbrunn, wenige Frauen, zwei Erzherzoginnen, Fürstin Lilly Kinsky, die alte Fürstin Pauline Metternich, Fürstin Fürstenberg, Betka Potocka und neben mir gottlob Daisy Pless mit ihrem stattlichen Mann – »Gotha«-Typ, auch in den steifen Umgangsformen. Daisy leise: We are the two beauties. Das hat mir wohlgetan. Dann tauschten wir unsere Erfahrungen als Weihnachtsengel aus, sie in Fürstenstein und Waldenburg, ich in Körmend und Steinamanger. Wir aßen von goldenen Tellern, am Fuß der Portieren, in den Ecken des Speisesalons, und auf den Tischen blühten die Orchideen weiß, rosa, violett. Majestät erhoben sich um elf, und damit waren wir aus der Pflicht dieses Jahres entlassen. Nein; im Stadtpalais erwarteten uns die zwölf Lakaien und ebenso viele Mägde auf der Haupttreppe, jene in blauweißen Livreen, diese in Tiroler Dirndln, um uns ein gutes Neujahr zu wünschen. Erneute Bescherung. Im Salon sprachen Max und ich bis morgens um zwei über die militärischen Hotzenplotze, die auf einen Präventivkrieg gegen Serbien versessen scheinen. Mir kommt dies vor, als ob die Blinden die Lahmen in den Krieg führten. Max’ Kommentar: »Der Conrad ist halt nicht von altem Adel.« Und als ich unwillig lache: »Esch doch woa!« – »Natürlich stimmt’s, doch du könntest genausogut sagen: Seine Haarbürste hat keinen silbernen Griff.« Darauf Max, der immer für Überraschungen gut ist: »Hat sie nicht, nur Hirschhorn mit eingraviertem Monogramm, ärarisch, obligatorisch für alle Offiziere im Generalsrang, ebenso das gesamte Haarbesteck.« Was läßt sich dazu sagen?
Für unsern Urlaub von Wien hatte Seidl, unser Wiener Generaldirektor, bereits vorgesorgt. Die K.K. österreichische und die Königl. Ungarische Staatsbahn erwiesen uns ihre alte Gewogenheit, unsern kleinen heizbaren Salonwagen an die Züge anzuhängen. Am 3. Januar bereits fuhren wir ostwärts, hinaus in die weiße Wüste, wie Max es nennt, das weite Land in Eis und flockigem Tiefschnee, der unsern Wagen am Zugschluß in sausende Pulverstaubwolken hüllte. Eine Jahreszeit, die mich beglückt.
Die Kinder wußte ich aufgehoben in der Obhut von Fräulein Courvoisier und Herrn Waser; der Abschied von Klein-Eduard ging allerdings nicht ohne Tränen ab, Mári war zu klein, um unsere Abwesenheit zu bemerken. Im Wagen konnte ich wieder aufatmen: zwei von der Wiener Werkstätte den Bedürfnissen angepaßt möblierte Gastzimmer auf Rädern. Jedes Ding steht am richtigen Platz, keines scheint – wie das bei vielen Menschen der Fall ist – das Gefühl zu haben, es werde nicht gebührend beachtet und müsse auf sich aufmerksam machen. Die Seifenschale erwartet die Hand, wo man ohne hinzusehen nach der Seife greift, die Vertiefungen im Klapptisch unter dem doppelten Fenster finden sich dort, wo ein Trinkglas zu stehen kommt; die Kommoden, Stühle und Schränke sind schlank und einfach, der hellbraune Parkettboden wärmt.
Pips Schey hatte uns für eine Nacht auf sein Gut Kövecsespuszta eingeladen; wir wären am Bahnhof Szered mit dem Wagen abgeholt worden. Doch ich war zu müde, und Max, der gerne einen Abend mit Pips über Anekdoten verplaudert hätte, tat mir die Liebe, abzusagen. Was er allerdings nicht begriff, doch geschehen ließ: daß ich meine Adele für die paar Tage in den Urlaub bei den Eltern in Schwaz entlassen hatte. Nun, wofür haben wir gelernt, uns selbst zu waschen, anzuziehen und zu frisieren?
So wurden wir in Neuhäusel für die Nacht auf ein Abstellgleis geschoben, ließen uns das Paprikagulasch aus dem Bahnrestaurant in den warmen Wagen bringen und schliefen in unseren eigenen Betten. Zum zweitenmal umrangiert wurden wir am folgenden Vormittag in Altsohl, und es war mir ein Vergnügen, vom Band 5 des Kronprinzenwerks[1], den ich mit auf die Reise genommen hatte, für eine Weile aufzuschauen und das Treiben auf den bescheidenen Bahnhöfen zu beobachten: das Kommen und Wegfahren der Bauernschlitten, die dampfschnaubenden Pferde, die Eile der Kaufleute in Pelzmänteln, der frierenden Handlungsreisenden, die gewichtig weisenden Gesten der ihrer Bedeutung bewußten Bahnhofsvorstände, dann schweifte der Blick über rauchende Hochkamine, die bald zurückblieben, an die allmählich höher steigenden, eisgrau verschneiten Waldflanken des Gran-Tals. Nach Altsohl wand sich der Zug langsamer, auf holprigen Gleisen tiefer und höher ins Gebirge hinein: mir eine Herzlandschaft, obwohl ich sie erst nach der Heirat kennengelernt habe.
Auch Max freute sich ohne viele Worte auf das Ziel unserer Reise, das kleine Jagdschloß im oberen Schwarzwassertal hinter Bries oder Brschezno, wie die slowakischen Bauern und Köhler es nennen. Vom Dobrotsch aus würde er mit Janko Husak, dem Oberjäger, nach Lust und Laune durch den Urwald hinter Wild und Wolf herstapfen und, selbst ein Luchs, äugen, lauschen, ansitzen und am Abend Jankos Frau mit den Komplimenten des Bärenhungrigen glücklich machen. Ich hatte bereits am Neujahrstag ein Telegramm an den Gutsverwalter Silber geschickt. So würde uns das Jagdschlößchen für einige Tage in der Wärme seiner Holzwände beherbergen. Heimann Silber müßte Gold heißen, dieser getreuste Johannes aller Schaffner, er wäre der beste Freund unseres Fritz Friedli auf Gerzensee. Was man seiner Sorge anvertraut: keiner könnte es besser betreuen und ausführen. Max sagt, die Pacht des Krugs und der Branntweinbrennerei sei ein einträgliches Geschäft. So lieb ich ihn habe: Max und seine Adelsclique verstehen von Menschen, die nicht ›dazugehören‹, weniger als vom Schwarzwild. Und das Schlimme: Es fällt ihnen nicht auf, daß sie auf einem Auge blind sind. Wie lange noch? Ein Tanz auf dem Vulkan, wie Daisy Pless sagt – und sie wohnt immerhin in Schlesien. Allerdings scheint das Elend der Bergarbeiter dort jedes Maß zu übersteigen; sie erzählte mir von Familien, die selbst nach zwanzig Jahren eine Schuld von 150 Mark, eingegangen, um die Aussteuer zu kaufen, nicht zurückzahlen können und aus den Hütten geworfen werden. Wir beide kommen von außen.
Mir ging es weniger um Pirschgang und Schlittenfahrt als um das Dorf Tschierny Balog, das einige Meilen talauswärts vom Dobrotsch liegt. Dort sollte das Fest der Epiphanie Christi, also der Dreikönigstag am 6., noch mit der Einholung und Weihe des Wassers begangen werden, unter Anteilnahme der ganzen Bevölkerung und in tiefster Andacht. So das »Kronprinzenwerk«, eine der Anschaffungen, deren Nutzen ich (im Gegensatz zu Kutschen, Pferden und Roben) dem guten Max nie habe klarmachen können. Wann immer er mich bei der Lektüre überrascht, nötigt ihm dies einen mitleidigen Liebesblick ab. Adolf Pechány, der Autor des Kapitels über die oberungarischen Slowaken, vermutet orthodoxen Einfluß aus Gyetva im oberen Szalatna-Tal über den Kriváner Paß hinweg; hatte König Matthias Corvinus am Südfuß des Polana-Gebirges doch Serben aus Bosnien angesiedelt. Wahrscheinlich habe sich diese ostkirchliche Zeremonie, vermittelt von eingeheirateten Frauen, im abgelegenen Schwarzwassertal eingebürgert. Seit langem war es mein Wunsch, Epiphanias unter meinen Leuten aus dem Dorf und den außenliegenden Wald-Puszten zu feiern. So vertiefte ich mich während der Fahrt immer neu in die Schildderungen dieses unvergleichlichen Werkes; Max dagegen schlief oder plauderte im andern Abteil mit dem Leibdiener Franz beim Schmieren und Einölen seiner Jagdausrüstung und unterzog diese auch gleich der ersten Probe, indem er den einen oder andern Schuß zum Wagenfenster hinaus in die Wälder jagte.
Hinter Neusohl verengt sich das Tal; die Gegend erinnert ans Gurnigelgebiet und den Schwefelberg; weniger schroff als Gantrisch und Nünenen, doch einsamer, wilder. Die Dörfer versanken unter Schneekappen, so wie ich mir als kleines Mädchen den Stall des Christkinds vorgestellt hatte, die Schornsteine rauchten, zwischen den Schneewällen der Talstraße konnte ich hie und da Pferdeschlitten ausmachen. Sonst war das Land ausgestorben, und die kleinen hölzernen Bahnhöfe im Tirolerstil schienen zu schlafen, wenn nicht ein Reisender tief vermummt ausgestiegen und der Vorstand an unsern Wagen getreten wäre und ein gutes neues Jahr gewünscht hätte; offenbar waren wir von Station zu Station telegraphisch vorangemeldet worden. In Brschezová rauchte das lang an der Gran hingestreckte ärarische Eisenwerk aus allen Schloten. In Bries erwartete uns Heimann Silber mit dem Schlittengespann, sein kluger Kopf wuchs aus dem Pelzkragen über dem rot gestickten Lodenmantel, es wurde umgepackt, der Salonwagen in seine Remise geschoben. Reine Kälte. Es war drei Uhr und eine funkelnde Lust, unter dicken Pelzen hinter Schellenpferden kutschiert zu werden. Zunächst auf den Hügelrücken hoch, der das Schwarzwasser-vom Gran-Tal trennt; ich drehte mich um und winkte dem Djumbir, dem Herrn dieser Gebirgslandschaft; an diesem Tag blendete sein Zackenkamm wolkenfrei über den grauweißen Bärenwäldern. Dann zum Schwarzwasser hinab; über dessen sich verengender Waldschlucht hingen, weit im Nordwesten, die Rauchschwaden des Guß- und Emaillierwerks von Hronec rotbraun in der Sonne.
Die Wälder gingen gegen die Grate in höckrige Felsmassive über, segelgroße Fahnen glitzernden Schnees, wenn sich einer der Fichtenfittiche unter der späten Sonne seiner Überlast entledigte. Ein Glück. Und wieder schmerzte mich, daß ich nicht hatte studieren dürfen. »Il ne te faut pas étudier, du bist mehr als hübsch und reich genug«, sagte Papa, der doch ein verständnisvoller Vater gewesen ist. Den Doppelsinn seines Ukasses bemerkte nur ich. Sicher brauchte ich nicht. Hätte ich gedurft! – »Und dann?« – »U de hesch e liebe Maa u gfröiti Ching.« Archäologie, Geschichte und Ethnographie. Bei Dörpfeld in Troja oder in Pergamon …! Statt dessen habe ich Klavierspielen, Zeichnen, Singen, Tanzen und französische Konversation gelernt und daß der Herr Gemahl zweimal am Tag Fleisch und zum Frühstück hartgekochte Eier oder Rührei, zur Jagdzeit Würste und gebratenen Speck vorgesetzt bekommen müsse.
Wir fuhren nun im Tal des Schwarzwassers entlang der Holzfällerbahn und zwischen den kilometerlangen Stapeln unserer Sägereien in Tschierny Balog; die kleinen Lokomotiven mit den riesigen Funkenfängertöpfen lagen still und kalt, die niedrigen Kamine qualmten braun in den tiefblauen Himmel, und Max begann mir auseinanderzusetzen, warum er das herrschende, ideale Wetter für die Pirsch auf Schwarzwild und Wölfe geradezu prophetisch vorausgesagt habe. Nach einer Viertelstunde der Schwarzen Gran entlang tauchten die pseudogotischen Holzzinnen des Jagdschlosses aus dem Tann, und wir bogen ins Rondell ein, wo der Schnee so tief lag, daß der freie Platz vom Wild gemieden wurde. Endlich, nach achtzehn Stunden Fahrt und einer Übernachtung, waren wir wieder zu Hause.
Am 6. Januar fuhr mich noch vor Sonnenaufgang Janko Husak im einfachen Schlitten, da ich nicht auffallen mochte, nach Tschierny Balog hinunter. Aus den zwischen die Tannen getunnelten Waldpfaden schnaubten Gefährte von den benachbarten Puszten, und ich stellte fest, daß wir uns nicht unterschieden, hatten die Bauern den Pferden doch das beste Geschirr angelegt und trugen ihre Festtagskleider: Pelzmützen, feste dunkelblaue Lodenmäntel mit Pelzbesatz und Lederstickerei, Handschuhe; die Frauen hatten sich dunkelblaue, mit Pelz verbrämte Wämser um die Schultern geworfen und weiße gestickte Kopftücher umgeschlungen; sie waren überlang, und ihre Enden schleiften im Schnee. Ich hatte mit Janko vereinbart, daß er mich um die Mittagszeit bei der Sägerei des Hrabovsky erwarten solle. Selbst trug ich einen dunkelblauen Lodenmantel, dessen Pelzkragen und pelzverbrämte Säume wie auch meine Pelzmütze mit roter Lederstickerei gefaßt waren; meine Füße steckten in schwarzen pelzgefütterten Stiefeln. Max hatte darüber gewacht, daß mir nicht allzu kalt würde, da ich lange werde im Schnee stehen müssen. Ich kam mir abenteuerlustig vor wie vor zehn Jahren, als ich mit ihm den ersten Besuch auf dem Dobrotsch abstattete. Ich stieg aus und schwenkte das Steingutkrüglein kräftig wie als Mädchen beim Milchholen im Fankhauser-Hof.
Diesmal schwiegen die Sägeblätter, kein Rauch quoll aus den untersetzten Schornsteinen der Heizhäuser, deren Dampfmaschinen im Winter, wenn das Schwarzwasser unter Eis schläft, mit der Energie von Spänen, Sägemehl und Strünken die Kraft für die Wellenbäume liefern. In der Kirche waren die Frauen noch am Beichten, andere knieten und murmelten ihre Bußgebete. Voran prunkten Silberstickereien auf Blau und getriebener Silberschmuck, blankgewichste, mit rotem Leder verzierte Stiefel, wohl Frauen oder Töchter von kleineren Sägereibesitzern oder großen Viehbauern. Weiter hinten stand anderen die Armut im Gewand und die Sorge im Gesicht. Reinliche Wäsche, Filzstiefel, doch meist verdunkelte Mienen, frühzeitig uralte Züge oder dann die Versunkenheit im Gebet. In der Kirche kein Mann.
Draußen war der Küster mit dem Ordnen der Prozession beschäftigt, Fahnen, auf die Christi Leiden, die Muttergottes, die Anbetung der drei Könige und Christus als Weltenherrscher gestickt waren, Tragkreuze mit dem Leib des Gemarterten; zwischen Kopf und Schultern, Armen und Brust schossen vergoldete, sich schlängelnde Strahlenblitze heraus. Die Monstranz, getragen vom Kirchenvorsteher, führte den Zug an, die Frauen und Mädchen mit den Wassergefäßen, kleineren Deckelkesseln meist, hielten sich im Hintergrund. Ich ging zu ihnen hinüber; mir war unbehaglich: Bin ich doch nicht im katholischen Glauben erzogen und spreche nur Küchenslowakisch. Einige Frauen hatten sich Pelzmützen übergestülpt, die jungen trugen mit Pelz besetzte Tiaren aus Stickerei und Klöppelspitzen: Königinnen von achtzehn Jahren, die auf den Prinzen warteten. So war ich nicht die vornehmste. Wir älteren würden, in Umhängen und Pelerinen, das demütig stapfende Fußvolk am Schwanz der Prozession bilden.
Nun erschien der Priester in seiner mächtigen dunklen Pelerine und Glockenkappe mit Pompon, und die Prozession stolperte über den unter dem Schnee gefrorenen Schlamm der Gasse dorfauswärts nach der wundertätigen Quelle, wie Janko mir erzählt hatte, die am westlichen Talhang austrat und, Wunderwirksamkeit halber, weder versiegte noch gefror. Wieder fühlte ich mich auf unsicheren Füßen fern und fremd. Vielleicht hatte ich zu viele Bücher unseres Dr. Freud gelesen; Pechány im Kronprinzenwerk hatte nicht gelogen, wenn er schrieb, das Dreikönigsfest werde unter größter Anteilnahme und Andacht der Bevölkerung begangen. Die Frauen sangen, sogar einige Männer fielen ein, die Litanei hing gleich einer klingenden klagenden Wolke über dem Zug. Ich blickte hinter mich: Noch immer schlängelte er sich unter den Schneelasten der weit über die Gasse auskragenden Dächer hervor. Auch aus den Häusern traten von allen Seiten alte Frauen, die den Prozessionsbeginn an der Wärme abgewartet hatten. Ein Nornenzug.
Mir fehlt jede religiöse Erziehung; mein Vater hat mir und sich selbst die Teilnahme am selbstgenügsamen und selbstgerechten Berner Staatskirchenwesen erspart. Was ich unterscheiden konnte, war ein unzählige Male wiederholtes »cor Ihesu« (nicht mal Latein kann ich!), und Max, der’s gelernt, doch über Keiler und Bache vergessen hat, übersetzte mir nachher stockend aus Franz’ Missale die Litanei vom Heiligsten Herzen Jesu, die an Epiphanias gesungen wird. »… Herz Jesu, König und Kern aller Herzen … Herr, erbarme dich, Christ, erbarme dich …«
Ach, wär dem so! Doch die Militärs möchten endlich wissen, wie viele Serben und Russen die neuen Kanonen und Mörser in Fetzen reißen können, sie sind wie verhext, verflucht sind sie; dieser ahnungslose Flachkopf Conrad von Hötzendorf. Und der Kaiser markiert den Steinernen Gast.
An der Quelle, in einer Einsenkung der ringsum bewaldeten Bergflanke versammelten sich die Wasserträgerinnen zu einem mächtigen Ring, und der Priester, der dem Küster die Lodenpelerine übergeben hatte, begann mit der Segnung der Schöpfenden und ihrer vollen Krüge. Ein Glück, daß die Quelle in einen Steintrog gefaßt ist, so konnten wir zu viert und fünft unsere Gefäße eintauchen, andernfalls wären wir noch am Abend angestanden. Darüber die Fahnen und Kreuze. Auch so ging es eine Stunde. Was ich gelernt habe: Welche Würde dem Quellwasser genommen wird, wenn man es durch Leitungen in die Häuser preßt. Es verliert eine Eigenschaft, die es mit andern ersterschaffenen Dingen gemeinsam zu haben scheint, mit dem Schnee, in dem wir fast bis an die Knie standen und froren, mit der eisigen stillen Luft, mit den goldenen Funken, welche die schon etwas höher gestiegene Sonne von den Fichtenästen sprühte. Als ich vor dem Priester stand, schwitzte er, und Erstaunen huschte über sein feistes Gesicht; den Segensspruch sprach er gleichgültig und müde. Ich schlotterte als einzige und war herzlich froh, als wir hinter Monstranz, Fahnen und Tragkreuzen her mit vollen Wasserkesseln den Rückweg antraten. Vom Talhang gesehen, schienen die Häuser begraben unter Schnee.
Auch in der Kirche war die Trennung der Männer und Frauen (links) die allerstrengste, und wiederum war ich beeindruckt von der Versunkenheit meiner Nachbarinnen, wann immer ich unmerklich den Kopf bewegte und vorsichtig den Blick schweifen ließ: von harten Falten gespaltene, auch finstere Bäuerinnengesichter, die Augen meist geschlossen und beim »Gloria patri« und »Credo« fast lautlos die Lippen mitbewegend. Zahnlose Kiefer, zu viele Kinder. Dann wieder die Lebenslust auf den rundlichen Gesichtern der jungen Weiber. Mir schien, die Größe der Köpfe stehe oft in einem Mißverhältnis zu den gedrungenen Körpern und auch mich treffe die Schuld daran, daß der ärmlichen Verhältnisse wegen, die eine Frau ihr Leben lang von Erschöpfung zu Erschöpfung treiben, etwas groß Angelegtes nicht hatte heranwachsen können, und ich sehnte mich schmerzlich nach der trotz aller Sündenpredigten unseres Pfarrers Liechti absolut mangelnden Glaubensinbrunst unserer Bäuerinnen. Zumindest waren sie ganze Menschen und verstanden von Grund auf ihr Werk von Tag zu Tag, und ich freute mich wie ein Kind auf meinen Osterbesuch zu Hause in Gerzensee.
Plötzlich fühlte ich mich ausgehungert, verzweifelt und sah unwillkürlich auf die Uhr – und die Frau links in der Kirchenbank rückte von mir weg. Zum zweitenmal erkannt als Betrügerin. Die Messe mahlte fort, und ich schalt mich, daß ich das goldene Ding abzulegen vergessen hatte – und konnte nicht mehr. Ich stand auf und verließ die Kirche; sogar das am Fuß der Kirchenmauer unter Hundert Kesselchen stehende Steingutkrüglein vergaß ich, vorsätzlich. Janko holte es am folgenden Morgen. Noch stand es dort, das längst erstarrte Wasser hatte es in Stücke gesprengt. Er brachte mir die Scherben – und einen kleinen bauchigen Krug aus Eis. Übrigens hatte er bereits bei Hrabovskys Sägerei zwischen den haushohen, eingeschneiten Bretterstapeln gewartet, selbst der Holzduft schien eingefroren. »Kommen’S, Durchlaucht, dacht mir’s doch«, und er half mir in den Schlitten. Ich brachte nicht mal einen Dank heraus, sank zähneklappernd in die Pelze und Felle und fand – einer von Max’ rührenden und vorsorglichen Einfällen (erfuhr ich später) – zwei Wärmflaschen.
Als Max mir beim high tea erzählte, daß er einem Zwölfender auf der Fährte sei und ihn morgen zu erlegen hoffe, spaltete sich meine Empfindung erneut: Erleichterung, der Dorfwelt entronnen zu sein, dieser täglich wiederkehrenden, aussichtslosen, dem Glauben ausgelieferten Plackerei – und zugleich Blutleere im Herzen, als stürzte ich im freien Fall durch einen Angsttraum.
Bohr – Rutherford, fiktiv.
Kopenhagen 1913
Lieber Ernest,
am Anfang steht der Glaube, mein Glaube an Dein Planetenmodell des Atoms. Zur Strafe bleibt mir nun die Theorie. Thomsons positiver Napfkuchen mit negativen Rosinen läßt keinen Raum, ist bürgerliche Statik. Doch die Linien im Spektrum der Elemente müssen wir als Bild von Energie in Stufen deuten: Elektronen kreisen auf verschieden fernen Bahnen um den Kern in fast unendlicher Leere. Er hält sie am langen Zaum, und die Stärke seiner positiven Ladung bestimmt ihre Zahl und weist ihnen den Ort. Im nicht geladenen Teil des Kerns vermute ich den Anfang des Betazerfalls, wie Du ihn nachweist. Ein Neutron baut sich ab zu Proton und Elektron; dieses zwingt – wie, weiß ich noch nicht – einen Kollegen zum Sprung von Schale zu Schale nach außen – oder es tut ihn selbst, und diese Strahlung sehen wir als Linie im Spektrum. Warum sie nur auf wenigen Frequenzen auftritt, darfst Du mich noch nicht fragen.
Wahrscheinlich gilt für solche Übergänge von Term zu Term keine uns bekannte Mechanik und Elektrodynamik; ihre Größe und die freigesetzte Energie könnte das Plancksche Wirkungsquant bestimmen. Nennen wir’s Wechselwirkung zwischen Kern und Schale. Ernest, die Chemie wird sich erklären lassen – als Mikrophysik. Newton und Maxwell haben ihre Gesetze für den Normalfall gemacht, das Vakuum, die stationären Atommodelle. Doch leider schläft die Materie nicht immer wie der Bär im Winter, irgendwo ist immer Frühling.
Wir müssen erweitern, wir brauchen ein Raum- und Zeitkonzept der Physik, das nicht beim ersten Quantensprung in Brüche geht. Ach Gott, wir Wasserspinnen sollten von der Tiefsee erzählen! Tiefsee ist (noch) meine konsistente physikalische Theorie des Periodensystems der Chemie. Doch möglicherweise wird sie uns unter den Händen lichter. Du hast Dein Labor in Manchester, Ernest, du bist ein Bauernsohn. Also muß wohl ich den Gedanken spinnen. Deine Experimente können später vielleicht die Richtigkeit des hier und heute abend um elf von mir Assoziierten beweisen. Vorbehalten bleibt – und vorenthalten, immer –, die Wahrheit.
Mit freundschaftlichem Gruß
Niels Bohr
PS. Mein ceterum censeo: Kommst Du einmal nach Kopenhagen?
Die Zahl 1:
Zahlen zu Menschen
Eine der Volkszählungen, in denen ich mit ungeteilter Anteilnahme lese, ist im alten Königreich Ungarn durchgeführt worden, die letzte vor dem Zusammenbruch der Donaumonarchie, veranstaltet im Jahre 1910