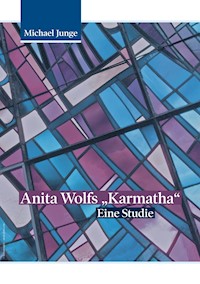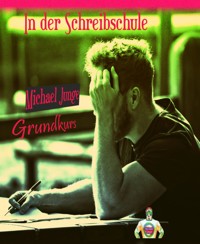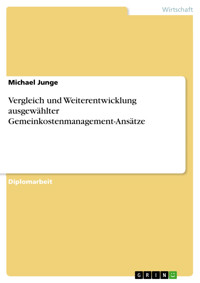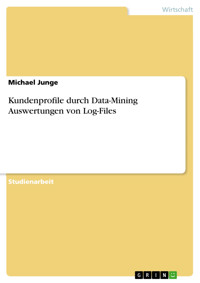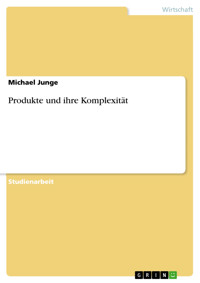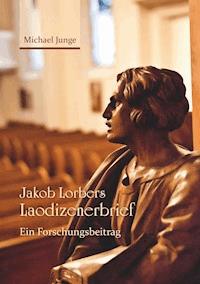
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Jakob Lorber (1800-1864) wird von seinen Anhängern als Neuoffenbarer verehrt. Zu seinem umfassenden religiösen Werk zählt auch der Laodizenerbrief. Die "lebendige Stimme" wertet darin die Ekklesia ab und lässt für eine erfahrbare Spiritualität keinerlei Raum. Die vergleichende Analyse des zum Großteil aus abgewandelten Kolosserbrief-Versen bestehenden Laodizenerbriefs offenbart zahlreiche Ungereimtheiten und lässt Zweifel am proklamierten göttlichen Anspruch der Schrift aufkommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 82
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Michael Junge, geboren 1960 in Berlin, Verlagskaufmann, seit den Achtzigerjahren mit der Neuoffenbarung Jakob Lorbers vertraut.
Kontakt: [email protected]
Geleitwort
Wie viele antike Schriften gilt auch der Brief an die Laodizener als verloren. Im Neuen Testament wird er erwähnt, aber er ist dort nicht überliefert.
Zugang zu dieser Schrift soll eine „Neuoffenbarung“ eröffnen: Der steierische Musiker und „Schreibknecht Gottes“ Jakob Lorber (1800–1864) will den authentischen Laodizenerbrief als Diktat von Jesus Christus empfangen haben. Anhänger seines Schrifttums sind bis heute davon überzeugt.
Michael Junge hinterfragt den Anspruch der Neuapokryphe Lorbers kritisch. Detailliert und umsichtig analysiert er die 140 Verse des Laodizenerbriefs und vergleicht sie mit dem neutestamentlichen Kolosserbrief. Dabei stößt er auf viele Widersprüche. Mit dieser Studie legt der Autor einen wichtigen Beitrag zur kritischen Auseinandersetzung mit dem von Lorber-Freunden erhobenen „Neuoffenbarungsanspruch“ vor.
Dr. Matthias Pöhlmann
Kirchenrat
Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, München
Vorwort
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. (Sprüche 3, 5–6)
Mit diesem Taufspruch wurde ich am 1. Januar 1961 in der Epiphanienkirche in Berlin-Charlottenburg in die Ekklesia, die Gemeinde der Gläubigen, aufgenommen. Welche Rolle er im Laufe der Jahre für mich spielen sollte, zeigt sich an meiner Beziehung zur Ekklesia und zum Neuoffenbarer Jakob Lorber.
Anfang der 80er-Jahre stand ich der Kirche fern. Ich hatte als Suchender keinen Zugang zur Bibel und empfand mich auch nicht als Herausgerufener. In jenen Jahren machte mich ein Bekannter auf das Werk von Jakob Lorber aufmerksam. Es weckte meinen religiösen Verstand und ich glaubte, daraus alles erklären zu können. Die Jenseitswerke wie auch die Aussagen über das Beten suggerierten mir, dass die Ekklesia überflüssig sei und mit „Entartungen“ einhergehe. Geführt von meinem religiösen Verstand, trat ich am 18. April 1984 ohne seelsorgerliches Gespräch aus der evangelischen Kirche aus.
1994 veröffentlichte die Lorber-Gesellschaft in ihrer Zeitschrift „Geistiges Leben“ eine Rezension über Matthias Pöhlmanns Buch „Lorber-Bewegung – durch Jenseitswissen zum Heil?“. Ich empfand die Rezension als derart tendenziös, dass ich gerade deshalb Pöhlmanns Buch zu lesen begann. Hier empfing ich den ersten Impuls, Lorbers Werk einmal grundsätzlich zu hinterfragen. Mein kritischer Fokus lag nun nicht mehr bei anderen Gemeinschaften und den Kirchen, sondern bei Lorber und der Lorber-Bewegung selbst. Trotz der „Theologie für Nichttheologen“ und des „Gebets zur geistigen Wiedergeburt“ wurde ich so geführt, dass ich Gottesdienste besuchte. Das Ergebnis meiner Hinterfragung war die Publikation „Dokumentation um Jakob Lorber“, die 2004 erschien. Der langjährige Kontakt zum Apologeten und Pfarrer Dr. Matthias Pöhlmann und die Gottesdienste in der Dankeskirche Düsseldorf-Benrath trugen dazu bei, dass ich am 3. Mai 2017 wieder in die evangelische Kirche eintrat.
Heute gehören Glaube, Kirche und Ekklesia für mich untrennbar zusammen, denn Christus, Kyrios, ist der Herr und somit auch Haupt der Ekklesia. Das Feiern der Gottesdienste ist fester Bestandteil meines Glaubens, ich komme damit der Heiligung des Feiertags nach. Denn nur hier vollziehen sich gemeinsame Anbetung, offenes Bekenntnis, das Hören der Predigt, liturgischer Gesang und der Empfang von Gottes Segen. Das gemeinsame Singen von Liedern aus dem Evangelischen Gesangbuch spielt dabei für mich und viele andere Gläubige eine große Rolle: Es ist ein Beten, bei dem sich der Gläubige mit all seinen Sinnen Gott zuwendet. Der Gottesdienst ruft auf, in der Heiligen Schrift zu lesen, und zwar betend und von ganzem Herzen, und bewahrt vor einer eigenwilligen Auslegung. Er ermutigt zur Nachfolge Christi und macht den Glauben erfahrbar. Ich freue mich über das sichtbare Zeichen Gottes in der Taufe und empfinde tiefe Ehrfurcht ebenfalls beim zweiten sichtbaren Zeichen Gottes, dem Heiligen Abendmahl.
Mein Wiedereintritt in die evangelische Kirche möge die Kerngemeinde stärken und noch Distanzierte herzlich dazu einladen. In, mit und für die Kirche zu beten, erachte ich für wichtig, denn es gilt vor allem, die Einigkeit im rechten Glauben zu wahren.
Düsseldorf, Dezember 2017
Michael Junge
Inhalt
Einleitung
1.1 Laodizenerbrief und Kolosserbrief
1.2 Der Apostel Paulus
1.3 Jakob Lorber und die „lebendige Stimme“
1.4 Ziel der Analyse
Analyse von Lorbers Laodizenerbrief
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Resümee
Literatur
I Einleitung
1.1 Laodizenerbrief und Kolosserbrief
Der lateinische Laodicenerbrief (Laod) entstand vermutlich um 150 n. Chr. (Berger/Nord 1999). Er ist in zahlreichen Bibelübersetzungen des 5. und 6. Jahrhunderts überliefert und wurde später ins Griechische rückübersetzt. Sein Ursprung bleibt jedoch ein Rätsel und bis heute gilt er als verloren. Der unbekannte Verfasser des Laod übernahm paulinische Formulierungen. Der abschließende Vers deutet darauf hin, dass der Laod das im Kolosserbrief1 genannte Schreiben ersetzen sollte (vgl. Betz 2008, S. 78).
Der Kolosserbrief besteht aus vier Kapiteln mit insgesamt 95 Versen und entstand laut Berger/Nord (1999) um 60 n. Chr. Wie auch der Laodizenerbrief stammt er nicht von Paulus selbst, sondern wurde von Paulus’ Schülern nach seinem Tod verfasst. Der Kolosserbrief steht den authentischen Paulusbriefen inhaltlich in der Christologie und Eschatologie sehr nahe und gilt damit als wichtiges Zeugnis des frühen Christentums.
1.2 Der Apostel Paulus
Saulus von Tarsus in Zilizien (um 10 – um 64 n. Chr.), ein gottesfürchtiger und eifernder Pharisäer, verfolgte zunächst die Gemeinde Jesu, um ihre Anhänger als Gefangene dem Hohepriester in Jerusalem zu übergeben. Beim Verfolgen der Anhänger des neuen Weges um Damaskus zwischen 32 und 35 n. Chr. traf Saulus das Licht aus dem Himmel, sodass er zu Boden stürzte. Eine äußere Stimme fragte ihn: „Saul, Saul, was verfolgst du mich?“ Saulus verstand das Zeichen Gottes und fragte gefasst: „Herr, wer bist du?“ Die erschütternde Antwort lautete: „Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt; da wird man dir sagen, was du tun sollst.“ Als er aufstehen wollte, merkte er, dass er blind war. So führten ihn seine Anhänger nach Damaskus, wo er drei Tage betete und weder aß noch trank. Saulus hatte eine Erscheinung im Gebet. Der Jünger Hananias wurde von Gott beauftragt, Paulus von seiner Blindheit zu heilen und ihn zu taufen. So wurde aus Saulus Paulus, der Heidenapostel, erster christlicher Theologe. Er starb nach zweijähriger Gefangenschaft als Märtyrer in Rom. Die Frucht des Heiligen Geistes sind unter anderem die 13 paulinischen Briefe, die Eingang ins Neue Testament fanden.
1.3 Jakob Lorber und die „lebendige Stimme“
Von einem Erlebnis, das an die Bekehrung des Paulus erinnern mag, berichtete der österreichische Musiker Jakob Lorber (1800–1864). Laut seiner Aussage hat er sich am 15. März 1840 im Morgengebet befunden, als er an der Stelle des Herzens eine Stimme hörte, die ihm zurief: „Steh’ auf, nimm deinen Griffel und schreibe!“ Diese innere Stimme hörte nur er. Lorber fragte nicht, wer die Stimme sei. Das Angebot für eine neue Anstellung, das er gerade erhalten hatte, lehnte er unverzüglich ab und diente seitdem der „lebendigen Stimme“ bis zu seinem Lebensende. Er bezeichnete sich als „Schreibknecht Gottes“ und hinterließ ein umfangreiches Schriftwerk über geschätzte 10 000 Druckseiten, das heute gemeinhin als „Neuoffenbarung“ gilt, wenngleich sich der Begriff nirgendwo in Lorbers Werk findet. Er wurde erstmals vom Pfarrer Hermann Luger 1923 in einem Vortrag verwendet und anschließend von Lorber-Interpreten verbreitet. Für Luger (1923, S. 78) stehen die Bibel wie auch das Werk Lorbers „auf demselben göttlichen Boden. Lorbers Schriften atmen durchaus biblischen Geist.“ Lorber vertraute sich weder einem Priester an noch predigte er – und dennoch empfand er sich als Knecht des Herrn. Er beansprucht die „lebendige Stimme“ für sich und stellt dadurch die Sündenvergebung durch den Empfang des Heiligen Geistes in Abrede, worauf bereits die ersten Worte seines Werkes schließen lassen: „Jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton Meiner Stimme vernehmen.“
Zu Lorbers umfangreichem Werk zählen auch apokryphe, angeblich verschollene urchristliche Quellen wie der Laodizenerbrief des Paulus. Er wurde mittlerweile ins Englische, Italienische, Niederländische, Portugiesische, Griechische, Lettische und Slowenische übersetzt. Gemeinsam mit dem Briefwechsel zwischen Jesus und Abgar Ukkama sowie einigen anderen von der „lebendigen Stimme“ diktierten Briefen entstand der Laodizenerbrief vermutlich 1844 in Greifenburg (Oberkärnten), als sich Lorber bei seinen Brüdern aufhielt, um ihnen bei ihren Holzgeschäften zu helfen (Daxner 2003, S. 99). Der Laodizenerbrief umfasst drei Kapitel mit insgesamt 140 Versen. Laut Vorwort der 1851 veröffentlichten Erstausgabe – in der übrigens Jakob Lorber nicht als Autor genannt wird – wurde der Brief 1844 auf Bitte eines „wißbegierigen guten Christen“ (o. A. 1851, S. 4) niedergeschrieben. Die derbe Ausdrucksweise des Briefes rechtfertigt der Autor des Vorworts mit den alttestamentlichen Propheten. Im Vorwort zur Ausgabe von 1980, die auch der folgenden Analyse zugrunde liegt, setzt Otto Zluhan den Fokus auf den Verfall in ein „zeremonielles Kirchenchristentum“ und stellt ihm das Ideal eines „reinen Geisteschristentums“ entgegen. Verwiesen wird auf Parallelen zum Neuen Testament, die jedoch gar nicht bestehen, wie in der Analyse detailliert zu zeigen sein wird. Lorber jedenfalls war von der Authentizität überzeugt, wie es auch heute noch die Lorber-Gesellschaft und die Neuoffenbarungsanhänger sind. Ein hoher Anspruch, der höchste Prüfung verdient.
1.4 Ziel der Analyse
Unter den 140 Versen des lorberschen Laodizenerbriefs2 finden sich 59 eigenständige Verse, 81 wurden zu großen Teilen aus dem Kolosserbrief3 oder den Evangelien übernommen und mehr oder weniger stark abgewandelt. Die vorliegende Analyse konzentriert sich auf die teils erheblichen Unterschiede, die sich zwischen diesen Versen und ihren Entsprechungen im Kolosserbrief auftun, und verdeutlicht ihre Konsequenzen.
Ziel ist es, eine differenzierte Beurteilungsgrundlage zu liefern. Die Analyse soll klären, ob der Geist des „armen Propheten“ tatsächlich aus Gott ist, nur weil er „Jesum Christum“ bekennt (o. A. 1851, S. 6), und ob die vielfach beteuerte Demut des „Schreibknechts Gottes“ sowie das Plädoyer für ein „reines Geisteschristentum“ auch einer sachlichen Prüfung standhalten. Dies soll Christen zu beurteilen helfen, ob jeder religiöse Inhalt gleichsam göttlichen Ursprungs ist.
1 „Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodizea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodizea lest.“ (Kol 4,16)
2 Lorber, Jakob: Paulus’ Brief an die Gemeinde in Laodizea. Bietigheim: Lorber-Verlag, 1980.
3