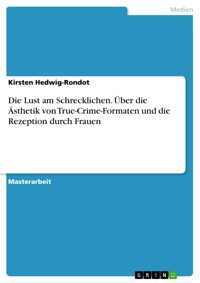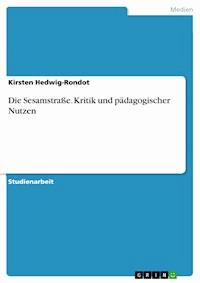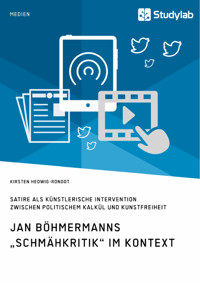
Jan Böhmermanns „Schmähkritik“ im Kontext. Satire als künstlerische Intervention zwischen politischem Kalkül und Kunstfreiheit E-Book
Kirsten Hedwig-Rondot
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Am 31.03.2016 trug Jan Böhmermann in seiner Satire-Sendung Neo Magazin Royale seine „Schmähkritik“ am türkischen Präsidenten Erdogan vor, die weltweit die Gemüter erhitzte. Erdogans Reaktion folgte mit einer Strafanzeige auf dem Fuß und löste eine breite gesellschaftliche Diskussion aus. Waren die Löschung und das Verbot, welches Präsident Erdogan von Deutschland forderte, tatsächlich legitim? Die Autorin Kirsten Hedwig-Rondot setzt sich im Rahmen einer umfassenden Publikation mit dem umstrittenen Thema auseinander. Sie erörtert, inwiefern Jan Böhmermanns Inszenierung als Performance-Kunst einzuordnen ist und ob sie unter den Schutzrahmen der Kunstfreiheit fällt. Welche Wechselwirkungen zwischen Politik, satirischer Kunst und Justiz hat Böhmermann mit seinem Schmähgedicht aufgedeckt? Hat Angela Merkel in der Böhmermann-Affäre die Kunst der Politik geopfert? Hedwig-Rondot geht diesen Fragen nach und stellt dabei grundlegende Überlegungen zur Macht von Satire an. Aus dem Inhalt: - Schmähkritik; - Satire; - Kunstfreiheit; - Meinungsfreiheit; - Jan Böhmermann; - Böhmermann-Affäre
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 78
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretischer Bezugsrahmen
2.1 Die Ethik des satirischen Schreibens
2.2 Rechtliche Einordnung der Satire in Deutschland
2.3 Performative Äußerungen und Performance-Kunst
2.4 Die Flüchtlingssituation und Angela Merkels Türkei-Deal
3 Erörterung der Forschungsfrage
3.1 Darlegung des ‚Falls Böhmermann’
3.2 Jan Böhmermanns Inszenierung – (Performance-)Kunst oder Schmähkritik?
3.3 Kunst als Opfer der Politik?
4 Fazit – Performance-Kunst mit tiefgreifenden Folgen
Literaturverzeichnis
Anlagen
Anlage 1: Verschriftlichte Version der Schmähkritik-Performance von Jan Böhmermann
Anlage 2: In der vorliegenden Bachelorarbeit erwähnte Gesetze der Bundesrepublik Deutschland
1 Einleitung
Satire hat das Potenzial, weltweiten Aufruhr auszulösen. Sie überspitzt Missstände in ihrer Darstellung bis ins Überzogene, um diesen ernsten Kern anhand dessen deutlicher und für jeden sichtbar zu machen. Bei einem derartigen Vorgehen kann die Kritik mitunter hart sein, für den Adressaten schmerzhaft und manch einer möchte eine solche als Beleidigung empfundene Satire nicht auf sich sitzen lassen.
Ein aktuelles Beispiel für eine solche Satire ist die sogenannte Schmähkritik-Performance von Jan Böhmermann, ausgestrahlt in einer Ausgabe seiner Satire-Sendung Neo Magazin Royale vom 31.03.2016.[1] Obwohl die gleichzeitige Nennung von ‚Schmähkritik’ und ‚Satire’ zunächst widersprüchlich erscheinen mag, sind die Löschung und das Verbot, welches Präsident Erdoğan von Deutschland fordert, nicht ohne Weiteres legitim. Eine Besonderheit der Affäre um Jan Böhmermann und seine Performance ist die Tatsache, dass er nicht nur eine grenzüberschreitende Satire darbietet, die durch ihre Gewagtheit große Teile der Welt und Europas beschäftigt und zur Diskussion anregt. Jan Böhmermann präsentiert mit der Inszenierung seiner Satire eine neue Art der Performance-Kunst - der künstlerischen Intervention - die nicht nur über Politik und Recht referiert, sondern diese Sphären allein durch Sprache selbst zur Performance macht und damit theoretische Diskurse zur Realität werden lässt.
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Macht der Sprache in Form von Satire und Performance-Kunst. Es wird genauer erörtert werden, inwiefern Jan Böhmermanns Inszenierung als Performance-Kunst einzuordnen ist, also unter den Schutzrahmen der Kunstfreiheit fällt, und darüber hinaus, wie er mit dieser Aufführung aktiv in die Realität eingreift. Des Weiteren hat Jan Böhmermanns Inszenierung große Auswirkungen auf den Diskurs um Kunst- und Meinungsfreiheit in Deutschland, weil er Bundeskanzlerin Angela Merkel durch seine Satire zwingt, sich entschieden für die diese positionieren oder sich klar auf die Seite der Türkei und Präsident Erdoğans zu stellen. Die Reaktionen bezüglich ihrer Entscheidung und ein Blick auf ihre möglichen Beweggründe sollen mithin die Frage klären, inwiefern Angela Merkel aus politischen Kalkül handelt und ihr Beschluss, die Ermittlungen gegen Jan Böhmermann freizugeben, als Opferung der Kunst zugunsten von Politik verstanden werden kann. Die Beantwortung dieser Frage bildet den einen weiteren Schwerpunkt dieser Bachelor-Thesis.
Das zweite Kapitel liefert zunächst eine Einführung in den theoretischen Bezugsrahmen, um wesentliche Grundlagen für die weitere Abhandlung zu schaffen. Eingangs wird ein genereller Überblick über die Diskussion der Frage nach einer Ethik des satirischen Schreibens gegeben. Darauf folgt im Unterkapitel 2.2 die kurze rechtliche Einordnung von Satire in Deutschland, um dann in 2.3 die Begriffe des Performativen und der Performance-Kunst einzuführen. Das Ende des zweiten Kapitels bildet eine kurze Darlegung der Flüchtlingssituation zum Zeitpunkt der Ausstrahlung von Jan Böhmermanns Performance. Dieses schließt auch das Flüchtlingsabkommen der Europäischen Union mit der Türkei ein, auf dessen Basis Angela Merkels Reaktion auf die Schmähkritik-Inszenierung analysiert werden kann.
Das im zweiten Kapitel gewonnene Vorwissen wird im dritten Kapitel dann zur Erörterung der Forschungsfrage zusammengeführt. Die Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, lautet: Wie ist Jan Böhmermanns Schmähkritik-Performance rechtlich und künstlerisch einzuordnen und welche Wechselwirkungen werden zwischen Politik, satirischer Kunst und Justiz provoziert?
2 Theoretischer Bezugsrahmen
Das anschließende Kapitel soll als Grundlage für die in Kapitel 3 folgende Untersuchung dienen. Um Böhmermanns Schmähkritik-Performance und die darauf folgenden Reaktionen einordnen zu können, werden zunächst die Ethik des satirischen Schreibens und die rechtlichen Gegebenheiten im Allgemeinen kurz vorgestellt. Außerdem erfolgt ein Überblick über die Performance-Kunst. Anschließend wird die Flüchtlingssituation in Europa zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dargestellt, was auch den Türkei-Deal der Bundeskanzlerin beinhaltet.
2.1 Die Ethik des satirischen Schreibens
Im Rahmen der Medien steht - wie auch im Fall der innerhalb dieser Arbeit thematisierten Inszenierung Böhmermanns - immer wieder die Frage im Raum, was Satire darf. Kurt Tucholsky beantwortet diese Frage im Jahr 1919 noch mit „Alles“[2]. Motivation der Satire sei, seiner Ansicht nach, der Wunsch pikierter Idealisten, die Welt, die eine schlechte ist, zu einer besseren zu machen. Mit der Satire als Werkzeug, rennten sie gegen die Missstände an und innerhalb dieser Intention dürfe die Satire grausam sein, sie dürfe übertreiben und sie dürfe auch boshaft sein, denn all das führe dazu, die Wahrheit deutlicher zu machen und vorhandene Missstände zu beseitigen.[3] Doch auch wenn Tucholsky in seinem Essay die Freiheiten der Satire verteidigt, so nennt er eine einzige Einschränkung, was Satire und Witz angeht: „Boshaft kann er [der Witz] sein, aber ehrlich sollte er sein.“[4]
Sowie es zu Lebzeiten Tucholskys Gegner seiner Einstellung gab, lässt sich die Frage nach eventuellen Grenzen, die Satire nicht überschreiten darf, auch heutzutage nicht ganz eindeutig beantworten. Einig ist man sich in der Ansicht, dass jene Frage wohl immer diskutabel bleiben wird.[5] Laut Maximilian Häusler hängt diese Tatsache eng mit den Begriffen der ‚Moral’ und der ‚Ethik’ zusammen.[6] Denn wie weit der Satiriker in seinen Äußerungen gehen ‚darf’, hängt vor allem mit den moralischen Regeln zusammen, die in der jeweiligen Kultur, in der er diese Äußerungen tätigt, ausgehandelt und anerkannt sind. Moralische Regeln sind nicht universal anwendbar, stattdessen herrschen nebeneinander zahlreiche zeit- und kulturspezifische Moralen.[7] Der Satiriker kann den Rahmen dieser Moralen nun bewusst ausreizen und damit Grenzen überschreiten, um eine Verschiebung ebendieser anzureizen. Kompliziert wird diese Praktik allerdings, wenn der Adressat aus einer Kultur mit anderen Moralvorstellungen stammt, denn dann müssen nicht nur die eigenen, sondern auch die moralischen Grundsätze des Empfängers einbezogen werden. Die Frage bleibt, wessen Grenzen in welchem Maße überschritten werden und ob es vertretbar ist, eine Satire zu verfassen, die zwar in der eigenen Kultur völlig akzeptabel ist, in der des Adressaten aber auf starken Widerstand stoßen wird. Mit einbezogen werden sollte hier allerdings nicht nur die Moralvorstellung des Empfängers, sondern auch dessen Persönlichkeit. Denn je stabiler seine Machtposition, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass er gegen einen satirischen Beitrag vorgehen wird.[8]
Zu der engen Verbindung von Moral und Satire hat sich Martin Sonneborn, der Mitherausgeber des Satire-Magazins Titanic, wie folgt geäußert: „Wenn wir denken, dass ein guter Witz aufs Cover soll, dann bringen wir den, egal, ob es moralische Bedenken gibt.“[9] Allerdings sei das Hinwegsetzen über den Rahmen der Moral in der Satire, im Gegensatz zu Comedy, bewusst und gewollt, um eine Wirkung zu provozieren. Somit sei die Satire auch in Fällen des Passierens unausgesprochener Barrieren anspruchsvoll und große Kunst der komischen Unterhaltung, da sie, im Gegensatz zu Comedy, ein moralisches Moment besitze.[10] Der wesentliche Unterschied zwischen Comedy und Satire ist der der Intention: „Der Witz ist für Satire das Mittel, für Comedy der Zweck.“[11]
Satire muss übertreiben, sie muss Grenzen überschreiten, um damit geltende Missstände aufzuzeigen und zu deren Beseitigung beizutragen. Jesko Friedrich, Autor der NDR Satire-Sendung Extra 3, vertritt diesbezüglich noch immer eine ähnliche Meinung wie Tucholsky vor rund hundert Jahren. Er sagt, Satire müsse schmerzhaft sein, allerdings nicht durch aus der Luft gegriffene Beleidigungen, sondern durch gezielte und harte Kritik.[12]
Der Erfolg tritt allerdings erst dadurch ein, dass eine lustige und nicht ernsthafte Umgebung geschaffen wird, in die die Satire eingebettet wird.[13] Diese „unernste Welt“[14] macht es möglich, Dinge auszusprechen, die in der ‚realen Welt’ geahndet würden. Dem Juristen Jan Hedde zufolge käme in dieser „unernsten Welt“[15] eigentlich gar kein Einspruch gegen eine Satire infrage, denn während sich die Satire nicht auf Ebene der ‚realen Welt’ bewege, tue die Justiz das sehr wohl. Um sich gerichtlich mit Satire auseinanderzusetzen, müsse die Justiz auf der einen Seite die Satire innerhalb ihrer „unernsten Welt“ verstehen, andererseits aber die ernste Grundlage beweisen, womit sie sich selbst nur lächerlich machen könne.[16] Dementsprechend ist Heddes Schlussfolgerung zu der Frage, was die Satire darf, noch immer die folgende: Sie darf alles, solange sie im Milieu des Unernsten bleibt. Das einzige, was sie nicht darf, ist langweilig sein.[17]
2.2 Rechtliche Einordnung der Satire in Deutschland
Grundsätzlich ist eine rechtliche Einordnung der Satire in Deutschland nicht eindeutig vorzunehmen. Das liegt daran, dass zum Schutz der Satire unterschiedliche Gesetze herangezogen werden können und damit die finale Bewertung der Satire vom Einzelfall abhängt.[18]